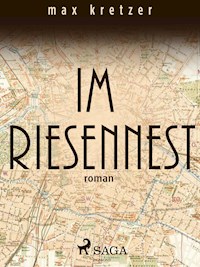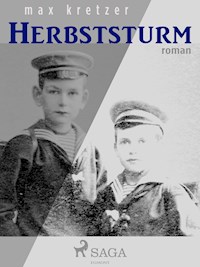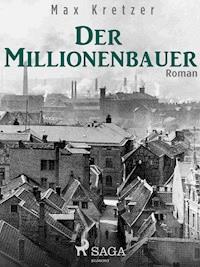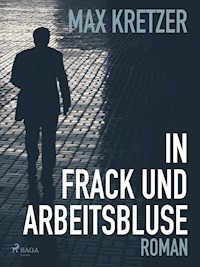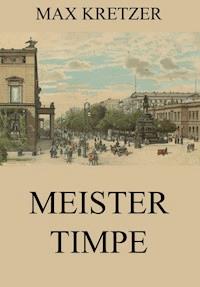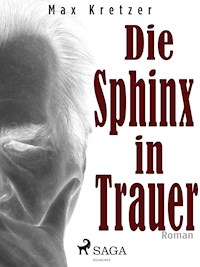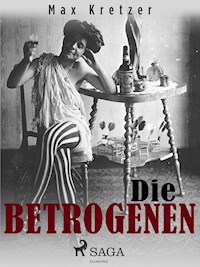Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Theologiestudent Gabriel Kreutz ist durch ein Erbe seiner Eltern unabhängig. Sein Geld trägt er vertrauensvoll auf einer wochenlangen Wanderung mit sich. Seinen besten Freund Thomas, mit dem es sich so herrlich über Gott und die Welt streiten lässt, hat er auf seine Kosten mitgenommen. Der geniale Techniker mit dem etwas groben Wesen hat kein Geld. Aber eines Tages wird er seinen Traum wahr machen und fliegen. Aber seit Thomas das Geld Gabriels an sich genommen hat und die Ausgaben verwaltet, bekommen ihre Dispute etwas Vergiftetes. Der eigentlich besonnene Gabriel hat außerdem entdeckt, dass Thomas eine Braut hat. Das Foto von ihr geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Eines Tages provoziert er den Freund mit dem Rat, vor dem irrsinnigen Flugmaschinenbau erst einmal Geld zu verdienen. Plötzlich entlädt sich der ganze Zorn Thomas' auf Gabriels naiven Gottglauben, seine abgesicherte Existenz, seine Großzügigkeit ihm gegenüber und er schleudert symbolisch Gabriels teuren Wanderstock in eine Schlucht. Die Freunde vertragen sich sofort wieder, Thomas seilt Gabriel ab, der den Stock wiederholen will. Auf einmal aber lässt Thomas das Seil los, der Freund stürzt ab. Als die Leiche nach ein paar Tagen nicht gefunden wird, geht Thomas nach Berlin zurück. Er heiratet Lisa und baut vor den Toren Berlins mit dem Geld Gabriels, den er nicht vergessen kann, an seinem Flugzeug. Eines Tages kommt ein Mann über das Feld geschritten ...Max Kretzer (1854–1941) war ein deutscher Schriftsteller. Kretzer wurde am 7. Juni 1854 in Posen als der zweite Sohn eines Hotelpächters geboren und besuchte bis zu seinem 13. Lebensjahr die dortige Realschule. Doch nachdem der Vater beim Versuch, sich als Gastwirt selbstständig zu machen, sein ganzes Vermögen verloren hatte, musste Kretzer die Realschule abbrechen. 1867 zog die Familie nach Berlin, wo Kretzer in einer Lampenfabrik sowie als Porzellan- und Schildermaler arbeitete. 1878 trat er der SPD bei. Nach einem Arbeitsunfall 1879 begann er mit der intensiven Lektüre von Autoren wie Zola, Dickens und Freytag, die ihn stark beeinflussten. Seit dem Erscheinen seines ersten Romans "Die beiden Genossen" 1880 lebte Kretzer als freier Schriftsteller in Berlin. Max Kretzer gilt als einer der frühesten Vertreter des deutschen Naturalismus; er ist der erste naturalistische Romancier deutscher Sprache und sein Einfluss auf den jungen Gerhart Hauptmann ist unverkennbar. Kretzer führte als einer der ersten deutschen Autoren Themen wie Fabrikarbeit, Verelendung des Kleinbürgers als Folge der Industrialisierung und den Kampf der Arbeiterbewegung in die deutsche Literatur ein; die bedeutenderen Romane der 1880er und 1890er Jahre erschlossen Schritt für Schritt zahlreiche bislang weitgehend ignorierte Bereiche der modernen gesellschaftlichen Wirklichkeit für die Prosaliteratur: das Milieu der Großstadtprostitution (Die Betrogenen, 1882), die Lebensverhältnisse des Industrieproletariats (Die Verkommenen, 1883; Das Gesicht Christi, 1896), die Salons der Berliner "besseren Gesellschaft" (Drei Weiber, 1886). Sein bekanntester Roman, "Meister Timpe" (1888) ist dem verzweifelten Kampf des Kleinhandwerks gegen die kapitalistische Konkurrenz seitens der Fabriken gewidmet. Während Kretzer anfangs der deutschen Sozialdemokratie nahestand, sind seine Werke nach der Jahrhundertwende zunehmend vom Gedanken eines "christlichen Sozialismus" geprägt und tragen in späteren Jahren immer mehr den Charakter reiner Unterhaltungsliteratur und Kolportage. Er starb am 15. Juli 1941 in Berlin-Charlottenburg. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
Steh auf und wandle
Roman
Saga
Steh auf und wandle
© 1913 Max Kretzer
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711502907
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
1.
Vor fünf Wochen waren die Freunde zu einer gemeinsamen Alpenwanderung von Berlin aufgebrochen, hatten acht herrliche Tage in München verlebt, waren am Bodensee gewesen, hatten den Bregenzerwald gesehen, waren dann nach Tirol gefahren, hatten sich am himmlischen Salzkammergut erfreut, waren am majestätischen Königssee gewesen und befanden sich nun im Allgäu, das sie über die Pässe erreicht hatten. In einem kleinen Berggasthof hatten sie übernachtet, und nun strebten sie Oberstdorf zu, das sie, ihrer Berechnung nach, am Nachmittage erreichen mussten. Von hier aus wollten sie dann über München wieder nach Hause.
So lagen sie denn seit zehn Minuten untätig auf der blühenden Talwiese und liessen sich die warme Vormittagssonne des Augusttages in das gebräunte Gesicht scheinen, so mit dem ganzen Behagen rastender Wanderer, die nach einem wohlverdienten Imbiss noch Zeit haben, ein wenig die Glieder zu strecken. Thomas Nagel hatte es sich auf seinem Rucksack, den er als Kopfkissen benutzte, bequem gemacht und, seitwärts gedreht, versuchte er mit geschlossenen Augen die Zeit nach seiner Weise auszunutzen. Gabriel Kreuz jedoch lag platt auf dem Rücken und blickte, die verschlungenen Hände unter dem Kopfe, unentwegt in den blauen Himmel.
„Gabriel, schläfst du?“ fragte Nagel plötzlich, ohne sich zu rühren.
„Nein, ich bin total munter,“ erwiderte Kreuz mit seiner weichen Stimme, die so angenehm für das Ohr war.
„Was machst du eigentlich?“
„Ich bewundere die Schwalben da oben.“
„Also hast du schon von mir gelernt, lieber Sohn. In ein paar Jahren werden die Menschen auch so herumfliegen, verlass dich darauf.“
„Aber nicht mit derselben Eleganz,“ spottete Kreuz, „vielleicht auch nicht mit derselben Behaglichkeit.“
„Abwarten und dann Tee kochen, mein Lieber. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, glaube mir. In Amerika haben sie ja schon den Anfang damit gemacht, und bei uns in Deutschland regt es sich auch bereits. Natürlich hinken wir wieder hinterdrein, nachdem man uns das Beste abgeguckt hat. Denk’ mal an Lilienthal.“
„Ja, an den denke ich gerade,“ sagte Kreuz gewissermassen wie im Triumph. „Sein Wahnsinn hat ihm das Leben gekostet, und so wird es den meisten andern auch gehen.“
Thomas Nagel geriet in Bewegung und kläffte ihn beinahe an: „Grosse Dinge erfordern immer Opfer, das beweist schon die Weltgeschichte. Und was zuerst für Wahnsinn gehalten wurde, das hat sich dann als ganz vernünftig herausgestellt. Es kommt eben alles auf Ursache und Wirkung an, lieber Sohn. Die Ursache kann noch so vernünftig sein, die Wirkung wird oftmals das Gegenteil erwecken. Glaube mir: gewöhnlich neigen diejenigen dem Wahnsinn zu, die alles Natürliche bezweifeln. Zu denen ich dich, mein lieber Gabriel, selbstverständlich nicht rechnen will. Denn du sträubst dich ja gegen solche Dinge aus angeborener Frömmigkeit, meinetwegen auch aus himmlischem Heimatgefühl, vielleicht auch noch aus Gründen des alten Kirchenglaubens. Nur nicht an den Himmel tippen, immer hübsch auf Erden bleiben, — das ist so dein elementarster Grundsatz, den du den Menschen aufbrummen möchtest. Aber selbstverständlich! Lass mich nur erst ausreden . . . Wir Praktiker jedoch, siehst du, finden es allmählich langweilig auf der Erde, schon weil wir viel zu viele sind, — daher wollen wir uns nun ein wenig da oben in der Luft umsehen, um sie mit der Technik ebenso zu erobern, wie wir es bereits mit dem Wasser und dem Feuer getan haben. Der Dampf durchquert die Erde, er durchrast sämtliche Meere, — warum soll er also eines Tages nicht auch die Luft durchbrausen. Du lachst? Du wirst noch Hurra schreien. Übrigens gibt es ja auch die elektrische Kraft. Was mich speziell anbetrifft, so wäre mein Ideal der fliegende Mensch, so ganz nach Vogelart, wie die Schwalbe da oben, weisst du. Etwa so: Stahlflügel, so dünn wie Spinngewebe, dass sie dem Windhauch folgen. Ein Federdruck, und sie blähen sich und tragen mich hinaus ins Unendliche. Ikarus, ohne geschmolzen zu werden. Donnerwetter, ja! Sache! . . . Eine Kiste guten Tobaks müsste ich allerdings immer bei mir haben, denn du weisst ja, ohne Rauchbolzen kann ich nicht leben. Grossartige Idee, wie? Um mich aber auf das Problem vorzubereiten, will ich jetzt ein Paar Augen voll Schlaf nehmen. Denk’ inzwischen darüber nach.“
Und danach warf er sich wieder auf die Seite und tat so, als ginge ihn nun auf der Welt nichts weiter mehr an.
Es war dasselbe Thema, das Thomas Nagel während der Wanderschaft wiederholt angeschlagen, und das er nun, Gabriels Meinung nach, mit dem fliegenden Menschen zu einer Ausgeburt krankhafter Phantasie erhoben hatte, gegen die man mit göttlicher Vernunft, und alle Vernunft hielt Kreuz als von Gott gegeben, nicht mehr ankämpfen konnte. Er hätte derartige Phantastereien des ewig zu Spott nnd Witz aufgelegten Genossen für Scherz gehalten, wenn die ganze Person Nagels nicht dazu geschaffen gewesen wäre, die Welt eines Tages mit etwas Unglaublichem zu überraschen. Durch und durch Verblüffungsmensch, dessen stets neue Einfälle ungeahnten Attacken glichen, gegen die Kreuz sich mit allem Verstande zu wehren hatte, schüttete er immer neue Erfinder-Ideen aus seinem mächtig gebauten Schädel, so dass jemand, der seine gesunde Ruhe nicht kannte, ihn mindestens für grössenwahnsinnig gehalten hätte. Gabriel Kreuz jedoch hatte sich schon daran gewöhnt, sowie er ohne Aufregung die vielen schäumenden, gurgelnden und wirbelnden Wildbäche in die Tiefe hatte gehen sehen, ohne etwas von Schwindel zu erleben. Und weil dem so war, liess er die überschüssigen Gedanken des Genossen auch diesmal austoben, ohne sich ihnen zu widersetzen.
Die Natur lud zum Schweigen ein. Göttliche Stille herrschte, die für den Denkenden etwas Ergreifendes hatte. Die ganze Landschaft lag im Traume, in dem sie nicht gestört sein wollte. Kein Vogel sang, kein Wipfel rauschte, kein Quellwasser murmelte, keine Biene summte dem Honig nach. Die grosse Luftharfe, die man sonst hörte, ohne sie zu sehen, sonnte sich unberührt, und wenn sich die Grashalme zum sanften Kosen neigten, so geschah es nur angehaucht von der leisen, kaum merklichen Kühle, die von den Höhen herunter über die Wiesen strich. Es war nur ein Fächeln, aber kein Wind. Und in diese Träumerei hinein wob die Märchenpracht ihre Farben. Rote und blaue Blumentupfer machten die Wiese zu einem bunten Teppich, dem das Buschwerk, das sich quer herüberzog, die dunkelgrüne Borte gab. Dahinter stiegen goldgelbe und braunrote Matten die Berglehne hinan, aber ohne das Wogen, das sonst den vollen Ährenfeldern die Bewegung des Meeres gab, denn schon war das Korn geschlagen und in die Scheunen gebracht. Ein dunkler Fichtenwald ragte starr über den Matten und umzog jenseits das ganze Tal. Zerstreut wie Spielzeug lagen die Häuschen eines einsamen Dorfes hoch oben in der Einöde, gerade noch erkennbar dem scharfen Auge. Dann aber wuchsen die kahlen, grauen Felsen wildzerrissen empor und türmten sich zu einem mächtigen, spitzen Gipfel auf, der in der klaren Luft schreckhaft gross und nahe erschien, obwohl es einer Tagesreise bedurft hätte, um an seinen Fuss zu gelangen. Im Sonnenlicht glitzerten, weiss wie flüssiges Silber, die schmalen Wasserfälle, die in den Felsenrinnen zu Tale gingen, und allmählich verwob sich das eintönige Grau und Grün zu einem violetten Dunst, in dem sich weit in der Ferne die Alpenkette verlor, am Horizont hingehaucht wie mit dunkelblauer Tusche auf hellblauem Himmel. Nur die Schneehäupter hoben sich blendend ab, hingeklext wie weisse Farbe in den Äther.
Noch immer blickte Gabriel Kreuz in das Unendliche. Die Art und Weise, wie die Wolken sich bildeten, erregte nun unausgesetzt seine Aufmerksamkeit. Vor fünf Minuten war über ihm noch reine Bläue, und nun lag da oben bereits ein dichter, von der Sonne durchleuchteter, weisser Flaum, der sich merklich zusammenballte. Wie aus einem Nichts war er entstanden. Kaum, dass das Auge Zeit fand, dieses Himmelsspiel zu verfolgen, hatten sich zarthelle Schwaden aus dem Äther losgelöst, fast wie dahinziehende Schleierchen, und waren bestrebt, sich zu vereinigen. Und schon wollte das Wölkchen im Luftmeere dahinsegeln, als der Wind es wieder auflöste und die zerfetzten Schleier höher trieb, bis das Blau des Himmels sie wieder verschlang. Dasselbe Spiel wiederholte sich, bald hier, bald dort, so dass Gabriel Kreuz seine Freude daran hatte, denn er bildete sich nun ein, etwas zu beobachten, worauf die meisten Menschen gewiss nicht achteten. Sie sahen eben den Himmel zuerst in reiner Bläue, erblickten dann plötzlich Wolken an ihm, ohne nachzuforschen, woher sie so schnell gekommen waren. Und doch ging alles ganz natürlich zu, wenn auch mit der Eile von Minuten.
Die weisse Wolke über ihm stand unbeweglich, denn sie trotzte gewissermassen der Luftströmung dort oben, die nur imstande war, die Form stetig zu verändern. Sie türmte sich auf, nahm Gestalt an und erschien nun wie der Oberkörper eines riesenhaften Menschen, der rechts und links die in Hermelin gehüllten Arme ausstreckte und ein Haupt mit langem Barte und langen Locken trug. Ein mächtiger, ehrwürdiger Greis schien segnend auf die Erde herabzublicken. So zauberte es wenigstens die reiche Phantasie Gabriel Kreuz vor, und im Augenblick ganz eingenommen davon, versäumte er nicht, den Wandergenossen darauf aufmerksam zu machen.
„Du, Thomas, hör mal zu,“ ermunterte er den Trägen, „ich habe eine neue Entdeckung gemacht.“
„Ist sie technisch oder idiotisch,“ fragte Nagel zurück, ohne sich im mindesten zu rühren. Das war seine ständige Redensart, womit er als Praktiker alles abtat, was seinen Zweifel erregte.
„Ich habe nämlich die Sprache der Wolken gefunden,“ fuhr Kreuz lebhaft fort.
„Also idiotisch,“ sagte Nagel ganz offen, weil er wusste, dass ihm nichts übel genommen wurde. Seine Stimme war wie immer belegt, und die Worte kamen aus verfetteter Kehle. „Ich gebe dir einen guten Rat: Gib ein Wolkenlexikon heraus und nimm ein Patent darauf. Ohne Patent ist heute nichts zu machen.“
Gabriel Kreuz lachte, obwohl er auch diese Litanei des zukünftigen grossen Erfinders zur Genüge kannte.
„Sieh doch lieber nach, ob du das Geld noch hast,“ sprach Nagel weiter, „das scheint mir im Augenblick viel wichtiger zu sein. Man kann nie wissen . . .“
Unter dem Deckel des spitzen Lodenhutes, den er sich über das Gesicht gestülpt hatte, riss er die Augen weit auf. Es war derselbe starre Blick ins Dunkle und Wesenlose, der ihn während der ganzen Nacht oben im Passasyl munter gehalten hatte, weil die aufgescheuchten Nerven in seinem Gehirn hässliche Bilder entstehen liessen, die, immer wiederkehrend, seine ganze Seele gefangen nahmen.
Gabriel Kreuz fühlte aus Gewohnheit unter dem Lodenjakett nach der linken Brustseite, wo in der Innentasche der Weste das Kuvert mit den siebzehntausend Mark in Scheinen steckte, dem Reste von dem Erbteil seiner Mutter. Und zum Überfluss glitt auch die Hand über die Hosentasche, in der sich das Portemonnaie mit dem losen Gelde für den Tagesbedarf befand. „Noch alles da, beruhige dich,“ sagte er dann, während er daran denken musste, wie oft der Freund mit derselben Frage gekommen war, fast täglich und bei jeder Gelegenheit, besonders wenn sie sich zum Aufbruch rüsteten. Und er hatte das auch zu würdigen verstanden; denn ohne viel Sinn für die Güter dieser Welt ging er etwas leichtfertig mit ihnen um. War es ihm doch erst neulich passiert, dass ihm vor dem Ankleiden das Kuvert aus der Weste gefallen war, was er wohl kaum gemerkt hätte, wenn nicht Thomas rechtzeitig mit seiner Aufmerksamkeit gekommen wäre.
„Na, dann ist es gut,“ sagte dieser und schob den Hut etwas höher hinauf, so dass seine Worte verständlicher wurden. „Du weisst ja: Dich muss man bewachen wie ein kleines Kind, sonst gehst du verloren. Was sollten wir beide wohl machen, wenn wir irgendwo festsässen, wie? Dann könnten wir als Landstreicher weiterziehen.“
Gabriel Kreuz zeigte ein heiteres Angesicht. „Du, das wäre gar nicht so übel. Das Dasein einmal von dieser ganz jämmerlichen Seite kennen zu lernen, — darin läge noch Poesie.“
„Und das entspräche auch ganz deinen Erwartungen von der menschlichen Nächstenliebe, nicht wahr? Steht ja wohl als Nummer eins in deinem Lebensprogramm.“
„Gott sei Dank. Ich glaube noch an die Menschheit.“
„Ich nicht,“ kam es barsch über Nagels Lippen. Und er warf sich auf die rechte Seite, so dass er dem Freunde jetzt zugekehrt war.
„Wie oft soll ich das eigentlich noch betonen,“ sprach Kreuz ruhig weiter, immer die hellen Augen zum Himmel gerichtet. „Du kennst doch meine Ansichten, die ich mit der Muttermilch eingesogen habe. Menschheit und Menschen sind zwei ganz verschiedene Begriffe, ebenso wie die Erde und Erde. Die Erde ist etwas unendlich Reines, Herrliches, von Gott Geschaffenes. Erde aber, verstehst du, als Teilchen gedacht, kann Schmutz enthalten.“
„Du, das habe ich bemerkt, als wir uns zuerst da oben hinlegen wollten, wo es so angenehm duftete,“ brachte Nagel seinen Witz wieder an.
„Der Wert des Edelsteins bleibt derselbe, auch wenn schmutzige Hände ihn berühren,“ fuhr Kreuz ernst fort, „und hat er gar in Schmutz gelegen, so wäscht man ihn einfach ab.“
„Und ganz genau so ist es mit den Menschen,“ warf Nagel ein. „Sind sie einmal in Dreck gefallen, dann erheben sie sich wieder und säubern sich einfach.“
„Ein kleiner Unterschied ist doch dabei, mein lieber Thomas. Denn siehst du, es gibt bei den Menschen einen inneren Schmutz, den alles Bürsten nicht vertreibt.“
„Den man aber Gott sei Dank nicht sieht,“ erwiderte Nagel mit gesteigertem Ärger.
„Aber er äussert sich durch schlechte Gesinnung und durch schlechte Handlungen,“ fuhr Gabriel Kreuz lebhaft fort, ganz aufgehend in seiner Meinung, ohne dabei an einen besonderen Fall zu denken.
Nagel schnaufte schon beinahe vor Wut, wie stets, wenn solche ihm unbehaglichen Fragen von Kreuz angeregt wurden. „Meinetwegen mag er sich äussern, wie er will, mein treuer Gabriel, — du kennst ja meinen Standpunkt: Die Welt ist da zum Geniessen und nicht zum Kopfzerbrechen über ihre Mängel. Jawohl. So ist es. Meine Meinung. Basta.“ Und er bohrte den Arm in die Luft und schrie jedes seiner Worte aus voller Kehle. „Übrigens, du — wenn’s dir Spass macht, geh doch mit deiner Poesie fechten und lasse mir’s Geld. Wir werden dann ja sehen, wer weiter kommt mit seiner Moral. Verlieren wirst du deine paar Kröten doch noch, ich seh’s schon kommen. Nächstens vergisst du noch, die Weste anzuziehen. Oder du schenkst sie aus aller Menschenfreundlichkeit einem armen Wurzelsepp und machst ihn in deiner Liebenswürdigkeit noch darauf aufmerksam, dass darin ein grosses Kuvert stecke, falls er an den lieben Gott schreiben wolle. Ja, lache nicht, dir traue ich’s zu.“
Gabriel Kreuz lachte wirklich dazu, obwohl ihm ganz ernst zu Mute war bei dem Gedanken, all’ seine Güte wieder so unterdrückt zu sehen. Thomas Nagel, der arm wie eine Kirchenmaus war, lebte während der ganzen Touristenfahrt nur von ihm; aber zartfühlend wie Gabriel war, unternahm er niemals den leisesten Versuch, ihn das merken zu lassen. Und so wartete er lieber auf den schönen Augenblick, bis der Freund von selbst einmal zu dieser Einsicht kommen würde, wenn auch nur dadurch, indem er der Ansicht des opfernden Gebers weniger herausfordernd und auch weniger zynisch begegnete. Dass aber dieser Augenblick bis jetzt nicht gekommen war, störte ihn nicht in seinem Bestreben, sich auch fernerhin ohne jede Selbstsucht zu zeigen, und nur der Stimme des Herzens zu folgen. Denn von all’ den schönen Sprüchen, die ihm sein alter Vater, der Schulmeister dort oben in Ost-Friesland, mit auf den Weg gegeben hatte, war ihm der Spruch des Evangeliums: „Geben ist seliger denn Nehmen“ am heiligsten.
„Reiss doch wenigstens einmal die Augen auf und sieh das wunderbare Gebilde da oben, es kostet ja nichts,“ ermunterte er abermals den Faulen, nun ebenfalls von Ärger erfasst.
Thomas Nagel tat ihm den Gefallen. Mit einem Ruck wälzte er sich auf den Rücken und blickte mit zwinkernden Augen in die Höhe, weil das weisse Tageslicht ihn blendete. „Wo denn? Ich sehe nichts.“
„Aber ich bitte dich! Sieht das nicht wie Gott aus, der über den Wolken thront?“
„Ich habe den alten Herrn noch nicht kennen gelernt, also kann ich nicht urteilen, weisst du,“ spottete Nagel los, wie immer so auch diesmal bestrebt, in solchen Dingen dem Freunde seinen Widerspruch zu erkennen zu geben. Man las ihm den Ärger von dem breiten, gesunden Gesicht ab, in dem die etwas kleinen, verborgen spielenden Augen mit der Schläfrigkeit kämpften. Er war unrasiert, und so sah er, sonnenverbrannt wie er war, etwas wüst aus, ganz im Gegensatz zu Gabriel Kreuz, der nun mit der schmalen, feinen Hand über das rötlich blonde Haar und über den vollen Spitzbart strich.
„Jetzt trägt er sogar eine Krone, sieh doch nur,“ fuhr dieser ganz entzückt fort.
„Dann ist es sicher der alte Barbarossa, der uns guten Tag sagen will,“ stiess Nagel unwirsch hervor und legte sich wieder auf die Seite. „Sprich dich nur ruhig mit ihm aus, lieber Gabriel, — mich aber lass gefälligst zufrieden mit dieser Bekanntschaft. Sei so gut, ja.“
„Geradezu einzig . . . herrlich . . . wunderbar,“ begeisterte sich Kreuz weiter. Und seine grossen, meerblauen Augen waren unablässig auf das köstliche Zufallsspiel hoch oben in der Luft gerichtet, das wirklich eine Minute lang etwas von einer überirdischen Erscheinung bot, dann aber anfing, in seinen scharfen Umrissen zu zerstieben. Die Herrlichkeit zerrann: die Krone schwebte fort, das Lockenhaupt wurde verzerrt und die ausgestreckten Arme im Hermelin fielen schlaff zusammen, als hätten sie es aufgegeben, die böse Welt da unten zu segnen. Kreuz bemühte sich, etwas Neues aus dem verschobenen Gewölk herauszulesen, gab dann aber die Hoffnung auf. Himmlische Wunder waren eben selten, das war im Augenblick seine Überzeugung.
„Nun, was sagt der alte Kyffhäuseronkel?“ meldete sich wieder Thomas Nagel, um ihn ein wenig aufzuziehen.
„Er meinte, du seiest ein ungläubiger Thomas, der niemals belehrt werden könne, besonders, was Gottes Sprache anbetrifft. Und deshalb hat er sich rasch verzogen.“
„Hübsch von dem alten Mann. Um so näher wirst du ihm ja sein, denn du heisst ja nicht umsonst Gabriel. Von einem Erzengel hast du allerdings wenig.“
Kreuz lachte hell auf, denn empfänglich für Humor, konnte er sich diesen Scherzen des Freundes selten verschliessen. Wie gross auch ihre innern Gegensätze waren, — Heiterkeit und Frohsinn des Lebens wurden immer wieder zur Brücke, auf der sie sich versöhnt fanden.
Gabriel Kreuz fuhr in seinen Beobachtungen fort. Kaum, dass er es bemerkt hatte, waren plötzlich überall weisse Wölkchen aufgetaucht, als hätte eine unsichtbare Hand sie aus dem unermesslichen, blauen Himmelsdom herniedergestossen. Sie ballten sich zusammen und rundeten sich zu übereinander geschichteten Kuppeln, und plötzlich ragte am Horizont eine riesige, weisse Wand empor, die fast die Täuschung hervorrief, als streckte sich dort ein unermesslicher Gletscher empor. Sie veränderte sich, und schon in einer halben Minute sah es aus, als wenn ein springendes Untier mit Hörnern von dort aus sich auf die Welt stürzen wollte. Und in seiner Freude über diese neue Entdeckung setzte Gabriel seine philosophische Erkenntnis wieder in Worte um: Alles, was ist, habe Sinn, denn sonst würde die ganze Schöpfung, die mit der Genauigkeit eines Sekundenmessers ihren Kreislauf vollbringe, keinen Zweck haben. Überall im Weltall sehe man die ordnende Hand einer unbegreiflichen Weisheit, und wenn alles dafür spräche, Sonne, Mond und Sterne, so sähe er nicht ein, weshalb auch nicht die Wolken ihre Sprache haben sollten, die sich bildlich äussere dem Sehenden und Empfindenden. Und sollten in ihr auch nur blosse Winke enthalten sein, sie seien doch immerhin dazu angetan, zum Nachdenken anzuregen. Und in diesem Falle hätten die wunderlichen Wolkengebilde ihren Zweck schon erreicht, denn sie zeugten vom Leben, das zum Leben spräche. Es gäbe eben nichts Totes in der Welt: alles fliesse, alles zeige den Strom ewigen Lebens, wenn es auch in anderer Form wiederkehre.
Gabriel Kreuz sprach das aber alles nur zu einem Tauben, denn Thomas Nagel, schon sattsam gewöhnt an diese Weltanschauung, der er kein Verständnis entgegenbrachte, gähnte laut und warf sich unruhig hin und her. Dann, wieder auf dem Rücken liegend, streckte er sich ganz gehörig und sagte trocken: „Dann lass nur alles ruhig weiterfliessen. Nur den Regen beschwöre nicht herauf, das bitte ich mir aus, denn davon haben wir schon genug zu kosten bekommen. Jetzt aber sei so gut, wenn ich bitten darf, nur ein Viertelstündchen, ich möchte schlafen. Und dann weiter, damit wir bald zu einem anständigen Glase Münchener kommen! Und ist ein hübsches Mädel dabei, um so besser. Gute Nacht.“
Und um seine Müdigkeit zu beweisen, spielte er mit Talent den Schnarchenden.
Das alte Schweigen trat ein, und die Natur träumte weiter in ihrer göttlichen Stille. Nur die beiden Menschen wachten, ein jeder auf seine Art, und überliessen sich ihren Gedanken, die so verschieden waren wie der blaue lachende Himmel und der tiefe, dunkle Abgrund, der sich irgendwo inmitten der Felsenriesen dahinten auftat.
2.
Gabriel Kreuz, überzeugt davon, dass der Freund schlief, überliess sich seinen Gedanken. Seine Eltern waren tot, er stand allein auf der Welt, und so dachte er darüber nach, was er, wieder heimgekehrt, beginnen solle, nachdem der Erbschaftsrausch sich in Nüchternheit aufgelöst haben werde. Er hatte Theologie studiert, zuerst in Greifswald, dann in Berlin, ohne aber, und das war das Merkwürdige, volle Befriedigung darin zu finden. Denn was ihn mächtiger anzog, ihn noch himmlischer dünkte als Gottes Wort, war die Musik, weil sie ihm gerade so weit entgegenkam, um die Stimmungen in seiner Gefühlswelt auszulösen. Sein Vater hatte vortrefflich Geige gespielt, und von irgend woher war in seiner Familie die Sage herübergeweht, dass ein Vorfahre, als die Kreuzens noch in den Dithmarschen angesiedelt waren, ein grosser Orgelspieler vor dem Herrn gewesen sei, zu dem sich das Volk in Scharen aufgetan habe, um sich an seiner mächtig brausenden Musik zu erbauen. Vielleicht, dass aus diesen vergangenen Jahrhunderten der Sinn für Töne sich gerade bei seinem Vater und ihm wieder neu belebt hatte nach dem Gesetz der sprunghaften Übertragung, woran er nun einmal glaubte wie an die ewigen Geheimnisse von Ursache und Wirkung im Weltall. Das hatte sich bei ihm schon als Kind gezeigt, da er, als bester Sänger im Dorfe, rein und melodisch sang, ohne eine Note zu kennen, und seiner Mutter Tränen der Rührung entlockte, wenn er am Weihnachtsheiligenabend das „Stille Nacht, heilige Nacht“ anstimmte. Das war es auch, was ihn nach Berlin getrieben hatte, in die Hochflut der musikalischen Genüsse, in der sein Brotstudium unterzugehen drohte, wie die Redensart des besorgten Vaters war, der den zukünftigen Pastor schon Schiffbruch leiden sah. Etwas Wahres war daran, Gabriel konnte es nicht bestreiten, wenn auch sein religiöses Gefühl dasselbe blieb.
Aber die elterliche Sparkasse sollte unter seinem schönen Eigensinn nicht leiden. Er nahm Stellungen als Stundenlehrer an, quälte sich, schon als junger Student, mit den unbegabtesten Rangen herum, um sein Musikstudium zu bezahlen und Oper und Konzerte besuchen zu können. Und diesen schweren Lebensweg zu gehen erleichterte ihm seine himmlische Geduld. Einmal erwog er, Sänger zu werden, dazu reichte aber seine Stimme nicht aus, und so begnügte er sich mit dem Klavierspiel, in dem er es nach und nach zu einer gewissen Fertigkeit gebracht hatte. Das Geigenspiel hatte er bereits vom Vater gelernt, es aber über dem andern Spiel vernachlässigt. Das alles aber genügte ihm nicht; er wollte höher hinauf, etwas Grosses erreichen: wollte Tonsetzer werden, unsterbliche musikalische Werke schaffen. Obwohl er aber drei Jahre lang ein Konservatorium besucht hatte, fast meist in den Abendstunden, kam er bald dahinter, dass seine Begabung sich nur in engen Grenzen bewegte. So blieb er in der Musik mehr der Empfangende als der Gebende: nicht nur zum Kummer seiner selbst, sondern auch seines Vaters, der den Gedanken an diese zersplitterte Existenz seines Einzigen mit ins Grab nahm.
Die Mutter glaubte mehr an ihn, so wie gute Mütter glauben. Und wenn Gabriel in den Ferien zum Besuch in das stille friesische Haus kam, sich an das alte Klavier setzte und seine schönen Lieder sang, ihr alle Opern vorspielte, dann sass sie mit gefalteten Händen da und hielt ihn für einen grossen Künstler, dem Gott wohlgefällig die Wege zu allen Offenbarungen gezeigt habe und noch weiter zeigen müsse. Wohl ihm, dass sie ausser dem Häuschen auch noch ein nettes Sümmchen für ihn bereit hatte, das ihm dereinst den Flug zur Höhe gar sehr erleichtern werde!
Und so war es denn gekommen, dass Gabriel Kreuz schon an die Dreissig sich befand, als auch die Mutter alles überstanden hatte, aber nicht, wie der treue, vorangegangene Lebensgefährte, irre geworden an dem Ein und Alles ihres Lebens; und so war es auch gekommen, dass Gabriel nun mit Schrecken inne wurde, dass er schwankender denn je in seinen Entschlüssen sei, ob er nun umkehren oder vorwärts solle. Er sah den toten Punkt, der einen Lebensabschnitt beschloss, ohne dass der Anfang zu einem neuen schon gefunden war. Des Haderns mit sich selbst müde, die Aussichten in der Tasche, wenigstens nicht Not leiden zu müssen, machte er sich zu einer Erholungsreise auf, um in den Bergen Kraft zu neuem Lebenskampfe zu schöpfen. Und dieser Lebensruck wurde tapfer von seinem Freunde Thomas Nagel unterstützt, der sofort der Meinung war, dass es sich zu zweien besser wandere, als allein. Gabriel Kreuz war das willkommen, denn so verfiel er nicht der Grübelsucht über sich und sein Schicksal, unter der er letzthin, war er allein, beinahe schon gelitten hatte. Und im Grunde genommen, liebte er doch die Geselligkeit, schon um der Aussprache willen über alles Grosse, was den Menschengeist bewegt. Und war es mit dem meistens spottsüchtigen und verneinenden Nagel auch nur ein Plaudern, manchmal über Tagesdinge, — so bot das doch genug Ablenkung und verkürzte die Zeit während der Fahrten.
Und das war es auch, was ihn besonders zu Thomas Nagel hingezogen hatte, als er ihn vor zwei Jahren als Stubennachbar bei seiner Wirtin in Berlin kennen gelernt hatte, in einer der älteren Strassen des Potsdamer Viertels, aus denen die Vornehmheit allmählich weiter nach dem Westen geflohen war. Er sah sofort, dass Nagel ein armer Teufel war, der alles Heil vom anderen Tage erwartete und an sich glaubte, wenn er auch nicht besonders wählerisch in den Mitteln war, die diesem Glauben zum Siege verhelfen sollten. Aber, du mein Gott, borgen war keine Schande, wenn die Not an die Tür pochte! Und da Gabriel Kreuz die Nächstenliebe als Pastor dereinst hatte verkünden sollen, so hielt er sich für verpflichtet, nun, wo er entgleist war, ebenso die offene Hand zu zeigen, wie er es nach christlicher Anschauung später erst recht hätte tun müssen. Ausserdem: in diesem findigen Techniker steckte etwas, was erst herausgeholt werden musste, und das war die beste Gewähr dafür, dass dieses Wohltun sich dereinst gut verzinsen würde; auch als Darlehen gedacht, denn grosse Gaben hatte Kreuz nicht zu verschenken.
Er hätte ebenso gut einen Kunstgenossen mit auf die Wanderfahrt nehmen können, denn es liefen genug davon herum im grossen Berlin, die mit Freuden eingeschlagen hätten. Dann wäre er aber um seine ganze Erholung gekommen, denn die Musik war dazu da, um sie auszuüben, nicht aber, um während des ganzen Tages davon zu sprechen. Thomas Nagel hörte aber darüber nur geduldig zu, ohne zu streiten, denn er verstand nichts von Musik, höchstens, dass er landläufige Bemerkungen darüber fallen liess, und das war für Gabriel Kreuz gerade das Beruhigende und Erfrischende. Er konnte seine Meinung austoben lassen, ohne wenigstens darin auf Widerstand zu stossen.
Und dann gab es noch eines, was sein Gemüt befruchtete: die drastische Ausdrucksweise des Freundes, die ihm, dem Norddeutschen von der Waterkant, wo die Derbheit manchmal gottgefällig war, als wohltuender Ausgleich mit der verlogenen Süssigkeit der überfeinen Kulturwelt dünkte. Denn dieser behagliche Dessauer, in jungen Jahren schon nach Spree-Athen gekommen, hatte sich mit der Zeit so ins Berlinertum eingelebt, dass sich aus dem Provinzialen schliesslich einer jener grossen Überschlauköpfe entwickelt hatte, von denen die Einheimischen einfach lernen können.
So glichen sie zwei aufgeweckten Kameraden, die um so besser miteinander auskommen, je entfernter ihre Lebensziele liegen. Ein jeder nahm die Belehrungen des anderen gerne hin, weil sie mit seinem Berufe nichts zu tun hatten. Und platzten sie in weltphilosophischen Dingen aufeinander, dann war es Gabriel Kreuz, der durch seine sanfte Ruhe den Zorn des anderen verrauchen liess, teils des Friedens wegen, teils weil er Mitleid mit ihm hatte.
Während Kreuz so seine Gedanken spann und nun erwog, ob es nicht an der Zeit sei, den Gefährten zu wecken, damit man weiter komme, wurde er, wohl durch den steten Blick auf die weisse Wolke über ihm, selbst von der Müdigkeit befallen, gegen die er vergeblich kämpfte. Bald schlief er ein, und seine regelmässigen Atemzüge verkündeten, dass dieser Schlaf in freier Luft tief und fest war, von der Art, wie ihn die Sorglosen und Unbekümmerten schlafen.
Gabriel träumte. Zuerst war es ein schöner Traum, aus reiner Seele geboren. Er sass oben in Ost-Friesland, im alten Schulmeisterhaus, bei Vater und Mutter. Sie lachten alle drei. Dann ging die Tür auf, und man brachte Johannes Kreuz, seinen Bruder herein, der als Matrose übers Meer gezogen war, und den man niemals wiedergesehen hatte, weil der Dreimaster mit Mann und Maus untergegangen war. Man legte ihn stumm und still auf die Dielen. Der Vater war starr, die Mutter aber schrie auf. Und da gerade, als sie sich jammernd über ihn geworfen hatte, wurde Johannes wieder lebendig, richtete sich auf und lachte sie alle an. Und sie lachten mit, und die Männer, die ihn gebracht hatten, lachten ebenfalls. Der Vater aber wischte sich die Tränen aus den Augen und meinte zu dem Wiedergekehrten, er solle doch solche Witze lassen. Dann nahm er seine Geige und spielte ihnen etwas Lustiges auf. Plötzlich war Gabriel allein im Zimmer und lag auf derselben Stelle, wo soeben noch der tote Bruder gelegen hatte. Es wurde dunkel, und ein Ungeheuer kroch auf ihn zu, und er konnte weder schreien noch sich bewegen, obwohl er beides wollte.
In Wirklichkeit passierte etwas Ähnliches. Thomas Nagel hatte sich zur Hälfte erhoben, sah sofort, dass der Freund fest eingeschlafen war, und machte sich vorsichtig an die Arbeit. Er knöpfte dem Schläfer das Lodenjackett auf, dann die Weste darunter, beides gerade weit genug, dass er hineinfassen und das Kuvert mit dem Gelde nehmen konnte. Rasch verbarg er es in seiner Innentasche. Alsdann knöpfte er Weste und Jackett wieder zu und streckte sich ruhig aus, als wäre nichts vorgefallen. Gabriel Kreuz stöhnte im Traume, unverständliche Laute entflohen seinen Lippen, ohne dass er die schweren Bande, die ihn niederdrückten, entfesseln konnte. Dann wich der schauerliche Alpdruck von seiner Brust und gab den starren Gliedern wieder Geschmeidigkeit. Mit heissem Kopfe richtete er sich auf und blickte erstaunt in die Landschaft, die überall ein bleiches Antlitz zeigte, was daher kam, weil ihm das weisse Sonnenlicht so lange auf den Augenlidern gelegen hatte. Allmählich wurde alles wieder bunt, und allmählich kam er zu sich. Gott sei Dank, dass er nur geträumt hatte.
Ruhig und friedlich lag der Genosse neben ihm und hielt seinen unverwüstlichen Schlaf.
Sollte er ihn wecken? Fast tat es ihm leid, weil Nagel vergangene Nacht schlecht geschlafen haben wollte. Er überlegte, denn er dachte an seinen Traum. Tote wieder lebendig werden sehen, — das gab nach Ansicht seiner Mutter, die auf solche Deutungen schwor, stets Streit, besonders in Erbschaftsdingen. Er musste lächeln, denn das hatte er von keiner Seite mehr zu erwarten. Träume waren eben Schäume, die keinen festen Bestandteil hatten. Diese Meinung beherrschte ihn, obwohl es zu seiner ganzen Natur gehörte, seine Glaubensseligkeit auch auf diese Dinge auszudehnen. Denn wunderbar und immer noch unerklärlich für die Gelehrten war dieser Zustand eines Schlafenden, der ihn unbewusst in ein Nebenleben führte, in dem die Erscheinungen der Vergangenheit und Gegenwart durcheinander wirbelten. Denn niemals sah man sich selbst in der Zukunft, und das war das Merkwürdige dabei, was wohl mit dem ewigen Arbeiten des Gehirns, das an die Zeit gebunden war, zusammenhing.
Gabriel Kreuz brach einen langen Grashalm ab und zog ihn spielend durch die Lippen, dabei immer an seinen Traum denkend. Etwas Schönes lag doch in dieser plötzlich entstandenen Scheinwelt, trotz des Grauens, das der Freude vorhergegangen war und sie dann wieder beschlossen hatte. Denn er war seinen Eltern wieder nahe gewesen, hatte sie in all ihrer rührenden Lebendigkeit um sich gehabt und hatte seinem guten Bruder, der nun schon zehn Jahre auf dem Meeresgrund lag, die harte Matrosenhand schütteln dürfen. Vielleicht war das Träumen, diese Fata morgana der Seele, eine tiefsinnige Deutung, sich der Verstorbenen wieder zu erinnern, indem man körperlich greifbar mit ihnen im Schlafe verkehrte!
Thomas Nagel schien sich zu regen, und so rüttelte nun Kreuz an ihm: „Du, hör’ mal, es wird Zeit, dass wir losgehen. Auf, auf!“
Nagel brummte etwas Unverständliches, tat erst so, als wollte er sich noch auf die andere Seite legen, reckte sich dann aber ganz gewaltig und wischte sich den Schlaf aus den Augen. Und dabei gähnte er laut und anhaltend. „So? Ist es schon so weit? Donnerwetter, ich glaube wirklich, ich habe fest geschlafen.“
„Das soll wohl sein,“ sagte Kreuz lachend. „Du hast sogar geschnarcht, als wenn eine schlechte Säge durch einen trockenen Ast ginge.“
Nagel log nicht, denn den Reichtum in der Tasche, hatte er sich wieder der dickfelligen Sorglosigkeit überlassen. Zwar hatte er erst gehorcht, ob der Freund gleich nach der Tat munter werden würde, dann aber, als er die gleichmässigen Atemzüge hörte, kämpfte er nicht länger gegen die Müdigkeit. Er hatte ja die personifizierte Weckuhr zur Seite, und die würde sicher gehörig zu schnarren beginnen, wenn sie vorzeitig, durch Schreck aufgerüttelt, ablaufen würde.
„Man hätte dich berauben können bis auf die Kleider,“ fuhr Kreuz fort.
„Das hättest du nur tun sollen, ich war schon lange für ein Sonnenbad.“ Und listig fügte er hinzu: „Dich vielleicht nicht? Mir war’s doch, als hättest du mir beim Schnarchen Konkurrenz gemacht.“ Danach richtete er sich ebenfalls auf und blickte ihn ganz harmlos an.
Kreuz blieb heiter. „Ja, du, ich musste es dir nachmachen, ob ich wollte oder nicht . . Hat dir etwas geträumt?“
„Du weisst, ich träume grundsätzlich nie, und das erlauben mir meine gesunden Nerven. Die zittern weder beim Wachen noch beim Schlafen. Träume sind nur die Folgen aufgescheuchter Nerven, die das vernünftige und klare Denken in Grübelsucht verwandeln . . in ungesunde natürlich. Und alles ungesunde Grübeln ist mir zuwider. Ich beschäftige mich nur mit realen Dingen. Und deshalb werde ich mir erst einen Tobak anstecken.“
Er rauchte unmenschlich viel Zigarren, und wo es nur anging, qualmte er, selbst auf hohem Bergesgipfel, so dass Kreuz nicht begreifen konnte, wie man stetig Dampf statt Ozon schlucken könne. Nagel jedoch, der die Zigarren fast „frass“, schüttelte bedauernd seinen dicken Kopf und meinte, dass er nun einmal ohne Zigarren nicht leben könne, weil ihr Genuss sein Denkvermögen bereichere. Andere bekämen ihre Ideen beim Weissbier, beim Sekt, beim reinen Alkohol, oder bei faulen Äpfeln, wie man von Schiller behaupte, — er müsse seine Zigarren paffen, um den Gehirnsprudel in Fluss zu halten. Danach biss er die Spitze der hervorgeholten Zigarre einfach ab, spuckte sie aus, wie es seine Gewohnheit war, und gab dem trockenen Kraut Feuer. Alsdann gähnte er noch einmal sehr unmelodisch, wodurch Kreuz angesteckt wurde.
„Du warst natürlich wieder im Paradies, wie ich dich kenne,“ sprach Nagel behaglich weiter. Seine Worte kamen immer aus schiefgezogenem Munde, was ihm stets etwas Aufsässiges gab.
„So halb und halb,“ erwiderte Gabriel mit einem Seufzer. Und ohne weiteres erzählte er seinen Traum.
„Du denkst eben zu sehr an das Vergangene und zu wenig an die Zukunft, lieber Sohn,“ warf Nagel ein. „Ich denke nur an die Zukunft, das ist die einzige Dame, mit der ich ständig verheiratet bin. Und je fetter sie wird, desto verlockender erscheint sie mir. Eure solche Gedankenehe lobe ich mir, weisst du. Denn sie kostet nichts, spornt aber an. Einmal wird mir das fette Weib doch aus dem Dalles helfen, glaubst du? Dann lasse ich die Illusionsdame natürlich sitzen und nehme mir ein frisches Mädel mit greifbaren Reizen. Mit all den Tugenden ausgestattet, die ich nicht besitze . . . Hörst du zu, Gabriel?“
Er hatte sich wieder niedergelassen, seinen vollbäuchigen Rucksack aber vor sich aufgestellt, so dass er sich nun mit dem Ellbogen auf ihn stützen konnte.
Gabriel sann nach. Dann sagte er: „Wir können unsere Lehren immer nur aus der Vergangenheit ziehen, meine ich. Sie ist die Mutter, und die Gegenwart ist ihre Tochter, die die Zukunft als ihr Kind noch unter dem Herzen trägt. Mit Bangen, denn sie weiss nicht, was werden wird.“
Thomas Nagel quetschte die Worte unter der Zigarre hervor. „Sehr geistreich gesagt, lieber Sohn. Dann hätte ich ja recht. Denn siehst du, ein Kind kann man noch erziehen, aus dem kann man noch etwas machen; das ist der Ton, den man kneten kann . . . sich gefügig machen kann. Du bist eben der Mann von gestern, und ich bin der Mann von heute. Du träumst und ich erlebe. Das haben wir schon in München gesehen bei der Resi. Wieder mal hübsch getroffen, nicht?“
Gabriel Kreuz lachte ohne Neid. „Ja, du bist der Mann des Augenblicks, wenig wählerisch und ohne Skrupel, — das heisst, das soll keine Beleidigung sein.“
Thomas blieb unbeweglich. „I, wo werden wir uns denn beleidigen! Wir sezieren uns nur gegenseitig, und das macht Spass. Gute Freunde können sich alles sagen . . . Aber weisst du, mein lieber Gabriel, ich hab mir über den Genuss dieser Welt meine Theorie aufgestellt. Denk’ mal, ich finde auf der Landstrasse eine schöne, duftige Rose einsam stehen. Soll ich vielleicht erst warten, bis der Kerl hinter mir sie in seine schmutzigen Hände nimmt? Nein, mein Sohn, da breche ich sie schon lieber selber. Was du Skrupellosigkeit nennst, ist wohlerwogenes Handeln.“
„Oder auch Selbstsucht?“
„Kann sein. Dann aber nur aus ganz natürlichen Gründen. Zuerst komme ich, und dann kommt der andere.“
„Der andere hätte die Rose aber vielleicht stehen lassen und sich an ihrem Dufte berauscht. Und dann hätten seine Mitmenschen wohl auch etwas davon gehabt.“
Thomas Nagel paffte ruhig weiter. „Der andere wärest du natürlich, mein lieber Gabriel. Das sähe dir ähnlich. Und dein Hintermann lacht dich aus, weil du ihm die schöne Sache aufgehoben hast. Denn Sache ist doch eigentlich alles im Leben. Auch die Menschen, sonst würden sie sich nicht nach Belieben schieben lassen. Zu drollig, dass wir uns immer noch darüber streiten . . . Ich erwarte nun übrigens deinen Vortrag über Träume . . . ich sehe es dir an, dass du da wieder etwas in petto hast. Schiess nur los, — du weisst, dass ich dir gern ins Mystische folge, wenn ich auch keinen Pfennig dafür gebe. Aber du machst die Sache immer so geistreich, lieber Sohn, dass ich mein Vergnügen daran habe. Und dann lerne ich auch dabei — man kann damit so schön imponieren, wenn man gläubige Toren findet.“
Gabriel Kreuz nahm das gar nicht übel auf; er lachte und sagte: „Du bist doch ein Gelegenheitsdieb, wie er im Buche steht.“
Nagel zeigte sich unruhig, denn er wusste nicht recht, was aus den grossen, hellen Augen des andern sprach, die so mutig auf ihn gerichtet waren. Er schnellte gewissermassen empor, im unklaren, ob sein Trick nicht bereits durchschaut sei und dieser unheilbare Idealist ihm die Wirkung der Komödie nicht vorwegnehmen wolle. Aber nein, so blickte keiner drein, der seine Verstellungskunst treiben wollte. Und in diesem Bewusstsein bog er sich wieder zurück und legte dem Worte eine harmlose Bedeutung bei.
„Was heisst Gelegenheitsdieb,“ sagte er pomadig. „Aufpassen, aufpassen heisst die Parole der Gegensünder. Im Kleinen wie im Grossen. Dann würden auch nicht ganze Länder gestohlen werden, was ja nach dem Völkerrecht erlaubt sein soll. Und dein lieber Gott duldet das.“
Gabriel nickte aus Gefälligkeit, während seine Gedanken wieder einen hohen Flug nahmen. „Was den Traumzustand anbetrifft, so habe ich soeben darüber nachgedacht,“ sagte er sinnend, ohne sich durch das eingeworfene „Also doch“ des Freundes beirren zu lassen. „Eigentlich ruht doch nur der Körper und liegt sozusagen in Fesseln, weisst du, der Geist bleibt fortwährend munter und verrichtet auch im Schlafe seine Arbeit. Er beschützt einfach den machtlosen Körper und bewacht ihn so lange, bis der Schlaf wieder geflohen ist. Und nur der Schlaf ist es, der den Eindruck erweckt, als ginge im menschlichen Geiste nichts vor. Der Geist arbeitet aber unaufhörlich, und der beste Beweis dafür sind die Träume. Woraus du also siehst, dass es auch im Denken keinen Stillstand gibt. Ruht überhaupt etwas in der Natur? Schläft der Wald da drüben in der Nacht? Nur die Dunkelheit täuscht uns den Stillstand vor. Denn sonst würden wir sehen, dass alles Leben weitergeht, alles weiter wächst und blüht.“
„Auch der Unsinn,“ warf Nagel brutal ein, „womit ich natürlich nicht deine höchst verständigen und geistreichen Erörterungen meine, sondern vielmehr unsere Bummelei. Denn ist es vielleicht kein Unsinn, dass wir uns über die Zubereitung von Luftklössen und Traumpasteten unterhalten, während uns irgendwo wahrhaftige Leberknödel mit bayrischem Kraut winken? Auf nach Valencia!“
Und um zu beweisen, dass er ein ganzer Kerl sei, sprang er mit einem Ruck auf, streckte die Arme in die Luft und reckte sich, so dass ihm die Glieder knackten und sein Gesicht braunrot wurde.
„Wenigstens habe ich dich endlich dadurch auf die Beine gebracht,“ sagte Kreuz lachend, der sich über derartige Plattheiten nicht mehr aufregte, sie im Gegenteil wie einen notwendigen Bestandteil des andern betrachtete, der zu seiner Natur gehörte wie der Dünger auf dem Felde, der doch nicht verhindern konnte, dass aus dem Korn schmackhaftes Brot wurde. Ein Schelm gab mehr als er konnte, und ein Weiser blieb derselbe, auch wenn man versuchte, ihn lächerlich zu machen. Und weil sich Gabriel Kreuz wieder als Sieger über den Unverstand des andern fühlte, so erhob er sich denn ebenfalls leichtbeschwingt und machte sich zum Weiterwandern bereit.
3.
Die Freunde rafften die Lodenmäntel zusammen und brachten die verschiedenen Dinge, die sie während des Frühstücks den Rucksäcken entnommen hatten, in diesen wieder unter. Schon wollte sich jeder aufs neue mit seinem Pack beladen, als Thomas den grossen Augenblick für gekommen hielt, sich würdig als der Überlegene in Szene zu setzen. Zuerst holte er sich eine frische Zigarre hervor, die er sich an dem noch glühenden Stummel der alten anrauchte, wonach er dann diesen in einem weiten Bogen ins Gras warf. Alsdann tat er ein paar kräftige Züge und fragte, den Glimmstengel im Mundwinkel: „Nun sag’ mal, lieber Sohn, kannst du auch dafür garantieren, dass dich dein Geist ordentlich bewacht hat, während du schliefst? Frag’ mal deinen Korpus.“
Kreuz verstand ihn nicht gleich, denn natürlich glaubte er wieder, dass das eine neue Kritik an seiner Traumphilosophie sein solle. Unwillkürlich blickte er um sich, als könnte er etwas vergessen haben. Dann aber sagte er heiter: „Ach, lass uns gehen.“
„Nein, nein, du — es ist kein Scherz,“ zog ihn Nagel weiter auf. „Mir war’s vorhin so, als machte sich ein Kerl bei dir zu schaffen, der dann über alle Berge ging. Möglich, dass ich nur geträumt habe, — jedenfalls fühle mal in deiner Tasche.“ Und als er dann Kreuz, der ihm wiederum diesen Gefallen tat, schreckensbleich und wortlos vor sich stehen sah, weidete er sich mit Behagen an diesem Anblick und sagte ganz gemütlich: „Siehst du, mein lieber Kronensohn, du hast das Wolkenmänneken da oben so lange beschworen, bis es auf dich heruntergesegelt ist. Und die Folge davon: es hat dich gehörig geplündert. Nun können wir wirklich fechten gehen.“
Breit und massiv stand er da, den spitzen Tirolerhut mit der Hahnfeder wie einen Trichter auf den dicken Kopf gestülpt, unergründliche List in den versteckten Augen, die vor dem aufsteigenden Tabaksqualm in ihre tiefsten Winkel flohen. Sein Mienenspiel blieb unbeweglich, nur die schiefgezogenen Lippen über dem mächtigen Kinn sogen unaufhörlich an der Zigarre.
Gabriel Kreuz, der seine Possen kannte, fasste sich rasch. „Lass doch solchen Unsinn, du jagst mir ja unnütze Schrecken ein,“ sagte er erregt. Und er atmete tief auf, als er seine Vermutung, Nagel habe sich einen schlimmen Scherz mit ihm erlaubt, bestätigt fand. Denn gar zu fürchterlich wäre der Gedanke gewesen, eine ruchlose Hand hätte ihm das in einer Minute geraubt, was Mutterliebe jahrelang für ihn aufgespeichert hatte.
Thomas Nagel holte kaltblütig das Kuvert mit dem Gelde aus seiner Rocktasche, hielt es dem Freunde vor die Nase und sagte mit grausamem Spott: „Siehst du, mein lieber Gabriel, — ich wollte dir nur beweisen, dass all’ deine Philosophie ein Loch hat. Dein Geist hat sich den Teufel darum gekümmert, was inzwischen mit deinem Körper geschah. Obgleich er hübsch munter gewesen sein soll, als du wie ein Toter dalagst. Ich hätte dir auch noch deine Uhr mopsen können und den Siegelring von deinem seligen Alten, — du hättest absolut nichts gemerkt. Denk’ nur! Es heisst zwar sonst immer: der Geist ist willig, der Körper aber schwach, — diesmal aber scheint es umgekehrt der Fall zu sein. Deine Tasche, die doch auch beinahe einen Bestandteil deines Körpers bildet, gab willig alles her, und dein Geist fiel dabei vor Schwäche auf die Nase. Siehst du. Und weil dem so ist und du dich als ein ganz unsicherer Kantonist in punkto Geldaufbewahrung bewiesen hast, so werde ich von nun an die Kasse führen. Denn auf meinen Geist, glaube mir, darf ich mich mehr verlassen. Und das, lieber Sohn, ist die Moral von der Geschichte.“
Und als verstände es sich von selbst, und als duldete er gar keinen Widerspruch, brachte er das dicke Kuvert sorgsam in seiner Tasche unter.
Kreuz riss zwar die meerblauen Augen weit auf, liess ihn aber gewähren, denn schliesslich zeitigte ein Scherz den andern; und nahm er den einen nicht übel, durfte er es beim andern auch nicht tun. Später fand sich schon wieder Zeit, den Ernst hervorzukehren. Im übrigen hatte er nun den Beweis dafür bekommen, wie gut es dieser treue Wandergenosse mit ihm meinte, der sich diesen Witz doch nur erlaubt hatte, um ihn in seiner Weise zu belehren. Und so sagte er denn wie zur Anerkennung: „Ich wusste ja, dass dein Geist um so mehr für mich wachte, also konnte ich ruhig schlafen.“
„Aber wenn ich nun ausgerissen wäre, he!“ quetschte Nagel die Worte hervor.
Kreuz lachte sorglos auf. „Erstens trau’ ich dir das nicht zu, und zweitens hätte es nicht lange bei dir gereicht.“
„Erlaube mal, — mit siebzehntausend Mark lässt sich schon was anfangen. Mancher ist zum Millionär dadurch geworden. Das Geld nur immer haben, wenn man es zur rechten Zeit gebraucht, — das heisst, die Konjunktur auszunutzen.“
„Geld macht nicht glücklich,“ sagte Gabriel mit Überzeugung.
„Aber es macht den Dümmsten gescheit und gibt ihm Ansehen.“
„Und da du immer schon gescheit warst und bei mir in gutem Ansehen stehst, mein lieber Thomas, so scheidest du also bei dieser Frage völlig aus,“ sagte Kreuz bei bester Laune, worauf Nagel vor Verblüffung die Antwort schuldig blieb. „Im übrigen glaube mir: dein Gewissen hätte dich schon wieder zu mir zurückgeführt, wie ich dich kenne.“
„Und du hättest mich wieder mit offenen Armen empfangen, wie?“
„Welche Frage! Der Mensch ist am grössten im Verzeihen, und wer da Reue zeigt, der findet auch den Weg wieder zu sich selbst.“
„Es ist eigentlich niemals an dich herangekommen,“ sagte Nagel ärgerlich.
Das kannst du eigentlich nach dieser Mauserei nicht behaupten,“ legte Kreuz die Worte nach seiner Weise aus, um dem Gespräch eine heitere Wendung zu geben.
Sie waren bereits aufgebrochen und schritten über die blühende Wiese, die den zweiten Schnitt noch trug, dem schmalen Pfade zu, der sich darüber hinschlängelte und zur nächsten Anhöhe führte. Kaum hatten sie den festen Boden unter sich, so blieb Nagel, der voranschritt, wieder stehen und wandte sich fragend zurück: „Sag’ mal, — was verstehst du überhaupt unter Gewissen? Ich bin neugierig, deine Ansicht darüber zu hören. In dir steckt doch immer noch der Gottesmann, auch wenn aus dem Betpult ein Notenpult geworden ist.“ Und mit rotem Kopfe ging er weiter, weil er sich nicht ins Gesicht sehen lassen wollte. Wie alle Menschen, die andauernd auf der Grenze zwischen Gutem und Bösem stehen, ärgerte es ihn, seine wahren Gefühle nicht offenbaren zu können. Denn er hatte Gabriel gern, hatte ihn im Laufe der Jahre liebgewonnen seiner Uneigennützigkeit wegen; er schätzte seinen offenen Charakter, war stets bezwungen von seiner Sanftmut, die immer das gleiche Lächeln der Verzeihung ausstrahlte und allen Wortangriffen mit unendlicher Geduld begegnete. Das aber war es gerade, was Thomas manchmal in heimliche Wut versetzte, weil seine innerliche Raufnatur dadurch nicht befriedigt wurde. Er war der Mann der Tat, ein Lebensbejaher, der den ganzen Kerl sehen wollte und nicht den halben: den kampflustigen Feind, der bis zur Niederlage focht, auch wenn er im Unrecht war. Demut war ihm Schwachheit, nur geschaffen für das Weib, das seiner Ansicht nach die Sklavin des Mannes sein musste.
„Das Gewissen ist die Auferstehung im Menschen, die ihn von Golgatha in den Himmel führt,“ erwiderte Gabriel. „Denn keine grössere Befreiung für uns, als wenn wir nach grossen Seelenqualen bereit sind, die Sühne auf uns zu nehmen. Wir müssen, ob rein oder unrein, ob Verbrecher oder nicht.“
„Hübsch gepredigt, mein Sohn,“ sprach Nagel zurück, ohne seine Schritte zu hemmen. „Aber ich kann dir sagen, dass du damit bei den meisten Leuten kein Glück haben wirst. Denn, willst du glauben: für sie ist das Gewissen nur der schwarze Mann, mit dem man kleine Kinder erschreckt. Ein Gummiball, den man springen lässt und der einem nicht wehe tut, wenn er mal ins Gesicht zurückfällt. Eine Nervenfrage, denn mehr oder weniger hängen doch alle unsere Taten nur mit unseren Nerven zusammen. Starke Nerven scheuen und bereuen nichts, denn sie sind das Blut und Eisen der Weltgeschichte, die Sieger und Schöpfer, die über Leichen gehen. Nur die Schwachnervigen heulen und sehen Gespenster, die natürlich bloss in der Einbildung vorhanden sind. Ergo ist Gewissen nur Einbildung.“
„Die Einbildung schafft aber den Wahn, und der Wahn kann zum Verderben führen.“
Thomas Nagel blieb stehen und sah sich um. „Ja, da hast du recht, darin liegt etwas Wahres. Deshalb darf man sich eben von der Einbildung nicht unterkriegen lassen.“ Und er schritt wieder weiter.
„Des Menschen Wille wird schwach, wenn Gott ihn bricht,“ sagte Kreuz wieder. „Und unser aller Gewissen ist Gott.“
„Ach was!“ rief Nagel nun gereizt aus. „Gott ist nur für die Schwachen da.“
„Aber der Glaube an ihn macht die Schwachen stark,“ erwiderte Kreuz gelassen.
„Dann hättest du deinem Glauben noch eine höhere Potenz zu geben,“ sprach Nagel dickköpfig weiter, ohne seine Gangart einzustellen.
Gabriel Kreuz, der ihn verstand, nahm das gutmütig auf. „Meiner Nachgiebigkeit wegen, wie?“
„Die doch im allgemeinen nur Schwäche ist, lieber Sohn.“
„So legst du es aus als Gewaltmensch,“ erwiderte Kreuz, nun lauter hinter ihm her, weil der andere schon seinen Siebenmeilenschritt nahm. „Ich nenne es Starksein aus innerer Kraft. Widerstrebe nicht dem Übel.“
Thomas Nagel lachte laut in die Landschaft hinein. Dann schrie er, wie zum Hohne, unbändig vor sich hin: „Tolstojaner! Ist ja Quatsch, Philosophie der Mummelgreise, der Impotenten, der ausgebrannten Krater. In ihrer Jugend haben sie sich vielleicht die Füsse mit Sekt gewaschen, und wenn sie alt geworden sind, dann schmieren sie sich den Schädel mit Glaubenssalbe ein. Wie die Dirnen, die nach genossenen Freuden sich als alte Betschachteln zur Ruhe setzen. Nichts leichter, als auf diese Art mit Seelenschmalz hausieren zu gehen und die Dummen zu fangen.“ Und er lachte abermals schallend auf, als wollte er die ganze Welt mit seiner Bärenstimme erschüttern.
„Das hat vor Tolstoj schon ein ganz anderer gesagt,“ wandte Kreuz ein, dem nur die Worte „Widerstrebe nicht dem Übel“ im Sinne lagen. „Und der war wahrhaftig keiner von deiner Sorte.“
Beide sagten eine ganze Weile nichts mehr, denn wieder hatten sie die Empfindung, an der äussersten Grenze ihres inneren Widerspruchs angelangt zu sein. Schon oft hatten sie das Gefühl, dass nur noch ein Wort genügen würde, um die offene Beleidigung ausbrechen zu lassen, und davor scheute sich besonders der abhängige Nagel. Und obwohl er, den Schatz in der Tasche, sich plötzlich als Herr und Gebieter über den anderen fühlte, so wie der blinde Zufall aus dem Nehmenden den Gebenden macht, so lenkte er auch diesmal vorsichtig ein, nicht zuletzt aus Scham, sich wieder als der Niedrige gezeigt zu haben. Denn das fühlte er bei solcher Gelegenheit immer: dass die verborgenen Instinkte wie aus einem blasigen Morast in seiner Seele emporquollen und dann die Erbschaft seines Grossvaters antreten wollten, der als Verbrecher im Zuchthause gestorben war. Und weil er dieses Geheimnis seiner Familie hütete und es durch eigene gleiche Taten nicht entschleiern wollte, so schlug er seine belastete Natur stets in Fesseln, obgleich er in solchen Minuten gedämpften Zornes zu sehr empfand, dass an diesen Fesseln verborgene Mächte ganz frech rüttelten, um sie gegen seinen Willen mit höhnischem Lachen zu zerreissen.
Plötzlich blieb er wieder stehen und gab dem hinter ihm her kommenden Kreuz einen Wink, sich still zu verhalten. Dann blickten beide gespannt über den schroff am Rande hinführenden Pfad auf die Wiese, wo, wenige Meter unter ihnen, auf einem Steine sitzend, ein vereinsamter Hänfling sich abmühte, einen ergatterten Wurm mundgerecht zu machen. Er pickte mit seinem Schnabel darauf los, ohne recht zu wissen, wo er den Anfang machen sollte. Und es war ganz drollig, wie sein Schwanz dabei in die Höhe ging, wie er rechts und links äugte, dem Zappelnden ein wenig Erholung gönnte und dann wieder darauf losschlug. Dann, aufgeschreckt durch die beiden Menschen, nahm er sein Opfer in den Schnabel und flog davon, um die Mahlzeit ungestört zu vollenden.
„Siehst du, da hast du ein Beispiel für meine Theorie,“ sagte Nagel und verweilte noch, um sich eine frische Zigarre anzuzünden. „Kampf ums Dasein, — die Grossen fressen die Kleinen auf.“
„Nichts Neues,“ erwiderte Gabriel heiter.
„Aber wert, immer wieder rekapituliert zu werden. ‚Stirb du, damit ich lebe,‘ sprach der Vogel einfach zum Wurm, und das, siehst du, mein lieber Kreuz, —. das ist die Parole im ganzen Kampfe ums Dasein. Wie bei den Tieren, so auch bei den Menschen. Selbsterhaltungstrieb. Nur mit dem Unterschied, dass die Tiere aus Instinkt handeln und wir mit Bewusstsein. Überlegung, weisst du, ist wohl bei beiden vorhanden. Denn man sah es ja ordentlich, wie dieser Wiesenproletarier erst Übungen vornahm, um das Gleichgewicht im Schnabel zu halten. So etwas interessiert mich ungemein, schon aus Gründen der Flugtechnik.“
Das brauchte er eigentlich nicht mehr zu sagen, denn Gabriel hatte seine Erläuterungen darüber schon bis zum Überdruss gehört. Während der ganzen Wanderschaft, sowie sich Gelegenheit dazu bot, kam Nagel mit seinem Gleichnis zum Vorschein: dass man, um das Problem des fliegenden Menschen zu lösen, den Flug des Vogels studieren müsse, so wie es der bei Berlin verunglückte Lilienthal, der geniale Vorkämpfer auf diesem Wege, zeit seines Lebens getan habe. Und als sie hoch oben in den Alpen waren, an einem Felsengrat, der in schauerlicher Tiefe senkrecht abfiel, und ein Adler über ihnen kreiste, reckte Thomas Nagel so sehr den Hals nach ihm, geriet er mit seiner Erklärung derartig in lebhafte Bewegung, dass er beinahe abgestürzt wäre.
Schweigend gingen sie weiter inmitten finsterer Fichten, deren gekrümmte Wurzelausläufer über den ausgetretenen Fusssteg liefen und natürliche Treppenstufen schufen, die hinaufführten und dann wieder hinunter. Eine Weile schritten sie wie auf schwankendem Grunde, denn dieses ungeheure Wurzellabyrinth trug hier den Erdboden, so dass man den Fuss auf nachgiebigen Gummi zu setzen glaubte. Rechts stieg der Wald hinan und hüllte sich in dämmeriges Dunkel, in dem die graubemoosten Findlinge wie unförmliche Ungeheuer zwischen den schwarzen Stämmen lagen; von links jedoch winkte das lachende Tal mit seinem gleissenden Sonnenschein, der alles in grünes Licht tauchte und das Auge fast blendete. Das Gebirge drüben zog wie ein schmaler blauer Streifen mit, der sich hin und wieder verlor, dann wieder durch die Lichtlucken mächtig anwuchs, bis man plötzlich, wenn die Fernsicht es gestattete, einen blauen Kegel in die Wolken ragen sah.
Diesmal regte sich in Gabriel der Widerspruch, und so fühlte er sich versucht, ein Wortgefecht über die brutalste aller Weltanschauungen zu beginnen. Denn je mehr in seinen Augen der Lebensgigant vor ihm wuchs, der sicher dereinst sein Ziel mit eisernem Beharren erreichen würde, je tiefer bemitleidete er ihn, weil er den Wert des Lebens immer nur auf der Wage der Rücksichtslosigkeit wog. Manch’ guten Zug, den er barg, hätte Gabriel zu gerne aus ihm herausgeholt, und als Kämpfer für das Höchste wollte er nichts unversucht lassen, ihn umzuformen nach dem alten Rezept von Güte und Geduld.
Thomas aber hatte seine schlechte Stunde, wo ihm alles nicht schnell genug ging und er am liebsten die ganze Menschheit massakriert hätte, weil sie seinen Höhenflug noch nicht kannte, ihm keine Millionen zur Erreichung seines Zieles vor die Füsse legte und bisher so wenig Notiz von seiner geliebten Person genommen hatte.
Wie? Was? muckte er gehörig auf. Er habe nicht recht mit seiner Ansicht, obwohl sie der ganzen natürlichen Schöpfungsgeschichte entspreche? Was habe denn Darwin gelehrt, he? Sei der vielleicht ein Dummkopf gewesen? Er habe die Überbibel geschaffen, das wissenschaftliche Abc des gesunden Menschenverstandes, wonach jedes grosse Kind im Buche der Natur lesen lernen könne. Dja! . . . Nun gar erst Haeckel, dieser Finder im unermesslichen Reiche natürlicher Entwicklung. Dieser göttliche Weise auf Erden! Niemand habe reiner aus dem Quell der Wahrheit geschöpft, als er.
„Was ist Wahrheit?“ wagte Kreuz mit abgeklärtem Spotte einzuwenden. „Wo ist sie zu finden? Nicht bei dir und nicht bei mir. Auf alle Fälle ist die Wahrheit ein Begriff, den sich die liebe Menschheit zurechtgemacht hat, um mit Willkür damit umzugehen. Vielleicht, weisst du, ist sie auch nur eine grosse Einbildung, eine Selbstlüge, eine geistige Blindheit, die uns Dinge sehen lässt, die gar nicht vorhanden sind. Wahr allein ist der Glaube, denn er führt ins Grenzenlose, also ins Ewige. Und die Ewigkeit allein steht fest. Also hat auch der Glaube etwas unbedingt Wahres und etwas unbedingt Unerschütterliches. Nach dem Gesetze der Logik sogar.“
Da blieb Nagel mit einem Rucke stehen und wandte sich heftig nach ihm um. „Soll ich dir sagen, was Wahrheit ist?“ Dann höre es, du unverbesserlicher Erdensohn, Säulenheiliger und Rückständiger. Wahrheit ist, meinen neuesten Forschungen nach (er lachte über diesen Witz), dass die erbitterte Menge dem gekreuzigten Christus nicht den bekannten Hohn: „Bist Du Gottes Sohn, so hilf Dir selber“ ins Antlitz schleuderte, sondern dass sie ihm vielmehr einfach hundertstimmig das soziale Vernichtungswort zurief: „Stirb Du, damit ich lebe!“ Denn es wäre ja nicht auszudenken, wenn die allgemeine Menschenverbrüderung damals schon den berechtigten Egoismus des Einzelnen unterbunden hätte. Denn siehst du, mein lieber Sohn, es gibt keinen grösseren Feind des Ichs mit seinem eigenen Sinn, als die Verallgemeinerung mit tausend Köpfen, die immer nur Verwirrung anrichtet. Ich bin ich und weiss, was ich will, die Menge jedoch weiss nie, was sie will. Glaube mir. Mein Ziel führt geradeaus, das Ziel der Menge aber geht nach allen