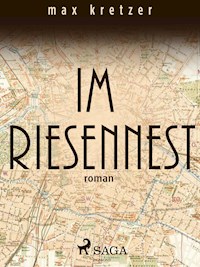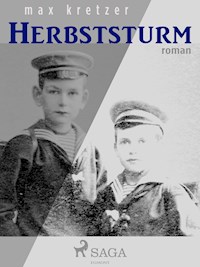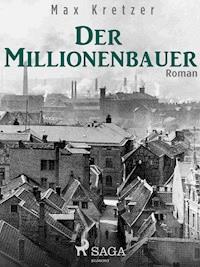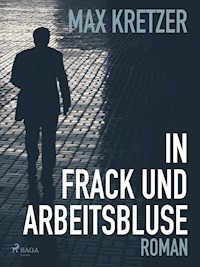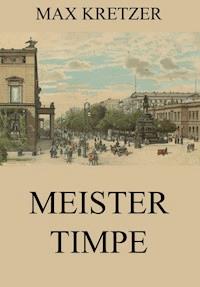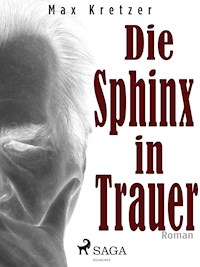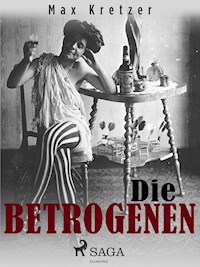Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hans Hauff, 35 Jahre alt, nervenschwach, angstbeladen und hypochondrisch, wird nach einer Nervenattacke ins Forsthaus am Teufelssee im Berliner Grunewald gebracht. Dort trifft er auf eine geheimnisvolle junge Frau, der er fortan auf sonderbare Weise immer wieder begegnet. Nach anfänglicher Zurückhaltung verliebt er sich immer mehr in die rätselhafte "Madonna vom Grunewald", die sein Inneres fast besser zu kennen scheint als er selbst. Doch je mehr er Hilda Donner habhaft zu werden wünscht, desto mehr scheint sie sich ihm zugleich zu entziehen. Ein außergewöhnlicher Liebesroman über die Angst vor dem Alleinsein, den Triumph des Willens über die eigene Schwäche und über die Macht der Liebe, die alle Hindernisse zu überwinden vermag. Mit dem scharfen Blick des Diagnostikers und mit den Augen des Dichters sowie absoluter Lebenstreue und, nicht zu vergessen, einer erfrischenden Prise Humor, hat Kretzer in diesem Roman einen Stoff behandelt, dessen faszinierende Eigenartigkeit ebenso überrascht wie fesselt. Die ganze Erzählkunst des bedeutenden naturalistischen Autors tritt hier glänzend zutage.Max Kretzer (1854–1941) war ein deutscher Schriftsteller. Kretzer wurde am 7. Juni 1854 in Posen als der zweite Sohn eines Hotelpächters geboren und besuchte bis zu seinem 13. Lebensjahr die dortige Realschule. Doch nachdem der Vater beim Versuch, sich als Gastwirt selbstständig zu machen, sein ganzes Vermögen verloren hatte, musste Kretzer die Realschule abbrechen. 1867 zog die Familie nach Berlin, wo Kretzer in einer Lampenfabrik sowie als Porzellan- und Schildermaler arbeitete. 1878 trat er der SPD bei. Nach einem Arbeitsunfall 1879 begann er mit der intensiven Lektüre von Autoren wie Zola, Dickens und Freytag, die ihn stark beeinflussten. Seit dem Erscheinen seines ersten Romans "Die beiden Genossen" 1880 lebte Kretzer als freier Schriftsteller in Berlin. Max Kretzer gilt als einer der frühesten Vertreter des deutschen Naturalismus; er ist der erste naturalistische Romancier deutscher Sprache und sein Einfluss auf den jungen Gerhart Hauptmann ist unverkennbar. Kretzer führte als einer der ersten deutschen Autoren Themen wie Fabrikarbeit, Verelendung des Kleinbürgers als Folge der Industrialisierung und den Kampf der Arbeiterbewegung in die deutsche Literatur ein; die bedeutenderen Romane der 1880er und 1890er Jahre erschlossen Schritt für Schritt zahlreiche bislang weitgehend ignorierte Bereiche der modernen gesellschaftlichen Wirklichkeit für die Prosaliteratur: das Milieu der Großstadtprostitution (Die Betrogenen, 1882), die Lebensverhältnisse des Industrieproletariats (Die Verkommenen, 1883; Das Gesicht Christi, 1896), die Salons der Berliner "besseren Gesellschaft" (Drei Weiber, 1886). Sein bekanntester Roman, "Meister Timpe" (1888) ist dem verzweifelten Kampf des Kleinhandwerks gegen die kapitalistische Konkurrenz seitens der Fabriken gewidmet. Während Kretzer anfangs der deutschen Sozialdemokratie nahestand, sind seine Werke nach der Jahrhundertwende zunehmend vom Gedanken eines "christlichen Sozialismus" geprägt und tragen in späteren Jahren immer mehr den Charakter reiner Unterhaltungsliteratur und Kolportage. Er starb am 15. Juli 1941 in Berlin-Charlottenburg.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Max Kretzer
Die Madonna vom Grunewald
Roman
Saga
Die Madonna vom Grunewald
© 1901 Max Kretzer
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711502778
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Hedwig und Luise
gewidmet
Ein banges Sehnen hat mein Herz erfasst!
Wie ich dies Fleckchen Erde euch auch neide:
Ich schaue nur die Wiesen meiner Scholle.
Und nächtens wähn’ ich meine märk’sche Heide;
Dort träume ich ein Plätzchen fern und still,
Wo nah’ der Kiefern Düfte wehn
Und eine sagenvolle Blume blüht
In jenen dunklen, stummen Seen.
In dieser Erde zauberische Flut,
Wo grauer Vorzeit Märchen mich umtönt,
In diese heil’gen Wasser senkt mich tief! —:
Todmüde, doch verlangend und versöhnt.
Gustav Theodor Schuhr.
Erstes Kapitel.
An einem dunkeln Nachmittage, als kurze Regenschauer hintereinander den Grunewald durchnässt hatten, vernahmen Holzfäller tief im einsamen Forst laute Hilferufe, die vom Wege herzukommen schienen, der von der sogenannten Saubucht mitten durch eine offene Schonung führte. Und als zwei von ihnen mit langen Schritten der Stelle zueilten, fanden sie einen Herrn vor, der mit schreckhafter Miene auf einem Baumstumpf sass, sich abwechselnd mit der Linken an die Kehle und an sein Herz fasste und den Eindruck eines Menschen machte, der den Tod vor Augen zu haben glaubt.
Er war ihnen nicht unbekannt. Schon öfter hatten sie ihn in Gesellschaft anderer Herren gesehen, die an bestimmten Tagen ihre Fusstour durch den Wald zu machen pflegten. Ohne ihn näher zu kennen, wussten sie nur, dass die Wandergenossen ihn mit Herr Doktor anredeten, und so benutzten sie denn auch diese Titulatur sofort, um sich nach der Ursache seiner Bedrängnis zu erkundigen.
„Wo sind sie denn? Wohl durch die Schonung?“ fragte Stahlknecht, nachdem er sich teilnahmsvoll zu ihm niedergebeugt hatte. Die blauen Augen des bärtigen Hünen, der, noch kaum ausgereckt von der Arbeit des ewigen Bückens, mit leicht geknickten Knien vor dem Unglücklichen stand, gingen suchend im Kreise, als müsste er noch irgendwo des Attentäters ansichtig werden, um ihn seine mächtige Faust fühlen lassen zu können.
„So’n Gesindel. Schon am lichten Tag treiben sie’s,“ warf Vater Krause ein, ein bereits weissbärtiger Mann, der seinem Genossen kaum bis an die Schulter reichte. Und auch seine kleinen, kugelrunden Augen gingen beweglich hin und her, während er sich aber zugleich misstrauisch das Haar unter dem schmutzigen Filzdeckel kraute. Wenn es einen Überfall gab, so mussten doch mindestens immer zwei dabei sein, und er hätte bei den vierzig Jahren, die er hier im Walde zugebracht hatte, schwören mögen, nur einen Menschen zwischen den Bäumen bemerkt zu haben.
Doktor Hauff gab ihnen in abgerissenen Worten Aufklärung, wobei seine Stimme schwach und unsicher klang. Er habe einen Nervenanfall gehabt, durch den er beinahe erstickt worden sei. Dort drüben, wo der Holzstoss liege, habe es begonnen. Das Herz habe ihm plötzlich wie dumpfer Kanonendonner geschlagen, ein grosses Schwächegefühl sei über ihn gekommen, fürchterliche Angst habe ihn gepackt und so habe er laut um Hilfe gerufen und sich hier niedergelassen, um den Tod zu erwarten. Seine Visitenkarte mit den letzten Grüssen an seine Angehörigen habe er neben sich gelegt.
Alles das sagte er mit grosser Überzeugung, als hätte er Leute aus seinen Kreisen vor sich, die ihn sofort verstehen müssten. Aber Stahlknecht und Vater Krause verstanden ihn auch nicht, als die Worte „die Nerven, die Nerven“ immer wieder an ihr Ohr drangen.
Fast gleichzeitig nahm jeder von ihnen die kurze Pfeife aus dem Munde, drückte mit dem Finger den schmokenden Kanaster zusammen und sah dabei den anderen an, als wollte er sagen: „Merkst du ’was davon? Er sieht ja gesund als wie die Kiefer oben am Zopf. Am Ende will er uns nur aufziehen.“
Sie hatten von Nerven noch nichts gehört, wenigstens nicht in diesem Zusammenhange; und dass die Nerven nun gar imstande sein könnten, einen Menschen anzufallen — davon hätten sie sich niemals etwas träumen lassen. Am liebsten hätten sie lachen mögen, wenn sie bedachten, dass sterbenskranke Menschen auch danach aussehen mussten.
Erst, als Doktor Hauff sich mit Mühe erhob und wie verlangend die Arme nach ihnen ausstreckte, hatten sie die dunkle Empfindung, es mit irgend einem Ereignis zu tun zu haben, für das ihnen das Verständnis abging. Bereitwillig zeigten sie die Unterstützung braver Menschen, ergriffen ihn sanft und hielten ihn aufrecht, in der Meinung, er könnte im nächsten Augenblick ihren Händen wieder entfallen.
Hans Hauff blieb stehen und fühlte wieder jene Kraft in sich, die den nervenschwachen Menschen überkommt, sobald er das Bewusstsein hat, nicht mehr ohne Hilfe zu sein. Der Wille seiner fünfunddreissig Jahre regte sich kraftvoll, der stärkere Geist versuchte den Körper zu knechten, und so ging er am Arme Stahlknechts, zwar schwankend und unsicher wie ein Betrunkener, aber doch mit dem schönen Gefühle, das der Mensch hat, wenn er dem Tode soeben entwichen ist. Nur der Schauer der Sterbeangst war zurückgeblieben und durchzitterte nach wie vor seine Glieder. Unbestimmte Wahnvorstellungen folterten ihn und liessen ihn den Druck eines Seelenzustandes empfinden, den er niemals vorher gekannt hatte.
„Führen Sie mich nach dem Forsthause, es soll Ihr Schaden nicht sein,“ sagte er, getrieben von der Sehnsucht nach einem Orte, wo er bekannt war.
„Jawohl, Herr Doktor, das tu’ ich gern,“ gab Stahlknecht zurück.
Man musste an der Stelle vorüber, wo die Männer arbeiteten. Im Herbst vergangenen Jahres hatte es einen starken Windbruch gegeben, so dass mächtige Kiefern wie die Halme gefallen waren. Das hatte Arbeit den ganzen Winter durch gemacht, um das Nutzholz wegzuschaffen, und nun war man dabei, das Brennholz zu spalten und aufzuklaftern und auch aus den Kronen das Brauchbare herauszuschneiden.
Noch ein dritter Arbeiter rührte gemächlich die Hände. Er war taub, zog beim Anblick des Doktors nur die Mütze und arbeitete ruhig weiter. Erst als Vater Krause ihm etwas ins Ohr hineinrief, fiel es ihm auf, dass der Herr am Arm des Kollegen hing. Verwundert betrachtete er ihn einige Augenblicke, dann beugte sich der steife Rücken wieder zur Erde.
Ein grosser, schwarzer Ziehhund, der unter der Deichsel des Holzwagens lag, wurde munter und stiess beim Anblick Hauffs ein kurzes freudiges Bellen aus, das dumpf und hohl den stillen Wald durchschallte. Die Herren vom „Waldklub“ hatten ihn wie die übrigen Tiere, die sie am Wege fanden, durch das Mitbringen von Knochen verwöhnt, und so witterte er auch jetzt die übliche Papierhülle in der Tasche des Doktors. Er beruhigte sich erst, als Stahlknecht ihn mit einem energischen „Kusch dich“ aus dem Bereiche Hauffs brachte, denn wütend hatte er zuletzt an seinem Strick gezerrt und den ganzen Wagen in Bewegung gebracht.
Hauff gab jedem eine Zigarre, verschmähte nicht einen schluck aus der Flasche Vater Krauses, der ihm wie ein seltenes Labsal erschien, und schritt dann in Begleitung Stahlknechts die Schonung entlang, deren ganze äusserste Ecke man nehmen musste, um ans Ziel zu gelangen.
Der frische Erdgeruch des beginnenden Frühlings stieg empor, erweckt vom warmen Regen. Schärfer als je strömten die Kiefern ihren Duft aus, mit dem sich der starke Geruch des Kiens im geschlagenen Holz mischte. Die Luft war rein und geklärt, aber noch erfüllt von den leisen Schauern der Nässe. Das erste frische Grün der Grasspitzen lugte verlangend aus dem Boden hervor. In der Ferne zwischen den Stämmen hing der graue Nebeldunst des Abends, der schwer und trübe, beschleunigt durch die dunkeln Wolkenmassen am Himmel, früh hereinzubrechen drohte.
Und diese trostlose Stimmung im Walde war es gerade, die auf Hauffs Gemüt gewirkt und seine Nerven in Aufruhr gebracht hatte. Noch einmal wollte er in einem grossen Gedankenzug den Vorgang mit allen Einzelheiten zusammenfassen, aber es gelang ihm nicht, denn ihm fehlte die Kraft zum Denken — jene frische befriedigende Kraft, die ihn noch am Abend vorher in seiner Studierstube so beglückt hatte. Wie froh hatte er sich schlafen gelegt, zwar aufgeregt wie immer nach geistiger Tätigkeit, die bis tief in die Nacht währte, aber doch friedlich, ungepeinigt von dem Angstgefühl, das ihn nun die Einsamkeit wie ein Schreckgespenst empfinden liess. Denn er wusste: hätte man ihm einen goldenen Berg versprochen, er würde heute nicht noch einmal denselben Weg genommen haben, den er soeben zurückgelegt hatte.
Er war krank, wirklich krank; in einer Stunde war er es geworden, wie die heitere Schönheit sich plötzlich in traurige Hässlichkeit verwandelt. Er fühlte einen anderen Menschen in seinen Kleidern, einen über die Jahre hinaus gealterten, der den Gedanken nicht los werden konnte, der Tod müsste ihn doch noch plötzlich ereilen.
Sein Herz schlug ihm bis zum Halse, so dass er fortwährend an die Kehle griff, und Handflächen und Stirn waren fettig von nervösem Angstschweiss, der immer aufs neue sich zeigte, so oft er ihn auch trocknete.
Als das Stahlknecht eine Weile beobachtet hatte, kam ihm dieses Benehmen sonderbar vor, und noch mehr, als Hauff wiederholt mit der Frage hervorkam, wie er denn aussehe.
„Aber ganz gesund, Herr Doktor, ganz gesund,“ gab er zurück. „Man sollte meinen, dass Ihnen gar nichts fehlt.“ Sein Gedanke dabei aber war: „Etwas los bei ihm da oben muss doch sein.“ Und er wurde in dieser Meinung noch bestärkt, als Hauff ihm erwiderte: „Die kranken Nerven kann man nicht sehen, lieber Mann.“
Stahlknecht schritt auf seinen grossen Waldtretern gleichmässig neben ihm her. Das Wort „Nerven“ machte ihm wieder zu schaffen. Das mussten ja verflixte Dinger sein, die dem Menschen zusetzten, ohne dass man es ihm ansehen konnte. Nur die feinen Leute sollten sie haben, davon hatte er schon gehört. Menschen seines Schlages blieben davon verschont, das wusste er auch.
„Nun können der Herr Doktor sich ja selbst etwas verschreiben, was gut tut dagegen,“ sagte er wieder. Seiner Meinung nach waren alle Herren, die diesen Titel führten, Ärzte. Und als Hauff ihm die Aufklärung gab, dass er es mit einem „anderen Doktor“ zu tun habe, machte der Hüne ein etwas dummes Gesicht, schob seine Mütze zurück und sagte wichtig: „Das is nu so, Herr Doktor. Sie müssen mit dem Kopp arbeiten und wir mit den Fäusten. Dafür kriegen wir auch die Dinger nich, die Sie haben.“ Dann, nach einer Kunstpause, kam er vorsichtig mit der Frage hervor, was die Nerven eigentlich seien.
„Bestien, Bestien, lieber Stahlknecht,“ gab Hauff zur Antwort, „kleine, lose Bestien. Sie peinigen uns, ohne dass wir sie dafür bestrafen können. Im Gegenteil — wir müssen ihnen noch gut zureden und sie sanft behandeln. Sonst rächen sie sich doppelt.“
Nun wurde Stahlknecht erst recht nicht daraus klug. Mit einem „Ach, so ist das“ schwieg er sich aus.
Sie waren am Teufelssee angelangt, zu dem es bergab ging. Still und grau lag der Spiegel des Wassers, in dem sich der Torfstich vorn wie eine schwarze Wand in der Tiefe verlor. Der bewölkte Himmel, die dunkeln Kiefern, die sich drüben, den Berg hinauf, wie eine starrende Wehr auftürmten, das leise Prasseln des Regens, der jetzt aufs neue in grossen Strichen herniederfiel — alles erhöhte die trübe Stimmung in Hauffs Seele. Gerade so hatte sich plötzlich der Himmel verfinstert, als er es Nacht in sich und um sich werden fühlte.
„Kommen Sie schneller,“ sagte er und klammerte sich ängstlicher an des Waldarbeiters Arm fest.
„Nun hat’s keine Weile mehr, Herr Doktor. Da pustet die Maschine schon.“
Vorn, der Fahrstrasse zu, die hinauf nach Westend führte, lagen die Charlottenburger Wasserwerke. Das rote Mauerwerk hob sich leuchtend aus dem Waldesgrunde ab, und wie eine Porphyrsäule ragte der Schlot in den Regendunst hinein, gekrönt von dem schwarzen Qualm, der sich in mächtigen Flocken um seinen Kranz legte. Das dumpfe Fauchen der Maschine schien aus der Erde zu kommen. Hauff blieb verwirrt stehen. Er glaubte wieder das laute Klopfen seines Herzens zu vernehmen, und so ging er erst beruhigt weiter, als Stahlknecht ihm seinen Irrtum genommen hatte.
Das Forsthaus lag hinter dem Wasserwerk. Es war ein schmuckes, steinernes Haus, das mit seinem Erker und den Treppenüberdachungen mehr den Eindruck eines Landhauses machte. Hinter dem Hause befand sich ein Gärtchen, in dem kleine Lauben mit Naturtischen dm Wanderer zum Ruhen einluden. Es gab nur Kaffee und frische Milch. Die Frau Förster, eine rundliche Frau mit einnehmenden Zügen, stand im Rahmen der Haustür. Sie hatte die beiden kommen sehen und war verwundert hinausgeeilt.
„Dem Herrn Doktor ist schlimm geworden,“ raunte ihr Stahlknecht zu, als Hauff wortlos nach einem „Guten Tag“ in dem kleinen Wohnzimmer Platz genommen hatte, das mit den vielen Geweihen, dem Schmuckschrank, der mächtigen Truhe und sonstigen Möbelstücken ein Gemisch von Stadt- und Landeinrichtung bildete.
Oh, das tue ihr leid. Sie wolle gewiss alles tun, um dem Herrn wieder auf die Beine zu helfen. Sofort kam sie mit Baldriantropfen, von denen sie fünfzehn auf ein Stückchen Zucker tröpfelte, das sich Hauff geduldig in den Mund schieben liess. Dann blickte er wieder, den Kopf auf die Hand gestützt, durch die kleinen Scheiben hinaus in den Wald, ohne an etwas anderes als an seinen Zustand zu denken. Die Stubenluft tat ihm plötzlich wohl. Und so gab er sich mit stillem Behagen der ersten Ruhe hin.
„Herr Doktor, ich kenne Sie ja gar nicht wieder,“ rief die Frau Förster aus, die ihn bisher nur als einen munteren, stets gut aufgelegten Herrn gekannt hatte.
„Er hat’s mit den Nerven,“ raunte ihr Stahlknecht wieder zu, der, die Mütze in der Hand, bescheiden an der Tür stehen geblieben war. „Das sollen ja höllische Bestien sein, Frau Förstern. Und gut zureden soll man ihnen — und gut behandelt müssen sie auch werden.“
Sie lachte unterdrückt. „Das wollen wir schon besorgen, Stahlknecht. Ein starker Kaffee tut Wunder. Sie können draussen auch eine Tasse trinken.“
Hauff hatte ihm ein Markstück in die Hand gedrückt, und so empfahl er sich mit einem ungeschickten Bückling, dem Herrn Doktor gute Besserung wünschend.
Es dauerte nicht lange und die Frau Försterin kam mit dem heissen Kaffee, den Hauff begierig schlürfte. Allmählich fühlte er sich belebt, die Mattigkeit schwand, das Herz schlug ruhiger, obgleich er den fettigen Schweiss nach wie vor auf Stirn und Hand verspürte. Die Neugierde der Wirtin regte sich. Stahlknecht hatte ihr zwar draussen von dem Auffinden Hauffs erzählt, sie hätte diesen aber noch gar zu gern ausgeforscht, wie denn alles gekommen sei. Schon wollte er gesprächig werden, als er bemerkte, dass sie nicht allein waren.
Hinter ihm, am Sofatisch, sass eine junge Dame, die ebenfalls ihren Kaffee trank und allem Anscheine nach gleich ihm hier eingekehrt war. Sein Blick hatte sie nur flüchtig gestreift, so dass ihm nur ein Paar grosse, ganz merkwürdige Augen in der Erinnerung geblieben waren. Und so fühlte er sich plötzlich eingeschüchtert, hier von seiner Schwäche zu reden.
„Oh, es ist durchaus nichts Besonderes, Frau Förster,“ bemerkte er ausweichend. „Nur ein kleines Unwohlsein, das bald vorübergehen wird. Das kann ja einem Menschen begegnen, der Frau und Kinder hat, wie Ihr Mann immer zu pflegen pflegt.“
„Und der Herr Doktor haben noch nicht ’mal welche.“ Sie glaubte einen Witz gemacht zu haben, lachte laut auf, so dass ihre kernigen Zähne sichtbar wurden, fragte nach seinem sonstigen Begehren und ging dann, als er dankend abgelehnt hatte, mit einer alltäglichen Bemerkung hinaus, weil lautes Kindergeschrei vernehmbar wurde.
Eine Weile herrschte Stille im Zimmer. Gleichmässig ertönte das harte Ticktack der alten Wanduhr und dazwischen das sanfte Klirren des Löffels vom Sofatische her. Hauffs Gedanken drehten sich um die Frage, wie er wohl nach Hause kommen werde. Der Regenschauer war wieder vorübergegangen, ein Sonnenstrahl verirrte sich verheissungsvoll zur Erde nieder und durchleuchtete die grossen Regentropfen, die an den Sträuchern im Gärtchen hingen. Und während sein Auge erquickend diesen ersten Sonnenstrahl am dunkeln Nachmittage mit einer gewissen Erlösung förmlich einsog, platzte eine melodische Stimme in sein stilles Brüten hinein, so dass er erschreckt auffuhr.
„Bitte um Verzeihung, mein Herr ... Ich hörte soeben, dass Sie nervenleidend seien — Sie sollten dann jedenfalls nicht allein Ihre Spaziergänge machen.“
Er war so überrascht, dass er nicht gleich eine Antwort fand, sondern seinem Stuhl einen Ruck gab, sich ihr zuwandte und sie erwartungsvoll anblickte. Von dem Bedürfnis beseelt, in dieser schweren Stunde fremde Gesichter zu fliehen, fühlte er sich gerade jetzt am wenigsten aufgelegt, sich mit einer Unbekannten in Erörterungen über seine persönlichsten Dinge einzulassen. Und so erwiderte er etwas kurz angebunden:
„Ich werde jedenfalls Ihren Rat befolgen, mein Fräul— — werte Frau,“ verbesserte er sich rasch.
„Bitte, bleiben Sie bei dem Fräulein,“ warf sie lächelnd ein. „Das tut ja auch nichts zur Sache. Ihr ,jedenfalls‘ gibt mir ,jedenfalls‘ eine Lehre, mich nicht um die Leiden anderer zu bekümmern. Es interessierte mich nur, weil es einem mir bekannten Herrn gerade so erging wie Ihnen heute. Er hatte auch einen Anfall, als er allein war. Leider hatte er nicht die Willenskraft, Herr über seine Nerven zu werden.“
Ihre letzten Worte waren von einem schwachen Seufzer begleitet. „Bitte nochmals um Verzeihung für meine Voreiligkeit.“
Damit leerte sie rasch ihre Tasse und sah sich nach der Tür um, als müsste sie jeden Augenblick das abermalige Erscheinen der Frau Förster erwarten. Schon vorher hatte sie, Geld aus einem kleinen Netzportemonnaie genommen, und so rüstete sie sich nun zum Aufbruch.
Hauff fühlte sich leicht beschämt, denn diese Wendung hatte er nicht erwartet. Und sich sofort bewusst werdend, dass er eine Dame vor sich habe, die mit den Gepflogenheiten der grossen Welt da draussen vertraut sei, lenkte er ein, indem er nun seinerseits um Entschuldigung dafür bat, dass man in seinem „jedenfalls“ etwas gefunden, was er nicht beabsichtigt habe.
„Na, na, Sie haben es doch getan,“ klang es unter einem Lächeln zurück, das mehr Gutmütigkeit als Spottsucht enthielt.
„Und Sie nicht?“ gab er mit leisem Ärger zurück. „Ich habe Ihr ,jedenfalls‘ auch ganz gut verstanden, meine Gnädige.“
„Ich bin nicht gnädig, mein Herr, Gott allein ist es. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass wir wirkliche Gnade nur vom Himmel zu erwarten haben. Deswegen brauchen Sie mich aber nicht gleich für fromm zu halten. Keineswegs. Aber von allen Phrasen, die wir Menschen im täglichen Leben wechseln, ist mir das Wort ,Gnädige‘ am verhasstesten. Was ist heute nicht alles gnädig: der Hausknecht, wenn er Protz geworden ist, die Köchin, wenn sie auf derselben Glücksleiter emporgeklimmt ist, und schliesslich auch der unreinlichste Mensch, wenn er die gehörigen gesellschaftlichen Waschungen durchgemacht hat. Ich bilde mir das wenigstens ein. Gnade soll das Vorrecht der Fürsten auf Erden sein, also doch nicht etwas Alltägliches. Wir aber haben das Wort gnädig zu einer ganz gewöhnlichen Umgangsform herabgewürdigt, und das imponiert mir nicht.“
Alles das sagte sie sehr ruhig und bestimmt, während sie den Schleier, den sie über den schmucklosen, dunkeln Winterhut gestreift hatte, langsam über das Gesicht zog und glättete, wobei er ihre auffallend schmalen und weissen Hände bewundern konnte.
An diesen Händen hing sein Blick mehr als an ihrem Gesicht, in dem auch jetzt noch die grossen Augen auffallend sich bemerkbar machten und ihren unberechenbaren Glanz durch die Maschen des Schleiers sandten.
Er wusste nicht, ob er sich durch diese lebensphilosophische Auseinandersetzung angenehm berührt fühlen sollte; jedenfalls empfand er im Augenblick keine grosse Lust, darauf einzugehen. Und so nickte er nur zerstreut, ungefähr wie jemand, der derartige Redensarten sehr schön findet, sich aber dadurch belästigt fühlt. Bei sich aber dachte er: „Dumm scheint sie nicht zu sein. Schade nur, dass ich heute keinen Geschmack daran finde. Schliesslich kann man ja nie wissen, wie’s gemeint ist.“
Eine trübe Erfahrung hinter sich, verspürte er keine Neigung, sich eine neue Bekanntschaft aufzuhalsen, und so glaubte er durch eine letzte höfliche Verbeugung seiner Anstandspflicht genügt zu haben. Er wandte sich wieder dem Fenster zu und blickte mit Seelenwollust in die breiten Sonnenstreifen, die nun das junge Grün des Waldes hell erglänzen liessen.
Als er dann ein kurzes „Adieu“ vernahm und ebenso erwiderte, sah er nur flüchtig eine schlanke Gestalt zur Tür hinausschlüpfen. Sie musste sich besonnen haben, nicht mehr länger auf die Wirtin zu warten, vielmehr draussen zu bezahlen, denn er hörte ein lautes „Auf Wiedersehen“ der Frau Förster. Unwillkürlich reckte er den Hals, um der Unbekannten noch einmal ansichtig zu werden. Wirklich sah er sie auch vorübergehen, und dabei hatte er die Empfindung, sie müsste noch einen Blick auf ihn zurückwerfen. Aber sie tat es nicht. Rasch war sie um die Ecke verschwunden.
Plötzlich empfand er grosse Unruhe. Das Zimmer erschien ihm dumpf und eng, er erhob sich, ging hastig von einem Fenster zum anderen und blickte hinaus, um nach Menschen zu spähen. Erst als die Frau Förster eintrat, atmete er erleichtert auf.
„Was machen wir nun, was machen wir nun,“ brachte sie lebhaft hervor. „Ich wollte Ihnen den Revierjungen mitgeben, und nun ist er hinter meinem Rücken fortgegangen. Er muss es gerade überhört haben.“
Sie war sehr besorgt um Hauff, denn sie hatte sich zusammengereimt, dass er auch noch bis zum Bahnhof eines Begleiters bedürfen werde. Als sie nachsann, kam sie auf den Gedanken, dass er die Dame noch einholen könnte, wenn er sich ein wenig beeilte. Falls der Herr Doktor nichts dagegen habe, würde sie übrigens sofort das Mädchen, die Minna, hinterherlaufen lassen, um die Dame zu bitten, auf ihn zu warten. Als sie in ihrer Aufregung schliesslich selbst der Davongegangenen nacheilen wollte, hielt er sie mit einem Dank zurück.
Es war ihm heiss geworden bei dem Gedanken an die Möglichkeit eines nochmaligen Zusammentreffens mit der Unbekannten, die ihm so schlagfertig begegnet war. Er heuchelte jedoch Ruhe und meinte, dass ihm bedeutend besser sei und dass er ganz gut den Weg allein zurücklegen könne. Wirklich fühlte er in dieser Minute einen gewissen Aufschwung seines Mutes, der aber eigentlich nur die versteckte Sehnsucht enthielt, nun auch von hier so rasch als möglich wegzukommen. Und so bezahlte er und ging, noch bis zur Aussentür von der Försterin begleitet, die ihm alles Gute wünschte und ihm riet, nur immer hübsch auf dem Wege zu bleiben, wo er Menschen treffen könnte.
Ein Weilchen zögerte er noch. „Kennen Sie die Dame schon länger?“ fragte er, während er sich mit seinem Regenschirm beschäftigte. „Ich könnte doch noch mit ihr zusammentreffen, und da möchte man doch gern wissen —.“
„In diesem Jahr habe ich sie eigentlich zum erstenmal wiedergesehen. Aber vorigen Sommer, Herr Doktor, war sie öfter hier, in Begleitung eines Ehepaares. Da ging sie in Trauer. Und vor zwei Jahren sah ich sie stets mit einem alten Herrn. Aber weiter weiss ich wirklich nichts. Sie ist immer sehr fein und nett.“
Er dankte abermals und verabschiedete sich.
Zweites Kapitel.
Als er den Zaun hinter sich hatte, atmete er die frische Luft wieder mit vollen Zügen, aber doch nicht mit der glücklichen Heiterkeit, die ihn sonst beseelt hatte. Der starke Kaffee hatte seine Nerven belebt, bald aber merkte er, dass dieser Zustand nur ein künstlich geschaffener war. Denn kaum war der mächtige Schlot seinem Auge entschwunden, als er die Stille des Waldes wie einen dumpfen Druck auf seine Nerven empfand.
Die Sonne hatte sich aufs neue verfinstert, und so erweckte das graue Licht, das in der Entfernung den fahlen Dunst des Abends schuf, in seinem Gemüt die Vorstellung von einem neuen Anfall. Die Eintönigkeit der schweigenden Kiefern lastete auf ihm, und je tiefer er in den Wald hineinging, nur begleitet vom Schall seiner Schritte, je mehr peinigte ihn die Furcht, die Finsternis könnte ihn umgeben, bevor er sein Ziel erreicht habe. Diese vielen Bäume, die er früher wie seine Freunde betrachtet hatte, erschienen ihm nun wie drohende Gespenster, die ihm jeden Augenblick den Weg versperren wollten. Er empfand das stille Grausen eines Menschen, der nicht weiss, was kommen wird.
Er wollte umkehren, um sich doch noch irgend eine Begleitung auszubitten. Als er aber zehn Schritte zurückgegangen war, blieb er wieder stehen, denn er schämte sich seiner Schwäche.
„Du wirst dich lächerlich machen,“ waren seine Gedanken. Und so nahm er seine ganze Kraft zusammen und ging weiter, mit der Empfindung eines gewissen Hemmnisses in seinen Beinen, das er vordem nie gekannt hatte. Wiederholt blickte er sich um, als könnte er einen Verfolger hinter sich haben. Irgend ein schwaches Geräusch hatte seine erregte Phantasie mit plötzlichem Schrecken erfüllt.
Der Schatten, der in der Entfernung zwischen den Bäumen hing, wurde dunkler. Die Stämme hoben sich schwärzer aus der Dämmerung hervor, die seinen Blick verwirrte. Die heisse Sehnsucht nach dem Klang einer menschlichen Stimme erwachte in ihm, und damit verband sich die Gedankenfrage: „Wo ist sie eigentlich?“ Er meinte die Unbekannte, nach der er sich vergeblich umgeschaut hatte.
Er wunderte sich, sie nicht mehr zu sehen, da man ihm versichert hatte, sie habe denselben Weg hier eingeschlagen. Vielleicht war sie schnell gegangen oder war irgendwo abgebogen, wo sie es näher zu haben glaubte. Plötzlich, als er eine Weile unsicher weitergeschritten war, den Blick immer vor sich auf den Weg gerichtet, der kaum noch zu erkennen war, bekam sein Herz einen jähen Ruck, so dass er seinen Schritt bannte. Vor sich sah er eine schwarze Frauengestalt dahinwandeln. Das konnte nur sie sein, er fühlte es sofort an einer gewissen Beruhigung, die ihn überkam.
Sein Entschluss war gefasst, er wollte nicht an ihr vorübergehen, ohne sie angesprochen zu haben. Und so begrüsste er sie mit einer scherzhaften Wendung. „Also habe ich Sie doch noch eingeholt.“
„Ah, Sie sind’s, mein Herr. Ich konnte mir denken, dass Sie mir nachkommen würden.“ Sie hatte seinen Gruss nur leicht durch ein Kopfnicken erwidert und ging nun mit ihm weiter.
Er stutzte und gab dann verwundert zurück: „Sie konnten sich denken? Wieso?“
„Gewiss, mein Herr, Sie hatten eine Begleitung nötig. Ich kenne das Gefühl, unter dem nervenschwache Menschen in der Verlassenheit leiden. Obendrein hier, mitten im Walde. Sie klammern sich da an den ersten besten an, der ihnen über den Weg läuft und den sie vielleicht in gesunden Tagen niemals beachtet hätten.“
Er erschrak förmlich vor diesem sicheren Erkennen seines Zustandes, so dass er sie von der Seite betrachtete, um irgend einen hämischen Zug an ihr zu entdecken. Aber in ihrem Gesicht, das unter dem Schleier hervorleuchtete, regte sich nichts.
„Sie scheinen sich in meinem Zustand doch zu irren, meine Gnädige,“ sagte er ärgerlich.
„Aber so lassen Sie doch, bitte, das ‚Gnädige‘. Ich sprach doch schon im Forsthaus darüber. Hier im Walde klingt es mir wie eine Beleidigung der Natur.“
„Bitte um Verzeihung — ich hatte ganz vergessen. Es soll gewiss nicht wieder vorkommen.“
„Dann werden wir auch bis zum Bahnhof viel besser auskommen.“
Er glaubte aus den Worten „bis zum Bahnhof“ eine Betonung herauszuhören, durch welche sie ihn auf eine gewisse Schranke zwischen sich und ihm aufmerksam machen wolle.
„Also — mein ‚Fräulein‘, wenn Sie gestatten,“ warf er um so höflicher ein.
Schweigend gingen sie eine Weile weiter. Es war, als wären sie von derselben Empfindung beseelt: nun, wo der Zufall sie wieder zusammengeführt hatte, sich nicht besonders zu beeilen. Die Ruhe, die von ihr ausging und sich gleichsam auf ihn übertrug, berührte ihn wohltuend. Merkwürdig, wie das Angstgefühl von ihm wich, wie er sich befreiter fühlte, wie der schweigende Wald mit seinen drohenden Stämmen ihm weniger unheimlich vorkam.
„Weshalb soll ich mich in Ihrem Zustand geirrt haben?“ begann sie wieder. „Ich sah Ihnen schon am Teufelssee an, was Ihnen fehlt. Ich merkte es an dem Fettglanz auf Ihrer Stirn, überhaupt an der ganzen Hast Ihrer Bewegungen.“
„In welchem Krankenhause waren Sie denn barmherzige Schwester?“ hatte er schon auf den Lippen, als sie ihm wieder zuvorkam.
„Sie leiden an Zwangsvorstellungen und haben Angst vor dem Alleinsein. Und das kann nur durch Willenskraft überwunden werden. Weniger arbeiten und mehr ruhen. Gewiss sind Sie geistig zu stark beschäftigt. Vielleicht haben Sie auch seelischen Kummer gehabt.“
„Woher wissen Sie das?“ unterbrach er sie zaghaft.
„Ich denke es mir, denn wie jemand, der toll gelebt hat, sehen Sie mir nicht aus,“ gab sie ruhig wie zuvor zurück.
„Manchmal irrt man sich in der Diagnose, mein Fräulein — auch wenn sie von gescheiten Damen gestellt wird.“
Sich durchaus nicht getroffen fühlend, lachte sie vergnügt auf, so dass er ihre Zähne blitzen sah. Dann sagte sie gelassen: „Ich irre mich nie, mein Herr. Unser ganzes Leben besteht aus einer Kette von Erfahrungen, und ich trage sie unsichtbar mit mir herum.“
„Was für Erfahrungen mögen das sein?“ war sein Gedanke, als er sie abermals musterte. Sie war nur wenig kleiner als er, aber kräftig und fest gebaut. Trotzdem hatte sie einen leichten, fast schwebenden Gang, was ihm mehrmals auffiel. Kaum, dass er ihren Tritt hörte, während sie, immer zu seiner Rechten, mit ihm langsam dahinschlenderte. Abermals schwieg er sich aus und suchte aufs neue nach Worten. Fast verspürte er einen männlichen Zug in ihr, der aber sofort wieder verdrängt wurde durch den Schmelz ihrer Stimme, der etwas von einem vollen Glockenton hatte. Sie sprach schön und klar, als wäre sie auf jedes Wort vorbereitet. Und wenn sie ihre Hand dabei bewegte, so geschah es ungezwungen, wie in anerzogener Schönheitsform.
Alles das nahm er voll Interesse wahr, während er still gegen diese Art der Überlegenheit ankämpfte, die ihn zugleich anzog und doch seinen Unmut erweckte.
„Verzeihen Sie, wenn ich nochmals darauf zurückkomme,“ begann er wieder. „Weshalb soll ich gerade die Absicht gehabt haben, Sie einzuholen?“
Sie lachte abermals leicht auf. „Das haben Sie noch nicht verschmerzt? Mein Gott, das ist sehr einfach —: Sie konnten eben keine andere Begleitung finden. Und die mussten Sie doch haben. Ich bin nicht so eitel anzunehmen, dass Ihr Interesse meiner Person galt. Stellen Sie sich vor, Sie wären einem alten Grossmütterchen begegnet. Wären Sie nicht ebenso zufrieden gewesen?“
Es ärgerte ihn wieder, dass sie ihn wie einen durchsichtigen Glasmenschen behandelte, aber er unterdrückte seinen Groll und zwang sich zur Höflichkeit. „Ich will Ihnen nicht unrecht geben, mein Fräulein.“
„Nun, sehen Sie. Ich treffe immer das Richtige. Leute, die Ihr Leiden haben, suchen um jeden Preis Gesellschaft,“ fuhr sie lebhaft fort. „Dann fühlen sie sich sicherer. Sind sie wieder allein, beginnt aufs neue der alte Zustand. Immer grübeln sie über ihr Leiden und kriegen’s mit der Angst. Das ist aber alles nicht so schlimm. Wenn nur der Organismus gesund ist, und hoffentlich ist’s bei Ihnen der Fall. Vor allem dürfen Sie nicht die Einsamkeit aufsuchen. Und dann meiden Sie nervöse Menschen, denn so etwas steckt an.“
Er glaubte seinen Arzt zu hören, der ihm schon vor Wochen dieselben Ermahnungen erteilt hatte, als er zu ihm von einem „Knacks“ sprach, den er eines Tages wegbekommen könnte. Und so fühlte er sich verpflichtet, für ihre Ratschläge zu danken. Er träfe sich sonst immer mit einigen Herren hier im Grunewald, gerade heute aber habe er das Pech gehabt, niemand von ihnen zu sehen, da er mit einem späteren Zug gefahren sei.
Ihr Gespräch stockte wieder, und so erging er sich in Gedanken über dieses merkwürdige Zusammentreffen, durch das er heilsame Lehren empfing. Mit dem Trost, den sie ihm gab, liess sie auch gleich eine schlimme Aussicht durchblicken. Ein leises Grauen packte ihn, als er daran dachte, das gewisse wohlige Gefühl, das er jetzt empfand, könnte schon in der nächsten Stunde in das gerade Gegenteil Umschlagen.
„Es wird heute früh dunkel,“ unterbrach er dann das Schweigen, als mit der Dämmerung im Walde die Stämme hinten sich nur noch wie Schatten verwoben.
„Ja, die Sonne ist hinter den Wolken untergegangen,“ erwiderte sie, wobei ihre Fussspitzen mit einer Wurzel in unangenehme Berührung kamen. Unwillkürlich streckte er die Hand nach ihr aus, um sie vor dem Stolpern zu bewahren.
Sie dankte mit einem leichten Lachen, wich ihm aber sofort aus, was er als einen Wink aufnahm, das zweite Mal eine voreilige Hilfe zu unterlassen. Er hörte, wie ihr Atem schneller ging, und so malte er sich in seiner Einbildung aus, sie könnte plötzlich errötet sein bei dem Drucke seiner Hand, unter dem er die Rundung eines vollen Armes verspürt hatte.
Zum erstenmal blieb sie stehen, dabei vernahm er, wie sie mit grossen Zügen die Luft einsog. Dann sagte sie: „Ich habe den Kiefernduft zu gern. Namentlich nach einem Regen. Sie sollten auch noch ein paar kräftige Züge nehmen. Das ist gesund für die Nerven. Wie lange dauert’s, und man muss wieder die stickige Luft in den Strassen atmen.“
Er glaubte ihr einen Gefallen tun zu müssen, und so tat er dasselbe wie sie.
Näher erschallte das Fauchen der Lokomotive, deren leichten Pfiff man vernahm, und vor ihnen in der Ferne lag nun der schwache Schein der beginnenden Lichtung.
„Lieben Sie Berlin?“ sagte sie dann wieder, als sie weitergeschritten waren.
„Manchmal hasse ich es,“ gab er zurück, um ihren Widerspruch herauszufordern. „Es zerreibt die Kräfte mehr als jede andere Stadt.“
„Aber es hat einen grossen Vorzug,“ sprach sie weiter, „man kann nirgends einsamer sein als unter einer Million Menschen, die man nicht kennt und von denen man nicht gekannt wird. Dabei hat man das schöne Gefühl, niemals allein zu sein. Das werden Sie auch schon noch empfinden — gerade jetzt bei Ihrem Leiden. Passen Sie auf.“
„Und doch gehen Sie hier allein spazieren,“ wandte er ein.
„Um neue Kräfte für den täglichen Kampf zu sammeln. Und ich liebe diesen täglichen Kampf, weil man an ihm seine Kraft erproben kann. Das wird Ihnen vielleicht etwas wunderlich klingen, weil eine Frau es sagt, aber es ist so. Es wird jetzt soviel von dem sogenannten Milieu gesprochen, das die Menschen umwandle. Das sagen immer diejenigen, die für ihre Energielosigkeit eine Entschuldigung haben wollen. Ich bleibe dabei, dass der Wille alles macht, vorausgesetzt, dass ein gesunder Organismus vorhanden ist. Willensstärke gibt auch Seelenreinheit. Der Mut ist immer der bessere Teil der Kraft.“
Weshalb sagte sie das alles gerade ihm? Hatte sie schon so manchen Spezialfall erlebt, aus dem sie die Berechtigung herleitete, ihre Erkenntnis in kleinen Dosen zum besten zu geben? Gar zu gern hätte er etwas Näheres darüber erfahren, er machte auch mehrmals während der gleichgültigen Unterhaltung, die nun folgte, eine dahinzielende Wendung, der sie aber jedesmal geschickt auswich. Sie schien keine Neigung zu haben, auf ihre Verhältnisse einzugehen.
„Hätten Sie sich nicht gefürchtet, allein zum Bahnhof zu gehen? Es ist doch bereits finster geworden,“ sagte er plötzlich, weil er schon längst darauf zurückkommen wollte.
„Fürchten? Weshalb? Ich habe ja gesunde Nerven.“
Er schwieg. Am liebsten hätte er ihr gesagt, dass sie zu beneiden sei, aber er dachte es nur und verlor sich in Gedanken.
„Es ist auch nur der reine Zufall, dass es heute so spät geworden ist,“ fuhr sie währenddessen fort. „Ich weiss wohl, dass es nicht gerade angenehm auffällt, wenn eine Dame allein so weite Spaziergänge macht, aber ich bin nun mal ganz selbständig. Auch in solchen Dingen. Früher ging ich oft mit meinem seligen Vater, aber nun — —.“
Er glaubte einen ähnlichen leichten Seufzer zu vernehmen, wie sie ihn bereits im Forsthause ausgestossen hatte. Ohne Zweifel musste sie stillen Kummer haben, den sie aber tapfer zu verbergen trachtete. Er wusste nicht, wie es kam — aber es war ihm nicht unangenehm, dass der „ältere Herr“, von dem die Frau Förster gesprochen hatte, jedenfalls der Verstorbene gewesen war.
Sie habe sich übrigens heute mit einer anderen Dame verabredet gehabt, die aber plötzlich verhindert gewesen sei, fuhr sie fort. Sie habe aber dabei nicht viel verloren, denn die Betreffende sei etwas geschwätzig, und das verderbe ihr manchmal die ganze Stimmung. Der Weg bis zum Teufelssee sei in der Regel immer belebt, und sie wundere sich selbst, dass sie heute so wenig Menschen begegnet sei. Die lieben Berliner wüssten eben gar nicht, was sie auch in der Woche an ihrem Grunewald hätten.
Hauff gab ihr zu verstehen, dass sie sich, falls sie Lust dazu hätte, getrost den Herren anschliessen könnte, mit denen er sonst hier seine Wanderungen unternehme. Es seien allerdings einige alte Brummbären darunter, mit denen sie schon vorliebnehmen müsste.
Sofort fiel sie ihm mit der Bemerkung ins Wort, dass er gar nicht wissen könne, ob er in den nächsten Tagen den Mut finden werde, den Wald wieder aufzusuchen. Mit den Nervenanfällen sei es wie mit dem Feuer, das man scheue, wenn Man sich einmal verbrannt habe. Man meide den Ort, wo einem so etwas passiert sei. Die Zukunft würde ihm beweisen, dass sie recht gehabt habe.
„Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für Ihre Liebenswürdigkeit,“ schloss sie. „Wenn der Zufall es einmal so macht, will ich mich Ihnen gern anschliessen. Hoffentlich dulden mich dann die Herren ein wenig.“
„Aber ich bitte Sie —!“ wandte er zur Beruhigung ein.
„Bitten Sie lieber nicht, Sie könnten bei der Majorität doch auf Widerstand stossen.“
Sie hatten die Lichter des Bahnhofs vor sich und mussten sich nun beeilen, um den Zug noch zu erreichen. Der Zufall wollte es, dass sie allein in einem Wagenabteil zweiter Klasse fuhren. Sie hatte ihm gegenüber Platz genommen, und als sie den Schleier wieder über den Hut schob, weil sie es nach dem andauernden Gehen warm fand, hatte er jetzt erst Gelegenheit, sie im hellen Lichte aufmerksam zu betrachten. Der flüchtige Eindruck, den er von ihr im Forsthause empfangen hatte, war verwischt, und so wunderte er sich nun, sie ganz anders zu finden, als wie er sie sich im Dunkel des Waldes ausgemalt hatte.
Entschieden hatte sie etwas Kluges in ihrem Gesicht, was auch die auffallende Weichheit ihrer Linien nicht verdrängen konnte. „Ich hätte sie mindestens für Dreissig gehalten,“ dachte er, „aber sie kann doch höchstens Mitte der Zwanzig sein. Das macht wohl die Art ihres Auftretens.“
Während sie an ihren Handschuhen nestelte und den Blick dabei gesenkt hielt, so dass er die langen, seidenartigen Wimpern bewundern konnte, setzte er seine heimliche Beobachtung fort. Die Base war vielleicht zu wenig fein, der Mund nicht klein genug, um für tadellos schön zu gelten, dafür aber war der Schwung der Lippenlinien edel und herausfordernd. „Zum Küssen“, fügte er seiner Gedankenbeschreibung hinzu. Das Ohr war zierlich und anliegend, so dass es ihm wie eine rosige Fleischmuschel erschien. „Auch Kinn und Hals sind ganz mollig,“ dachte er weite.
Am meisten gefiel ihm die Zartheit ihrer Gesichtsfarbe, in die das Laufen die gesunde Wangenröte getrieben hatte. Fürwahr, es war ein merkwürdiger Typus, über den er als Kunstschriftsteller nicht so leicht hinwegkommen konnte. Sie erschien ihm wie ein Gemisch von Weib und Kind — wie eines jener seltsamen Geschöpfe, deren Äusserungen dem Aussehen ganz widersprechen. Wenn sie schwieg, glaubte er sie für unbedeutend zu halten, sprach sie dann aber in ihrer gemessenen, wohlüberlegten Weise, so hätte er am liebsten die Augen schliessen mögen, um sich in der Einbildung zu wiegender habe eine reife, lebenskundige Frau vor sich.
Ihre Hände machten ihm besonders zu schaffen. Sie hatte die Handschuhe abgestreift und in ihren Schoss gelegt. Da sie die Empfindung hatte, dass ihr der Hut nicht recht sitze, so nahm sie ihn ab, nachdem sie sich vergeblich bemüht hatte, die lange Nadel gefügiger zu machen. Glänzend-braunes Haar leuchtete ihm entgegen, das in der Mitte glatt gescheitelt war, sich nach den Ohren zu leicht kräuselte und am Hinterkopf in einen üppigen Flechtenkranz auslief. Während sie mit der Hand darüber hinfuhr und den losen Knoten fester steckte, kamen ihm die beweglichen Finger wie weisse Schlangen vor, die sich durcheinander wühlten. Fast aufdringlich musterte er sie, so dass er vermeinte, ihre Rote setzte sich bis in die Stirn fort, als sie sich beobachtet fühlte.
„Was für schöne Hände Sie haben,“ sagte er unwillkürlich, hingerissen vom Schauen, „ein Maler könnte seine Freude daran haben.“
„Meinen Sie? Dann muss ich sie mir selbst einmal ansehen.“ Mit einem kurzen Lachen brachte sie beide Handflächen zusammen und musterte sie mit der Neugierde eines Kindes.
Sie erschien ihm plötzlich freundlicher, nicht mehr so würdevoll wie im Waldes weicher und weibischer in ihrem Wesen. „Die Gioconda von Leonardo da Vinci hat solche Hände.“
„Ach was. Nie etwas davon gehört.“
„Gerade so spitz auslaufend, geschmeidig, fast ohne Knochen.“