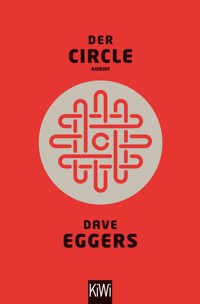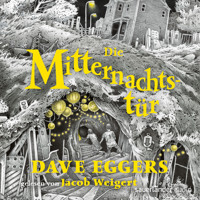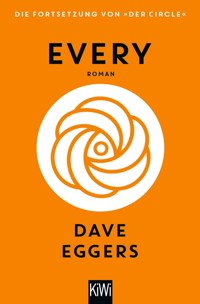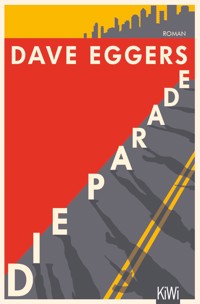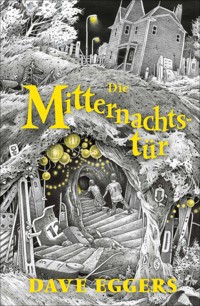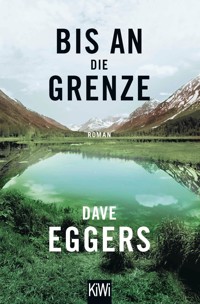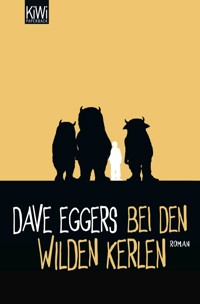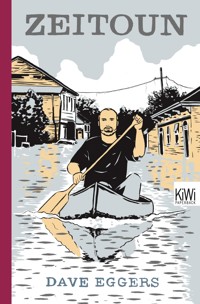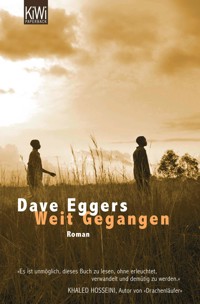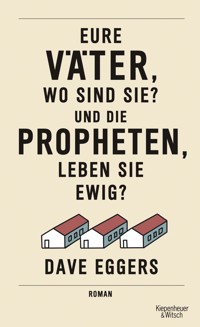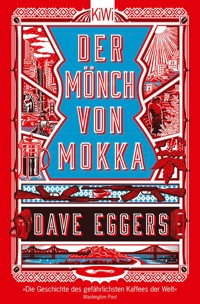
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Mönch von Mokka - Eine unglaubliche Reise von San Francisco in den Jemen auf der Suche nach dem perfekten Kaffee Dave Eggers erzählt die faszinierende Geschichte von Mokhtar Alkanshali, einem jungen Mann, der als Kind aus dem Jemen in die USA eingewandert ist. Mit 24 Jahren stößt er zufällig auf die jahrhundertealte Kaffeetradition seiner Heimat und macht sich auf den Weg in das Land seiner Vorfahren, um alles über diesen besonderen Kaffee zu lernen. Sein Ziel: Den Kaffee zu fairen Bedingungen für alle Beteiligten produzieren zu lassen. Auf seiner Reise entgeht Mokhtar nur knapp den Bomben der Saudis, doch er schafft es zurück nach Amerika. Heute produziert seine Firma "Port of Mokha" einen der besten fair gehandelten Kaffees weltweit und verhilft seinen Landsleuten zu einem besseren Leben. Der Mönch von Mokka ist eine inspirierende Geschichte über Nachhaltigkeit, Flucht und die Kraft, seine Träume zu verwirklichen. Ein biografischer Roman, der zeigt, dass die unglaublichsten Geschichten immer noch das Leben schreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dave Eggers
DerMönchvonMokka
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Dave Eggers
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Dave Eggers
Dave Eggers, geboren 1970, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren. Sein Werk wurde mit zahlreichen literarischen Preisen ausgezeichnet. Sein Roman »Der Circle« war weltweit ein Bestseller. Der Roman »Ein Hologramm für den König« war nominiert für den National Book Award, für »Zeitoun« wurden ihm unter anderem der American Book Award und der Albatros-Preis der Günter-Grass-Stiftung verliehen. Eggers ist Gründer und Herausgeber von McSweeney’s, einem unabhängigen Verlag mit Sitz in San Francisco. Dave Eggers stammt aus Chicago und lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Nordkalifornien.
Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, beide Jahrgang 1955, haben fast alle Bücher von Dave Eggers übersetzt und wurden für ihre hervorragende Übersetzung von »Zeitoun« gemeinsam mit dem Autor mit dem Albatros-Preis ausgezeichnet.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mokhtar Alkanshali ist ein 24-jähriger Hotelportier in San Francisco. Als Junge mit seiner Familie aus dem Jemen in die USA eingewandert, hat er lange nach einer Berufung in seinem Leben gesucht. Bis er durch Zufall die uralte Kaffeetradition des Jemen entdeckt. Er vertieft sich in die Recherche, reist in den Jemen, um sich mit Kaffeeplantagenbesitzern zu treffen und seinen Plan zu verfolgen, den guten jemenitischen Kaffee in seine neue Heimat, die USA, zu importieren. Als dann plötzlich der Krieg ausbricht und die Bomben der Saudis sein Leben bedrohen, muss Mokhtar einen Weg aus dem Land finden, ohne seine Identität und seine noch im Jemen lebende Familie zu verraten. Er schafft es unter dramatischen Umständen außer Landes und gründet seine Firma »Port of Mokha«, die heute einen der besten Kaffees der Welt herstellt und faire Bedingungen für alle Beteiligten garantiert.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe The Monk of Mokha
© 2018 by Dave Eggers
All rights reserved
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
© 2018, 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung Rudolf Linn, Köln, basierend auf dem Originalumschlag von Hamish Hamilton
Covermotiv © 2018 by Shawn Harris
ISBN978-3-462-31555-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Karte
Prolog
Buch I
Kapitel I Die Umhängetasche
Kapitel II Portier im Infinity
Kapitel III Der Junge, der Bücher stahl
Kapitel IV Kluger Rat von Ghassan Toukan
Kapitel V Jemen
Kapitel VI Rupert der Karrierist
Kapitel VII Rupert verkauft Hondas
Kapitel VIII Richgrove-Aktivisten
Kapitel IX Der Knopf
Buch II
Kapitel X Die Statue
Kapitel XI Der Plan
Kapitel XII Kluger Rat von Ghassan Toukan
Kapitel XIII Erste Schritte
Kapitel XIV Das Kaffee-Einmaleins
Kapitel XV Der Kaffeemarkt und die drei Wellen
Kapitel XVI Der Plan
Kapitel XVII Wie der Kaffee von Holland nach Amerika kam
Kapitel XVIII Die Lehrlinge
Kapitel XIX Die Q-Prüfung
Buch III
Kapitel XX Hamood und Hubayshi
Kapitel XXI Ein Traum in anderer Gestalt
Kapitel XXII Ausgangspunkt
Kapitel XXIII Out of Sanaa
Kapitel XXIV Der hier ist interessant
Kapitel XXV Ein Land ohne Regierung
Kapitel XXVI Geld in der Hand, nicht im Herzen
Kapitel XXVII Die Amerikaner
Buch IV
Kapitel XXVIII Chaos
Kapitel XXIX Berge in Flammen
Kapitel XXX Summers Schiff
Kapitel XXXI Unterwegs nach Aden
Kapitel XXXII Willkommen in Aden
Kapitel xxxiii Der andere Mokhtar
Kapitel XXXIV Ein schneller Tod durch eine scharfe Klinge
Kapitel XXXV Eine sanfte Hand
Kapitel XXXVI Sechs Bewaffnete am Fußende des Bettes
Kapitel XXXVII Der Hafen von Mokka
Kapitel XXXVIII Herzlich willkommen in Dschibuti
Buch V
Kapitel XXXIX Rückkehr ins Infinity
Kapitel XL Kaffee sticht in See
Kapitel XLI Die Luciana
Kapitel XLII Die Portiers tun sich zusammen und machen das Dach auf
Epilog
Danksagung
Über den Autor
Die Mokka Foundation
»Und warum? Weil er das Gewicht der ganzen Welt auf sich drücken ließ. Zum Beispiel? Nun zum Beispiel, was es heißt, ein Mann zu sein. In einer Stadt. In einem Jahrhundert. Im Übergang. In einer Masse. Von der Wissenschaft umgemodelt. Unter organisierter Macht. Gewaltigen Kontrollen unterworfen. In einem durch die Mechanisierung verursachten Zustand. Nach der jüngsten Enttäuschung radikaler Hoffnungen. In einer Gesellschaft, die keine Gemeinschaft war und die Persönlichkeit entwertete. Aufgrund der multiplizierten Kraft von Zahlen, die das Ich zur Unerheblichkeit verurteilte. Die Rüstungsmilliarden gegen auswärtige Feinde ausgab, aber für die Ordnung im Lande nicht bezahlen wollte. Was der Brutalität und Barbarei in den eigenen großen Städten Tür und Tor öffnete. Zu gleicher Zeit der Druck von Millionen Menschen, die entdeckt haben, was gemeinsame Anstrengungen und Gedanken erreichen können. Wie Megatonnen Wasser auf dem Grund des Ozeans die Organismen gestalten. Wie die Gezeiten Steine glätten. Wie die Winde Klippen höhlen. Die schöne Supermaschinerie öffnet ein neues Leben für unzählige Menschen.«
– Saul Bellow: Herzog
Prolog
Mokhtar Alkanshali und ich verabreden uns in Oakland. Er ist gerade aus dem Jemen zurückgekehrt, nur knapp mit dem Leben davongekommen. Mokhtar, ein amerikanischer Staatsbürger, wurde von seiner Regierung im Stich gelassen und musste auf sich allein gestellt saudischen Bomben und Huthi-Rebellen entgehen. Er hatte keine Möglichkeit, das Land zu verlassen. Die Flughäfen waren zerstört, und die Straßen, die außer Landes führen, waren unpassierbar. Es wurde keine Evakuierung geplant, keine Hilfe geleistet. Das Außenministerium der Vereinigten Staaten kümmerte sich nicht um Tausende Amerikaner jemenitischer Herkunft, die gezwungen waren, eigene Mittel und Wege zu finden, um einem Blitzkrieg zu entkommen – Abertausenden in den USA hergestellten Bomben, die von der saudischen Luftwaffe über dem Jemen abgeworfen wurden.
Ich warte vor einem Café der Rösterei Blue Bottle Coffee auf dem Jack London Square auf Mokhtar (Betonung auf der ersten Silbe). Anderswo in den Vereinigten Staaten, in Boston, läuft ein Gerichtsverfahren gegen einen jungen Mann, der angeklagt ist, zusammen mit seinem Bruder zwei Bomben während des Boston-Marathons gezündet zu haben, mit drei Todesopfern und Hunderten Verletzten. Hoch oben kreist ein Polizeihubschrauber zur Beobachtung des Streiks der Arbeiter im Hafen von Oakland. Es ist das Jahr 2015, vierzehn Jahre nach 9/11 und sieben Jahre nach Amtsantritt von Präsident Barack Obama. Als Nation haben wir die extreme Paranoia der Bush-Jahre überwunden; die Schikanen gegenüber amerikanischen Muslimen haben ein Stück weit nachgelassen, aber jede von einem amerikanischen Muslim begangene Straftat lässt die Islamophobie wieder einige Monate lang aufflammen.
Als Mokhtar ankommt, sieht er älter und gelassener aus als bei unserer letzten Begegnung. Der Mann, der da aus dem Auto steigt, trägt eine Kakihose und einen lila Pullunder. Er hat eine gegelte Kurzhaarfrisur und einen ordentlich gestutzten Kinnbart. Er geht auffällig ruhig. Sein Oberkörper bewegt sich kaum, während seine Beine ihn über die Straße und zu unserem Tisch auf dem Bürgersteig tragen. Wir schütteln einander die Hände, und mir fällt auf, dass er an der rechten Hand einen klobigen Silberring mit filigranen Mustern und einem großen rubinroten Stein trägt.
Er verschwindet kurz im Blue Bottle, um Freunde zu begrüßen, die drinnen arbeiten, und um mir eine Tasse äthiopischen Kaffee zu holen. Er besteht darauf, dass ich abwarte, bis er auf die richtige Trinktemperatur abgekühlt ist. Kaffee sollte nicht zu heiß getrunken werden, sagt er. Die Hitze überlagert das Aroma und betäubt die Geschmacksknospen. Als wir endlich in Ruhe sitzen und der Kaffee abgekühlt ist, erzählt er mir von seiner Gefangennahme und Befreiung im Jemen, wie er im San Franciscoer Viertel Tenderloin aufwuchs – in vielerlei Hinsicht die problematischste Gegend der Stadt – und wie er im Kaffee seine Berufung fand, während er als Portier einer schicken Hochhausanlage in der Innenstadt arbeitete.
Mokhtar redet schnell. Er ist sehr witzig und ungemein aufrichtig, und er illustriert seine Geschichten mit Fotos auf seinem Smartphone. Manchmal spielt er die Musik vor, die er sich während einer bestimmten Episode seiner Geschichte angehört hat. Manchmal seufzt er. Manchmal staunt er über sein Leben, sein Glück, dass aus ihm, einem armen Kind aus Tenderloin, ein durchaus erfolgreicher Kaffeeimporteur geworden ist. Manchmal lacht er, wundert sich, dass er nicht tot ist, obwohl er die saudische Bombardierung von Sanaa erlebt hat und von zwei verschiedenen Splittergruppen im Jemen als Geisel festgehalten wurde, nachdem das Land in den Bürgerkrieg stürzte. Doch vor allem will er über Kaffee reden. Will mir Bilder von Kaffeepflanzen und Kaffeebauern zeigen. Will über die Ursprünge des Kaffees reden, ineinandergreifende Geschichten erzählen von Abenteuern und Heldentaten, die dem Kaffee seinen heutigen Status als Triebkraft für einen Großteil der weltweiten Produktivität und als globale Siebzig-Milliarden-Dollar-Konsumware verschafft haben. Er wird nur ein einziges Mal langsamer, als er schildert, wie besorgt seine Familie und seine Freunde während seiner Gefangenschaft im Jemen waren. Tränen steigen ihm in die großen Augen, und er verstummt kurz, starrt die Fotos auf seinem Smartphone an, ehe er sich wieder sammelt und weiterredet.
Heute, da ich dieses Buch abschließe, sind seit unserem Treffen in Oakland drei Jahre vergangen. Bevor ich dieses Projekt in Angriff nahm, war ich ein anspruchsloser Kaffeetrinker und stand Spezialitätenkaffee äußerst skeptisch gegenüber. Ich fand ihn zu teuer, und ich hielt jeden für einen Angeber und Blödmann, der sich zu sehr dafür interessierte, wie sein Kaffee aufgebrüht wurde oder woher er kam, oder der sich in lange Warteschlangen stellte, nur um einen ganz bestimmten Kaffee zu trinken, der nach einer ganz bestimmten Methode zubereitet worden war.
Aber die Reisen zu Kaffeefarmen und -farmern rund um den Globus von Costa Rica bis Äthiopien haben mich eines Besseren belehrt. Mokhtar hat mich eines Besseren belehrt. Wir haben seine Familie im kalifornischen Central Valley besucht, und wir haben Kaffeekirschen in Santa Barbara gepflückt – auf der einzigen Kaffeefarm Nordamerikas. In Harar haben wir Khat gekaut, und auf den Hügeln über der Stadt sind wir zwischen einigen der ältesten Kaffeepflanzen auf der Erde spazieren gegangen. Als wir in Dschibuti Mokhtars Spuren folgten, besuchten wir ein staubiges und trostloses Flüchtlingscamp in der Nähe des Hafenstädtchens Obock, und ich beobachtete, wie Mokhtar darum kämpfte, den Pass eines jungen jemenitischen Zahnmedizinstudenten zurückzubekommen, der vor dem Bürgerkrieg geflohen war und nichts mehr hatte – nicht mal seine Identität. In den entlegensten Bergregionen des Jemen tranken Mokhtar und ich süßen Tee mit Botanikern und Scheichs und hörten uns die Klagen von Menschen an, die nichts mit dem Bürgerkrieg zu tun hatten und sich nur nach Frieden sehnten.
Nach all dem machte die Mehrheit der US-Wähler – genauer gesagt der Wahlmänner – die Präsidentschaft eines Mannes möglich, der versprochen hatte, Muslimen die Einreise in die USA zu verbieten – »bis wir genau wissen, was los ist«, sagte er. Nach der Amtseinführung versuchte er zweimal, ein Einreiseverbot für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Staaten durchzusetzen. Auf dieser Liste stand auch der Jemen, das vielleicht verkannteste Land der Welt. »Ich hoffe, sie haben in den Camps WLAN«, sagte Mokhtar nach der Wahl zu mir. Es war ein makabrer Scherz, der unter US-amerikanischen Muslimen die Runde machte und auf der Annahme basierte, dass Trump bei der ersten sich bietenden Gelegenheit – zum Beispiel im Falle eines muslimischen Terroranschlags in den USA – die Registrierung oder gar Internierung aller Muslime fordern wird. Als Mokhtar diesen Scherz machte, trug er ein T-Shirt mit dem Aufdruck MAKE COFFEE, NOT WAR.
Mokhtars Sinn für Humor durchdringt alles, was er tut und sagt, und ich hoffe, es ist mir in diesem Buch gelungen, nicht nur diesen Humor wiederzugeben, sondern auch die Art, wie er Mokhtars Blick auf die Welt prägt, selbst wenn sie sich von ihrer gefahrvollsten Seite zeigt. Während des jemenitischen Bürgerkriegs wurde Mokhtar in Aden von Milizionären gefangen genommen und eingesperrt. Da er in den USA aufgewachsen ist und die amerikanische Popkultur praktisch mit der Muttermilch aufgesogen hat, kam ihm der Gedanke, dass einer seiner Entführer aussah wie Karate Kid. Als Mokhtar mir die Episode erzählte, nannte er den Mann immer nur Karate Kid. Wenn ich diesen Spitznamen hier verwende, dann nicht, um die Gefahr, in der Mokhtar sich befand, herunterzuspielen. Ich halte es hingegen für wichtig, die Einstellung eines Mannes widerzuspiegeln, der unglaublich schwer zu verunsichern ist und für den Gefahren lediglich vorübergehende Barrieren auf dem Weg zu einem bedeutsameren Ziel sind – das Auffinden, Rösten und Importieren von jemenitischem Kaffee sowie die Förderung der Bauern, für die er sich einsetzt. Und ich vermute mal, dass dieser Milizionär tatsächlich so aussah wie der Ralph Macchio der frühen 1980er-Jahre.
Mokhtar ist voller Demut angesichts der historischen Entwicklung, an der er teilhat, und zugleich respektlos gegenüber seinem eigenen Platz darin. Aber seine Geschichte ist eine von der altmodischen Sorte. Sie handelt im Wesentlichen vom amerikanischen Traum, der sehr lebendig und sehr bedroht ist. Seine Geschichte handelt auch von Kaffee und von Mokhtars Anstrengungen, die Kaffeeproduktion im Jemen zu verbessern, einem Land, in dem vor fünfhundert Jahren erstmals Kaffee angebaut wurde. Sie handelt auch vom San Franciscoer Viertel Tenderloin, einem Tal der Tränen in einer enorm reichen Stadt, und von den Familien, die dort wohnen und versuchen, in Sicherheit und mit Würde zu leben. Sie handelt von der seltsamen Vormachtstellung der Jemeniten im kalifornischen Spirituosenhandel und der erstaunlichen Geschichte der Jemeniten im Central Valley. Und davon, wie ihre Arbeit in Kalifornien ein Widerhall ihrer langen landwirtschaftlichen Tradition im Jemen ist. Und davon, dass Direkthandel das Leben der Bauern verändern kann, indem er ihnen Einfluss und Ansehen verschafft. Und davon, dass Amerikaner wie Mokhtar Alkanshali – US-Bürger, die enge Beziehungen zum Land ihrer Vorfahren unterhalten – durch unternehmerisches Engagement und beharrlichen Einsatz unentbehrliche Brücken zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern bauen, zwischen Staaten, die produzieren, und solchen, die konsumieren. Und davon, dass diese Brückenbauer aufs Beste und Mutigste den Grund verkörpern, warum die USA ein Land elementarer Chancen und unbegrenzter Offenheit sind. Und davon, dass wir, wenn wir vergessen, dass dies die Grundvoraussetzung für das Beste an diesem Land ist, uns selbst vergessen – ein Völkergemisch, das nicht durch Stillstand und Feigheit und Angst geeint wird, sondern durch unvernünftigen Überschwang, durch weltweiten Unternehmergeist auf menschlicher Ebene, durch den Glauben daran, dass es richtig ist, nach vorn zu schauen, immer nach vorn, angetrieben von unbändigem und unbeugsamem Mut.
Eine Vorbemerkung zu diesem Buch. Es handelt sich hier nicht um einen Roman, sondern um die Darstellung von Ereignissen, wie sie von Mokhtar Alkanshali wahrgenommen und erlebt wurden. Bei meinen Recherchen habe ich Mokhtar im Verlauf von fast drei Jahren mehrere Hundert Stunden lang interviewt. Wann immer möglich, konnte ich seine Erinnerungen mithilfe von Zeugen oder mithilfe von zeitgeschichtlichen Dokumenten untermauern. Sämtliche in diesem Buch enthaltenen Dialoge sind so wiedergegeben, wie Mokhtar oder andere Beteiligte sich an sie erinnern. Manche Namen wurden geändert. Wenn ein Dialog im Jemen stattfindet, sollte stets davon ausgegangen werden, dass die gesprochene Sprache das Arabische ist. Ich habe mein Bestes getan, um den Ton und den Geist der Gespräche mit Mokhtars Hilfe angemessen zu übertragen.
Buch I
Kapitel IDie Umhängetasche
Miriam machte Mokhtar Geschenke. Normalerweise waren es Bücher. Sie schenkte ihm Das Kapital. Sie schenkte ihm Noam Chomsky. Sie nährte seinen Geist. Sie schürte seine Ambitionen. Sie waren rund ein Jahr zusammen, aber ihre Chancen standen schlecht. Er war ein amerikanischer Muslim jemenitischer Herkunft, und sie war halb Palästinenserin, halb Griechin und noch dazu Christin. Aber sie war schön und leidenschaftlich, und sie kämpfte härter für Mokhtar, als er für sich selbst kämpfte. Als er sagte, er wolle endlich seinen Bachelor machen und Jura studieren, kaufte sie ihm eine Umhängetasche. Die Tasche war eines gestandenen Anwalts würdig, in Granada hergestellt, sorgfältig aus dem weichsten Leder gefertigt, mit Messingnieten und Schnallen und eleganten Innenfächern. Vielleicht würde sie helfen, den Traum zu verwirklichen, dachte Miriam.
Allmählich fügte sich alles zusammen, dachte Mokhtar. Er hatte endlich genug Geld gespart, um sich am City College von San Francisco einzuschreiben, und er würde im Herbst sein Studium beginnen. Nach zwei Jahren am City würde er nach zwei weiteren an der San Francisco State seinen Bachelor machen, um dann sein dreijähriges Jurastudium anzugehen. Wenn er seinen Abschluss in der Tasche hatte, wäre er dreißig. Nicht ideal, aber doch ein Zeitplan, mit dem er arbeiten konnte. Zum ersten Mal gab es in seinem Leben so etwas wie Klarheit und Entschlossenheit.
Fürs College brauchte er einen Laptop, deshalb bat er seinen Bruder Wallead, ihm das Geld dafür zu leihen. Wallead war knapp ein Jahr jünger – sie bezeichneten einander scherzhaft als Fast-Zwillinge –, doch Wallead wusste, wo’s langgeht. Nachdem er jahrelang als Portier in einem Hochhauskomplex namens Infinity gearbeitet hatte, war er nun endlich an der University of California in Davis immatrikuliert. Und er hatte genug Geld gespart, um Mokhtars Laptop zu finanzieren. Wallead bezahlte das MacBook Air mit seiner Kreditkarte, und Mokhtar versprach, die elfhundert Dollar bei ihm abzustottern. Mokhtar steckte den Laptop in Miriams Umhängetasche; er passte perfekt hinein und sah richtig professionell aus.
Mokhtar nahm die Tasche mit zu einer Spendensammlung für Somalia. Es war 2012, und er hatte zusammen mit etlichen Freunden eine Aktion in San Francisco organisiert, um Geld für Somalia zu beschaffen, wo eine Hungersnot wütete, der schon Hunderttausende zum Opfer gefallen waren. Die Benefizveranstaltung fand im Ramadan statt, daher aßen alle gut und hörten somalisch-amerikanischen Rednern zu, die über die verzweifelte Lage ihrer Landsleute sprachen. Es wurden dreitausend Dollar gespendet, das meiste davon in bar. Mokhtar packte das Geld in seine Umhängetasche. Er trug einen Anzug, und mit seiner Ledertasche, in der ein neuer Laptop und ein dicker Packen Dollarscheine steckten, fühlte er sich wie ein Mann der Tat.
Weil er aufgekratzt und von Natur aus impulsiv war, überredete er einen seiner Mitorganisatoren, Sayed Darwoush, unmittelbar nach der Veranstaltung mit ihm und dem Geld nach Santa Clara zu fahren, das eine Autostunde südlich lag. Dort würden sie in die Moschee gehen und den Betrag einem Repräsentanten des Islamic Relief überreichen, der weltweit arbeitenden gemeinnützigen Organisation, die in Somalia Hilfsgüter verteilte. Ein anderer Helfer bat Mokhtar, außerdem eine große Kühlbox mit übrig gebliebenem ruh afza mitzunehmen, einem rosafarbenen pakistanischen Getränk aus Milch und Rosenwasser. »Müsst ihr denn wirklich heute Nacht noch fahren?«, fragte Jeremy. Er fand, dass Mokhtar sich oft zu vieles zu schnell aufhalste.
»Ich bin fit«, sagte Mokhtar. Es muss heute Nacht sein, dachte er.
Also setzte Sajed sich ans Steuer, und während sie auf dem Highway 101 unterwegs waren, sprachen sie über die Großzügigkeit, die sich an diesem Abend gezeigt hatte, und Mokhtar dachte, wie gut es sich doch anfühlte, eine Idee zu verfolgen und in die Tat umzusetzen. Er dachte auch daran, wie es sein würde, seinen Juraabschluss in der Tasche zu haben, der erste Alkanshali in Amerika mit einem Doktortitel zu sein. Wie er dann Asylsuchende vertreten würde, andere arabische Amerikaner mit Immigrationsproblemen. Vielleicht würde er sogar irgendwann in die Politik gehen.
Auf halber Strecke wurde Mokhtar von Müdigkeit überwältigt. Er hatte Wochen daran gearbeitet, die Benefizveranstaltung auf die Beine zu stellen. Jetzt verlangte sein Körper nach Ruhe. Er legte den Kopf gegen die Seitenscheibe. »Nur mal kurz die Augen zumachen«, sagte er.
Als er wach wurde, standen sie auf dem Parkplatz der Moschee in Santa Clara. Sayed rüttelte ihn an der Schulter. »Aufwachen«, sagte er. Die Gebete würden in wenigen Minuten beginnen.
Mokhtar stieg völlig verschlafen aus dem Auto. Sie holten die Kühlbox mit ruh afza aus dem Kofferraum und gingen eilig in die Moschee.
Erst nach den Gebeten fiel Mokhtar auf, dass er seine Umhängetasche draußen vergessen hatte. Auf dem Boden neben dem Auto. Er hatte eine Tasche mit dreitausend Dollar und einem nagelneuen elfhundert Dollar teuren Laptop mitten in der Nacht auf dem Parkplatz stehen lassen.
Er rannte zum Auto. Die Tasche war weg.
Sie suchten den Parkplatz ab. Nichts.
Keiner in der Moschee hatte irgendwas gesehen. Mokhtar und Sayed suchten bis in die frühen Morgenstunden. Mokhtar tat kein Auge zu. Sajed fuhr am nächsten Tag nach Hause. Mokhtar blieb in Santa Clara.
Es hatte eigentlich keinen Zweck, noch zu bleiben, aber nach Hause zu fahren war unmöglich.
Er rief Jeremy an. »Ich hab die Tasche verloren. Ich hab dreitausend Dollar und einen Laptop verloren, bloß wegen dieser verdammten rosa Milch. Was soll ich den Leuten sagen?«
Mokhtar konnte den Hunderten von Menschen, die für die Hungerhilfe in Somalia gespendet hatten, unmöglich sagen, dass ihr Geld verschwunden war. Er konnte es Miriam nicht sagen. Er wollte gar nicht daran denken, was sie für die Tasche bezahlt hatte, was sie von ihm halten würde, nachdem er alles, was er besaß, auf einen Schlag verloren hatte. Er konnte es seinen Eltern nicht sagen. Und er konnte Wallead nicht sagen, dass er elfhundert Dollar für einen Laptop abstottern würde, den er nie benutzen würde.
Am zweiten Tag nach dem Verlust der Tasche flog ein anderer Freund von Mokhtar, Ibrahim Ahmed Ibrahim, nach Ägypten, um sich ein Bild davon zu machen, was aus dem Arabischen Frühling geworden war. Mokhtar ließ sich von ihm mit zum Flughafen nehmen – der lag auf halber Strecke nach Hause. Ibrahim würde in ein paar Monaten die Uni in Berkeley abschließen. Er wusste nicht, wie er Mokhtar trösten sollte. Das wird schon wieder, kam ihm zu lahm vor. Er verschwand in der Schlange vor dem Sicherheitscheck und flog nach Kairo.
Mokhtar ließ sich in einen der schwarzen Ledersessel in der Flughafenhalle sinken und blieb stundenlang da sitzen. Er beobachtete die Menschen, sah Familien abfliegen und ankommen. Sah die Geschäftsleute mit ihren Aktentaschen und Plänen. Im International Terminal, einem Symbol der Mobilität, saß er zitterig, gestrandet.
Kapitel IIPortier im Infinity
Mokhtar wurde Portier. Nein. Concierge. Diese Bezeichnung wurde im Infinity bevorzugt. Was bedeutete, dass Mokhtar Portier war. Mokhtar Alkanshali, erstgeborener Sohn von Faisal und Bushra Alkanshali, älterer Bruder von Wallead, Sabah, Khaled, Afrah, Fowaz und Mohamed, Enkel von Hamood al-Kanshali Zafaran al-Eshmali, Löwe von Ibb, Spross des al-Shanan-Stammes, dem wichtigsten Zweig der Bakil-Stammeskonföderation, war Portier.
Das Infinity war ein Wohnkomplex aus vier Gebäuden, die alle eine eindrucksvolle Aussicht auf die Bucht von San Francisco boten, auf die sonnengebleichte Stadt und die Berge im Osten. In den Infinity-Towern residierten Ärzte, Hightech-Millionäre, Profisportler und reiche Ruheständler. Sie alle kamen und gingen durch die Hochglanzlobby, und Mokhtar hielt ihnen die Tür auf, damit sie ohne unnötige Anstrengung hindurchschreiten konnten.
Das City College war keine Option mehr. Nach dem Verlust der Tasche brauchte Mokhtar einen Vollzeitjob. Omar Ghazali, ein Freund der Familie, hatte ihm die dreitausend Dollar geliehen, damit der Islamic Relief seine Spende bekam. Aber er musste Omar das Geld zurückzahlen, und da er Wallead nach wie vor elfhundert Dollar schuldete, würde das College auf unbestimmte Zeit warten müssen.
Wallead verschaffte ihm den Job als Portier. Es war dieselbe Stelle, die er selbst einige Jahre zuvor gehabt hatte. Wallead hatte 22 Dollar die Stunde verdient, und jetzt bekam sein älterer Bruder Mokhtar 18 Dollar. Zu Walleads Zeit im Infinity waren die Mitarbeiter gewerkschaftlich organisiert gewesen, doch jetzt war die Gewerkschaft verschwunden, und der Komplex wurde von einer gestylten Peruanerin namens Maria gemanagt, die auf High Heels klackend über die Hochglanzböden stöckelte. Sie hatte Mokhtars adrettes Aussehen gemocht und ihm den Job angeboten. Mit seinen 18 Dollar die Stunde konnte er sich nicht beklagen, schließlich lag der Mindestlohn in Kalifornien bei 8,25 Dollar.
Aber er ging nicht aufs College, und er sah auch keine Möglichkeit, in absehbarer Zeit aufs College zu gehen. Er war von morgens bis abends in der Lobby des Infinity-Towers B, öffnete Türen für die Bewohner und die unterschiedlichen Angehörigen der Servicebranche, die Leute, die die Bewohner mit Essen und Massagen versorgten, die die kleinen Hündchen Gassi führten, die die Wohnungen putzten und neue Kronleuchter anbrachten. Mokhtar nahm immer ein Buch mit zur Arbeit – er versuchte sich erneut an Das Kapital –, aber für einen Concierge war Lesen fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die Unterbrechungen waren unaufhörlich, der Lärm nervig. Die Lobby lag auf Straßenhöhe, und der Stadtteil veränderte sich rapide. Praktisch jeden Monat wurde ein neues Gebäude hochgezogen, sodass South of Market sich allmählich in eine Art Mini-Manhattan verwandelte.
Der Lärm war eine Sache, aber das, was Mokhtar hauptsächlich daran hinderte, mal länger an einem Stück zu lesen oder nachzudenken, war die Tür selbst. Die Lobby war ein Glaskasten, ein transparentes Hexagon, und der Concierge musste stets wachsam sein, um auf jeden reagieren zu können, der aus egal welcher Richtung auf die doppelte Eingangstür zusteuerte. Die meisten Leute, die sich näherten, waren Leute, die er kannte – Bewohner, Infinity-Wartungsarbeiter, Lieferanten –, aber es gab auch Besucher außer der Reihe. Gäste, Personal Trainer, Immobilienmakler, Therapeuten, Handwerker. Sobald jemand auf die Tür zuging, musste Mokhtar sprungbereit sein.
Wenn ein Lieferant kam, konnte er in aller Ruhe aufstehen, lächeln, die Tür aufmachen. Aber bei einem Bewohner blieben Mokhtar nur ein oder zwei Sekunden, um von seinem Platz hinter der Empfangstheke aufzuspringen, zur Tür zu hasten (ohne einen überhasteten Eindruck zu erwecken), sie aufzumachen, mit einem breiten Lächeln und einer stets munteren und möglichst glaubwürdigen Frage auf den Lippen: Wie lief’s heute mit dem Joggen, Ms Agarwal?
Das alles war neu, und es ging auf Marias Konto. Als Wallead hier Concierge war und die Mitarbeiter noch eine Gewerkschaftsvertretung hatten, war die Stelle als sitzende Tätigkeit beschrieben worden, was bedeutete, dass der Concierge nicht jedes Mal aufstehen musste, wenn jemand kam oder ging. Aber Maria hatte das geändert. Jetzt verlangte der Job permanente Wachsamkeit, die Fähigkeit, elegant und eilfertig aufzuspringen und quer durch die Lobby zu laufen.
Es spielte keine Rolle, dass jeder die Tür mühelos selbst hätte öffnen können. Darum ging es nicht. Es ging um die persönliche Note. Ein lächelnder Mann in einem ordentlichen blauen Anzug, der einem die Tür aufhielt, signalisierte sowohl Luxus als auch schlichte Höflichkeit. Es vermittelte den Bewohnern, dass dieses Gebäude etwas Besonderes war, dass der gepflegte und aufmerksame Mann in der Lobby nicht bloß ihre Päckchen annahm und dafür sorgte, dass ihre Gäste begrüßt und unangemeldete Besucher in Augenschein genommen und gegebenenfalls abgewiesen wurden, sondern dass ihm auch so viel an ihnen lag, dass er ihnen die Tür aufhielt und so nette Sachen sagte wie Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Sieht nach Regen aus, Hoffentlich wird Ihnen nicht kalt, Viel Vergnügen beim Spiel, Genießen Sie das Konzert, Ich wünsche Ihnen einen schönen Spaziergang. Dieser charmante Mann sagte Hallo zu ihrem Hund, zu ihren Enkeln, zu ihrer neuen Freundin, zu dem Harfenspieler, den sie als Musikbegleitung für ihre Dinnerparty engagiert hatten.
Das gab es wirklich. Den Mann gab es wirklich. Er war ein echter Harfenspieler, und er hatte eine Firma namens »I Left my Harp in San Francisco«. Mokhtar lernte ihn gut kennen. Für ein paar Hundert Dollar kam er mit seiner Harfe und spielte, während Leute aßen, während Leute tranken. Ein Ehepaar, das hoch oben im Gebäude wohnte, engagierte ihn einmal im Monat. Er war freundlich. Das Gleiche galt für den Mann, der Kronleuchter reparierte. Er kam aus Bulgarien und plauderte häufig mit Mokhtar. Die Ernährungsberaterin für Haustiere war eine leutselige Frau mit blauen Strähnchen im Haar und einem Arm voll mit klimperndem Silberschmuck. Tag für Tag zog eine kaleidoskopartige Parade durch diese Tür. Personal Trainer, mehr als ein Dutzend davon, und Mokhtar musste sie alle kennen, musste wissen, wer von ihnen die Gesundheit und Lebenserwartung welchen Bewohners verbesserte bzw. erhöhte. Es gab die Kunstsachverständigen, die Personal Shopper, die Nannys, die Schreiner, die Leibärzte. Es gab die Lieferanten, die Essen vom Chinesen mit dem Fahrrad brachten, Pizza mit dem Auto, Wäsche von der Reinigung zu Fuß.
Aber vor allem gab es die Paketboten. Von FedEx, von UPS, von DHL. Sie brachten Kartons von Zappos, bodybuilding.com, diapers.com. Manche unterhielten sich gern, manche waren ständig spät dran, brauchten bloß schnell eine Unterschrift, Danke, Kumpel. Manche kannten Mokhtar mit Namen, manche interessierte nicht, wie er hieß. Manche hielten gern ein Schwätzchen, beschwerten sich, lästerten ab. Aber die Masse an Päckchen, die durch diese Tür kam – die war schier unglaublich.
Was haben wir denn heute?, fragte Mokhtar meist.
Wir haben Cashewkerne aus Oregon, sagte der Paketbote beispielsweise.
Wir haben Steaks aus Nebraska. Die sollten möglichst schnell in den Kühlschrank.
Wir haben Hemden aus London.
Mokhtar unterschrieb auf den Klemmbrettern und brachte die Päckchen in den Lagerraum hinter dem Empfang, und wenn der betreffende Bewohner durch die Lobby ging, hob Mokhtar einen Finger und eine fröhliche Augenbraue und verkündete, dass ein Paket angekommen war. Beide freuten sich. Einmal öffnete ein älterer Bewohner, James Blackburn, ein Päckchen und zeigte Mokhtar zwei neue Montblanc-Füller.
Die besten Füller, die’s gibt, sage Mr Blackburn.
Mokhtar, immer höflich, bewunderte die Füller und stellte ein paar Fragen dazu. Einige Monate später lag zu Weihnachten ein Geschenk auf der Empfangstheke, und als er es auspackte, kam ein Montblanc-Füller zum Vorschein. Ein Geschenk von Mr Blackburn.
Die meisten Bewohner waren Neureiche, und sie gewöhnten sich erst an das Leben im Infinity. Falls sie eine eher distanzierte Beziehung zum Concierge bevorzugten, stellte Mokhtar sich darauf ein. Falls sie reden wollten, redete er, und gelegentlich hatten sie Zeit und Lust auf ein Gespräch. Zum Beispiel, während sie in der Lobby darauf warteten, abgeholt zu werden. Mokhtar musste dann in der Nähe der Tür bereitstehen, bis der Wagen kam, und so ergaben sich verlegene Minuten, in denen sie beide auf die Straße starrten.
Viel los heute?, fragte ein Bewohner dann vielleicht.
Nicht besonders, antwortete Mokhtar stets. Es war wichtig, niemals überfordert zu wirken. Ein Concierge musste die Aura ruhiger Kompetenz ausstrahlen.
Schon gehört, dass der neue Pitcher von den Giants in Tower B eingezogen ist?, fragte der Bewohner vielleicht noch, dann kam der Wagen, und das war’s.
Mit James Blackburn blieb es nicht so oberflächlich. Schon vor dem Montblanc-Füller hatte er ein ehrliches Interesse an Mokhtar bekundet. Sie sind ein intelligenter Bursche, Mokhtar. Was haben Sie für Pläne?
Mokhtar fühlte mit ihm. James, ein weißer Ruheständler Mitte sechzig, war ein anständiger Mann, und diese Begegnungen waren auch für ihn peinlich. Falls er unterstellte, dass Mokhtar etwas Besseres machen wollte, als am Empfang zu sitzen und die Tür zu öffnen, wäre das eine Herabwürdigung seines derzeitigen Jobs, der ja möglicherweise Mokhtars ganzer Stolz war. Wenn er hingegen unterstellte, dass dieser Job tatsächlich Mokhtars ganzer Stolz war, führte das prompt zu einer ganzen Reihe weiterer beunruhigender Unterstellungen.
Die meisten Bewohner stellten diese Frage nicht. Sie wollten es nicht wissen. Der Job, Mokhtars Existenz im Infinity, erinnerte sie daran, dass es Leute gab, die in gläsernen Towern wohnten, und solche, die ihnen die Türen aufmachten. Hatten sie mitbekommen, dass er Die Verdammten dieser Erde las? Möglicherweise. Er versteckte seine Lektüre nicht. Hatten sie ihn in den Nachrichten gesehen, wenn er mal wieder an einer Protestaktion teilnahm oder sie anführte, um bessere Beziehungen zwischen der Polizei von San Francisco und den arabischen und muslimischen Bürgern der Stadt zu fordern? Mokhtar hatte hin und wieder im Licht der Öffentlichkeit gestanden, und manchmal glaubte er sogar, dass seine Zukunft im Organisieren von Veranstaltungen lag, als Repräsentant von Arabern und Muslimen. Vielleicht im Stadtrat? Als Bürgermeister? Manche Infinity-Bewohner kannten sein Engagement als junger Aktivist, und für die meisten war er ein beunruhigendes Rätsel. Mokhtar wusste, dass sie ihre Portiers lieber fügsamer, etwas weniger interessant mochten.
Aber dann war da James Blackburn. Wo sind Sie aufgewachsen?, fragte der. Sind Sie ursprünglich von hier?
Kapitel IIIDer Junge, der Bücher stahl
Mokhtars früheste Erinnerung an San Francisco war die, wie ein Mann auf einen Mercedes defäkierte. Das beobachtete er gleich am ersten Tag in Tenderloin. Mokhtar war acht, das älteste von damals fünf Kindern. Die Familie hatte jahrelang im Brooklyner Viertel Bedford-Stuyvesant gewohnt, wo sein Vater Faisal einen kleinen Laden namens Mike’s Candy and Grocery betrieb, der Mokhtars Großvater Hamood gehörte. Aber er wollte keinen Alkohol mehr verkaufen, womit er sich nie wohlgefühlt hatte. Nachdem sie jahrelang Pläne geschmiedet und sorgenvolle Überlegungen angestellt hatten, fassten Faisal und seine Frau Bushra endlich den befreienden Entschluss. Sie zogen nach Kalifornien, wo Faisal ein Job als Hausmeister in Aussicht gestellt worden war. Er wollte lieber ohne einen Cent in der Tasche neu anfangen, als weiter unter der Fuchtel seines Vaters zu stehen und mit Spirituosen zu handeln.
Sie fanden eine Wohnung in Tenderloin, das als das problematischste und ärmste Viertel der Stadt galt. An dem Tag, als sie mit dem Auto in San Francisco ankamen, schaute Mokhtar, der mit seinen Geschwistern auf der Rückbank saß, einmal aus dem Fenster, als sie vor einer roten Ampel warten mussten, und sah auf der Spur neben ihnen einen weißen Mercedes stehen. Während Mokhtar den Wagen mit seiner makellosen Lackierung und dem glänzenden Chrom bestaunte, sprang ein zerlumpter Mann auf die Motorhaube des Mercedes, zog sich die Hose runter und defäkierte. Das war nur einen Häuserblock von ihrer zukünftigen Wohnung entfernt.
In Brooklyn hatten sie eine geräumige Wohnung gehabt, mit einem eigenen Zimmer voller Spielsachen für die Kinder, und ein Leben geführt, in dem es laut Mokhtars Erinnerungen an nichts mangelte, und nun zogen sie in eine Zweizimmerwohnung auf der Polk Street 1036, die in einem Haus zwischen zwei Pornoläden lag. Mokhtar und seine vier Geschwister schliefen im Schlafzimmer und seine Eltern im Wohnzimmer. Die ganze Nacht hindurch heulten Sirenen. Drogensüchtige brüllten. Mokhtars Mutter Bushra hatte Angst, abends allein vor die Tür zu gehen, und schickte Mokhtar zum Einkaufen in den Lebensmittelladen auf der Larkin Street. Bei einem der ersten Male auf dem Weg zu dem Laden warf jemand eine Flasche nach ihm, die über seinem Kopf an einer Hausmauer zersplitterte.
Mokhtar gewöhnte sich an die Drogendealer, die tagein, tagaus in aller Öffentlichkeit ihre Geschäfte machten. Er gewöhnte sich an die Gerüche – menschlicher Kot, Urin, Marihuana. An das Geschrei von Männern und Frauen und Babys. Er gewöhnte sich daran, über gebrauchte Spritzen und Erbrochenes zu steigen. Ältere und jüngere Männer, die in Seitenstraßen Sex hatten. Eine Über-Sechzigjährige, die sich einen Schuss setzte. Eine bettelnde Obdachlosenfamilie. Ein betagter Junkie, der mitten auf einer belebten Straße stand.
In San Francisco ging man davon aus, dass die Polizei Tenderloin als eine Art Freizone für illegale Aktivitäten betrachtete, dass die Stadt die einunddreißig Häuserblocks von Tenderloin zum Anlaufbereich für Crack, Crystal Meth, Prostitution, Kleinkriminalität und öffentliche Darmentleerung erklärt hatte, genau wie sie Fisherman’s Wharf zur Quarantänezone für Touristen erklärt hatte. Selbst der Name, Tenderloin, hatte einen verruchten Ursprung: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kassierten die Polizisten und Politiker in dem Viertel so großzügige Bestechungsgelder, dass sie nur die zartesten Rinderfilets aßen.
Aber es gab auch nachbarschaftlichen Zusammenhalt in Tenderloin. Es war eine der erschwinglichsten Wohngegenden der Stadt, und es hatte seit Jahrzehnten Familien angelockt, die aus Vietnam, Kambodscha, Laos und dem Nahen Osten ihren Weg hierher gefunden hatten. Darunter waren auch einige Hundert Jemeniten, und die meisten Männer arbeiteten als Hausmeister. Unter den mannigfaltigen Scharen von Menschen, die ihre Herkunftsländer verließen, um in den Vereinigten Staaten zu leben, waren die Jemeniten Spätankömmlinge. Sie emigrierten erst seit 1960 in nennenswerter Zahl und fanden meist auf den Farmen im kalifornischen San Joaquin Valley und bei den Autoherstellern in Detroit Arbeit. Die ersten jemenitischen Einwanderer waren fast ausschließlich Männer, die größtenteils aus dem landwirtschaftlich geprägten Gouvernement Ibb stammten. Sie kamen nach Kalifornien, wo sie ihr Geld als Obstpflücker verdienten, doch in den 1970er-Jahren gingen Scharen von Jemeniten, die auf den Obstplantagen gearbeitet hatten, nach San Francisco, um sich einen Hausmeisterjob zu suchen. Die Bezahlung war besser, und es gab Zusatzleistungen. Irgendwann bestand die in Tenderloin ansässige Gewerkschaftsgruppe, in der Arbeitnehmer im Bereich Gebäudeservice organisiert waren, zu 20 Prozent aus Jemeniten.
Das war auch Faisals Plan. Er wollte als Hausmeister arbeiten oder zumindest in dem Bereich anfangen. Er bekam einen Job, behielt ihn aber nicht lange. Sein Chef war es gewohnt, die Immigranten, die für ihn arbeiteten – überwiegend aus Nicaragua und China, überwiegend Illegale –, abfällig und verächtlich zu behandeln. Mokhtars Vater war stolz und kannte seine Rechte, also kündigte er und fand einen Job als Wachmann im Sequoias, einem Apartmenthochhaus. Dort war er während Mokhtars ersten Jahren in San Francisco beschäftigt, und als Schichtdienstler arbeitete er manchmal achtzehn Stunden am Stück.
Wodurch Mokhtar reichlich Zeit hatte, sich unbeaufsichtigt herumzutreiben. Er konnte durch die Schaufenster der nicht jugendfreien Videoläden spähen, konnte den halb nackten Mann ignorieren, der Obszönitäten über die Straße brüllte. Er konnte bei einem der vielen jemenitischen Gemüseläden vorbeischauen – die Jemeniten betrieben die Hälfte aller lokalen Gemüseläden, selbst einen namens Amigo’s. Er konnte einen Zwischenstopp im Sergeant John Macauley Park einlegen, einem winzigen Spielplatz gegenüber vom New Century Strip Club. Ein Stück weiter, an der O’Farrell Ecke Polk Street, war eine Hauswand bemalt mit einer Unterwasserszene von Walen und Haien und Schildkröten. Jahrelang glaubte Mokhtar, in dem Gebäude wäre ein Aquarium untergebracht. Erst viel später wurde ihm klar, dass es sich um das Mitchell Brothers O’Farrell Theatre handelte, eines der ältesten und berüchtigtsten Striplokale in den USA, in dem angeblich der Lapdance erfunden wurde. Es gab einunddreißig Spirituosenläden in der Gegend und nur wenige Möglichkeiten für Kinder, gefahrlos zu spielen, aber in diesen heruntergekommenen Häuserblocks lebten Tausende Kinder, und sie wurden schnell groß.
Als Mokhtar in die Pubertät kam, war er längst ein Schnelllerner, ein Schnellredner, ein Schlitzohr geworden, der gelernt hatte, sich durchzuschlagen, und mit vielen Kindern befreundet war, die ebenfalls Schnellredner und Schlitzohren waren. In Tenderloin mieden sie die Junkies und Stricher, und wenn sie konnten, unternahmen sie Streifzüge in eine völlig andere Welt, die sich, wie sie wussten, in jede Richtung bloß ein paar Querstraßen weiter befand. Im Norden lag Nob Hill, eine der teuersten Wohngegenden in den Vereinigten Staaten mit dem Fairmont Hotel und dem Mark Hopkins Hotel. Wenige Häuserblocks weiter östlich lag das Viertel Union Square mit seinen teuren Geschäften, den Cable Cars und Juwelieren.
Überall gab es Touristen, und Touristen boten immer Unterhaltung. Mokhtar und seine Freunde trieben sich gern im Hafenviertel Fisherman’s Wharf herum und gaben europäischen Besuchern unsinnige Wegbeschreibungen. Oder sie stellten ihnen unverständliche Fragen. Sie sprachen zum Beispiel einen Touristen an und fragten, Wissen Sie, wie wir nach Miau Miau kommen? Nein? Und nach Ackakakakaka? Sie spazierten an den Fenstern irgendwelcher Restaurants vorbei, die sie sich nicht mal im Traum je würden leisten können, und drückten ihre nackten Hintern gegen die Scheibe. Wenn sie ein paar Dollar brauchten, liefen sie zum Ghirardelli Square und fischten aus dem dortigen Brunnen die Münzen, die Touristen hineingeworfen hatten.
Mokhtar wusste, dass seine Familie arm war, aber gewisse Entbehrungen ließen sich beheben. Er wusste, dass sie sich kein Nintendo 64 leisten konnten – jahrelang hatte er sich zu jedem Geburtstag eins gewünscht, bis er die Hoffnung schließlich aufgegeben hatte –, aber in dem riesigen Elektronikladen Circuit City, der nur vier Blocks von ihrer Wohnung entfernt lag, ging es immer so hektisch und chaotisch zu, dass er und seine Freunde sich als potenzielle Kunden ausgeben konnten, die ein Game ausprobierten. Meistens schafften sie es, etwa eine Stunde lang Mario Kart zu spielen, bevor man sie verscheuchte.
Mokhtars Nachbarn waren eine eingeschworene Gemeinschaft. In ihrem Mietshaus auf der Polk Street wohnten fast ausschließlich jemenitische Familien, und die kümmerten sich umeinander. Die Familien besuchten dieselbe Moschee, die Kinder spielten auf den Fluren Fußball, und aus für Mokhtar unerfindlichen Gründen wurden die meisten Kinder auf Treasure Island zur Schule geschickt. Die Treasure Island Middle School war die Schule, auf die sehr viele Kinder gingen, die keine anderen Möglichkeiten hatten. Der Name klang fast romantisch: Schatzinselschule. Die Insel selbst war bizarr, eine unerklärliche, künstlich erschaffene Masse aus Gegensätzen. Die US-Marine erschuf sie 1936, indem sie gleich neben einer natürlichen Insel namens Yerba Buena und zwischen San Francisco und der East Bay 287.000 Tonnen Felsgestein und fast 40.000 Kubikmeter Erde in der Bucht von San Francisco versenkte. Die Insel, die während des Zweiten Weltkriegs als Militärstützpunkt genutzt wurde, hieß damals noch nicht Treasure Island. Der Name kam hinterher, als der Stützpunkt geschlossen wurde und die Verantwortlichen die Insel in der Hoffnung, sie einer kommerziellen Nutzung zuführen zu können, nach Robert Louis Stevensons Buch über mordlüsterne Piraten benannten.
Aber eine kommerzielle Nachkriegsnutzung irgendwelcher Art blieb aus, und die Gründe dafür waren vernünftig, aber nicht unüberwindlich. Erstens: Es herrschte einiges Rätselraten darüber, was in der eigentlichen Landmasse der Insel steckte. Die Marine gab nicht preis, welche schädlichen Abfälle dort möglicherweise entsorgt worden waren, und niemand war bereit, die notwendigen Untersuchungen und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Zweitens: Angesichts des steigenden Meeresspiegels wuchsen die Bedenken hinsichtlich der Frage, wie es um die gesamte Insel, die nur etwa einen halben Meter aus dem Wasser ragte, in etwa zwanzig Jahren bestellt sein würde.
In der Schule fiel es Mokhtar schwer, Ärger aus dem Weg zu gehen. Vielleicht neigte er dazu. Vielleicht zählte er zu den Anführern. Es gab schwarze Kinder, samoanische Kinder, Latino-Kinder, jemenitische Kinder, und die Jungs tranken schon mit dreizehn Alkohol und rauchten Pot – und zwar beides auf dem Schulgelände, einem Konglomerat von Asphaltplätzen und lang gestreckten Flachbauten, allesamt knapp über Barackenniveau. Es war die Blütezeit von Mokhtar, dem Schlitzohr. Seine Eltern wussten, dass er dabei war, auf Abwege zu geraten. Sie versuchten, ihn zur Rechenschaft zu ziehen, aber er konnte sich aus jeder Klemme herausreden. Als er etwa zwölf war, hörten sie auf, ihm zu glauben.
»Alles Ausflüchte«, sagten sie.
Dennoch, seine Lehrer wussten, dass er nicht dumm war. Mokhtar las für sein Leben gern. Zu Hause hatte er sogar eine eigene Bibliothek. In der kleinen Wohnung war kein Platz für Bücherregale, aber Mokhtar hatte sich in der winzigen Vorratskammer neben der Küche ein Regalbrett unter dem mit den Konservendosen und über dem mit Pasta und Gewürzen für seine Bücher gesichert. Bücher, die er gefunden hatte – oder gestohlen. Beim Beschaffen der Bücher ging es nicht immer mit rechten Dingen zu – er hatte kein Geld, um sich welche zu kaufen, aber er wollte eigene haben, ordentlich aufgereiht wie in einem ganz normalen Zuhause. Einige lieh er sich auf unbestimmte Zeit in der Stadtbücherei. Seine Sammlung wuchs. Fünf Bücher, dann zehn, dann zwanzig, und schon bald machte das eine Regalbrett in der Vorratskammer richtig was her, als wäre dieser kleine dunkle Raum neben der Küche sozusagen eine Oase der Gelehrsamkeit.
Und weil Mokhtar kein eigenes Zimmer hatte, nicht mal eine eigene Zimmerecke, war die Bibliothek der einzige Ort, der wirklich ihm gehörte. Zu seiner Sammlung zählten Gänsehaut-Bücher, Comics, Die Chroniken von Narnia, Der Herr der Ringe. Aber nichts bedeutete ihm so viel wie Harry Potter, der unter einer Treppe wohnte, aber eigentlich nicht dorthin gehörte, sondern in Wahrheit für große Dinge auserkoren war. Wenn Mokhtar es satthatte, arm zu sein, über obdachlose Drogensüchtige zu steigen, mit sechs Geschwistern in einem Zimmer zu schlafen, ließ er seine Gedanken schweifen und träumte von der Möglichkeit, dass er vielleicht wie Harry war, vorerst noch Teil dieser schäbigen Welt, aber zu Höherem bestimmt.
Kapitel IVKluger Rat von Ghassan Toukan
Teil I
Mokhtar nahm an der Hausaufgabenbetreuung teil, die von der Al-Tawheed-Moschee auf der Sutter Street angeboten und von den Toukans betrieben wurde, einer palästinensisch-amerikanischen Familie. Ghassan Toukan, nur sieben Jahre älter als Mokhtar, war einer der Lehrer, und Mokhtar wusste, dass er Ghassan schier wahnsinnig machte. Mokhtar war schlecht in der Schule, und er war schlecht nach der Schule. Er lenkte alle ab. Er war gelangweilt. Und er glaubte nicht, dass Ghassan Toukan, der einfach in allem ein Ass war, daran etwas ändern würde.
»Mokhtar«, beschwor Ghassan ihn. »Setz dich hin. Mach deine Hausaufgaben. Mach irgendwas.«
Jeden Tag lag Ghassan Mokhtar in den Ohren wegen derselben Sachen, wegen allem. Weil er sich nicht benahm. Weil er seine Hausaufgaben nicht machte. Erklärte ihm, was es ihm für wunderbare Vorteile bringen würde, wenn er seine Hausaufgaben machte. Mokhtar konnte ihn nicht ernst nehmen. Er konnte nichts davon ernst nehmen. Er besuchte eine Schule auf Treasure Island, einem ehemaligen Militärstützpunkt mitten in der Bucht von San Francisco. Es war eine Schule für die Vergessenen, von denen es keiner je zu etwas bringen würde.
Deshalb war Mokhtar bei der Hausaufgabenbetreuung der Toukans ein Unruhestifter. Er fand einen gleichgesinnten Komplizen in einem Jungen namens Ali Shahin. Alis Vater war Imam an einer anderen Moschee, doch wie Mokhtar ließ auch Ali sich leicht ablenken. Gemeinsam brachten sie Ghassan auf die Palme. Sie störten. Sie nervten. Sie arbeiteten nicht, und die jüngeren Kinder sahen, dass sie nicht arbeiteten, wodurch jegliche konzentrierte Lernatmosphäre, die die Toukans zu erzeugen versuchten, ruiniert wurde.
»Mokhtar!«, schrie Ghassan. Jeden Tag schrie er Mokhtars Namen. Er sagte, er solle sich hinsetzen, zuhören, lernen.
Stattdessen schlichen sich Mokhtar und Ali aus der Moschee. Sie bummelten durch Tenderloin, immer auf der Hut vor Mokhtars Vater. In den Jahren als Wachmann hatte Faisal sich unermüdlich bei den städtischen Verkehrsbetrieben von San Francisco um einen Job beworben und war für seine Ausdauer endlich mit einer Stelle als Busfahrer belohnt worden. Er kündigte seinen Spätschichtjob bei Sequoias, und jetzt hatte er vernünftige und regelmäßige Arbeitszeiten. Die neunköpfige Familie – er und Bushra hatten zwei weitere Kinder bekommen – konnte das Gehalt plus Zulagen gut gebrauchen, und die Arbeit selbst entsprach seinem Naturell. Er saß gern am Steuer, und er redete gern.
Für Mokhtar hingegen war der neue Job seines Vaters ein Problem. Er engte ihn ein. Er machte ihn paranoid. Sein Vater fuhr an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Routen, und Mokhtar konnte sich nie merken, welche er an einem bestimmten Tag fahren würde. Deshalb musste das Schlitzohr jetzt vorsichtiger sein. Es kam vor, dass Mokhtar und seine Freunde gerade irgendwas ausheckten und einer von ihnen aufblickte. Kommt da nicht dein Pa, Mokhtar? Sein Vater kreiste durch seine Kindheit, wie er durch die Stadt kreiste – eine Art rastloses Gewissen von 18 Metern Länge.
Mokhtar und Ali kehrten dann wieder in die Moschee zurück, zurück zu Ghassan und seinen Versuchen, sie zu bändigen. Und eines Tages platzte Ghassan der Kragen. Er befahl den vier Jungen, Mokhtar, Ali und zwei weiteren Störenfrieden namens Ahmed und Hatham, sie sollten sich hinsetzen.
Ghassan zeigte auf Hatham. »Was macht dein Vater beruflich?«
»Taxifahrer«, sagte Hatham.
Er zeigte auf Ahmed. »Was macht dein Vater?«
»Hausmeister«, sagte Ahmed.
Er zeigte auf Mokhtar.
»Busfahrer«, sagte Mokhtar.
»Gut«, sagte Ghassan. Er wusste, dass Alis Vater Imam war, aber auch um ihn machte er sich Sorgen. Er machte sich um alle diese Kinder Sorgen. »Eure Eltern sind als Einwanderer hierhergekommen, und sie hatten keine andere Wahl. Wollt ihr Taxi fahren? Toiletten putzen? Bus fahren?«
Mokhtar zuckte mit den Achseln. Ahmed und Hatham zuckten mit den Achseln. Sie hatten keine Ahnung, womit sie später mal ihr Geld verdienen wollten. Sie waren erst dreizehn. Mokhtar fiel auf die Frage, was er wollte, nur eine Xbox ein.
»Sie sind mit euch hierhergekommen, damit ihr eine Wahl habt«, sagte Ghassan. »Und ihr setzt gerade euer Leben in den Sand. Falls ihr was anderes machen wollt, wenn ihr erwachsen seid, müsst ihr euch endlich am Riemen reißen.«
Kapitel VJemen
Mokhtars Eltern sahen das auch so, deshalb schickten sie ihn in den Jemen. Sie fanden, dass er einen Ortswechsel bräuchte, frische Luft, dass es ihm guttäte, in die Kultur seiner Herkunft einzutauchen. Nach der Zweizimmerwohnung seiner Eltern in Tenderloin wohnte Mokhtar nun im sechsstöckigen Haus seines Großvaters Hamood in Ibb. Er hatte ein eigenes Zimmer. Er hatte ein eigenes Stockwerk. Das Haus hatte Dutzende Räume, einen Balkon mit Blick über ein grünes Tal mitten in der Stadt. Eigentlich war es ein Schloss, das Hamood aus dem Nichts erbaut hatte.
Hamood war mehr als ein Patriarch. In der Familie Alkanshali war es unmöglich, sich seinem Einfluss zu entziehen. Und obwohl er mittlerweile Ende sechzig war, reiste er noch immer fast täglich hundert Meilen, von Sanaa nach Ibb oder von Ibb in die Dörfer, wo er an Hochzeiten oder Trauerfeiern teilnahm oder Stammesstreitigkeiten schlichtete. Er war kein groß gewachsener Mann mehr – das Alter hatte ihn kleiner und dünner gemacht –, doch er hatte einen flinken Verstand, war geistreich und streng. Zwar hatte er sich weitgehend zur Ruhe gesetzt, doch in Ibb war er nach wie vor eine graue Eminenz. Wenn er einen Hochzeitssaal betrat, erhoben sich alle. Manche küssten ihm die Hand, andere küssten ihm den Kopf – ein Zeichen größten Respekts.
Er war in den 1940er-Jahren als fünftes von acht Kindern in Al-Dakhla zur Welt gekommen, einem kleinen Dorf in Ibb. Schon als kleiner Junge hatte er das Gefühl, der Lieblingssohn seines Vaters zu sein. Als er gerade erst neun oder zehn Jahre alt war, geriet sein Vater in Streit mit einem anderen Stammesangehörigen, der in der Gunst der Herrschenden stand. Der Streit, bei dem es um Grundbesitz ging, brachte ihn schließlich ins Gefängnis, wo seine Gesundheit sich rapide verschlechterte. Als er spürte, dass es mit ihm zu Ende ging, ließ er nur eines seiner Kinder, Hamood, zu sich in die Zelle kommen, eine Bevorzugung, die Hamoods Beziehung zu seinen Geschwistern vergiftete, besonders die zu seinen älteren Brüdern. Nach dem Tod des Vaters ächteten diese Brüder ihn und weigerten sich, ihm vom Land ihres Vaters etwas abzugeben.
Mit dreizehn beschloss Hamood, allein loszuziehen. Barfuß und nur mit einem Rucksack auf dem Rücken verließ er Ibb und ging zu Fuß nach Saudi-Arabien. Diese Geschichte erzählte er Mokhtar häufig.
»Das sind dreihundert Meilen«, sagte Mokhtar dann.
»Und ich bin sie barfuß gegangen«, beteuerte Hamood jedes Mal.
Doch bevor er sich auf den Weg machte, bat Hamood seine Brüder um einen Esel. Er erklärte ihnen, dass er fortgehen wolle, dass sie ihn dann endlich los wären und dass er lediglich einen Esel als Lastentier brauche.
»Ein Esel ist mehr wert als du«, sagten die Brüder.
Also brach Hamood ohne Esel auf.
In Saudi-Arabien, einem Land, das in Öldollars schwamm und um ein Vielfaches reicher war, als der Jemen es je sein könnte, verkaufte Hamood Wasser am Straßenrand. Er putzte in Restaurants. Er nahm jeden Job an, den er finden konnte, und er sparte Geld, das er seiner verwitweten Mutter nach Hause schickte. Und jeder Geldsendung legte er einen Zettel bei mit den Worten: »Das ist von dem Jungen, der weniger wert ist als ein Esel.«