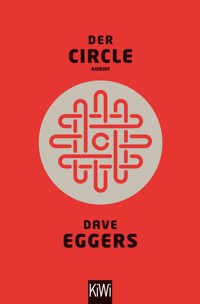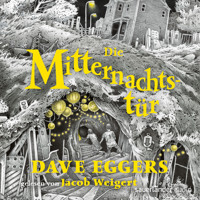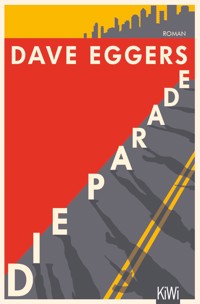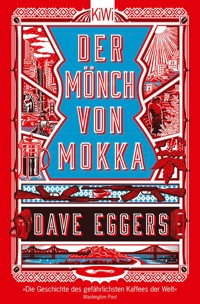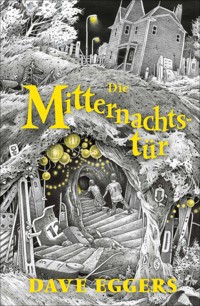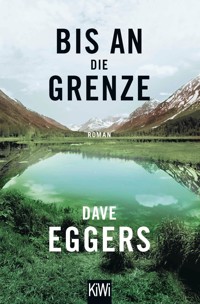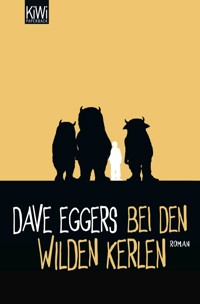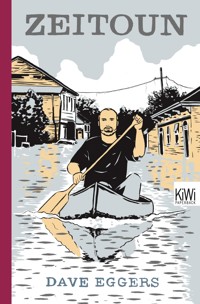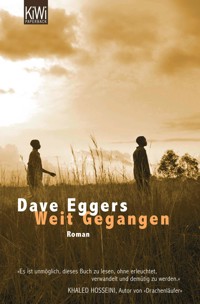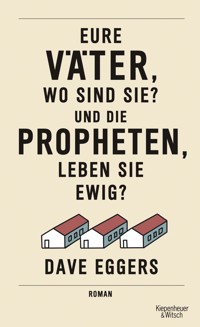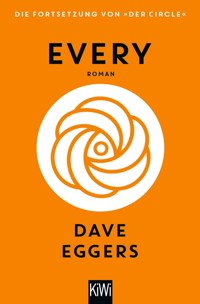
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach »Der Circle« legt Dave Eggers mit »Every« eine rasante Fortschreibung seines Weltbestsellers vor - ein hochbrisanter Thriller Der Circle ist die größte Suchmaschine gepaart mit dem größten Social-Media-Anbieter der Welt. Eine Fusion mit dem erfolgreichsten Onlineversandhaus brachte das reichste und gefährlichste – und seltsamerweise auch beliebteste – Monopol aller Zeiten hervor: Every. Delaney Wells ist »die Neue« bei Every und nicht gerade das, was man erwarten würde in einem Tech-Unternehmen. Als ehemalige Försterin und unerschütterliche Technikskeptikerin bahnt sie sich heimlich ihren Weg, mit nur einem Ziel vor Augen: die Firma von innen heraus zu zerschlagen. Zusammen mit ihrem Kollegen, dem nicht gerade ehrgeizigen Wes Kavakian, sucht sie nach den Schwachstellen von Every und hofft, die Menschheit von der allumfassenden Überwachung und der emojigesteuerten Infantilisierung zu befreien. Aber will die Menschheit überhaupt, wofür Delaney kämpft? Will die Menschheit wirklich frei sein? Wie schon bei »Der Circle« weiß Dave Eggers wie kein zweiter unsere Wirklichkeit so konsequent weiterzudenken, dass einem der Atem stockt beim Lesen. Man kann nur inständig hoffen, dass die Realität nicht schneller voranschreitet, als Dave Eggers schreiben kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dave Eggers
Every
Endlich ein Gefühl von Ordnung oder die letzten Tage des freien Willens oder grenzenlose Auswahl zerstört die Welt
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Dave Eggers
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Dave Eggers
Dave Eggers, geboren 1970, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren. Sein Roman »Der Circle« war weltweit ein Bestseller. Sein Werk wurde mit zahlreichen literarischen Preisen ausgezeichnet. Der Roman »Ein Hologramm für den König« war nominiert für den National Book Award, für »Zeitoun« wurde ihm u. a. der American Book Award verliehen. Dave Eggers stammt aus Chicago und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Nordkalifornien.Dave Eggers, geboren 1970, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Autoren. Sein Roman »Der Circle« war weltweit ein Bestseller. Sein Werk wurde mit zahlreichen literarischen Preisen ausgezeichnet. Der Roman »Ein Hologramm für den König« war nominiert für den National Book Award, für »Zeitoun« wurde ihm u. a. der American Book Award verliehen. Dave Eggers stammt aus Chicago und lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Nordkalifornien.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Kein Mensch liest diese Klappentexte. Und doch gibt es sie in jedem gebundenen Buch und sogar in einigen aufwendig gestalteten, meist französischen Taschenbüchern. Unzählige Stunden dauert es, diese Klappentexte zu schreiben, zu redigieren, zu drucken, und dann werden sie nicht gelesen. Das ist eine unverzeihliche Verschwendung von Ressourcen und beweist, dass dem Verlagswesen – vielleicht mehr als jeder anderen Branche – ein Umbruch bevorsteht. Bei Every wollen wir den Umbruch. Wir stellen Fragen. Wir suchen nach Antworten. Wir suchen nach Lösungen. Und wenn wir diese Lösungen gefunden haben, dann setzen wir sie mit Nachdruck um. Als wir Bücher unter die Lupe genommen haben, haben wir viel Raum für Verbesserungen vorgefunden. Einige Fragen haben Sie sich wahrscheinlich auch schon gestellt: Warum wird ein Buch von vorn nach hinten gelesen? Wozu brauchen wir Autoren? Sollte es Bücher überhaupt geben, wenn sie doch Platz wegnehmen, Bäume töten und gelesen werden müssen? Nehmen wir zunächst einmal an, dass es Bücher geben sollte. Wie können wir die Technologie nutzen, um sie zu verbessern? Erstens: Figuren. Vor nicht allzu langer Zeit waren Bücher voller Figuren, die die falschen Dinge sagten und taten. Diese Figuren waren unnötig komplex und oft unsympathisch. Wir haben uns gefragt: Gibt es keinen besseren Weg? Den gibt es: FictFix. Wir behaupten nicht, dass unser FictFix-Algorithmus jeden Fehler in jedem Roman beheben kann, aber wir können mit empirischer Gewissheit sagen, dass er es bei 86 Prozent der Fehler in 92 Prozent der Romane kann. Angefangen bei den Figuren. Jahrhundertelang waren die Leser verblüfft über die Entscheidungen, die bestimmte Figuren trafen, und verärgert über bestimmte Dinge, die sie sagten. Sehr oft – zu oft – verhielten sich diese Figuren unangemessen. Vor allem in älteren Romanen sagten und taten Figuren Dinge, von denen wir heute wissen, dass sie falsch sind. FictFix hat diese Fehler behoben, und die Leser haben darauf reagiert. 71 Prozent der Leser fanden, dass unsere FixedBux eine Verbesserung gegenüber ihren unbearbeiteten Vorgängern darstellten. Aber was ist mit der Struktur? Mit dem Tempo? Was ist mit der Länge der Sätze, der Kapitel? Wie steht es mit dem Entfernen unangenehmer Ideen und dem Einfügen geschmackvoller Romantik in vorhersehbaren Abständen? All diese Dinge sind lösbar – wir brauchen nur die Daten, die Werkzeuge und den Mut. Fragen, die Akademiker jahrhundertelang vor ein Rätsel gestellt haben – und die manchmal als unlösbar galten –, wurden von unserem Algorithmus leicht beantwortet. Wie lang sollte ein Buch sein?
Jetzt wissen wir es: nicht mehr als 579 Seiten. Wie viele Witze sollten in einem Buch stehen? Witze sollten nicht in Büchern vorkommen, aber wenn es Witze in Büchern gibt, sollten es nicht mehr als zwölf sein. Wie viele kranke Hunde und Figuren namens Rowena dürfen in einem Roman vorkommen? Eins und eins. Beruhigt dich das? Zahlen haben das so an sich, sie geben uns Gewissheit, und Gewissheit beruhigt, und das Leben ist nur lebenswert, wenn wir frei von Unbehagen sind. Aber gibt es da nicht noch eine letzte Frage, die schwer zu beantworten ist – ja sogar frustrierend subjektiv? Ja. Die Qualität. Wie kann man sie messen? Woher weiß man, welche Bücher gut sind und welche nicht? Auch dafür haben wir eine Lösung. Die Bücher werden auf einer Website bewertet, die die Kundenrezensionen zu einem Fünf-Sterne-Durchschnitt zusammenfasst.
Um die größtmögliche Genauigkeit (und damit Gewissheit) zu erreichen, wird dieser Durchschnitt auf die hundertste Dezimalstelle berechnet. So wissen wir, welche Bücher gut sind und welche nicht, und so wissen wir auch, dass Don Quijote eine 3,89 ist. Aber natürlich kann und wird diese Bewertung noch verbessert werden.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: The Every
© Dave Eggers
All rights reserved
Aus dem Englischen von Klaus Timmermann und Ulrike Wasel
© 2021, 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach dem Originalumschlag von Eve Weinsheimer für Penguin Random House
Covermotiv: © Jessica Hische
ISBN978-3-462-30278-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Leseanalyse
Motti
Vorbemerkung
I. Genesis
II. Den Mann bezaubern
III. Kann mir gut vorstellen, dass du Wandteppiche machst
IV. Rette mich, Jennifer
V. Carlo und Shireen: Werte der Anerkennung
VI. Der größere Verlust
VII. Unbefleckte Empfängnis
VIII. Warum wir keine Dinge haben sollten
IX. Er liebt sie, sie dankt ihm
X. Ozeanregen
XI. An einen jungen todgeweihten Kämpfer
XII. Beweis für das Schrumpfen der menschlichen Seele, Teil 1
XIII. Der Weg allen Fleisches
XIV. Den Datensatz erweitern
XV. Ein simpler Plan
XVI. Die Tyrannei der freien Auswahl
XVII. Die Mühen unserer Frucht
XVIII. Wie dieser Text zu lesen ist
XIX. Wo Ideen herkommen
XX. Wo schlechte Ideen herkommen
XXI. Der längste Tag
XXII. Dreizehn Arten zu sehen
XXIII. An Joan: Ein Sternfunkeln grell
XXIV. Ode an ein griechisches Lamm
XXV. Beweis für das Schrumpfen der menschlichen Seele, Teil 2
XXVI. Gezügelt und zufrieden
XXVII. Deine Launen, ihr Leiden
XXVIII. Unvollendete Vergangenheit
XXIX. Schnelles Ende einer flüchtigen Bedrohung
XXX. Auf dem Siechbett
XXXI. Auf den Sieger – Victor
XXXII. Der aufziehende Sturm
XXXIII. Sieh mich, hör mich, rette mich
XXXIV. Das soll nur heißen
XXXV. Die irre Befragung
XXXVI. Pinnacle
XXXVII. EveryThrow
XXXVIII. Es ist was geschehen
XXXIX. Lady Lazarus
XL. Die Gewohnheit der Vervollkommnung
XLI. Da bist du ja wieder
XLII. Gregorys Mädchen
XLIII. Daheim und unterwegs
XLIV. Der gefesselte Prometheus
XLV. Die einvernehmliche Wirtschaftsordnung
Danksagung
Über McSweeney’s
I
12 min read
88% match
Score: 86.67
II
11 min read
81% match
Score: 82.18
III
14 min read
67% match
Score: 89.22
III
18 min read
62% match
Score: 92.54
IV
66 min read
97% match
Score: 61.34
V
81 min read
91% match
Score: 71.45
VI
09 min read
34% match
Score: 78.91
VII
23 min read
55% match
Score: 98.33
VIII
45 min read
28% match
Score: 90.12
IX
78 min read
13% match
Score: 76.89
X
91 min read
76% match
Score: 45.87
XI
10 min read
92% match
Score: 41.45
XII
10 min read
83% match
Score: 09.18
XIII
10 min read
89% match
Score: 14.66
XIV
13 min read
44% match
Score: 56.86
XV
32 min read
67% match
Score: 42.81
XVI
23 min read
33% match
Score: 93.87
XVII
92 min read
39% match
Score: 91.65
XVIII
64 min read
46% match
Score: 84.02
XIX
32 min read
53% match
Score: 86.43
XX
11 min read
94% match
Score: 88.12
XXI
07 min read
63% match
Score: 90.22
XXII
01 min read
78% match
Score: 81.33
XXIII
88 min read
75% match
Score: 44.63
XXIV
76 min read
84% match
Score: 58.04
XXV
07 min
18% match
Score: 01.54
XXVI
12 min
23% match
Score: 34.87
XXVII
09 min
98% match
Score: 81.77
XXVIII
11 min
91% match
Score: 86.08
XXIX
41 min
67% match
Score: 45.68
XXX
34 min
34% match
Score: 90.67
XXX
I23 min
37% match
Score: 45.67
XXXII
07 min
66% match
Score: 76.01
XXXIII
08 min
61% match
Score: 26.17
XXXIV
76 min
74% match
Score: 88.60
XXXV
44 min
71% match
Score: 81.41
XXXVI
22 min
80% match
Score: 99.67
XXXVII
18 min
76% match
Score: 82.27
XXXVIII
12 min
23% match
Score: 80.98
XXXIX
56 min
11% match
Score: 76.01
XL
12 min
65% match
Score: 86.67
XLI
09 min
88% match
Score: 67.02
XLII
22 min
91% match
Score: 81.98
XLIII
17 min
02% match
Score: 34.92
XLIV
23 min
76% match
Score: 90.02
XLV
11 min
81% match
Score: 88.91
Acks
14 min
76% match
Score: 75.81
Note A
10 min
51% match
Score: N/A
Note B
88 min
67% match
Score: 100.91
Note C
42 min
83% match
Score: 44.51
»Gib den Menschen ein neues Wort, und sie glauben, sie haben eine neue Tatsache.«
– Willa Cather
»Wenn eine Idee zuerst nicht absurd erscheint, dann taugt sie nichts.«
– Albert Einstein
»Gibt es vielleicht außer dem angeborenen Wunsch nach Freiheit auch eine instinktive Sehnsucht nach Unterwerfung?«
– Erich Fromm
Vorbemerkung: Diese Geschichte spielt in der nahen Zukunft. Versuchen Sie nicht herauszufinden, wann. Eventuelle zeitliche oder physikalische Anachronismen sind gewollt. Alle Fehler in Bezug auf Technologie, Chronologie oder Urteilsvermögen sind Absicht und in Ihrem Interesse.
I.
Delaney trat aus der dämmrigen U-Bahn in eine Welt aus reinem Licht. Es war ein klarer Tag, und die Sonne, die auf die unzähligen Wellen der Bucht traf, warf goldene Funken in alle Richtungen. Delaney wandte dem Wasser den Rücken zu und ging die rund hundert Schritte bis zum Every-Campus. Schon das allein – die U-Bahn zu nehmen, sich unbegleitet und zu Fuß dem Tor zu nähern – machte sie zu einer Anomalie und irritierte die beiden Posten in ihrem Wachhaus. Ihr Arbeitsplatz war aus Glas und pyramidenförmig, wie die Spitze eines Kristallobelisks.
»Sie sind hierher gelaufen?«, fragte der weibliche Wachposten. ROWENA, ihrem Namensschild nach, war um die dreißig, schwarzhaarig und trug ein adrettes gelbes Top, hauteng wie ein Fahrradtrikot. Als sie lächelte, kam eine charmante Lücke zwischen ihren Vorderzähnen zum Vorschein.
Delaney nannte ihren Namen und sagte, sie habe ein Vorstellungsgespräch mit Dan Faraday.
»Finger bitte«, sagte Rowena.
Delaney drückte ihren Daumen auf den Scanner, und auf Rowenas Monitor erschien ein Raster aus Fotos, Videos und Daten. Es waren Fotos von Delaney, die sie selbst noch nicht gesehen hatte – war das eine Tankstelle in Montana? Auf den Ganzkörperaufnahmen hatte sie eine gekrümmte Haltung, die Folge davon, dass sie als Teenager zu groß geraten war. Delaney stellte sich gerader hin, während ihr Blick über die Bilder glitt, die sie in ihrer Park-Ranger-Uniform zeigten, in einer Mall in Palo Alto, in einem Bus, der anscheinend durch Twin Peaks fuhr.
»Sie haben sich die Haare wachsen lassen«, sagte Rowena. »Sind aber immer noch ziemlich kurz.«
Delaney fuhr sich reflexartig mit den Fingern durch den vollen schwarzen Bubikopf.
»Hier steht, Sie haben grüne Augen«, sagte Rowena. »Sehen aber braun aus. Treten Sie bitte näher.« Delaney trat näher. »Ah! Hübsch«, sagte Rowena. »Ich geb Dan Bescheid.«
Während Rowena Faraday anrief, stand der zweite Wachposten, ein hagerer Mann um die fünfzig mit einem britischen Akzent, vor einer anderen Herausforderung. Ein weißer Van war vorgefahren, und der Fahrer, ein rotbärtiger Mann, der ein gutes Stück höher als das Wachhausfenster saß, erklärte, er habe eine Lieferung.
»Was für eine Lieferung?«, fragte der hagere Wachmann.
Der Fahrer drehte sich kurz in seinem Sitz um, als wollte er sich vergewissern, dass seine bevorstehende Beschreibung stimmte. »So ein Haufen Körbe. Geschenkkörbe. Stofftiere, Pralinen und so«, sagte er.
Jetzt schaltete sich Rowena ein, von der Delaney annahm, dass sie in dem Glasobelisken das Sagen hatte. »Wie viele Körbe?«, fragte sie mit Blick auf einen Monitor im Wachhaus.
»Keine Ahnung. Etwa zwanzig«, sagte der Fahrer.
»Und werden die von jemandem erwartet?«, fragte Rowena.
»Keine Ahnung. Ich denke, die sind vielleicht für potenzielle Kunden«, sagte der Fahrer, der plötzlich erschöpft klang. Dieses Gespräch zog sich offensichtlich schon sehr viel länger hin, als er das gewohnt war. »Oder es sind Geschenke für Leute, die hier arbeiten«, sagte er, nahm ein Tablet vom Beifahrersitz und tippte ein paarmal darauf herum. »Hier steht, die sind für Regina Martinez und das Initiative K Team.«
»Und wer ist der Absender?«, fragte Rowena. Sie klang jetzt fast amüsiert. Es war klar, zumindest für Delaney, dass diese spezielle Lieferung ihr Ziel nicht erreichen würde.
Wieder konsultierte der Fahrer sein Tablet. »Hier steht, Absender ist etwas namens MDS. Bloß M-D-S.« Jetzt hatte die Stimme des Fahrers einen fatalistischen Ton angenommen. Würde es etwas ändern, so schien er sich zu fragen, wenn er wüsste, wofür MDS stand?
Rowenas Gesicht entspannte sich. Sie murmelte in ein Mikrofon, sprach offenbar mit einer anderen Security-Bastion innerhalb von Every. »Ist schon gut. Ich hab’s im Griff. Wird abgelehnt.« Sie nickte dem Fahrer mitfühlend zu. »Sie können gleich da vorne wenden.« Rowena zeigte auf einen Wendehammer fünfzehn Meter weiter.
»Soll ich die Körbe da ausladen?«
Rowena lächelte wieder. »Oh nein. Wir haben keine Verwendung für Ihre …« – die Pause schien dafür gedacht, genug Verachtung in das nächste, bislang so harmlose Wort zu legen – »Körbe.«
Der Fahrer hob die Hände gen Himmel. »Seit zweiundzwanzig Jahren fahre ich Lieferungen aus, und noch nie ist eine abgelehnt worden.« Er sah Delaney an, die noch immer neben dem Wachhaus stand, als suchte er in ihr eine potenzielle Verbündete. Sie wandte den Blick ab und betrachtete das höchste Gebäude auf dem Campus, einen aluminiumverkleideten gewundenen Turm, der Algo Mas beherbergte, den Algorithmus-Thinktank des Unternehmens.
»Erstens«, erklärte Rowena, die sich offensichtlich nicht für die berufliche Erfolgsgeschichte des Fahrers interessierte, »Ihre Ladung entspricht nicht unseren Sicherheitsvorgaben. Wir müssten jeden einzelnen Ihrer …« – wieder spuckte sie das Wort förmlich aus – »Körbe durchleuchten, und dazu sind wir nicht bereit. Zweitens, das Unternehmen hat Richtlinien, die es untersagen, nicht nachhaltige oder unsachgemäß beschaffte Waren auf den Campus zu lassen. Ich vermute, diese Körbe« – es klang aus ihrem Mund jetzt wie ein Schimpfwort – »enthalten aufwendige Plastikverpackungen? Und verarbeitete Lebensmittel? Und Obst aus der Intensivlandwirtschaft ohne Bio- oder Fair-Trade-Siegel, höchstwahrscheinlich mit Pestiziden besprüht? Sind vielleicht auch Nüsse in diesen« – noch mehr Gehässigkeit – »Körben? Ich nehme es an, dieser Campus aber ist nussfrei. Und sagten Sie nicht was von Stofftieren? Völlig ausgeschlossen, dass ich Ihnen erlaube, billige, nicht biologisch abbaubare Spielsachen auf den Campus zu bringen.«
»Sie akzeptieren keine nicht biologisch abbaubaren Spielsachen?«, fragte der Fahrer. Er hatte jetzt eine Hand gegen das Armaturenbrett gestemmt, als müsste er sich abstützen, um nicht zusammenzubrechen.
Rowena atmete geräuschvoll aus. »Sir, hinter Ihnen warten jetzt schon einige Fahrzeuge. Sie können da gleich hinter dem Wachhaus wenden.« Sie zeigte auf den Wendehammer, auf dem sicherlich den ganzen Tag lang von Every unerwünschte Menschen, Lastwagen und Waren ihren Rückweg in die ungeprüfte Welt antraten. Der Fahrer starrte Rowena lange an, bevor er schließlich seinen Van startete und Richtung Wendehammer rollte.
Die Szene war in vielerlei Hinsicht merkwürdig, dachte Delaney. Schon allein der nicht zu Every gehörende Auslieferungsfahrer. Fünf Jahre zuvor hatte der Circle einen E-Commerce-Giganten aufgekauft, der nach einem südamerikanischen Dschungel benannt war. So war das reichste Unternehmen entstanden, das die Welt je gesehen hatte. Die Übernahme machte es erforderlich, dass der Circle seinen Namen in Every änderte, was den Unternehmensgründern einleuchtend und zwangsläufig erschien, da es Allgegenwart und Gleichheit suggerierte. Auch der E-Commerce-Riese war froh über einen Neuanfang. Man hatte den ehemals rationalen, ehemals verlässlichen Online-Marktplatz zu einer chaotischen Wüstenei von dubiosen Verkäufern, Produktfälschungen und offenem Betrug verkommen lassen. Das Unternehmen hatte alle Kontrolle und Verantwortung aus der Hand gegeben, woraufhin die Kunden sich nach und nach zurückzogen; niemand lässt sich gern betrügen oder täuschen. Als das Unternehmen den Kurs korrigierte, hatte es das Vertrauen der wankelmütigen Öffentlichkeit bereits verloren. Der Circle arrangierte eine Aktienübernahme, und der Gründer des E-Commerce-Giganten, zunehmend durch Scheidungen und Gerichtsverfahren abgelenkt, ließ sich nur allzu gern auszahlen. Zusammen mit seiner vierten Frau widmete er sich fortan der Erkundung des Weltraums, schließlich planten die beiden, ihren Lebensabend auf dem Mond zu verbringen.
Nach der Akquisition wurde ein neues Logo entworfen. Es bestand im Wesentlichen aus drei Wellen, die um einen vollkommenen Kreis wirbelten, und deutete das Strömen von Wasser an, das Aufblitzen neuer Ideen, Interkonnektivität, Unendlichkeit. Beliebt oder nicht, es stellte auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber dem früheren Logo des Circle dar, das an einen Gullydeckel erinnert hatte, und übertraf das langjährige Logo des E-Commerce-Giganten, ein verlogenes Grinsen, ohnehin. Da die Verhandlungen angespannt und schließlich feindselig verlaufen waren, war es jetzt, nach Abschluss der Fusion, unklug, den früheren Namen des E-Commerce-Unternehmens auf dem Campus zu benutzen. Falls es überhaupt erwähnt wurde, hieß es nur der dschungel, wobei das kleingeschriebene d Absicht war.
Der Circle war seit seiner Gründung im nahen San Vincenzo angesiedelt, doch eine zufällige Kette von Ereignissen brachte das Unternehmen nach Treasure Island, eine größtenteils künstlich angelegte Insel mitten in der San Francisco Bay – und eine Erweiterung der natürlichen Insel Yerba Buena. Auf der 1938 aufgeschütteten Landmasse hatte ursprünglich ein neuer Flughafen gebaut werden sollen. Doch nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs machte man die Insel zum Militärstützpunkt, und in den Jahrzehnten danach wurde der Flickenteppich aus Flugzeughangars allmählich in Werkstätten, Winzereien und bezahlbaren Wohnraum umgewandelt – mit atemberaubender Aussicht auf die Bucht, die Brücken und die Berkeley Hills. Dennoch, aufgrund des unbekannten militärischen (und mutmaßlich giftigen) Mülls, der unter dem meterdicken Beton begraben lag, zeigten große Bauträger kein Interesse an dem Areal. In den 2010er-Jahren aber handelten Spekulanten schließlich eine Risikominderung aus, und es wurden wunderbare Pläne entworfen. Ein neuer Hafen entstand, die Insel bekam eine U-Bahn-Station, und zum Schutz vor dem erwarteten Anstieg des Meeresspiegels in den folgenden Jahrzehnten wurde um das ganze Gelände herum eine ein Meter zwanzig hohe Mauer errichtet. Dann kamen die Pandemien, der Finanzfluss versiegte, und die Insel war zum Spottpreis zu haben. Der einzige Haken bestand in den kalifornischen Gesetzen, die verlangten, dass der Öffentlichkeit Zugang zum Uferbereich gewährt werden musste. Every ging erst diskret, dann öffentlich dagegen an, jedoch ohne Erfolg, sodass eine fünfeinhalb Meter breite Uferzone um die Insel herum für jeden zugänglich blieb, der dorthin gelangen konnte.
»Delaney Wells?«
Delaney fuhr herum und sah einen Mann Anfang vierzig vor sich stehen. Sein Kopf war kahl geschoren, und er hatte große braune Augen, die von einer randlosen Brille noch vergrößert wurden. Der Kragen seines schwarzen Reißverschluss-Shirts war hochgeschlagen, seine Beine steckten in einer engen grünen Jeans.
»Dan?«, fragte sie.
Seit den Pandemien galt Händeschütteln als hygienisch bedenklich – und aggressiv, wie viele fanden –, aber man hatte sich auf keine Ersatzbegrüßung einigen können. Dan entschied sich, einen imaginären Zylinder zu ziehen. Delaney verbeugte sich knapp.
»Gehen wir ein Stück?«, fragte er und schlüpfte an ihr vorbei durch das Tor. Er spazierte nicht auf den Campus, sondern hinaus auf den schmalen Uferstreifen von Treasure Island, der Every umgab.
Delaney folgte ihm. Sie hatte gehört, dass die meisten ersten Vorstellungsgespräche bei Every so abliefen. Um das Risiko auszuschließen, dass der Campus kontaminiert wurde, sollten weder Menschen noch biologisch nicht abbaubare Spielsachen, die nicht durchleuchtet worden oder ausdrücklich erwünscht waren, hereingelassen werden. Jede neue Person stellte ein Risiko dar, und da Bewerberinnen wie Delaney keine Sicherheitsfreigabe hatten und nicht gründlich überprüft worden waren – abgesehen von drei oberflächlichen KI-Screenings –, war es ratsam, das erste Gespräch außerhalb des Campus zu führen. Dan sagte jedoch etwas anderes.
»Ich muss auf meine Schritte kommen«, erklärte er und zeigte auf sein Oval, ein allgegenwärtiges Armband, das zahllose Gesundheitswerte maß und von sämtlichen Versicherern und den meisten Behörden verlangt wurde.
»Ich auch«, sagte Delaney und zeigte auf ihr eigenes Oval, das sie mit Inbrunst hasste, für ihre Tarnung aber unerlässlich war.
Dan Faraday lächelte. Delaney war sicher, dass die meisten Kandidaten alle möglichen Every-Produkte trugen. Das war keine Anbiederei. Es war ein obligatorischer Einsatz, ehe das Spiel begann. Dan signalisierte ihr, die Straße zu überqueren und die öffentliche Uferpromenade anzusteuern.
Verzeih mir, dachte Delaney. Von jetzt an ist alles gelogen.
II.
Fürs Erste war es Delaneys Aufgabe, Dan Faraday so unverschämt zu bezaubern, dass er sie für ein zweites, gründlicheres Bewerbungsgespräch empfahl. Danach würde es noch mindestens drei weitere geben. Manche Every-Beschäftigte, so hatte sie gehört, waren über einen Zeitraum von sechs Monaten zwölf Mal interviewt worden, bevor man sie einstellte.
»Wir können plaudern und uns ein bisschen umschauen«, sagte Dan. Seine Augen waren freundlich, klar, scheinbar unfähig, etwas anderes auszustrahlen als bedächtige Ruhe. »Wenn du unterwegs einen Imbiss siehst, wo du etwas essen oder trinken möchtest, können wir eine Pause machen und uns setzen.«
In der Umgebung vom Every-Campus hatte sich eine Reihe von anscheinend privat geführten Läden angesiedelt, in denen die Touristen einkauften, die wegen der spektakulären Aussicht gekommen waren. Das Ganze sah aus wie eine hastig zusammengezimmerte Filmkulisse. Es gab ein dämmrig beleuchtetes, menschenleeres Architekturbüro, einige bunt dekorierte, aber wie ausgestorben wirkende Konditoreien und vegane Eiscafés. Die Straßen waren größtenteils leer, bis auf das ein oder andere Duo, das genauso aussah wie Delaney und Dan: Every-Beschäftigte – genannt Everyones –, die sich mit potenziellen neuen Kollegen – genannt Möchtegern-Everyones – unterhielten.
Delaney, die sonst selten nervös wurde, war aufgeregt. Über Jahre hinweg hatte sie gezielt und mit akribischer Sorgfalt ihr Profil, ihr digitales Selbst aufgebaut, aber es gab so viele Dinge, von denen sie nicht wusste, ob sie sie wussten. Außerdem, und das machte ihr noch mehr zu schaffen, war sie auf dem Weg zum Campus geshamt worden. Auf dem U-Bahnsteig hatte sie eine Verpackung fallen lassen, und bevor sie sie aufheben konnte, hatte eine ältere Frau das Vergehen mit ihrem Smartphone gefilmt. Die Erfindung und Verbreitung von Samaritan, einer Standard-App auf Everyphones, und einer wachsenden Mehrheit von anderen Tech-Innovationen wurde angetrieben durch eine Mischung aus gut gemeintem Utopismus und pseudofaschistischer Verhaltenskonformität. Millionen Shams – eine krude Verschmelzung von Samaritan und shame – wurden täglich gepostet, prangerten rücksichtslose Autofahrer an, laute Stöhner in Fitnessstudios, Vordrängler in Louvre-Warteschlangen, Benutzer von Wegwerfplastik und unbekümmerte Eltern, die ihre Kinder in der Öffentlichkeit weinen ließen. Geshamt werden war nur dann ein Problem, wenn du identifiziert und getaggt wurdest, das Video oft geteilt und kommentiert wurde und deine Sham-Bilanz in inakzeptable Höhe trieb. In diesem Fall aber konnte es dich dein Leben lang verfolgen.
»Zunächst mal, herzlichen Glückwunsch, dass du hier bist«, sagte Dan. »Nur drei Prozent der Bewerber schaffen es so weit. Du kannst dir ja denken, dass die KI-Screenings sehr streng sind.«
»Absolut«, sagte Delaney und zuckte innerlich zusammen. Absolut?
»Dein Lebenslauf hat mich beeindruckt, und mir persönlich gefällt, dass du Libarts studiert hast«, sagte Dan. Libarts. Entweder hatte Dan diesen Terminus für Geisteswissenschaften erfunden, oder er versuchte, ihm zum Durchbruch zu verhelfen. Als wäre er unsicher, wie die Neuschöpfung ankam, zupfte er an der Schlaufe seines Shirt-Reißverschlusses. »Wie du weißt, stellen wir ebenso viele Geisteswissenschaftler ein wie Techniker. Alles, um neue Ideen in die Welt zu bringen.« Er ließ den Reißverschluss wieder los. Das war anscheinend seine Art, die Luft anzuhalten. Während er einen Satz formulierte und aussprach, hielt er den Reißverschluss fest; wenn er ihm ganz passabel über die Lippen gekommen war, entspannte er sich und ließ den Reißverschluss los.
Delaney wusste, dass Every auch sehr viele Nichttechniker beschäftigte, und verließ sich darauf. Dennoch, sie hatte sich große Mühe gegeben, um selbst in ihrer mathe-schwachen Gruppe positiv aufzufallen.
Vor zwei Jahren war Delaney nach Kalifornien gezogen und hatte in einem Start-up namens Ol Factory angefangen, das sich vorgenommen hatte, Computerspiele um Gerüche zu bereichern. Das erfolgreichste Release, Stench of War!, brachte die Gerüche von Diesel, Staub und verwesendem Fleisch in Jungenzimmer weltweit. Delaney ging richtigerweise davon aus, dass Ol Factory darauf spekulierte, von Every gekauft zu werden, und als dieser Deal achtzehn Monate später über die Bühne ging, wurden die Gründer, Vijay und Martin, ebenfalls von Every übernommen, ohne irgendetwas zu tun zu bekommen. Da Delaney noch relativ neu bei Ol Factory gewesen war, wurde sie nicht automatisch übernommen, Vijay und Martin aber waren entschlossen, jeder und jedem bei Ol Factory ein Every-Bewerbungsgespräch zu verschaffen, falls das gewünscht war.
»Dein beruflicher Hintergrund und deine Ansichten sind wirklich genau das, wonach wir suchen«, sagte Dan. »Du bist widerständig, und genau das möchten wir auch sein.« Widerständig war ein seit Neustem beliebtes Wort. Es hatte rebellisch verdrängt, das aufsässig verdrängt hatte, das Störung/Störer verdrängt hatte. Dan hielt wieder die Reißverschlussschlaufe in den Fingern. Es war, als wollte er ihn komplett aufziehen, sich von seinem Shirt befreien, wie ein kleiner Junge, den sein kratziger Pullover juckt.
Sie kamen an einem Laden vorbei, der allem Anschein nach Haushaltswaren verkaufte und auch tatsächlich hübsch arrangierte Haushaltswaren im Schaufenster ausstellte, in dem aber weder Kunden noch Personal zu sehen waren.
»Das habe ich an Every immer bewundert«, sagte Delaney. »Ihr habt eure Flagge auf dem Titan gehisst, während alle anderen noch mit dem Mond liebäugelten.«
Dan wandte ihr den Kopf zu, und Delaney wusste, dass sie einen Treffer gelandet hatte. Bewundernd sah er sie aus seinen warmen Augen an, doch dann verengten sie sich, kündigten den Wechsel zu ernsteren Themen an.
»Wir haben deine Abschlussarbeit gelesen«, sagte er.
Delaneys Gesicht wurde für einen Moment heiß. Obwohl die Abschlussarbeit das A und O ihrer Bewerbung war und mit Sicherheit der Hauptgrund, warum sie zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden war, hatte sie nicht damit gerechnet, so schnell darauf zu sprechen zu kommen. Sie war davon ausgegangen, dass das erste Gespräch lediglich eine Art Plausibilitätstest sein würde.
Sie hatte ihre Abschlussarbeit über die Absurdität von Kartellverfahren gegen den Circle geschrieben, denn die Frage, ob der Konzern eine Monopolstellung hatte oder nicht, war irrelevant, solange er den Menschen das bot, was sie wollten. Sie prägte den Begriff Menschenfreundliche Marktbeherrschung für die nahtlose Symbiose zwischen Unternehmen und Kunde und damit den perfekten Seinszustand des Konsumenten, in dem sämtliche Wünsche effektiv und zu Niedrigstpreisen bedient wurden. Das zu bekämpfen, lief dem Willen des Volkes zuwider, und was hatte es für einen Sinn, wenn Regulierungsbehörden im Widerspruch zu den Wünschen der Bevölkerung standen? Delaney postulierte, dass einem Unternehmen, das alles weiß und alles am besten weiß, doch wohl erlaubt werden sollte, das Leben der Menschen ungehindert zu verbessern. Sie sorgte dafür, dass der Text online veröffentlicht wurde. Er wurde, wie sie erfuhr, in mehreren internen Threads der Every-Belegschaft erwähnt und kurz, aber an wichtiger Stelle, in einem seltenen EU-Urteil zitiert, das zugunsten von Every ausfiel.
»Die Hauptpunkte, die du da formuliert hast, sind bei uns viel diskutiert worden«, sagte Dan. Er war stehen geblieben. Delaney staunte, wie schnell ihre Achselhöhlen zu Feuchtgebieten werden konnten. »Du hast Dinge geschrieben, die wir natürlich für wahr halten, aber nicht so überzeugend in Worte fassen konnten.«
Delaney lächelte. Every war für die Verbreitung der Ideen der Welt – in Form von Worten, Audios, Videos und Memes – von entscheidender Bedeutung, und doch hatte das Unternehmen keine Ahnung, wie es sich gegenüber Regierungen, Regulierungsbehörden und Kritikern erklären sollte. Die Every-Führungsriege, besonders seit dem erzwungenen Halbruhestand von Eamon Bailey, ehemals Marktschreier und Prediger in Personalunion, verhielt sich fortwährend unsensibel, arrogant und gelegentlich geradezu beleidigend. Sie hatten nie den Eindruck erweckt, irgendeinen Kartellrechtsverstoß zu bedauern oder durch die eventuell verderbliche oder Schäden verursachende Nutzung ihrer Produkte zur Einsicht gebracht zu werden. Der Circle hatte jeden Tag millionenfachen Hass verbreitet, was zu unsäglichem Leid und zahllosen Todesfällen geführt hatte; er hatte zum Niedergang der amerikanischen Demokratie beigetragen, und als Reaktion darauf Ausschüsse gebildet, in denen das Problem diskutiert wurde. Das Unternehmen optimierte Algorithmen. Es verbannte bekannte Hassprediger und stellte schlecht bezahlte Moderatoren in Bangladesch ein.
»Wie du unsere Kartellrechtsprobleme aus historischer Perspektive betrachtet hast«, fuhr Dan fort, »das war sehr erhellend, selbst für jemanden wie mich, der ich von Anfang an dabei bin.« Seine Stimme war wehmütig geworden. »Du hast einen sehr wachen Verstand, und genau danach suchen wir hier.«
»Danke«, sagte Delaney und schmunzelte in sich hinein. Genau danach suchen wir hier.
»Wie hat deine Professorin die Arbeit bewertet?«, fragte Dan.
Sie dachte mit einem jähen Bedauern an ihre Professorin, Meena Agarwal. Delaney hatte ihr Seminar »Freie Dinge > Freier Wille« im dritten Semester belegt und war unter Agarwals massivem Einfluss zu der Überzeugung gelangt, dass der Circle nicht nur eine Monopolstellung innehatte, sondern auch das skrupelloseste und gefährlichste Unternehmen war, das es je gab – eine existenzielle Bedrohung für alles Ungezähmte und Faszinierende der menschlichen Spezies.
Als Delaney zwei Jahre später Agarwal bat, ihre Arbeit zu betreuen, sagte die bereitwillig zu, war aber entsetzt, als Delaney ihre 77 Seiten starke Abhandlung über die unternehmensfeindliche Torheit der Reglementierung des Circle abgab. Agarwal hatte Delaney eine Eins gegeben. »Ich habe mich wegen der sorgfältigen Argumentationsführung und Recherche für diese Note entschieden«, schrieb sie, »aber mit tiefen moralischen Vorbehalten gegen Ihre Schlussfolgerungen.«
»Ich war zufrieden«, sagte Delaney.
Dan lächelte. »Gut. Dann gibt es in der akademischen Welt noch immer etwas Respekt für intellektuelle Unabhängigkeit.«
Sie bogen um eine Ecke und wären fast in ein anderes erstes Bewerbungsgespräch geraten. Eine elegante junge Everyone ging neben einem mindestens fünfzigjährigen Mann her, der krampfhaft versuchte, dynamischer und unverzichtbarer zu wirken, als sein Alter vermuten lassen könnte. Sein Brillengestell war orange, sein Button-down-Hemd glänzend schwarz, seine Sneaker neu und neongrün. Die Interviewerin war eine schlanke junge Frau in silbrigen Leggings, und Delaney war sicher, dass sich die Augen der Frau, als sie Dan erblickte, eine Mikrosekunde in gespielter Verzweiflung weiteten.
»Das Alter der Bewerber spielt für uns keine Rolle«, sagte Dan, und Delaney fragte sich, ob er sie mit ihren zweiunddreißig Jahren als jemanden sah, der eine Art Anti-Altersdiskriminierungsquote erfüllte. »Ältere Kandidatinnen und Kandidaten können aus so viel Lebenserfahrung schöpfen«, sagte er und ließ den Blick über Delaneys Schultern gleiten, als ob ihre Lebenserfahrung genau dort zu finden sei.
»Sieh mal«, sagte er und führte Delaney zu einem Spielplatz, der nach einem Entwurf von Yayoi Kusama angelegt und von Every bezahlt worden war. Erwachsene willkommen! stand auf einem Schild und darunter in Klammern: Nur in Begleitung eines Kindes. Delaney überflog das Kleingedruckte, das erklärte, wie wichtig PLAY! (immer mit Ausrufungszeichen) für die Kreativität von Erwachsenen war.
PLAY! war der Name der aktuell vorherrschenden Managementtheorie und folgte damit auf Trends wie Multitasking, Singletasking, Ausdauer, Aus-Fehlern-Lernen, Powernapping, Cardio-Training, Nein-Sagen, Ja-Sagen, Weisheit der Vielen > Bauchgefühl, Bauchgefühl > Weisheit der Vielen, die Viking-Management-Theorie, die Commissioner-Gordon-Workflow-Theorie, X-Teams, B-Teams, Einfachheit schätzen, Komplexität anstreben, Zemblanität suchen, Kreativität durch radikalen Individualismus, Kreativität durch Gruppendenken, Kreativität durch Ablehnung von Gruppendenken, organisatorische Achtsamkeit, organisatorische Blindheit, Mikroarbeit, Makroträgheit, angstvolle Kameradschaft, liebevolle Kameradschaft, liebevoller Terror, Arbeiten im Stehen, Arbeiten im Gehen, Lernen im Schlaf und, zuletzt, Limetten.
»Wie war es so bei Ol Factory?«, fragte Dan und setzte sich auf einen übergroßen Gummipilz. Delaney setzte sich ihm gegenüber auf ein Lama aus recycelten Plastikfasern. Delaney wusste, dass der größte Fehler, den sie jetzt machen konnte, der wäre, ihre früheren Chefs zu kritisieren. »Es war unvergleichlich«, sagte sie. Sie hatte gehört, dass das Wort unvergleichlich bei Every beliebt war. »Sie haben mich sehr gefördert. Ich habe jeden Tag eine neue Welt kennengelernt.« Eine neue Welt kennengelernt. Diese Formulierung hatte sie noch nie benutzt. Aber als sie zu Dan hinüberschaute, sah sie, dass er sie zu befürworten schien.
»Ich fand die Akquisition gut«, sagte Dan. »Der Preis war hoch, aber das Talent war …« Delaney vermutete, dass er normalerweise unvergleichlich gesagt hätte, aber das Wort hatte sie ihm geklaut. Er fand eine Alternative: »… herausragend. Was denkst du über den Übernahmepreis?«
»Talent ist teuer«, sagte sie, und er lächelte. Es war die einzig richtige Antwort, denn die Zahlen entbehrten jeder Logik. Every hatte Ol Factory, ein drei Jahre altes Start-up, das mit seinen zweiundzwanzig Beschäftigten keinen Gewinn erwirtschaftete, für knapp unter zwei Milliarden Dollar gekauft.
»Gut gesagt«, antwortete Dan.
Anscheinend machte eine Firmenübernahme für Tech-Käufer oder -Verkäufer keinen Sinn, wenn der Preis nicht mindestens eine Milliarde betrug. Delaney hatte ein Auge auf Ol Factorys Umsätze gehabt, und ihres Wissens hatte das Unternehmen in der gesamten Dauer seines Bestehens nicht mehr als 23 Millionen Dollar eingenommen. Dennoch hatte Every 1,9 Milliarden Dollar bezahlt. Ganz ähnlich verhielt es sich mit dem unprofitablen Kopfhörerhersteller, der 1 Milliarde gekostet hatte, der unprofitablen VR-Firma, die 2,8 Milliarden gekostet hatte, sowie der unprofitablen Gewaltfreies-Gaming-Firma, die 3,4 Milliarden gekostet hatte. Die Preise schienen eigentlich nur auf der Rundheit der Zahlen und auf einer herrlichen logischen Volte zu basieren: Wenn du eine Milliarde zahltest, war es auch eine Milliarde wert – eine kühne Vorstellung, die die Lehren aus tausend Jahren Geschäftsbuchhaltung im Handumdrehen vergessen machte.
»Ich habe Vijay und Martin noch nicht kennengelernt«, sagte Dan. Er schaukelte jetzt, und Delaney merkte, dass der Pilz einen biegsamen Stiel hatte. Sie fragte sich, ob ihr Lama ähnlich flexibel war. Sie versuchte es. Vergeblich.
»Ich glaube, sie sind in der Romantik«, sagte er und deutete vage in Richtung Campus. Irgendwo dort hockten Vijay und Martin. Delaney mochte die beiden sehr und vermutete, dass sie jetzt unglücklich waren, so wie jedes Gründerteam, das seine Firma verkauft hatte, und dass sie es auch während der vereinbarten fünfjährigen Sperrfrist bleiben würden. Danach würden sie sich vom Acker machen, um Familienstiftungen zu gründen.
Doch die milliardenschweren Akquisitionen sorgten dafür, dass die Technologiewelt weiterlebte und weiterträumte, und die cleversten Unternehmer waren diejenigen, die erkannten, dass es sehr viel leichter und sehr viel logischer war, sich auf eine Übernahme durch Every einzustellen, als entweder auf eigene Faust Profit machen zu wollen – sisyphusmäßiger Irrwitz – oder den tückischen und unberechenbaren Weg eines Börsengangs einzuschlagen.
»Ich weiß, deine Stellenbezeichnung hat sich ein paarmal geändert, deshalb wüsste ich gern mehr über deine Aufgaben bei Ol Factory. Muss nicht unbedingt chronologisch sein«, sagte Dan. »Darf ich?« Er stand auf und deutete an, dass er auf Delaneys Lama wechseln wollte. Delaney verließ ihr Lama und nahm seinen Pilz-Platz ein. »Sie waren amorph«, sagte sie und sah jähe Bewunderung in Dans Augen aufblitzen. Noch so ein Wort, das ihm gefiel. Er war leichtes Spiel, erkannte sie. Jahrelang hatte Every durch seine AutoFill-Algorithmen Tausende Wörter verdrängt und stets die wahrscheinlichsten den weniger verbreiteten vorgezogen, was den unerwarteten Effekt gehabt hatte, dass ganze Bereiche der englischen Sprache nahezu obsolet geworden waren. Wenn ein Wort wie amorph verwendet wurde, war das Ohr eines Everyones überrascht, als hörte es ein schwach vertrautes Lied aus einer fast untergegangenen Zeit.
Delaney schilderte ihren Werdegang bei Ol Factory. Sie hatte mehr oder weniger als Executive Assistant angefangen und war danach eine Zeit lang Office Manager genannt worden, obwohl sich an ihrer Tätigkeit im Grunde nichts änderte, da sie nach wie vor alles umfasste. Sie organisierte die Verpflegung der Beschäftigten, kümmerte sich um die Instandhaltung der Räumlichkeiten, beauftragte die Gärtner und gab ihnen Anweisungen. Sie arrangierte jedes Event, von zwanglosen Meetings der Belegschaft über Geschäftsausflüge nach Presidio bis hin zu Martins Hochzeit auf dem Gipfel des Mount Tamalpais (für die sie ein Team Paraglider engagieren musste, die bereit waren, in Smokings zu fliegen). Das alles erklärte sie Dan mit absoluter Offenheit, aber in der Hoffnung, ihm unmissverständlich klarzumachen, dass sie nicht vorhatte, bei Every Partys zu planen und sich ums Catering zu kümmern.
»Ich habe auch Bewerbungsgespräche mit Bewerbern geführt«, bemerkte sie. »Bloß die ersten Plausibilitätstests.« Sie lächelte Dan vielsagend an, hoffte, dass ihm diese Anspielung auf gemeinsame Aufgaben gefiel.
Er lächelte zurück, aber nur flüchtig. Sie hatte einen wunden Punkt getroffen. Und sie hatte zuvor schon wunde Punkte getroffen. Bei den Everyones, die sie kennengelernt hatte, sechs oder sieben, die ihr in Bars oder bei Abendessen vorgestellt worden waren, handelte es sich ausnahmslos um normale Menschen. Sie waren allesamt idealistisch, sehr oft herausragend auf ihrem Gebiet, und die meisten von ihnen waren imstande, offen über ihre Arbeit und ihr Leben zu reden. Aber bei jedem Einzelnen von ihnen gab es eine Grenze, die nicht überschritten wurde. So konnte sie mit ihnen zwanzig Minuten lang angeregt über die vielen fragwürdigen und lächerlichen Aspekte ihres Lebens bei Every oder über die mitunter positiven, doch meistens fatalen Auswirkungen des Konzerns auf die Welt plaudern, doch gerade wenn Delaney das Gefühl hatte, dass dieser Everyone wirklich sagen und denken konnte, was er wollte, ging irgendein Thema, irgendein Satz zu weit, und der neue Every-Freund nahm eine förmlichere, defensivere Haltung ein. Das Wort Monopol wurde nicht ausgesprochen. Kool-Aid blieb ungesagt. Jeder Vergleich, selbst scherzhaft und im beschwipsten Zustand, von Jim Jones oder David Koresh oder Keith Raniere mit Eamon Bailey – dem Mitgründer des Circle – wurde als geschmacklos und nicht mal annähernd zutreffend eingestuft. Jede Erwähnung von Stenton, einem anderen der Drei Weisen des Circle, der Every verlassen hatte, um eine unheilige Allianz mit einem öffentlich-privaten Unternehmen in China einzugehen, verdarb unwiderruflich jedes Gespräch. Was über Mae Holland, die derzeitige CEO von Every, gesagt werden durfte, war schwer abzuschätzen.
Mae hatte vor zehn Jahren im Kundenservice des Circle angefangen und war kurz darauf zur ersten vollkommen transparenten Mitarbeiterin geworden, die ihre Tage und Nächte streamte, und da sie dem Unternehmen gegenüber vollkommen loyal war und außerdem jung und attraktiv und einigermaßen charismatisch, machte sie mit verblüffender Geschwindigkeit Karriere. Ihre Kritiker fanden sie langweilig und viel zu vorsichtig. Ihre Fans – sehr viel zahlreicher – hielten sie für achtsam, respektvoll ambitioniert, inklusiv. Beide Seiten aber waren sich in einem Punkt einig: Sie hatte dem Unternehmen in all den Jahren keine bedeutsame neue Idee gebracht. Selbst nach der Fusion mit dem dschungel schien sie sich verwirrt zu fragen, was das alles eigentlich bedeutete und wie die Unternehmen mit größtmöglichem Gewinn miteinander verbunden werden konnten.
»Wie viele Leute waren bei Ol Factory?«, fragte Dan.
Delaney wusste, dass er die Zahl kannte. Sie wusste auch, dass sie, falls sie nicht die genaue Zahl nannte, als jemand dastehen würde, dem nichts an seinen Kolleginnen und Kollegen lag oder der nicht zählen konnte.
»Zweiundzwanzigeinhalb«, sagte sie. »Wir hatten einen frischgebackenen Dad, der zum Zeitpunkt der Übernahme nur halbtags gearbeitet hat.«
»Die hatten da eine gute Work-Life-Balance, findest du nicht?«, fragte Dan. Er zupfte wieder an seinem Reißverschluss.
Delaney erzählte ihm von den vielen Tagen, an denen sie draußen Mittagspause gemacht hatten, von den dreimal im Jahr stattfindenden Betriebsausflügen (die sie geplant hatte), dem besonders warmen Freitag im Juni, an dem Vijay und Martin alle an den Strand in Pacifica geschickt hatten.
»Das gefällt mir«, sagte Dan. »Aber nachdem du in so einem kleinen Laden angefangen hast – denkst du, du wirst dich in einem so viel größeren Unternehmen wie Every wohlfühlen? Uns geht es auch um eine gewisse Absorptionsfähigkeit.«
»Da bin ich mir ganz sicher«, sagte sie. Absorptionsfähigkeit. Sie dachte an die Menschen, die Everyones, die absorbiert worden waren, erfolgreich oder auch nicht.
In den letzten drei Jahren hatte es auf diesem Every-Campus neunzehn Selbstmorde gegeben, was die globale Zunahme an Suiziden widerspiegelte, doch niemand wollte darüber reden – hauptsächlich, weil offenbar niemand bei Every den Grund dafür kannte oder wusste, wie sich diese Welle aufhalten ließ. Selbst die Zahl Neunzehn war umstritten, denn es gab keine Lokalnachrichten, keine Journalisten – sie alle waren von Social Media, der Werbe-Apokalypse und vor allem vom Krieg gegen die Subjektivität hinweggefegt worden. Somit wurde alles, was über die Todesfälle bekannt war, entweder aus Gerüchten zusammengestückelt oder aus rasch unterdrückten Berichten von Leuten, die hier und da an der Bucht eine angeschwemmte Leiche gesehen hatten. Denn das war die typische Methode, mit der Everyones ihrem Leben ein Ende setzten – sie warfen sich in die permanent steigenden Fluten.
»Ich muss zugeben«, sagte Delaney, »ich habe geahnt, dass Ol Factory früher oder später übernommen werden würde, deshalb hatte ich Zeit, mir zu überlegen, ob ich hierherkommen wollte. Natürlich bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich genommen werde. Aber ich hatte Zeit, darüber nachzudenken und mir auszumalen, wie es wäre.«
Delaney hatte die Absicht, dieses Unternehmen zu vernichten. Sie hatte jahrelang auf die Chance gewartet, für Every zu arbeiten, in das System einzudringen, um es zerschlagen zu können. Ihre College-Abschlussarbeit war der Auftakt zu ihrem Sabotageplan gewesen. Schon da hatte sie gewusst, dass sie für Every wie eine Verbündete wirken musste, eine Schwester im Geiste, die sie gern in ihre Mitte aufnehmen würden. Sobald sie drin war, wollte Delaney die Maschinerie genau unter die Lupe nehmen, nach Schwachstellen suchen und den ganzen Laden in die Luft jagen. Sie würde den Konzern snowden, sie würde ihn manningen. Sie würde ihn ausspionieren und dann deep-throaten. Ihr war egal, ob mit der kultivierten, verdeckten Infodump-Methode, die ihre Vorgänger angewendet hatten, oder mit einem Frontalangriff. Sie hatte nicht die Absicht, irgendwen zu verletzen, würde kein reales Haar krümmen, trotzdem würde sie Every den Garaus machen, seine bösartige Herrschaft auf Erden beenden.
Dan stieg vom Lama und checkte wieder sein Oval. Er begann, auf der Stelle zu traben, wurde immer schneller, bis er eine verschwommene Gestalt aus Knien und Fäusten war. Das ging zwei Minuten so, nicht länger, denn schließlich ertönte ein fröhliches Geräusch aus seinem Oval, und er stoppte. »Sorry«, sagte er keuchend zu Delaney. »Ich hab’s meiner Frau versprochen. Deshalb lebe ich jetzt vegan und mache Cardio-Training, wenn das Oval sagt, dass der Zeitpunkt optimal ist. Sie ist letztes Jahr gestorben.«
»Oh Gott. Das tut mir sehr leid«, sagte Delaney.
»Hast du in letzter Zeit ein MRT machen lassen?«
Hatte sie nicht. Dan hatte einen Ärmel hochgeschoben und zeigte ihr sein Handy, das er am Unterarm trug – eine beliebte neue Variante. Er scrollte, so schien es, durch Tausende Videos derselben Frau in einem Haus mit hellen Böden, in einer Hängematte an einem grünen Hang, in einem Rosengarten kniend. Sie sah viel zu jung aus, um tot zu sein.
»Das ist Adira«, sagte er, während die Thumbnails vorbeiglitten. Er schien zu überlegen, welches Video er Delaney zeigen sollte, einer Person, die er gerade erst kennengelernt hatte. »Sie war schon im Stadium IV, als der Tumor entdeckt wurde«, sagte er und blickte hoch Richtung Bay Bridge, wo ein winziges Auto das Sonnenlicht reflektierte, während es lautlos gen Westen fuhr. »Jedenfalls. Sie hat mir das Versprechen abgenommen, dass ich gesundheitsmäßig vorbeuge. Ich rate dir dringend, das auch zu tun.«
»Mach ich«, sagte Delaney völlig überrumpelt. Dan, da war sie sicher, sorgte sich um sie, und das fühlte sich an wie eine grausame Masche.
Er scrollte weiter. Delaney betete, dass er kein Video aussuchen, dass er sie nicht bitten würde, es sich anzuschauen. Doch er tat es.
»Sie war eine gute Läuferin«, sagte er, und Adira wurde auf dem Display lebendig. Sie hatte offensichtlich gerade einen Marathon beendet und stand japsend da, die Arme über dem Kopf gekreuzt, lächelnd, mit der Startnummer 544 auf ihrem Tanktop. Einen Moment lang dachte Delaney, der Ton wäre aus und sie würde Adiras Stimme nicht hören müssen.
»Sorry«, sagte Dan und stellte lauter.
»Hab ich das wirklich geschafft?«, keuchte Adira lächelnd.
»Hast du«, antwortete eine Stimme aus dem Off. Es war Dans. Er klang unheimlich stolz. »Du hast es geschafft, mein Engel«, dann war der Clip zu Ende.
Dans Finger tippten aufs Display, er scrollte erneut, suchte nach weiteren Momenten in Adiras Leben, die er ihr zeigen wollte. Er schien alles dazuhaben, alles, was Adira ausmachte, an seinen Arm geschnallt, und Delaney stand neben ihm, sah zu, wie er suchte und suchte.
III.
»Ich kann’s nicht«, sagte Delaney.
»Wieso?«, fragte Wes. »Weil seine Frau gestorben ist?«
»Ja. Unter anderem.«
»Hat er gefragt, ob du ruderst?«
Das passierte ihr häufig. Es hatte irgendwas mit ihrer Größe, ihren Schultern zu tun. Die Leute fragten, ob sie ruderte oder Volleyball spielte, manchmal auch Basketball. Sie war mindestens zehn Zentimeter größer als Wes, eine Tatsache, die ihm nichts auszumachen schien, ihm offenbar nicht mal auffiel. Er hatte es nie erwähnt.
»Nein«, sagte Delaney. »Er hat einfach nur ganz normal gewirkt. Wie ein normaler Mensch. Damit hatte ich nicht gerechnet.«
»Wir haben über diese Möglichkeit gesprochen. Dass du manche Leute dort mögen könntest«, sagte Wes. »Bist du so weit?«
Wes Makazian tauchte in der Tür auf, drahtig, knochig und o-beinig, und mit seinem sandfarbenen Haar – eigentlich eher ein Gestrüpp – erinnerte er an einen Viehdieb aus dem neunzehnten Jahrhundert. Seine Augen waren klein und hell, Mund und Zähne ulkig überdimensioniert. Wenn er lächelte, sah er aus wie ein kleiner, aber glücklicher Wal.
»Siehst du?«, sagte er. »Ich bin so weit.«
Er zog es normalerweise vor, keine langen Hosen oder Schuhe zu tragen, und verbrachte die meisten Tage – Wochen – in Shorts mit Kordelzug und einem Logo der Utah Jazz, einer Mannschaft, der er sich nicht verbunden fühlte. Außerdem liebte er ein bestimmtes T-Shirt, auf dem das Konterfei von Olof Palme prangte, dem ermordeten schwedischen Ministerpräsidenten, und weil das Gesicht des Toten außerdem Wes’ kleinen Kugelbauch kaschierte, hatte er gleich acht Stück davon gekauft und war nur selten in irgendwas anderem zu sehen.
»Ist es kalt draußen?«, fragte Delaney.
»Ist es kalt draußen?«, wiederholte Wes. Er trug einen Hoodie unter seinem Palme-Shirt. Wes und Olof wandten sich dem Hund zu. »Sie lebt in Ocean Beach und will wissen, ob es draußen kalt ist.«
Hurricane, Wes’ mittelalter Hund, sah mit flehenden Augen zu Delaney hoch. Sie konnte innerhalb von Minuten ausgehfertig sein, Wes und Hurricane jedoch waren niemals nicht ausgehfertig. Delaney nahm einen Pullover und streifte ihn sich über den Kopf.
»Bitte zieh nicht noch die Sneaker an«, sagte Wes.
Ihr dabei zuzusehen, wie sie sich die Schuhe zuband, löste bei Wes und insbesondere bei Hurricane einen schier unerträglichen Leidensdruck aus. Sobald sie damit anfing, wandte sich Wes ab und Hurricane tänzelte im Kreis, wobei seine Krallen wie Steppschuhe auf dem weiß getünchten Boden klackerten.
»Wie wär’s mit Sandalen?«, schlug er vor. »Oder Schuhen mit Klettverschluss?«
Delaney ließ ausnahmsweise den Doppelknoten weg.
»Zufrieden?«, fragte sie.
Sie zogen die Tür zu und gingen am Fenster des Haupthauses vorbei. Wes’ Mutter, Gwen, saß in der Küche und machte für irgendwen die Steuern. Sie blickte nicht auf.
Wes und Delaney wohnten in einem kleinen Hinterhaus nahe des Pazifiks, das sie die Seehütte nannten. Die Bay Area war zu einer grotesk unbezahlbaren Gegend geworden, in der Vermieter aberwitzige Preise verlangten und jede Forderung fast unweigerlich von neuem und naivem Geld erfüllt wurde.
Hier und dort jedoch waren noch Überbleibsel des alten San Francisco zu finden – kleine Dachgeschosswohnungen, umgebaute Garagen, zugige Cottages in den Gärten alternder Hippies, die sich weigerten, junge Mieter über den Tisch zu ziehen. Delaney hatte so eine Unterkunft mitten in Outer Sunset gefunden. Das Cottage, nicht weit vom Fischrestaurant Doelger Fish Co und auf ewig von dessen Geruch durchdrungen, wurde komplett möbliert samt Waschtrockner und einem sechsunddreißigjährigen Mann namens Wes vermietet. Das Haupthaus gehörte Wes’ Mutter Gwen und ihrer Frau Ursula. »Ich wohne bei meinen Moms«, hatte er ihr erklärt, bevor sie einzog – ein Satz, den sie seitdem hundertmal aus seinem Mund gehört hatte.
Als sie auf die Straße traten, rief Gwen ihnen von der Haustür aus hinterher: »Limonade, bitte.« Erst kürzlich hatte ein Verkäufer einen Stand auf der Strandpromenade aufgemacht, an dem er selbst gemachte Limonade anbot. Es würde nicht lange dauern, bis das Gesundheitsamt ihn wieder vertrieb, aber bis dahin würden die Moms Wes stets bitten, ihnen welche mitzubringen. Gwen winkte Delaney.
»Geh nicht hin«, sagte Wes.
»Hi, Gwen«, sagte Delaney.
»Weitergehen«, sagte er. »Sonst sind wir noch eine Stunde hier. Hi, Mom!«
Delaney verstand sich blendend mit Gwen und Ursula, aber die beiden wussten sie nicht recht einzuordnen. Sie hatten so manches Gerücht gehört und neigten daher zu der Annahme, dass ihre Beziehung zu Wes nicht unbedingt keuscher Natur war. Sie nickten brav, wenn Delaney ihnen sagte, dass Wes und sie nur gute Freunde seien, aber es war offensichtlich, dass sie etwas anderes vermuteten. Sie vertrauten wenigen Menschen und noch weniger Systemen. Deshalb lebten sie in einem Trog-Haus und auch deshalb sah Gwen ihre Arbeit als Steuerberaterin als eine Form von sozialem Protest; ihre Mandanten sollten fair behandelt werden.
Rose, die Postbotin, kam dazu. Delaney grüßte sie und ging weiter. Sie wusste, dass Rose und Gwen die Post völlig vergessen und über ihre Gärten reden würden. Genau das, das nutzlose Plaudern im Dienst, gehörte zu den Dingen – und davon gab es sehr viele –, die Anti-Trogs fast um den Verstand brachten. Die Ineffizienz, die Undurchsichtigkeit, die Verschwendung. Nichts war für sie so unwirtschaftlich und unsinnig wie die Post. Das ganze Papier. Das ganze verlorene Geld, die zigtausend unnötigen Jobs, Lastwagen, Flugzeuge, gefällten Bäume, das ganze CO2. Nachdem Mae Holland die Nutzung von Bargeld und Papier und Papierprodukten unterbunden hatte (sie hatte bislang ein Dutzend Papierfabriken gekauft, nur um sie zu schließen), sah sie es jetzt als ihre Mission, die Institution der Post abzuschaffen, die heilige Kuh aller Trogs.
Trog war ein Terminus mit subjektiven Konnotationen. Ursprünglich als Beleidigung für Tech-Skeptiker gedacht, machten sich diese Skeptiker die Bezeichnung zu eigen und trugen sie stolz, und schon bald wurde es von beiden Seiten benutzt, um alles zu bezeichnen, das sich der unumschränkten Machtübernahme der Technologie widersetzte. In der Seehütte gab es keine smarten Geräte, nichts, was ständig (oder problemlos) mit dem Internet verbunden war. Wenn Delaney und Wes wollten, konnten sie über Satellit online gehen, aber stets mit einem manischen Augenmerk auf Sicherheit und Anonymität. Diese Lebensweise war immer seltener und in vielerlei Hinsicht sehr viel teurer geworden. Die Versicherungsraten für Trog-Häuser waren unweigerlich höher, und seit gut zehn Jahren gab es Bestrebungen, Trog-Wohnungen ganz zu verbieten. Nachdem Every-Lobbyisten eine Litanei von Gefahren ins Feld geführt hatten, war ein Gesetz erlassen worden, nach dem Kinder grundsätzlich nicht mehr in Trog-Häusern wohnen durften; es wurde erwartet, dass das Gesetz bald auf alle Menschen und alle Arten von Trog-Wohnraum ausgedehnt werden würde. Die Nachbarn, jedenfalls die meisten, waren misstrauisch – eine Haltung, die von Every gefördert wurde. Das Unternehmen hatte eine Reihe von Apps gekauft, mit denen Nachbarn Gerüchte und Angst verbreiten konnten, und die Algorithmen der Apps machten besonders solche Posts sichtbar, in denen sich Nachbarn besorgt fragten, was genau eigentlich in diesen nicht angeschlossenen Häusern vor sich ging. Dennoch gab es in den meisten Städten noch Viertel, die standhaft blieben; das in San Francisco wurde TrogTown genannt, und Every sorgte dafür, dass es als verdrecktes Getto mit hoher Kriminalität und schlechter Kanalisation wahrgenommen wurde.
Delaney und Wes waren jetzt auf der 41st Avenue, die in einem Bogen runter zum Meer führte. Hurricane zerrte an seiner Leine.
»Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich bin doch keine Spionin«, sagte Delaney. »Ich hab keine Ausbildung für so was.«
»Ausbildung«, sagte Wes. »Gibt’s denn dafür eine Ausbildung?«
Wes war ein seltenes, aber nicht völlig unbekanntes Phänomen, ein begabter Programmierer, der offline lebte – ein Tech-Trog. Und weil er sich die längste Zeit seines Lebens sozial abgegrenzt hatte, war seine Weltsicht die eines großmütigen Teenagers geblieben: Schlecht war schlecht, gut war gut, Rebellion grundsätzlich ehrenhaft. Delaney hatte sieben Monate gebraucht, bis sie ihm so weit vertraute, dass sie ihm ihre Pläne verriet, aber er hatte sie sofort verstanden und ermutigt.
»Ich kann’s nicht«, sagte Delaney. »Ich hab gedacht, ich könnte es, aber ich kann’s nicht.«
Wes blieb stehen. Hurricane legte sich noch entschlossener in die Leine. Er war sieben Menschenjahre alt, an seiner Schnauze zeigte sich das erste Grau, aber er war ein Läufer, schon immer gewesen, und über den harten nassen Sandstrand zu flitzen, war seine größte Freude. Er war ein Mischling, und Wes – sowie jeder, der ihn rennen sah – war sicher, dass er Windhund-Blut in den Adern hatte.
»Vielleicht können wir es ja von außen zerschlagen«, sagte Delaney.
Wes grinste. Seine Augen weiteten sich. »Das können wir!«, sagte er. »Ich schicke denen einen zackigen Brief. Und du stellst dich mit einem Plakat vors Tor. Vielleicht könnte einer von uns einen Roman schreiben.«
»Hör auf«, sagte sie. »Ich kann da nicht wieder hin. Das Problem ist, dass ich mich dabei arglistig fühle. Die Menschen, die da arbeiten, sind so arglos.«
»Sie richten allerdings kollektiv Schaden an«, sagte Wes.
»Aber meine Existenz dort wäre auf Arglist begründet.«
»Und auf dem Wunsch, die Welt zu retten«, stellte Wes klar. Zufrieden mit seinem Einwand ging er weiter, was Hurricane sichtlich erleichterte, der kurz davor war, sich selbst zu strangulieren. Am Strand ließ Wes ihn von der Leine, Hurricane raste los und verschwand in einer Wolke aus Sand. Er rannte jeden Tag eine volle Stunde lang. Wenn er mal nicht seinen täglichen Auslauf bekam, wurde er unruhig, rastlos, gar unberechenbar, kaute auf Kabeln, fraß Delaneys Schuhe und starrte sehnsüchtig durch die Jalousien.
»Das zweite Vorstellungsgespräch ist doch schon vereinbart«, sagte Wes. »Du bist so gut wie drin.«
Das stimmte nicht, und das wussten sie beide. Delaney schaute aufs Meer. Die anlaufende Brandung erschien ihr wie eine Armee fröhlicher Wischlappen.
»Ich hab überlegt, segeln zu lernen«, sagte sie. »Oder drechseln. Wir hatten zwei Pandemien, und ich hab nie drechseln gelernt. Ich könnte ein Kino eröffnen! Das Alexandria ist noch immer geschlossen. Oder Wandteppiche. Ich würde gerne mal einen Wandteppich weben.«
»Wandteppiche«, sagte Wes und schaute aufs Meer. »Kann ich mir bei dir gut vorstellen.«
Als Hurricane schließlich erschöpft zu Wes zurückgetrabt kam, ließ er sich theatralisch zu dessen Füßen fallen – seine Art, ihm zu sagen, dass er jetzt wieder nach Hause wollte.
An der Treppe vom Strand zur Betonpromenade kam ihnen eine Frau in einer schwarzen Windjacke mit Reflektorstreifen an den Ärmeln entgegen, irgendeine Ordnungskraft.
»Hi«, sagte sie. »Wollte mich nur vergewissern, dass Sie die neuen Strandregeln für Haustiere kennen. Ist der Hund gechippt?« Sie reckte den Kopf nach rechts und links, taxierte Hurricane. »Wir fragen das alle«, schob sie nach.
»Ist er nicht«, sagte Wes, bemüht, seinen Ärger zu unterdrücken.
Die Frau nagte an ihrer Unterlippe. »Tja, ab nächste Woche müssen alle Hunde innerhalb der Stadtgrenzen gechippt sein. Zur Sicherheit der Bürger und der Tiere. Falls er mal wegläuft.«
»Er läuft nicht weg«, sagte Wes.
Die Frau verdrehte die Augen. »In Zukunft befindet sich der Teil des Strandes für gechippte Tiere zwischen den beiden Markierungen dort drüben.« Sie zeigte zum Strand, wo ein Bereich von der Größe einer Doppelgarage markiert worden war. »Und es besteht Leinenzwang.«
»Chips und Leinen«, wiederholte Wes.
»Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der von allen anderen, die den Strand genießen wollen«, sagte die Frau.
Wes bedachte sie mit einem wütenden Blick, schaute dann rasch weg. Sie trug eine hochauflösende Bodycam um den Hals, sodass jedes Stirnrunzeln oder böse Wort aufgezeichnet und registriert werden würde. »Danke«, sagte er, und sie gingen weiter.
Sobald sie außer Hörweite waren, explodierte Wes. »Verdammte Scheiße!«
Ocean Beach war der letzte Ort in der Stadt, der letzte Ort im Umkreis von fünfzig Meilen, an dem Hunde frei laufen durften. Er schielte zu Hurricane hinunter, den Wes’ Tonfall offenbar beunruhigte.
»In meiner Kindheit konntest du da Lagerfeuer machen«, tobte er. »Du konntest ohne Genehmigung surfen oder angeln. Du konntest laufen, schwimmen, vögeln, egal was. Und warum? Weil der Strand riesig ist! Bestimmt fünf Meilen lang. Da gibt’s Platz für alles. Scheiße!«
Weit vor der Küste trübte Ozeanregen den Himmel über den Farallon Islands.
»Du musst diesen Konzern vernichten«, sagte er. »Letzten Endes läuft alles auf ihn hinaus. Vernichte Every, und wir haben eine Chance.«
Delaney wusste nicht, was sie sagen sollte.
»Ich brauch eine Ablenkung«, sagte Wes.
Sie brachten Hurricane nach Hause und gingen ins Free Gold Watch, eine nostalgische Spielhalle auf der Waller Street, einen Block von der Haight Street und einen Steinwurf von der schmalen Verlängerung des Golden Gate Park entfernt. KEINE CAMS stand auf dem Schild an der Tür. HIC SUNT TROGS. Drinnen spielte ein halbes Dutzend Leute Flipper und Centipede. Delaney hatte nie rausbekommen, wer in dem Laden arbeitete. Nie schien ein Verantwortlicher vor Ort, und doch war immer alles sauber und in einwandfreiem Zustand. Wes schob einen Quarter in einen kleinen Galaga-Spielautomaten.
»Spielst du mit?«, fragte er. Delaney zuckte mit den Schultern. Er warf noch einen Quarter ein. Delaney lehnte sich gegen die Wand und beobachtete im Spiegel, wie sich ein Mann, der ein Damned-T-Shirt trug, an einem alten Zielschießen-Spiel im Western-Stil versuchte.
Wes’ Raumschiff wurde schnell abgeschossen, und er ließ Delaney an den Automaten.
»Wie geht’s Pia?«, fragte sie.
Pia war Wes’ Gespielin. Sein Wort – Gespielin. Sie wohnte bei ihm, als Delaney einzog, und noch in der ersten gemeinsamen Woche hatte Delaney sie für clever und witzig befunden. Als Kind hatte Delaney wie jedes Mädchen, mit dem sie aufgewachsen war, davon geträumt, Meeresbiologin zu werden, und Pia war eine echte Meeresbiologin, wenn auch eine, die auf der Jagd nach Stipendien ständig um die Welt reiste (zurzeit war sie in Chile). Dann jedoch wurde Delaney klar, dass Wes und Pia beide in dem Glauben lebten, Pia sei die verführerischste Frau der Welt und kein Mensch könne Pia Minsky-Newton begegnen, ohne sich in Pia Minsky-Newton zu verlieben. Pia sah gut aus, aber für Pia und Wes war die überwältigende Herrlichkeit ihres Antlitzes eine ständige Belastung. Ihr etwas strähniges Haar erinnerte in Pias und Wes’ Augen an die Kennedys, und ihr Busen, den Delaney für durchschnittlich hielt, war für die beiden ein Kontinentalschelf, das alle Welt zu unablässiger Lüsternheit trieb.
»Ganz gut. Aber in ihrem Programm arbeitet ein gewisser Karl, der sich ihr praktisch an den Hals schmeißt. Er hat ein Lied für sie geschrieben –«
»Kommt sie über Weihnachten?«
»Ich glaube, ja. Für eine Woche. Du bist dran.« Delaney trat an den Automaten und wurde prompt abgeschossen.
»Du musst wieder hingehen. Noch ein Vorstellungsgespräch machen«, sagte er.
»Ich kann nicht. Ich bin einfach keine Spionin. Ich verkleide mich nicht mal an Halloween.«
»Hast du nicht diesen Ex-Freund, der undercover gearbeitet hat? Der Naturschutztyp mit der schrillen Panoramasonnenbrille? Dirk?«
»Derek. Du weißt genau, dass er Derek hieß.«
Derek, modemäßig Mittelmaß, aber zutiefst aufrichtig, arbeitete als Undercover-Agent für die Naturschutzbehörde von Montana und gab sich als Käufer von Bären, Wapitis und außerhalb der Jagdsaison geschossenen Elchen aus; die Arbeit war überraschend gefährlich.
»Er hat mir mal erzählt, worauf es ankommt, wenn du unter Druck lügen musst«, sagte Delaney. »Sie kommen dir auf die Schliche, wenn sie dir eine Frage stellen, die eine Lüge erforderlich macht und du die Frage direkt beantwortest – sie erkennen die Lüge sofort. Aber wenn du stattdessen auf eine andere Frage antwortest, eine, die du dir ausgedacht hast, reagiert all das, was die Lüge verrät, deine Augen, der Mund, die Gesichtsmuskulatur, nicht auf die Lüge, sondern auf diese andere ausgedachte Frage, die du wahrheitsgemäß beantworten kannst.«
»Danke für diesen fürchterlichen Wortsalat«, sagte Wes. »Ich hab nix verstanden. Aber ich freu mich für dich. Klingt, als hättest du’s begriffen. Du hast eine Lügenstrategie, also alles bestens.«
»Aber ich hab ihnen nichts zu bieten. Du bist der Programmierer. Mach du’s doch. Ich wär deine Assistentin.«
Wes ließ sein Raumschiff in ein Geschoss gleiten. Er sah Delaney an, während die Explosion über den Bildschirm grollte. »Das war deine Idee, Del. Du planst das seit Jahren. Du kannst mir nicht einfach deinen Traum abtreten. Ausgeklügelte Umsturzpläne sind nicht übertragbar.«
»Aber für dich wäre es viel einfacher. Du wirst eingestellt, schreibst einen … Wie nennst du das?«
»Code.«
»Echt? Einfach nur Code? Okay. Du schreibst einen Code, sprengst den Laden von innen.«
»Es gibt keinen Code, der den Laden sprengt«, sagte Wes. »Und das weißt du auch. Es geht nicht um den Code oder die Software, nicht mal um die Leute, die da arbeiten. Das, womit du den Laden vernichtest, wird etwas sein, woran wir noch gar nicht gedacht haben können, etwas, das du erst erkennst, wenn du drin bist.« Wes’ Blick schweifte ab. »Ich hab Hunger.«