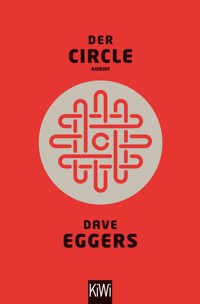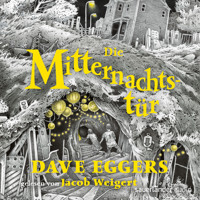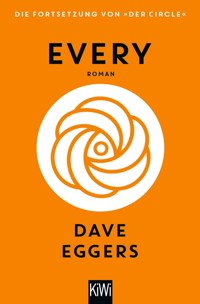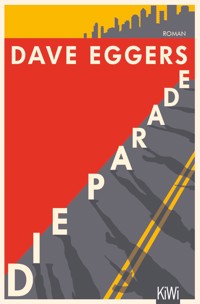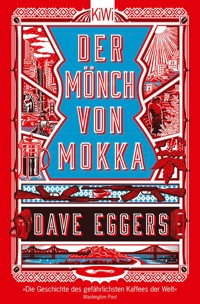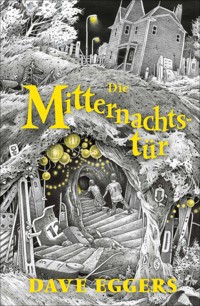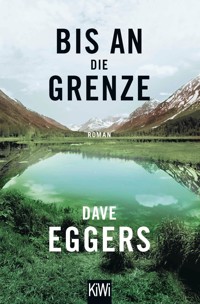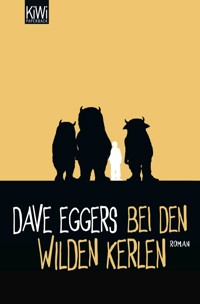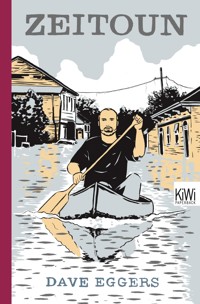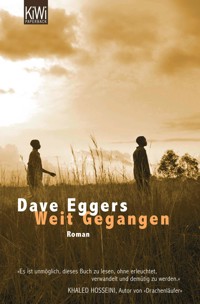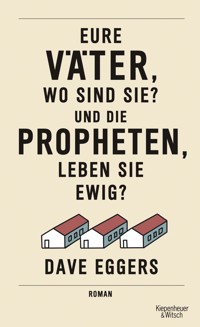Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Kinderbuch
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Johannes ist ein freier Hund in einem Stadtpark am Meer. Seine Aufgabe ist es, die Augen zu sein – alles zu sehen, was im Park passiert, und den Ältesten des Parks, drei Bisons, Bericht zu erstatten. Seine Freunde, eine Möwe, ein Waschbär, ein Eichhörnchen und ein Pelikan, helfen Johannes beim Beobachten der Menschen und Tiere und sorgen dafür, dass das Gleichgewicht im Park erhalten bleibt. Doch Veränderungen sind im Gange. Immer mehr Menschen kommen in den Park, auch gefährliche, ein neues Gebäude mit geheimnisvollen und hypnotisierenden Rechtecken wird errichtet, und dann tauchen auch noch Ziegen auf – eine ganze Bootsladung Ziegen – und mit ihnen eine schockierende Enthüllung, die Johannes' Sicht auf die Welt für immer verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dave Eggers
Die Augen & das Unmögliche
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Ilse Layer
Illustrationen von Johannes von Shawn Harris
atlantis
Für alle meine Lehrerinnen und Lehrer
&
für meine langjährigen Weggefährten
Amanda, Amy, Andrew, Shawn & Taylor
Diese Geschichte ist frei erfunden. Keinen der Orte gibt es wirklich. Keines der Tiere gibt es wirklich. Und vor allem steht keines der Tiere symbolisch für einen Menschen. Der Mensch neigt dazu, überall sich selbst zu sehen, zu glauben, alles Lebendige, insbesondere Tiere, wäre nur eine Begleiterscheinung. In diesem Buch ist das nicht der Fall. Die Hunde sind hier Hunde, die Vögel Vögel, die Ziegen Ziegen, die Bisons Bisons.
Paul Joseph Constantin Gabriël, Landschaft bei Abcoude, 1860–1870, Rijksmuseum Amsterdam, Niederlande
Eins
Ich drehe, drehe, drehe mich im Kreis, bevor ich mich schlafen lege, und stehe vor der Sonne auf. Ich schlafe drinnen, schlafe draußen, habe im hohlen Stamm eines tausend Jahre alten Baumes geschlafen. Zum Schlafen brauche ich es warm, geborgen und still. Dann träume ich von Müttern und Wolken – Wolken sind Boten Gottes. Und ich träume von Pupusas, gefüllte Tortillas fresse ich nämlich für mein Leben gern.
Ich heiße Johannes und bin ein Hund. Und ich habe euch gesehen. In meinem Park, in dem ich lebe. Wenn ihr schon mal hier wart, in diesem riesengroßen grünen, windigen Park am Meer, habe ich euch gesehen. Ich sehe alle Menschen, die herkommen. Sie wandern, laufen, fahren auf Rädern, reiten auf Pferden, halten nach den Bisons Ausschau, machen Picknicks oder tragen komische Umhänge und schießen mit Pfeilen. Wenn ihr schon mal hier wart, wart ihr da, wo ich lebe, da, wo ich Die Augen bin.
Ich habe euch alle gesehen. Die Großen, die Kleinen, die Dicken, die Dünnen und die Müffelnden. Reisende, Touristen, Einheimische, Rollschuhläufer und Menschen, die unter der moosbedeckten Brücke in Blechdinger blasen. Zappelmenschen, die über die andere Brücke tanzen, und Bärtige, die fliegende Scheiben in Metallkörbe werfen, aber meistens nicht treffen. Ich sehe alle, weil ich Die Augen bin und es meine Aufgabe ist, alles zu beobachten und darüber zu berichten. Fragt die Schildkröten nach mir. Fragt die Erdhörnchen. Fragt nicht die Enten. Die Enten haben keine Ahnung.
Ich kann so schnell rennen wie eine Rakete. Wie ein Laserstrahl. So etwas Schnelles wie mich habt ihr noch nie gesehen. Wenn ich renne, ziehe ich an der Erde und mache, dass sie sich dreht. Ihr habt mich gesehen? Ausgeschlossen. Ihr irrt euch. Niemand hat mich je rennen sehen, denn dann bin ich für Menschenaugen unsichtbar. Ich renne so schnell wie das Licht. Habt ihr schon mal gesehen, wie Licht sich bewegt? Na?
Ihr habt nicht gesehen, wie Licht sich bewegt. Ich mag euch trotzdem. Das habt ihr nicht erwartet oder verdient, aber trotzdem, ich mag euch.
Ich bin hier zur Welt gekommen. Das war so: Meine Mutter wurde in einem Haus gehalten und wird es immer noch. Als wir in ihrem Bauch waren, hat sie sich im Park eine Baumhöhle gesucht und ist geblieben, bis wir geboren waren. Warum sie uns lieber hier draußen zur Welt bringen wollte als in ihrem geschützten Menschenbau, weiß ich nicht und sie selber auch nicht. Sie hat eine Hundemarke um, bekommt jeden Tag zu fressen, wird immerzu gestreichelt und von Menschenärzten versorgt. Die haben sie bis jetzt am Leben gehalten, viel länger, als sie sonst gelebt hätte. Warum sie uns hier draußen bekommen hat, weiß ich nicht, aber so war’s, und nachdem wir alle aus ihr rausgerutscht waren, ganz schmierig und winselnd, hat sie etwas Unerwartetes getan. Sie hat sich einen von uns ausgesucht – meinen Bruder Leonard – und ihn in ihren Menschenbau mitgenommen. Anscheinend waren ihre Menschen überglücklich, dass sie wieder da war, und freuten sich über den neuen Kleinen. Uns andere hat sie in der Baumhöhle zurückgelassen.
Ich bin nicht verbittert.
Ich bin ein Komet.
Anfangs hat uns ein anderer Hund mit Nahrung versorgt, daran erinnere ich mich dunkel. Auch an seinen Geruch. War es überhaupt ein Hund? Oder eher ein Fuchs oder ein Waschbär? Janie behauptet, es war eine Eule. Joanie behauptet, es war ein Erdhörnchen. Joanie und Janie sind meine Schwestern. Es gibt auch noch meinen Bruder Steven. Jedenfalls hat uns irgendwer an diesen entscheidenden ersten Tagen geholfen. Für uns selber sorgen konnten wir erst nach ein paar Wochen, und das haben wir dann auch getan. Wir haben uns alleine durchgeschlagen und sind herangewachsen und es ging uns gut. Während Leonard das Futter hingestellt bekam, haben wir anderen alles geschnorrt, was wir im Park finden konnten.
Wir hatten oft Hunger, aber wir waren frei. Ich sorge immer noch selbst für mich und schnorre und bin immer noch frei. Niemand füttert mich. Ich habe keinen Besitzer, sondern bin ein freier Hund. Das ist mein Leben. Gott ist die Sonne. Die Wolken sind ihre Boten. Regen ist bloß Regen.
Der Park ist riesengroß. Mit Zahlen kenne ich mich nicht so aus, aber ich glaube, er ist zehntausend Kilometer lang und bestimmt dreitausend Kilometer breit. Teile davon sind richtiger Wald. Er ist lang und schmal und führt von der grauen Stadt weit hinaus bis zu einem zornigen grauen Meer mit einem breiten, windigen Strand, wo drei-, viermal im Jahr Menschen ertrinken, wenn das Meer mal so richtig herumtobt.
Ich war auch schon an diesem Strand, bin aber nicht ertrunken. Ich habe schon Schnellstraßen überquert, wurde aber nie verletzt. Wenn es sein musste, habe ich auch mal in Beine gebissen und bin von Hausdächern gesprungen und habe es immer heil überstanden.
Ich bin stark.
Ich habe schon direkt in eine Sonnenfinsternis geblickt und es hat mir nichts ausgemacht.
Ich bin unbesiegbar.
Vielleicht sterbe ich nie.
Als wir noch klein waren, haben Joanie, Janie, Steven und ich den Abfall am Imbissstand entdeckt und uns daraufgestürzt. Es war bequem und lecker. Wir haben uns an angebissenen Hotdogs und Brezeln satt gefuttert und angefangene Säfte und Limo getrunken. Die Limo haben wir aber wieder ausgespuckt, weil wir sie damals nicht vertragen haben und heute immer noch nicht. Hier gab es solche Massen an Futter, dass es leicht war und immer noch ist, oft zu fressen und satt zu werden.
Dann waren Joanie, Janie und Steven auf einmal weg. Das war ganz komisch. Wir waren noch Welpen, wie ich heute weiß. Wir waren alle Welpen, und eines Tages beobachteten wir die Menschen, die an der Brücke tanzten. Wir saßen alle vier da und schauten den Leuten beim Tanzen zu. Auf einmal haben Menschenhände Joanie und Steven hochgehoben, und die Menschen redeten darüber, dass sie noch Welpen seien und so klein und flauschig, und ich dachte: Nein! Ich dachte: Nein! und sagte zu Janie: Lauf weg!, aber sie dachte: Ja! und sagte: Ja! und blieb. Und dann wurde sie auch hochgehoben.
Alle drei wurden also von Menschen mitgenommen und sind inzwischen bestimmt Besitzerhunde, also Haustiere. Nur ich bin weggerannt, ich bin frei geblieben und Die Augen geworden.
Zwei
Wie ich Die Augen geworden bin? Das war so: Als ich irgend- wann mal schnell wie das Licht durch den Park lief, sagte eine tiefe Stimme:
»Bleib stehen.«
Ich denke gar nicht dran, stehen zu bleiben, bloß weil jemand das will. Schließlich bin ich frei und schnell! Wobei die Stimme gebieterisch war, aber auch freundlich, irgendwie mütterlich. Ich blieb zwar trotzdem nicht stehen, nein – wie auch? –, aber ich drosselte mein Tempo auf Schallgeschwindigkeit.
»Komm mal her.«
Ich drosselte auf Flugzeuggeschwindigkeit und hielt auf die Stimme zu. Sie schien aus einem fellbewachsenen Felsen zu kommen, der zwischen den Bäumen stand.
»Komm näher.«
Ich drosselte auf Höchstgeschwindigkeit eines gewöhnlichen sterblichen Säugetiers und wagte mich näher heran. Der Felsbrocken war lebendig. Es war ein Bison. Ich hatte die Bisons schon mal von Weitem gesehen, von der Straße aus, die durch den Park führt und an der ich manchmal entlangflitze, weil ich gern mit den Autos um die Wette renne. Ich bin hundertmal schneller! Es ist einfach nur ein schlechter Scherz, wie viel schneller ich bin. Das ist peinlich für die Autos und die Menschen, die sie fahren und bauen. Ich blamiere sie, aber es tut mir nicht leid.
»Komm her und red mit mir.«
Als ich mich noch näher heranwagte, sah ich, dass der Bison eine Sie und schon sehr alt war. Es war Freya. Mit Zeit kenne ich mich nicht so aus, aber ich schätze, sie war damals sechstausend Jahre alt. Inzwischen ist sie noch älter.
Sie war eines der drei Bisons – die beiden anderen sind Meredith und Samuel –, die in ihrem Gehege leben, einem großen, umzäunten Park innerhalb des Parks. Sie waren schon immer hier, und sie bewegen sich langsam und wirken oft müde, aber sie haben seit Millionen Jahren oder noch länger hier das Sagen.
»Ich hab dich rennen sehen«, sagte Freya. Ihre Augen unter den schweren Lidern waren riesig. »Du bist sehr schnell.« Ich nickte ernst und voller Stolz. »Wir, die Herrscher über diesen Park, müssen alles wissen, was hier vorgeht, und jetzt sind die meisten Kaninchen nicht mehr da und die Eulen sind unzuverlässig.«
»Sie denken sich Dinge aus und verfolgen ihre eigenen Ziele«, warf Meredith nicht unfreundlich ein. Meredith war von den dreien die Herzlichste, die einem immer glaubte und einen immer aufmunterte.
»Und die Enten sind bekanntlich Trottel«, ergänzte Samuel. Er war der Zynischste, der Müdeste, der Witzigste der drei.
Dass die Kaninchen nicht mehr da waren, wusste ich schon, aber nicht, dass die Eulen unzuverlässig sind. Ich prägte mir ein, dass Eulen ihre eigenen Ziele verfolgen. Dass die Enten Trottel sind, war mir nicht neu.
»Wir möchten, dass du zu unseren Augen wirst«, sagte Freya.
»Du könntest das bestimmt gut«, ergänzte Meredith.
Ich wollte sehr gern zu ihren Augen werden. Und so wurde ich Die Augen.
»Vermassel es nicht«, brummte Samuel.
Meine Aufgabe war einfach, aber wichtig. Ich würde jeden Tag durch den Park laufen, so wie jetzt auch schon, bloß dass ich jetzt nach Sonnenuntergang den Bisons berichten würde, was ich gesehen hatte. Gab es etwas Neues, Beunruhigendes? Etwas, das womöglich das Gleichgewicht stören konnte?
Der Park hat nämlich ein Gleichgewicht, so wie alle Orte in der Natur, und die Bisons wachen darüber. Sie sind die Hüter des Gleichgewichts. Kommt das Gleichgewicht durcheinander, gibt es Probleme. Wenn die Parkleute zum Beispiel einen neuen Weg anlegen, sind die Tiere dort nicht mehr ungestört, weil mehr Menschen hinkommen. Das kann das Gleichgewicht in Gefahr bringen. Neue Gebäude, neue Straßen, neue Regeln – alles wirkt sich auf das Gleichgewicht aus.
Dieses System, unser System, klappt gut. Ich sehe etwas, berichte es den Bisons und sie ersinnen eine Lösung. Als durch den Wald, in dem die meisten Waschbären lebten, eine neue Straße gebaut wurde, erzählte ich es den Bisons, und sie entschieden, wann und wohin die Waschbären umziehen mussten. Wenn sich die Füchse und die Erdhörnchen um ihr Revier zanken, berichte ich es den Bisons, und sie bestimmen, wer was bekommt. Wenn sich in unserem Park zu viele Menschen zu respektlos und zerstörerisch verhalten, erzähle ich es den Bisons, und sie schicken Bertrand mit den anderen Möwen zu ihnen, damit sie Kacke regnen lassen – Problem gelöst. Alles fängt damit an, was ich sehe. Mit den Neuigkeiten, die ich zusammentrage.
Diese Neuigkeiten betreffen fast immer die Menschen. Die meisten joggen, fahren Rollschuh, picknicken und machen, was man im Park eben macht. Sie spielen Krocket. Sie klettern auf Bäume. Fahren auf Rädern und schlendern über die Wege. Diese Menschen sind kein Problem. Aber es gibt auch noch die Konzertleute und die Camper, und beide können problematisch sein. Die Konzertleute kommen einmal im Jahr und machen auf dem Hauptplatz laut Musik. Sie kommen von überallher. Die meisten waren noch nie in unserem Park und haben keine Ahnung, wie es hier zugeht. Dass der Park Tausende Dauerbewohner so wie mich hat und nicht nur eine Bühne dafür ist, dass sie rumstehen, mit dem Kopf wippen und sich im Kreis drehen. Einmal im Jahr richten die Konzertleute den Park fast zugrunde mit ihrem Lärm und Müll und damit, dass sie überall hinkotzen und hinpinkeln.
Aber sie verschwinden wieder. Sie ziehen weiter und wir können uns erholen.
Mit den Campern ist es knifflig. Manche bleiben, sind schon jahrelang hier, und wir wissen, wie sie heißen. Einige sind überhaupt kein Problem. Marianne und Dennis schlafen in einem hübschen Zelt am Ententeich und sind schon so lange hier wie ich selber. Der fast blinde Thomas füttert Vögel und Erdhörnchen und lebt weiter weg am Strand. Es heißt, er wäre schon tausend Jahre hier. Diese Camper sind wie wir – sie wollen ihre Ruhe und gehen ganz, ganz leise durch den Wald. Sie achten das Gleichgewicht.
Es gibt aber auch die Problemmacher. Die essen und trinken stinkendes Zeug, übergeben sich und machen Krach. Sie prügeln sich und stehlen. Sie lassen Flaschen, Papier und Kacke zurück. Sie greifen Fremde an und behandeln Tiere schlecht. Sie machen den Wald gefährlich und verbreiten Gestank. Meistens durchqueren sie den Park in großen, lärmenden Fahrzeugen. Sie sind auf der Durchreise, kommen woandersher und wollen woandershin. Dass der Park unser Zuhause ist, ist ihnen egal.
Die meisten Menschen sind aber nur kurz hier und stellen kein Problem dar. Es ist genauso ihr Park wie meiner. Die Bisons verstehen das und die Schildkröten und Erdhörnchen auch. Die Enten verstehen wieder mal nichts, aber das ist ein anderes Thema.
Die meisten Menschen wohnen in ihren grauen Betonhäusern an ihren schwarzen Asphaltstraßen und halten sich nur ein, zwei Stunden hier auf. Ich beobachte sie alle. Ich beobachte die Jogger, die Reiter und die Bogenschützen. Ich beobachte die Fußballspieler und die Fußballzuschauer. Ich beobachte die Familien und ihre plötzlich freigelassenen Kinder. Ich beobachte die Hundebesitzer und lache über ihre Hunde. Hahahoooooo!
So hört sich mein Lachen an: Hahahoooooo!
Hahahoooooo! Haustiere!
Diese Besitzerhunde an ihren Leinen … Sie tun so, als würde ich mit ihnen lachen und nicht über sie, und darüber muss ich noch mehr lachen.
Hahahoooooo!
Hahahoooooo!
Herrlich. Herrlich. Herrlich.
Ich lache darüber, wie sie bei ihren Besitzern bleiben und gleichzeitig vorgeben, sie wären so frei wie ich. Mir gegenüber tun sie total lässig, als wäre die Leine überhaupt kein Problem. Als wären sie bald so frei wie ich, als könnten sie jederzeit frei sein, wenn sie nur wollten. Zum Totlachen! Hahahoooooo! Ich lache, bis mir die Tränen kommen, riesengroße Kullerlachtränen.
Nicht-frei ist nicht frei. Die Besitzerhunde kennen den Unterschied sehr wohl! Sie haben sich für Futter aus der Tüte entschieden. Sie haben sich für hingeworfene Brocken unter dem Esstisch entschieden. Sie haben sich für das Dach über dem Kopf und die Leine entschieden. Die Leine! Die Leine! Die Leine!
Hahahoooooo! – denn für mich kommt so etwas nicht infrage.
Drei
Jetzt möchte ich euch erzählen, wie alles anders wurde. Das ist noch nicht lange her, schätzungsweise zweihundert Jahre. Es war nach einer Nacht mit einer Milliarde Sternen, den Geschwistern unserer Sonne.
Ich wohne in einem hohlen Baumstamm. Der Baum ist eine Million Jahre alt und vor tausend Jahren gestorben, steht aber immer noch mitten im Park und ist inzwischen von Efeu überwuchert. Am Tag nach der Nacht mit den vielen Sonnengeschwistern wachte ich noch vor Morgengrauen in meiner Baumhöhle auf und streckte und schüttelte mich. Schnell wie das Licht rannte ich ans Meer, um im klirrkalten Wasser zu baden und wach zu werden. Am windigen Strand begegneten mir nur ein paar Jogger und etliche schillernde Quallen, die angespült worden waren und stumpfsinnig herumlagen. Ich beobachtete, wie sich der erwachende Himmel von schwarz über blau und violett zu rosa, orange und gelb färbte, dann kehrte ich sauber und hellwach in den Park zurück.
An dem Tag war nichts los. Beim Überqueren der Schnellstraße ließ ich mir reichlich Zeit, lief dann an der noch schlummernden Windmühle vorbei und drehte meine übliche Runde. Am Ententeich, der entsetzlich stinkt, hielten sich wie immer die Enten auf. Der Gestank stört sie nicht. So sind die Enten eben.
Ich lief über die Brücke, weil ich nach den Bogenschützen sehen wollte. So früh waren erst wenige da. Eine Frau hatte sich in einen dicken gelben Umhang gewickelt, der beim Gehen das Gras kitzelte. Es sah eindrucksvoll aus, wie das Gelb über das taufeuchte Grün der Wiese schleifte. Neben dem Bogenschießplatz ist der Fußballplatz, und der war voller junger Spieler mit ihren Eltern. Ich wollte eine Weile zuschauen, aber seltsamerweise spielten sie gar nicht Fußball, sondern rannten auf der Stelle, machten Luftsprünge, setzten sich auf den Boden, verdrehten Arme und Beine, hüpften herum und riefen irgendwas. Das war langweilig und ich lief weiter.
Unter einem Zelt saßen zwei Leute an einem Tisch. Sie nahmen von den Eltern der jungen Menschen Geld entgegen und steckten es in ein Metallkästchen mit Deckel. Das Geld war in diesem Fall das schmuddelige Papier, das mich nicht interessiert. Ich mag Münzen lieber.
Münzen! Ich liebe Silber und Kupfer. Wenn Münzen in der Sonne funkeln, will ich sie haben. Dann muss ich einfach stehen bleiben und sie anschauen. Ein paarmal habe ich welche in meine Baumhöhle gebracht, aber im Dunkeln funkeln sie nicht mehr, darum lasse ich sie draußen in der Sonne. Ja, sie sollen in der Sonne funkeln, damit ich sie anschauen kann.
Aber nicht zu lange!
Wenn man zu lange stehen bleibt und schaut, wird man gefangen. Steven, Janie und Joanie wurden gefangen, als sie den Tanzenden zugeschaut haben, aber ich lasse mich nicht fangen.
Ich werfe den Münzen nur einen Blick zu und erfreue mich am glänzenden Silber und Kupfer, dann renne ich weiter. So schnell wie ein Donnerschlag.
An der Reitbahn saßen Menschen auf Pferden wie Königinnen und Könige, während die Pferde im Kreis trabten, und das war auch langweilig. Darum lief ich weiter zu dem flachen Bassin, wo die Leute ihre Bötchen fahren lassen. Ein runder Mann, den ich noch nicht kannte, hatte ein neues Spielzeugboot dabei. Es war kleiner als ich – höchstens so groß wie ein ausgewachsenes Erdhörnchen –, fuhr aber sehr schnell. Das fand ich spannend. Das Boot war niedrig und vorn spitz wie ein Pfeil, und in Nullkommanichts hatte es eine Runde durchs Bassin gedreht.
Mit diesem Boot musste ich unbedingt um die Wette rennen!
Wenn viele Leute da waren, konnte man Wettrennen nicht machen. Weil außer dem runden Mann aber niemand am Bassin stand, sauste ich los wie eine Rakete und stellte fest, dass ich viel schneller war als das Pfeilspitzenboot.
Verglichen mit mir war das Boot ein Witz.
Verglichen mit mir war es ein Stück Treibholz.
Doch dann drehte es auf.
Es hatte sich bloß zurückgehalten!
Ich rannte schneller, das Boot beschleunigte, jetzt ging es gegen den runden Mann und sein Boot, und wir drehten Kopf an Kopf zwei Runden ums Bassin. Als ich an dem Mann vorbeikam, hörte ich ein Nicht schlecht! Belustigt rannte ich weiter. Für solche Fälle habe ich noch meine Lichtgeschwindigkeit auf Lager! Ich wurde zum Licht selbst und ließ Boot und Mann in der weißen Glut meiner unermesslichen Schubkraft zurück.
Das geschah an jenem Tag, ja, aber es war noch nicht das einschneidende Ereignis, das ich vorhin angekündigt habe.
»Kommst du jetzt endlich?«, fragte über mir jemand. Das konnte nur Bertrand sein, eine Möwe und mein bester Freund. Es war an der Zeit, mich auf der Großen Felskugel mit meinen Helferaugen zu treffen.
Die Helferaugen habe ich gar nicht erwähnt, tut mir leid. Sie unterstützen mich. Sie sehen, was mir entgeht. Wir sind Gefährten, Verbündete. Wir treffen uns jeden Tag, wenn die Sonne direkt über uns steht, auf einem großen Felsen, der so rund und hoch ist, dass ihn Menschen nicht erklimmen können. Ihre Hände rutschen einfach ab.
Oben im Felsen ist eine Vertiefung, eine Art Becken, das ist unser Treffpunkt. Von dort aus haben wir den ganzen Park im Blick, wir selbst werden aber nicht gesehen, außer von den Vögeln. Ich bin immer im Nu oben, wie eine Feder, die vom Wind hochgeweht wird, denn ich erreiche Fluggeschwindigkeit und auf meine Krallen ist Verlass.
Als ich ankam, saß Bertrand schon da und kratzte sich mit dem Schnabel unterm Flügel, wie es seine Gewohnheit ist. Fragt mich nicht, warum. Bertrand ist eine Seemöwe, und zwar eine große. Von allen Möwen hier ist er die größte und stärkste – glaube ich jedenfalls –, aber er ist bescheiden und will so etwas nicht hören. Er möchte einfach Bertrand sein.
»Hi-hi«, sagte er. So begrüßt er jeden. Es klingt albern und ein bisschen schwächlich – und das, obwohl er eine tiefe Stimme, einen Brustkorb wie ein Fass und gewaltige Schwingen hat.
»Ho-ho«, erwiderte ich wie immer. Das ist unser Privatscherz.
Ich erkundigte mich, was es Neues gab. Nicht viel, antwortete er, nur dass Rose-Marie, eine Möwe aus seiner Sippe, gestern ihren letzten Flug gemacht hatte. Das kam nicht unerwartet. Sie war schon alt und konnte nicht mehr gut fliegen, und wenn Möwen alt sind und nicht mehr fliegen können, ist es aus. Das gehört zu ihrer Kultur, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Wenn ihre Zeit gekommen ist, legen sie jedenfalls Wert auf einen eindrucksvollen Abgang. Ich wusste, dass Rose-Marie gut zu Bertrand gewesen war, und drückte ihm mein Beileid aus.
»Sie hat mir beigebracht, wie man Fische fängt.« Bertrand schaute aufs Meer hinaus.
»Einmal hat sie mir auch einen Fisch geschenkt«, sagte ich. Rohen Meeresfisch fresse ich eigentlich nicht, aber manchmal gibt mir eine Möwe etwas ab, und sei es nur, weil sie neugierig ist, was ein Hund wie ich von rohem Fisch hält. Silbrig und zappelnd, mit panischen Augen – so war der Fisch, den ich von Rose-Marie bekam. Eine grässliche Erfahrung, die ich nicht wiederholen möchte.
»Sie wird uns fehlen«, sagte Bertrand über Rose-Marie.
Bertrand sagt oft ernste Dinge, während er aufs Meer hinausschaut. Von allen Säugetieren und Vögeln, die ich kenne, ist diese Vorliebe bei ihm am stärksten ausgeprägt. Wir anderen mögen das. Wir schätzen seine nachdenkliche Art. Er wird oft um Rat gefragt.
Als Nächstes traf Sonja ein. Sonja ist ein Erdhörnchen und hat die Angewohnheit, einen nie richtig zu begrüßen, so als wäre sie gerade mitten in ein Gespräch hineingeplatzt. Sie gehört auch zu meinen Helfern und trifft sich seit mindestens sechshundert Jahren mit uns auf der Felskugel, darum verstehen wir nicht, warum sie immer erst so schüchtern ist. Seit einem Kampf mit einer Krähe fehlt ihr ein Auge, und die einfachste Erklärung wäre, dass es daran liegt. Aber ich bin nicht sicher. Die naheliegenden Erklärungen sind oft falsch.
»Hi-hi«, sagte Bertrand.
»Ho-ho-hoch«, erwiderte Sonja wie immer, wenn Bertrand »Hi-hi« sagt. Der Privatscherz der beiden.
Weil noch zwei weitere Helferaugen fehlten, hielt Sonja ihr kleines Gesicht in die Sonne. Das macht sie hier oben immer, wenn ausnahmsweise mal die Sonne scheint. Sie verbringt die meiste Zeit im Schatten unter den Pinien- und Eukalyptusbäumen. Darum hält sie hier oben das Gesicht in die Sonne und lauscht Gott. Wenn sie das unversehrte Auge schließt, sieht sie friedlich aus. Kaum ist es offen und das andere ein runzliger Stern aus Haut und Fell, wirkt sie unsicher und angespannt.
Yolanda landete wie üblich als Kuddelmuddel aus Flügeln und Füßen. Yolanda ist ein Pelikan, und zwar ein tollpatschiger, und das will etwas heißen. Schließlich sind alle Pelikane tollpatschig. Kein Wunder bei ihrem plumpen Körper und ihrer drolligen Art zu fliegen.
»Hi-hi«, sagte Bertrand.
»Ti-ti-tief«, erwiderte Yolanda. Das ist ihr Privatscherz. Wie alle Pelikane fliegt Yolanda am liebsten tief-tief über dem Wasser, ganz dicht über der Oberfläche. Es ist also sozusagen auch ein Insiderwitz zwischen ihr und Bertrand, weil beide Vögel sind. Zufällig ist Yolanda auch die Einzige von uns, die Menschenschrift lesen kann, eine Gabe, von der sie nicht viel Aufhebens macht.
Bevor Yolanda sich niederließ, schlug sie mit den Flügeln und drehte den Hals hin und her, um das Salzwasser und lose Federn abzuschütteln. »Wo ist denn Angus?«
Angus ist ein Waschbär, und Waschbären sind nachtaktiv, darum kommt Angus meistens zu spät und manchmal auch gar nicht. Bei seinen Schlafgewohnheiten braucht er nicht zu unseren Treffen zu kommen und muss auch kein Helferauge sein, das sage ich ihm immer wieder. Er will aber unbedingt dabei sein. Er will ein Helferauge sein, und darüber bin ich froh. Nachts sieht er vieles, das uns anderen entgeht. Er ist auch ein bisschen pummelig, so wie alle Waschbären hier im Park, wo es abwechslungsreiche Nahrung im Überfluss gibt. Als wir es unten an der Felskugel scharren hörten, wussten wir, dass sich Angus gerade zu uns hochhievte.
»Hi-hi«, sagte Bertrand.
»Hey, Bertrand!«, erwiderte Angus ganz außer Atem. Er hat sich noch nicht auf eine Privatscherz-Begrüßung mit Bertrand eingelassen. »Hey, ihr alle!« Er ließ sich auf den Felsen plumpsen. »Ich muss erst durchschnaufen. Fangt schon mal ohne mich an.«
Das taten wir, und ich fragte einen nach dem anderen, was es Neues gab. Yolanda erzählte, sie hätte hinter dem Radweg Parkleute beim Abmessen und Markieren von Bäumen beobachtet. »Vielleicht wollen sie einen neuen Weg anlegen.« Das war ganz in der Nähe der Stelle, wo Angus und die anderen Waschbären lebten. Davon wussten die Menschen aber nichts. Die Menschen wussten ja nicht mal, dass überhaupt Waschbären im Park lebten.
Hihi, dachten wir. Hahahoooooo! Hier gibt’s jede Menge Waschbären!
Trotzdem war ich in Sorge. Wo sollten die Waschbären hin, wenn die Menschen dort, wo sie im Verborgenen lebten, etwas Neues bauten?
Bertrand berichtete von ein paar neuen Problemmachern. »Es sind an die sechs Stück. Sie haben etwas Hinterhältiges an sich.« Wir vereinbarten, sie im Auge zu behalten.
»Haben alle schon das Neueste am Hauptplatz gesehen?«, warf Yolanda ein.