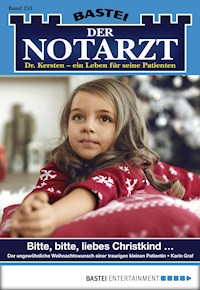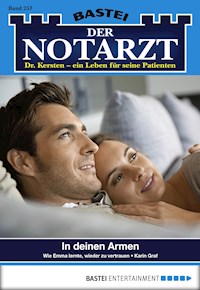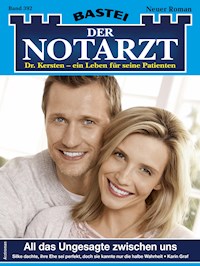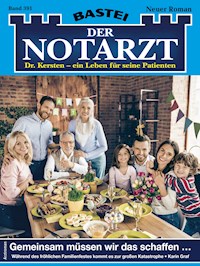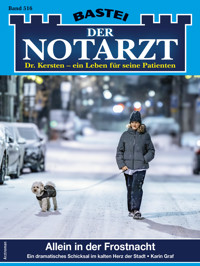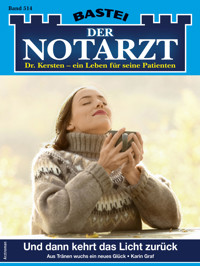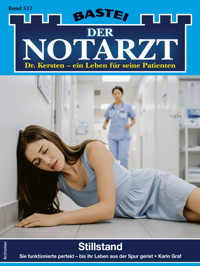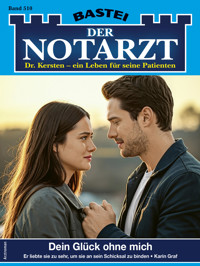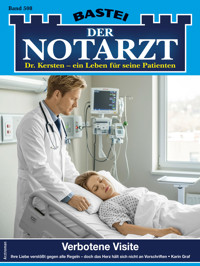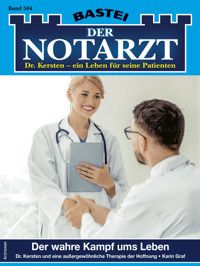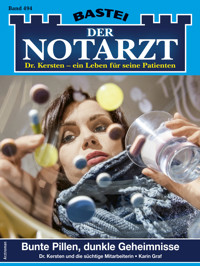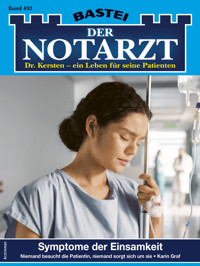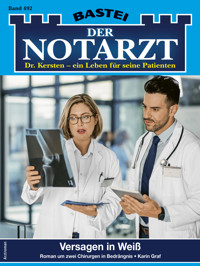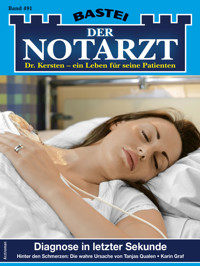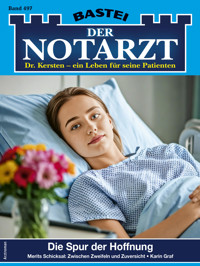
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer ist Henri? Und wo ist er? Diese Frage lässt die achtzehnjährige Merit Oswald nicht mehr los, seit ihre Tante Klara bei einer Familienfeier ein Baby namens Henri erwähnte. Tante Klara gilt zwar als ein wenig verwirrt, aber ihre Erinnerungen an Henri sind zu präzise, um frei erfunden zu sein. Stimmt vielleicht auch Tante Klaras Befürchtung, dass Henri unter dem Koiteich im Garten vergraben ist? Haben ihre Eltern etwas Furchtbares getan? Bevor Merit Antworten finden kann, schlägt das Schicksal mit voller Härte zu: Die Diagnose Blutkrebs reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. In der Sauerbruch-Klinik kämpft sie zwischen Leben und Tod - und die Zeit drängt. Dann geschieht das Unfassbare: Ein junger Arzt rettet sie im letzten Moment, indem er ihr sein eigenes Knochenmark spendet. Sein Name? Henri!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Die Spur der Hoffnung
Vorschau
Impressum
Die Spur der Hoffnung
Merits Schicksal: Zwischen Zweifeln und Zuversicht
Von Karin Graf
Wer ist Henri? Und wo ist er? Diese Frage lässt Merit Oswald nicht mehr los, seit ihre Tante Klara bei einer Familienfeier ein Baby namens Henri erwähnte.
Tante Klara gilt zwar als ein wenig verwirrt, aber ihre Erinnerungen an Henri sind zu präzise, um frei erfunden zu sein. Stimmt vielleicht auch Tante Klaras Befürchtung, dass Henri unter dem Koiteich im Garten vergraben ist? Haben ihre Eltern etwas Furchtbares getan?
Bevor Merit Antworten finden kann, schlägt das Schicksal mit voller Härte zu: Die Diagnose Blutkrebs reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. In der Sauerbruch-Klinik kämpft sie zwischen Leben und Tod – und die Zeit drängt.
Dann geschieht das Unfassbare: Ein junger Arzt rettet sie im letzten Moment, indem er ihr sein eigenes Knochenmark spendet. Sein Name? Henri!
»Henri! Wo ist Henri?«
Die eine Hälfte von Merit Oswalds großer Familie fuhr wie von der Tarantel gestochen herum, als Tante Klara diesen Namen aussprach oder besser gesagt, rief. Die andere Hälfte, die von Papas Seite, die guckten nur verständnislos, weil sie mit diesem Namen absolut nichts anfangen konnten.
Klara Neumeyer war die jüngere Schwester von Merits Mutter Karla Oswald, geborene Neumeyer. Sie hatte sich mit zehn Jahren eine Gehirnhautentzündung eingefangen und war seither ... na ja, um es höflich auszudrücken, sie war geistig zurückgeblieben.
Oder, wie Merits Vater Franz-Ferdinand Oswald es ausdrückte, sie hatte nicht mehr alle Nadeln an der Tanne, absolut keine Tassen mehr im Schrank, war ballaballa, gaga, schrummschrumm und strunzdoof.
»Iss deinen Braten und red keinen Unsinn, Klara!«, rügte ihre Schwester sie scharf.
»Henri, Henri, Henri! So hieß er doch, oder?« Tante Klara kippelte mit ihrem Stuhl vor und zurück. »Ich habe letzte Nacht von ihm geträumt. Wo ist Henri? Habt ihr ihn im Garten vergraben? Dort, wo jetzt der schicke Koiteich ist?«
Karlas Gesicht färbte sich schlagartig dunkelrot. Ihre Mutter, so dachte Merit, sah aus wie auf frischer Tat ertappt. Merkwürdig!
»Hör auf zu kippeln, Klara, und iss deinen Braten, sonst wird er kalt. Und wenn du nicht aufisst, bekommst du keinen Nachtisch! Du magst doch Nachtisch so gerne, nicht wahr? Und du weißt, was es gibt, denn du hast die Torte ja vorhin gesehen. Also, schweig jetzt und iss, oder du bekommst nicht ein einziges Stück davon!«
Die Wörter schossen nur so aus Karla heraus. Es hatte fast den Anschein, als ob sie verhindern wollte, dass ihre Schwester Klara auch nur noch ein einziges Wort sagen konnte.
Doch Tante Klara war ... eben Tante Klara. Sie konnte hartnäckig wie ein kleines Kind sein. Im Grunde genommen war sie das ja auch, zumindest im Kopf, obwohl sie in wenigen Wochen vierzig Jahre alt werden würde. Wenn Klara etwas wissen wollte, dann ... wollte sie es wissen! Da hätte selbst ein heranrasender Expresszug sie nicht stoppen können.
»Henri mochte Nachtisch auch sehr gerne, das weiß ich noch. Eiscreme hatte er am liebsten. Genau wie ich. Himbeere, Zitrone und Schokolade. Aber Torte mochte er auch. Wo ist Henri?«
»Wer ist denn Henri?«, fragte Onkel Hans-Jakob, einer der Brüder von Merits Vater.
Merits Vater zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich spinnt sie wieder einmal.« Er wandte sich an seine Frau. »Oder kennst du einen Henri?«
»Es gibt keinen Henri!«, erwiderte Karla Oswald wie aus der Pistole geschossen. »Es gab auch nie einen Henri! Das heißt ...« Sie lachte gekünstelt. »Jetzt weiß ich, was sie meint! Ich hatte einmal einen Kater namens Henri. Aber der ist doch schon lange tot, Klara.«
»Henri ist tot?« Tränen quollen unter den dichten, dunklen Wimpern der fast Vierzigjährigen hervor, die ziemlich hübsch war und der man es absolut nicht ansah, dass sie ... so war, wie sie war.
»Dass sie so schön ist, ist eine totale Verschwendung«, pflegte Merits Vater nach jedem Familienfest zu sagen. »Sie kann ja doch nichts damit anfangen. Einen Mann kriegt sie mit ihrer weichen Birne jedenfalls nie ab. Und bei Verrückten ist es ohnehin besser, wenn die sich nicht auch noch vermehren und noch mehr Verrückte in die Welt setzen.«
»Henri ist tot? Oje, oje, oje! Ich mochte ihn so gerne. Ich weiß noch, dass ich ihn einmal mit den Fläschchen füttern durfte, als er noch ganz klein war.«
»Die Katze war noch zu jung und zu klein, um selbst zu fressen!«, stellte Merits Mutter mit einem fast ängstlichen Blick in die Runde energisch klar. Dann hob sie auch noch die Hand und zeigte zwischen Daumen und Zeigefinger etwa fünf Zentimeter an. »So klein!«
»Und ich habe ihm hellblaue Höschen und Jäckchen gestrickt. Aus Schlafwolle.« Klara lachte. »Ich weiß genau, dass es in Wirklichkeit Schafwolle heißt. Schlafwolle, sage ich immer, weil man in Schafwolle so gut schläft. Henri hat darin wundervoll geschlafen, obwohl mir beim Stricken ein paar Maschen runtergefallen sind und bei den Söckchen immer ein Zeh herausgeguckt hat. Das hat Henri aber gar nichts ausgemacht.«
»Hellblaue Höschen mit vier Füßen dran?«, lachte Merit.
Sie mochte ihre Tante Klara. Während fast alle anderen Familienmitglieder sich für sie schämten, holte Merit ihre Tante oft aus dem Sanatorium ab, in das man sie abgeschoben hatte, und ging mit ihr bummeln oder in den Zoo, ins Kino oder im Wald spazieren, im Sommer ins Schwimmbad und im Winter Schlittenfahren.
Das Sanatorium, wie alle es nannten, war in Wahrheit ein betreutes Wohnheim für geistig behinderte Menschen. Aber Sanatorium klang einfach viel vornehmer.
»Vier?« Tante Klara sah ihre Nichte verdutzt an. »Wieso denn vier, liebe Merit? Henri hatte nur zwei Füßchen.«
»Er konnte auf den Hinterbeinchen laufen wie ein Mensch, der Kater! Henri war ein Kater! Er war grau-schwarz getigert! Der Kater!«
Merit warf ihrer Mutter einen verwunderten Blick zu. Sie hielt es doch sonst nie für notwendig, Tante Klaras oft recht wirre Geschichten richtigzustellen. Jetzt jedoch tat sie es mit einer solchen Vehemenz, als ob ihr Leben davon abhinge.
»Kater? Aber Henri war doch ...«
»Iss jetzt auf und schweig, Klara!«, fiel Karla ihrer Schwester energisch ins Wort. »Alle anderen sind mit dem Hauptgang fertig und warten darauf, dass die Käseplatte aufgetragen wird! Du hältst wieder einmal alle auf! Und an Merit denkst du wohl gar nicht? Merit bekommt ihre Geschenke erst nach der Käseplatte, wenn die Geburtstagstorte serviert wird. Deinetwegen muss sie nun eine halbe Ewigkeit lang darauf warten.«
»Meinetwegen?« Klara guckte auf dem Tisch herum und sah, dass tatsächlich alle Teller leer waren. Das hatte sie nicht gewollt, dass ihretwegen alle auf den Käse warten mussten und ihre allerliebste Lieblingsnichte auf ihre Geschenke.
Sie griff sich das noch ziemlich große Bratenstück mit den Fingern und schob es sich auf einmal in den Mund. Hinterher schob sie noch zwei kleine Kartoffeln und etwas Salat. Sie sah wie ein Feldhamster aus, der mit Wintervorräten voll beladen zu seiner Wohnhöhle unterwegs ist.
Zwei dünne Rinnsale aus Bratensoße liefen ihr aus den Mundwinkeln und tropften auf ihre geblümte Bluse.
»Klara!« Angela Neumeyer, Klaras und Karlas Mutter und Merits Großmutter, verdrehte stöhnend die Augen. »Kann man denn von dir nicht einmal ein Mindestmaß an Benehmen erwarten? Musst du dich immer wie ein ...«
»Lass sie doch!« Kurt Neumeyer, Merits Großvater, stieß seine Frau mit dem Ellbogen an. »Du weißt doch, dass sie schwachsinnig ist. Und uns geht das ja schon lange nichts mehr an. Wir haben unsere Schuldigkeit getan. Sie ist erwachsen, jetzt müssen sich andere um sie kümmern. Immerhin bezahlen wir ja auch genug dafür.«
Merit senkte den Kopf. Sie mochte es nicht, wenn so über Tante Klara geredet wurde. Schon als kleines Mädchen hatte sie sich vorgenommen, einmal einen Beruf zu erlernen, mit dem sie sehr viel Geld verdiente. Dann wollte sie Tante Klara zu sich zu nehmen und dafür sorgen, dass sie ein schönes Leben und viel Spaß hatte. Und dass nie mehr wieder jemand auch nur ein böses Wort über sie sagte!
Bald, sehr bald würde es so weit sein, denn sie wurde in wenigen Tagen achtzehn Jahre alt und hatte vor ein paar Tagen das Abitur mit der Bestnote bestanden. Genau deswegen fand ja auch heute die Familienfeier statt. Abitur und Geburtstag in einem Aufwasch.
Der nächste Gang verlief ohne weitere Zwischenfälle. Tante Klara schien den Kater Henri vergessen zu haben. Falls es sich überhaupt wirklich um einen Kater handelte.
Merit hatte diesbezüglich so ihre Zweifel, und sie hatte sich bereits fest vorgenommen, Tante Klara zu befragen, wenn sie einmal ein paar Minuten lang mit ihr alleine war.
Das Fotoalbum kam ihr wieder in den Sinn, das sie einmal gefunden hatte, als sie sieben oder acht Jahre alt gewesen war.
Sie hatte es beim Stöbern in den Kisten mit alten Sachen auf dem Dachboden entdeckt und darin geblättert. Es hatte einige Fotos von Mama mit einem Baby enthalten. Einem Baby in ziemlich schlampig gestrickten hellblauen Höschen und Jäckchen aus Schafwolle, nein, Schlafwolle, wie es ihr jetzt siedend heiß durch den Kopf schoss.
Sie war damals nicht über die Babyfotos hinausgekommen, denn ihre Mutter hatte sie beim Angucken überrascht und ihr das Album aus der Hand gerissen, als ob es sich um etwas schrecklich Gefährliches, Verbotenes oder Anrüchiges handeln würde.
Henri ...? Hatte sie vielleicht einmal ein älteres Brüderchen gehabt? Wenn ja, wohin war es verschwunden? Lag es vielleicht tatsächlich unter dem Koiteich? Tot, kalt und eingehüllt in eine Plastiktüte? Hatte es zu viel geschrien, und Mama oder Papa hatten es kurzerhand ... O Gott!
Merits ganzer Körper überzog sich unter ihrem neuen Kleid mit einer Gänsehaut.
Würde sie ihren Eltern so etwas Schreckliches zutrauen? Nein! Niemals! Oder ...? Na ja ...
Mama und Papa behandelten sie wie eine Prinzessin und verwöhnten sie nach Strich und Faden. Immer nur das Allerbeste für sie. Sie überschütteten sie förmlich mit Geschenken, mit Aufmerksamkeit und Liebe.
Aber Merit hatte schon sehr früh das Gefühl gehabt, dass ganz tief unter der rosaroten, zuckerwattigen Schicht aus Liebe und Geborgenheit etwas Grausames schlummerte. Immer wenn die beiden beispielsweise über Tante Klara sprachen, verließ Merit am liebsten das Zimmer, weil ihr die unschönen Worte in tiefster Seele wehtaten.
»Henri ...«, murmelte sie gedankenverloren und fast unhörbar.
»Was hast du gesagt, Merit?«, stellte ihre Mutter sie mit schneidender Stimme zur Rede.
»Henri. Ich habe Henri gesagt«, erwiderte Merit mit einem völlig unschuldigen Augenaufschlag. »Ich wollte auch immer ein Kätzchen haben. Ich habe aber nie eines bekommen.«
»Eben deswegen!«, erwiderte ihre Mutter hastig. »Weil ich mit diesem Kater damals so schrecklich viele Probleme hatte. Er hat alles zerkratzt und kaputt gemacht. Seither kommt mir kein Kätzchen mehr ins ...«
Ein vielstimmiges, langgezogenes »Aaaah!«, unterbrach Karlas linkische Rechtfertigung, die Merit noch misstrauischer machte, als sie es ohnehin schon gewesen war.
Ida, die Haushälterin, die schon vor Merits Geburt hier gewesen war, schob einen silbernen Servierwagen in das große Esszimmer. Darauf stand eine dreistöckige Torte in Merits Lieblingsfarben Orangerot und Gold, die mit weißen Zuckerröschen und achtzehn Kerzen verziert war.
Wie auf Kommando fingen sie alle zu singen an. »Zum Geburtstag viel Glück ...«
»Auspusten!«, riefen sie, als der letzte Ton verklungen war. Merit stand auf. »O Gott, es sind so viele! Das schaffe ich niemals auf einmal. Tante Klara, du musst mir dabei helfen.«
»Nicht doch!« Merits Vater schüttelte entschieden den Kopf. »Blöde und ungeschickt wie sie ist, macht sie die schöne Torte kaputt!«
»Es ist doch meine Torte, oder, Papa?«
»Natürlich, Prinzessin.«
»Gut! Und ich möchte, dass Tante Klara mir beim Auspusten hilft.«
»Auch beim Auspacken der Geschenke?« Klara guckte sehnsüchtig zu der Anrichte, auf der sich die Pakete türmten. Für sie machte sich schon lange niemand mehr die Mühe, eine Geburtstagsparty zu arrangieren. Wenn Merit nicht wäre, bekäme sie nicht einmal mehr ein Geschenk.
»Klara!«, wollte Merits Großmutter ihre schwachsinnige Tochter zurechtweisen, doch Merit ließ sie gar nicht erst zu Wort kommen.
»Auch beim Auspacken der Geschenke, Klara. Auch das schaffe ich niemals alleine. Es sind zu viele.«
Sie beugte sich über den riesigen Kuchen, und ihre Tante tat es ihr gleich.
»Auf drei, Tante Klara!«
»Ach, die kann doch nicht mal bis drei zählen!«, spottete Karla, doch Merit hörte nicht auf sie. Sie legte den Arm um Klaras Taille, zählte langsam bis drei, dann pusteten sie mit vereinten Kräften alle achtzehn Kerzen mit einem Atemzug aus.
»Danke, das hat großen Spaß gemacht«, flüsterte Klara Neumeyer in Merits Ohr.
»Danke, dass es dich gibt. Du bist meine beste Freundin, und ich hab dich sehr lieb«, flüsterte Merit zurück.
***
In der Frankfurter Sauerbruch-Klinik, keine zwanzig Kilometer von Bad Homburg entfernt, wo Merit und ihre Tante Klara jetzt mit Begeisterung die Pakete auszupacken begannen, betrat Dr. Peter Kersten den Bereitschaftsraum in der Notaufnahme.
»Kollege Romanovsky, der Chefarzt erwartet dich in seinem Büro«, sagte er ernst.
Der fünfundzwanzigjährige Assistenzarzt, der erst seit Montag in der Notaufnahme arbeitete, hob überrascht den Kopf.
»Heute? Es ist doch Samstag. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Chefarzt an einem Samstag in seiner Klinik ist. Sind die da nicht üblicherweise auf dem Golfplatz oder schippern auf ihrer Jacht über die Ostsee?«
Peter lachte. »Normalerweise schon. Aber unser Chefarzt ist nebenher ja auch noch der Leiter unserer Kardiologie, wie du wohl weißt. Es grenzt schon an ein Wunder, wenn er überhaupt hin und wieder mal nach Hause geht. Und Golf, Golf mag er nicht. Eine Jacht hat er übrigens auch nicht. Noch nicht mal einen Ferrari, eine goldene Rolex-Uhr oder eine vierzig Jahre jüngere Freundin.«
»Okay, das ist für einen Chefarzt wirklich außergewöhnlich«, lachte der junge Arzt. »Er will mich also sprechen? Um was geht es denn?«
Peter zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Geh rauf und finde es heraus.«
Als der junge Kollege den Bereitschaftsraum verlassen hatte, seufzte der Leiter der Notaufnahme tief. Er hatte geschwindelt. Er hatte doch zumindest eine ungefähre Ahnung, warum Prof. Lutz Weidner Romanovsky sprechen wollte, und das machte ihm Sorgen.
Sorgen deshalb, weil er den attraktiven jungen Mann vom ersten Moment an ins Herz geschlossen hatte.
Dr. Romanovsky war nicht nur unglaublich liebenswert und sympathisch, er war noch dazu auch ein verdammt guter Arzt.
Mit erst fünfundzwanzig Jahren hatte er seine Ausbildung zum Facharzt für Onkologie und Chirurgie nahezu abgeschlossen. In wenigen Wochen würde er beide Facharztprüfungen ablegen können, und Peter zweifelte keine Sekunde lang daran, dass er sie auch bestand.