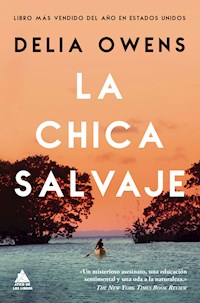9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gutkind Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Inspiration zum Weltbestseller Der Gesang der Flusskrebse: Mark und Delia Owens Seite an Seite mit Wildtieren in der Kalahari-Wüste - jetzt in Neuübersetzung Wir begleiten Mark und Delia Owens auf ihrer lebensgefährlichen Reise in das Herz der Kalahari-Wüste Botswanas. Mit nicht viel mehr als einem Fernglas und zwei Schlafsäcken im Gepäck, machen sich die beiden Zoologen 1974 auf in die Wildnis Afrikas - tausende Kilometer entfernt von Straßen, anderen Menschen oder der nächsten Wasserquelle. In dieser Einöde leben die Owens' Seite an Seite mit der Löwin Blue, der Hyäne Pepper, Schakalen, Wildhunden und Giraffen, während sie die Geheimnisse des Lebens in einem der letzten unberührten Gebiete der Erde enthüllen. Dieser mitreißende Klassiker des Nature Writing entführt uns in eines der letzten unberührten Gebiete der Erde, getrieben von der tiefen Liebe zur Natur. Der Ruf der Kalahari erscheint als aktualisierte Neuübersetzung. Tauchen Sie ein in die Magie der Kalahari und lassen Sie sich von diesem packenden Bericht mitreißen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Der Klassiker des Naturewriting von Mark Owens und Weltbestseller-Autorin Delia Owens
1974: Mit wenig mehr im Gepäck als einem Fernglas und zwei Schlafsäcken machen sich Mark und Delia Owens auf nach Botswana. In einem alten Land Rover fahren sie in die Kalahari-Wüste, wo sie sieben Jahre verbringen werden – tausende Kilometer entfernt von Straßen, Menschen oder der nächsten Wasserquelle. In dieser faszinierenden Einöde leben die Owens’ Seite an Seite mit der Löwin Blue, der Hyäne Pepper, Schakalen, Wildhunden und Giraffen.
Ein mitreißend geschriebener Klassiker des Naturewriting über eines der letzten unberührten Gebiete der Erde, durchglüht von der tiefen Liebe zur Natur.
Neu übersetzt und mit bisher unveröffentlichten Farbfotografien der Autoren.
„Lebendig und mitreißend.“ Los Angeles Times
„Eines der bewegendsten Zeugnisse vom Durchhaltevermögen, Idealismus und Mut von leidenschaftlichen Wildtierforschern.“ Washington Post
„Wunderbar. Die Erzählung ihres Überlebens ist fantastisch. Ein bewegendes Buch, tröstend und elegisch.“ Newsweek
„Eine außergewöhnliche Geschichte, meisterhaft erzählt.“ Chicago Tribune
„Außergewöhnlich. Wie dieses Paar die Gefahren der Wüste überlebt und lernt, deren Reichtum wertzuschätzen, ist faszinierend zu lesen. Die Lektüre dieses herausragenden Buches verzückt, bewegt und beeindruckt.” People Magazine
Die Autoren
Mark Owens ist Zoologe und Naturschützer. Gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Delia hat er die internationalen Bestseller Der Ruf der Kalahari, Das Auge des Elefanten und Secrets of the Savanna geschrieben.
Delia Owens erforschte über zwanzig Jahre als Zoologin zusammen mit ihrem damaligen Mann Mark in verschiedenen afrikanischen Ländern Elefanten, Löwen und Hyänen. Ihr Roman Der Gesang der Flusskrebse ist eines der erfolgreichsten US-amerikanischen Debüts aller Zeiten. Sie lebt auf einer Farm in North Carolina mit Pferden, Braunbären und unzähligen Vogelarten.
Die Übersetzerin
Elisabeth Liebl übersetzt aus dem Englischen, Italienischen und Französischen und übertrug unter anderem Lori Gottlieb, Nelson Mandela und Bob Woodward ins Deutsche.
Mark und
Delia Owens
Der Ruf
der
Kalahari
Mit Fotos der Autoren
Aus dem amerikanischen Englisch von Elisabeth Liebl
www.gutkind-verlag.de
Die Originalausgabe ist erstmals 1984 unter dem Titel The Cry of the Kalahari bei Houghton Mifflin, New York, erschienen.
ISBN 978-3-98941-025-1
Copyright der deutschen Neuausgabe © 2024: Gutkind Verlag GmbH, Berlin
Copyright der Originalausgabe:© 1984 Mark Owens und Delia Owens
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Umschlag: FAVORITBUERO, München
Umschlagabbildung: © Mark Owens und Delia Owens
Autorenfoto: © privat
Alle Fotos im Bildteil: © Mark Owens und Delia Owens
Karten von Botswana und Deception Valley: © Neil Gower
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Inhalt
Über das Buch / Über die Autoren
Titel
Impressum
Widmung
Vorwort
1 Die Jumblies
2 Wasser
3 Feuer
4 Der Ruf der Kalahari
5 Star
6 Im Lager
7 Maun: Wo die Zivilisation endet
8 Bones
9 Die Rivalität der Fleischfresser
10 Löwen im Regen
11 Die Geschichte mit Herrn van der Westhuizen
12 Rückkehr ins Deception Valley
13 Abschied vom Valley
14 Die Trophäenhütte
15 Echo Whisky Golf
16 Die Vagabunden der Kalahari
17 Die Kinder der Vagabundin
18 Löwen ohne Rudel
19 Der Staub meines Freundes
20 Eine Schule für Aasfresser
21 Pepper
22 Muffin
23 Uran
24 Blue
25 Schwarze Perlen in der Wüste
26 Der Rausch der Kalahari
Nachwort
Bibliografie
Danksagung
Bildteil
Orientierungsmarken
Cover
Inhalt
Textbeginn
Wir widmen dieses Buch dem Andenken an Dr. Richard Faust und Ingrid Koberstein von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, die so viel für die Tiere dieser Erde getan haben.
Und Christopher, der nicht mehr bei uns ist.
Vorwort
(mark)
Meine linke Schulter und Hüfte schmerzten vom harten Boden. Ich rollte mich auf die rechte Seite, schob mich über Grasbüschel und Steine, doch ich fand einfach keine bequeme Position. Die morgendliche Kälte trieb mich tiefer in meinen Schlafsack. Ich wollte unbedingt noch ein paar Minuten Schlaf finden.
Am Abend zuvor waren wir im Valley nach Norden gefahren, stets dem Brüllen eines Löwenrudels folgend. Aber ab drei Uhr morgens gaben sie keinen Laut mehr von sich. Vermutlich hatten sie Beute gemacht. Ohne ihre Stimmen, die uns führten, würden wir sie nicht finden. Daher hatten wir uns auf einer schmalen Lichtung neben einer dichten Hecke hingelegt. Nun glänzten unsere Nylonschlafsäcke in der Morgensonne wie die Haut zweier gigantischer Würmer.
Rrrrruuu – ein leises Knurren erschreckte mich. Ganz langsam hob ich den Kopf, spähte über meine Füße … ich konnte es nicht fassen. Eine ziemlich große Löwin – wohl um die hundertdreißig Kilo schwer –, und aus meiner Position wirkte sie noch riesiger. Sie kam direkt auf uns zu, war vielleicht noch eineinhalb Meter entfernt. Ihr Haupt schwankte hin und her, während ihre schwarze Schwanzquaste zuckte. Ich umklammerte mit eisernem Griff ein Grasbüschel. Die Löwin kam näher, ihre großen Pfoten hoben und senkten sich rhythmisch. Tautropfen glänzten an ihren drahtigen Schnurrhaaren, die dunklen, bernsteinfarbenen Augen waren aufmerksam auf mich gerichtet. Ich hätte Delia gern geweckt, hatte aber Angst, mich zu bewegen.
Als die Großkatze bei unseren Füßen angelangt war, wandte sie sich um.
»Delia! Schschsch! Wach auf! Die Löwen sind hier!«
Delias Kopf kam nach oben, ihre Augen weiteten sich. Der lange Körper der Katze, die von der Nasen- bis zur Schwanzspitze vermutlich knapp drei Meter maß, schob sich an uns vorbei und verschwand hinter einem nahen Busch. Delia ergriff meinen Arm und deutete ganz ruhig nach rechts. Langsam wandte ich den Kopf und sah eine zweite Löwin, ungefähr vier Meter entfernt auf der anderen Seite des Busches … und noch eine … und noch eine. Das ganze Blaue Rudel, neun Tiere insgesamt, bildete einen Kreis um uns. Doch fast alle Löwen schliefen noch. Wir teilten unser Lager buchstäblich mit einem Rudel wilder Kalahari-Löwen.
Blue lag auf dem Rücken wie eine riesige Hauskatze. Ihre Augen waren geschlossen, die Hinterbeine gaben den Blick auf das weiche weiße Bauchfell frei. Die Vorderpfoten hatte sie über der Brust gefaltet. Hinter ihr lag Bones, das große Männchen mit der struppigen schwarzen Mähne und der runzligen Narbe über dem Knie – Zeichen einer improvisierten Operation in finsterer Nacht nur wenige Monate zuvor. Gemeinsam mit Chary, Sassy, Gypsy und den anderen hatte er sich uns irgendwann vor dem Morgengrauen angeschlossen.
Wir würden noch öfter mit Kalahari-Löwen auf Tuchfühlung gehen und einige dieser Begegnungen würden nicht unbedingt freundschaftlich verlaufen. Doch dass das Blaue Rudel uns so selbstverständlich akzeptierte, dass es unser Lager zum Schlafplatz erwählte, war einer der schönsten Momente zu Beginn unserer Forschungsarbeiten in der weitläufigen zentralen Kalahari von Botswana im Süden Afrikas. Das Ganze war nicht leicht gewesen.
Als junge, idealistische Studenten waren wir auf eigene Faust nach Afrika aufgebrochen, um die Tierwelt in der Wildnis zu erforschen. Nach Monaten, in denen wir uns nach einer weitgehend unberührten Region umgesehen hatten, stießen wir auf die »Great Thirst«. Eine Wildnis, die so abgeschieden war, dass wir dort neben ein paar indigenen San-Gruppen die einzigen Menschen waren – auf einer Fläche, die so groß war wie Irland. Aufgrund der Hitze und weil es an Wasser sowie an Baumaterial für Hütten fehlte, war der Großteil der Zentral-Kalahari unerforscht und nicht besiedelt. Es gab kein Dorf in der Nähe von unserem Lager, in das man einfach mal die Straße runter hätte fahren können. Es gab ja noch nicht einmal eine Straße. Wir mussten unser Wasser ungefähr hundertfünfzig Kilometer durch den Busch transportieren. Und da es weder eine Hütte gab noch Elektrizität, Funk, Fernsehen, ein Krankenhaus oder einen Laden, da zudem jedes Anzeichen von anderen Menschen und der von ihnen geschaffenen Gegenstände fehlte, waren wir monatelang völlig abgeschnitten von der Außenwelt.
Die meisten Tiere, auf die wir hier stießen, hatten nie einen Menschen gesehen. Man hatte nie auf sie geschossen, sie nie mit dem Jeep gejagt, in Fallen gelockt oder mit Schlingen gefangen. Aus diesem Grund eröffnete sich uns die seltene Gelegenheit, sie auf eine Weise kennenzulernen, wie Menschen Wildtieren wohl nur selten begegnen. In der Regenzeit wachten wir manchmal auf und sahen, dass gut dreitausend Antilopen rund um unser Zelt grasten. Löwen, Leoparden und Schabrackenhyänen besuchten nachts unser Lager. Sie weckten uns, weil sie an den Abspannseilen unseres Zelts zerrten, oder überraschten uns in unserer Bade-Boma. Wenn wir vergaßen, das Abwaschwasser wegzuschütten, machten sie sich darüber her. Manchmal saßen sie mit uns im Mondlicht oder schnupperten gar an unseren Gesichtern.
Es war gefährlich – wir gingen täglich Risiken ein – und es kam auch beinahe zu Katastrophen, die wir nur mit viel Glück überlebten. Wir begegneten Terroristen, das Wasser ging uns aus, Stürme zogen über uns hinweg und Dürrezeiten zehrten uns aus. Wir kämpften uns durch kilometerlange Buschfeuer, die über unser Lager hinwegfegten – und wir lernten in der Wüste einen alten Mann kennen, der uns half, zu überleben.
Als wir mit einem Land Rover aus dritter Hand in einem Tal namens »Deception« – Täuschung – landeten und dort unser Lagerfeuer entzündeten, konnten wir nicht ahnen, dass wir neue und aufregende Details über die Naturgeschichte der Kalahari-Löwen und der Schabrackenhyänen aufdecken würden: wie sie Dürreperioden überleben, in denen es kein Trinkwasser gibt und allgemein Nahrungsmangel herrscht; ob sie herumwandern, um dieser Not auszuweichen; und wie die Angehörigen einer Art zusammen ihre Jungen großziehen. Wir würden eine der größten Antilopenwanderungen auf der Erde dokumentieren und feststellen, dass Zäune der Kalahari das Leben rauben.
Ich weiß nicht mehr genau, wann wir beschlossen hatten, nach Afrika zu gehen. Irgendwie hatten wir beide uns das wohl schon immer gewünscht. So lange wir denken können, haben wir jede Gelegenheit genutzt, um in die wilde Natur einzutauchen, um dort Kraft, Frieden und Einsamkeit zu finden. Damit verbunden war von Anfang an der innige Wunsch, sie vor der Zerstörung zu bewahren. Ich weiß noch gut, wie bestürzt und traurig ich war, als ich als Junge von meinem Beobachtungsposten ganz oben in einer Windmühle zusehen musste, wie mehrere Bulldozer sich durch die Wälder rund um unsere Farm in Ohio fraßen. Diese Bäume mussten einer Schnellstraße weichen – und würden mein Leben für immer verändern.
Delia und ich lernten uns in einem Seminar über Protozoologie (Zoologie der Urtierchen) an der Universität von Georgia kennen. Es dauerte nicht lange, bis wir herausfanden, dass wir ein gemeinsames Ziel hatten. Am Ende des Semesters war uns beiden klar, dass wir zusammen nach Afrika gehen würden. Zu jener Zeit hörten wir einen Vortrag von einem Wissenschaftler, der an unserer Universität Gastdozent war. Er sprach darüber, dass Afrikas Wildnis dem Untergang geweiht war: Mehr als zwei Drittel der Wildtiere waren bereits verschwunden, weil man sie aus ihrem natürlichen Habitat vertrieb, um Städte und riesige Farmen anzulegen. Im Süden Afrikas lockte man Tausende Beutegreifer in Fallen, erschoss und vergiftete sie, um das Vieh vor ihnen zu schützen. In manchen afrikanischen Ländern waren Naturschutz und sinnvolle Strategien zur Bewahrung von Flora und Fauna vollkommen unbekannt.
Das waren erschreckende Informationen. Und so beschlossen Delia und ich, ein afrikanisches Raubtier in einem großen, unberührten Gebiet zu studieren. Unsere Arbeit sollte dazu beitragen, dass Programme für den Erhalt solcher Ökosysteme entwickelt werden konnten. Vielleicht aber wollten wir auch nur sehen, ob es diese Art von Wildnis überhaupt noch gab. Nur wenn wir uns nicht auf der Stelle aufmachen würden, dann wäre vielleicht nichts mehr da, was wir noch erforschen konnten.
Im Rahmen unserer Doktorarbeiten nach Afrika zu gehen hätte noch jahrelanges Warten bedeutet. Und ohne Doktortitel waren die Chancen gleich null, ein Forschungsstipendium zu bekommen. Also entschieden wir uns für eine vorübergehende Auszeit von der Universität. Wir wollten genug Geld verdienen, um die Expedition selbst zu finanzieren. Wenn wir erst einmal den richtigen Ort gefunden hätten und da Feldforschung betrieben, dann, so dachten wir, würde irgendjemand uns schon ein Stipendium geben.
Nach sechs Monaten, in denen wir als Lehrer arbeiteten, hatten wir immer noch keinen Dollar zur Seite legen können. Ich suchte mir also einen anderen Job im Steinbruch, wo ich den Brecher bediente. Delia nahm alle möglichen Gelegenheitsarbeiten an. Nach einem weiteren halben Jahr hatten wir 4900 US-Dollar gespart sowie das Geld für die Flugtickets nach Johannesburg in Südafrika. Das reichte natürlich nicht einmal ansatzweise zur Finanzierung eines Forschungsprojektes. Aber es war Ende 1973, und die arabischen Staaten hatten gerade angefangen, dem billigen Öl in aller Welt einen Riegel vorzuschieben. Die Preise für Rohöl stiegen durch die Decke. Wenn wir jetzt nicht gehen würden, dann würde daraus vermutlich nie etwas werden.
Im verzweifelten Versuch, noch mehr Geld zusammenzukratzen, packten wir alles, was wir hatten – Stereoanlage, Radio, Fernseher, Angelruten und -rollen, Töpfe und Pfannen – in unseren kleinen Kombi und fuhren damit eines Morgens zum Steinbruch: Ich stand auf dem Auto und leitete die Auktion. Wir verkauften alles, inklusive Kombi, für insgesamt 1100 US-Dollar.
Am 4. Januar 1974 – ein Jahr nach unserer Eheschließung – bestiegen wir das Flugzeug: mit zwei Rucksäcken, zwei Schlafsäcken, einem Zwei-Personen-Zelt, einer kleinen Kochausrüstung, einer Kamera, je einer Garnitur Wechselkleidung und insgesamt 6000 Dollar. Mehr hatten wir nicht, um mit unserer Forschung zu beginnen.
In diesem Buch geht es nicht um eine detaillierte Darstellung unserer Forschungsergebnisse, die anderswo publiziert ist. Hier steht unser Leben mit den Tieren im Mittelpunkt, mit Löwen, Schabrackenhyänen, Schakalen, Vögeln, Spitzmäusen, Eidechsen und vielen anderen Geschöpfen, die wir kennenlernen durften. Diese Geschichte handelt davon, wie wir in einem der letzten großen, unberührten Gebiete dieser Erde überlebt und Tag für Tag unsere Forschung vorangetrieben haben. Die Geschichte haben wir unseren Tagebüchern entnommen. Die Dinge haben sich durchweg so zugetragen, und wahr sind auch die Namen und Dialoge. Obwohl jedes Kapitel immer nur von einer Person erzählt wird, haben wir das Erzählte gemeinsam erlebt und das Buch auch gemeinsam geschrieben.
1
Die Jumblies
Sie stachen in See per Sieb, so war’s,
Per Sieb stachen sie in See:
Und all ihre Freunde riefen halt,
Es war Winter, stürmisch recht sehr und kalt,
Per Sieb stachen sie in See!
…
Ungenau, fern im Grau,
Schwimmt das Land, das den Jumblies lieb;
Ihr Kopf ist grün, ihre Hände sind blau,
Und sie stachen in See per Sieb.
— Edward Lear, Die Jumblies
Ich konnte nicht schlafen. Mit der Stirn lehnte ich mich an das dicke Doppelfenster des Jets und starrte in die Dunkelheit der Nacht über dem Atlantik. Die Welt unten flog vorbei, während das Flugzeug in die afrikanische Morgendämmerung steuerte.
Vorsichtig und anmutig betritt der Gepard die weite Ebene. Mit erhobenem Haupt und fließenden Bewegungen nähert er sich der grasenden Herde, den Schwanz leicht gekrümmt. Die Gazellen werden unruhig, flüchten jedoch nicht. Die Katze ist hungrig und setzt zum Spurt an.
Das Flugzeug durchquerte die Dämmerung. Bald setzte es in der Nähe einer größeren Stadt auf einer Asphaltbahn auf und spuckte seine Passagiere aus. Zollbeamte in kurzen Hosen und makellos weißen Hemden mit dicken schwarzen Epauletten bellten Befehle und fuchtelten mit ihren Klemmbrettern herum. Wir füllten lange Formulare und Fragebögen aus, warteten in überfüllten Sälen und spähten durch den Maschendrahtzaun.
Geschwindigkeit, Koordination, Gleichgewicht und Form in absoluter Vollkommenheit: Der Gepard beschleunigt, die Gazellen setzen zur Flucht an. Er hat sich eine herausgepickt. Andere sprengen nach rechts und links, der ewige Wettlauf zwischen Jäger und Beute hebt an.
Ein kleineres Flugzeug, ein kürzerer Flug – wir sind eine Ewigkeit unterwegs. Dann der Zug. Wir starren nur noch blicklos auf unser Spiegelbild im Fenster. Meilenweit nichts als Dornsträucher. Alles sieht gleich aus, während wir, begleitet vom Rattern des Zuges auf den Schienen, durch die Landschaft donnern. »Ratter, ratter, du kannst nicht raus und nie mehr zurück, ratter, ratter …«
Der Gepard ist nur noch ein Schemen in der Ebene. Siebzig, achtzig, neunzig Stundenkilometer schnell schießt die lebende Rakete aufihr Ziel zu. In diesem Augenblick, in dem er das auf und ab tanzende Hinterteil seiner Beute vor Augen hat, lässt sich die tiefe Schönheit dieses Wettkampfes nicht mehrleugnen. Jeder der beiden ein Bildhauer, der– mit den Äonen der Zeit als Hammer und der Entwicklungsgeschichte als Meißel– im anderen etwas von so vollkommener Form und Vitalität, von solcher Wahrheit herausarbeitet, dass es niemals nachgeahmt werden kann. Diese Beziehung ist die Essenz der Natur.
Für die Gazelle ist der Moment der Wahrheit gekommen. Der Gepard, immer noch inHöchstgeschwindigkeit, holt mit der Pranke aus und bringt seiner Beute aus dem Gleichgewicht. Die Gazelle schlägt einen Haken, die vollkommene Form ist zerstört. Mit einer Geschwindigkeit von neunzig Stundenkilometern durchtrennt der Zaun die Nase des Geparden, dessen Kiefer und schleudert ihm den Kopf in den Nacken. Bevor die Bewegung im Zaun endet, ist der elegante Hals bereits gebrochen, der Splitter eines weißen Knochens schiebt sich aus seinem Vorderlauf. Der Zaun schnellt zurück und spuckt die zerbrochene, zerrissene und blutige Form in den Schmutz.
Die Druckluftbremse zischt, der Zug kommt mit einem Ruck zum Stehen und unterbricht den Albtraum. Wir schultern unsere Rucksäcke und stehen plötzlich an einem sandigen Bahnhof in der schwarzen afrikanischen Nacht. Hinter uns schnauft die Diesellok auf und die Wagenkupplungen scheppern, als der Zug sich wieder in Bewegung setzt. Mutterseelenallein standen wir nun um zwei Uhr morgens vor dem verfallenen Bahnhofsgebäude und fühlten uns wie in einem langen, finsteren Tunnel. Am einen Ende war im schwachgelben Licht einer Lampe ein Schild erkennbar: GABORONE BOTSWANA.
Die dunkle Stille schien uns zu verschlingen. Allein in einem fremden Land mit so wenig Geld, dass es in einer Seitentasche meines Rucksacks Platz hatte: Auf einmal hatten wir das Gefühl, dass diese Herausforderung nicht zu bewältigen war. Wir mussten einen Wagen mit Allradantrieb kaufen, das richtige Gebiet suchen und Forschungen betreiben, die aussagekräftig genug waren, um ein Stipendium zu erhalten, bevor unser Geld aufgebraucht war. Doch hatte uns auch die Reise erschöpft, und ehe wir uns überhaupt Sorgen machen konnten, brauchten wir erst einmal Schlaf.
Auf der anderen Seite der Lehmstraße baumelte eine zweite schwache Glühbirne. Sie erhellte die zerrissene Fliegengittertür des Gaborone Hotels – ein verfallenes Gebäude, von dessen Wänden die Farbe abplatzte. Rund ums Fundament wucherte kniehoch das Gras. Die Zimmer kosteten acht Dollar pro Nacht – mehr, als wir uns leisten konnten.
Als wir uns umdrehten und in die Nacht hinausgingen, rief der Nachtportier des Hotels uns hinterher. Er hielt eine flackernde Kerze in der Hand, die er mit der anderen abschirmte. So führte er uns durch die Lobby in den kleinen Hof hinaus, der von Unkraut und Dornbüschen überwuchert war. Sein breites Lächeln entblößte Zähne, die so braun waren wie verrostete Bolzen. Doch der Alte deutete zuerst auf meinen Rucksack, dann auf den Boden. Wir verbeugten uns dankbar und hatten innerhalb weniger Minuten unser kleines Zelt neben einem Dornbusch aufgeschlagen. Schon krochen wir in die Schlafsäcke.
Am Morgen weckte uns das Geplauder der Botsuaner, die wie Ameisen in Kolonnen durch Dornbüsche und hohes Gras auf den Ort zuhielten. Viele von ihnen trugen offene westliche Hemden, farbenfrohe Hosen und Kleider europäischen Zuschnitts, auch wenn die Farben für unser Empfinden nicht zusammenpassten. Frauen trugen alle möglichen Lasten auf dem Kopf – Halblitermilchkartons, einen Korb mit Früchten oder an die zwanzig Kilo Feuerholz. Ein Mann hatte sich Reste von alten Autoreifen als Sandalen um die Füße gebunden. Um die Schultern hatte er einen Umhang aus Ziegenleder geworfen. Vom Kopf baumelte ihm verwegen der getupfte Schwanz einer Ginsterkatze, deren Fell ihm als Mütze diente. Diese Menschen verdienten sich ihr Geld, indem sie Falken schnitzten, Gehstöcke und andere Dinge, die sie dann durch die Zugfenster an Reisende verkauften. Sie lebten in Baracken und Unterständen aus Wellblech, Pappe, alten Brettern und Lehmziegeln. Eine der Hütten war nur aus leeren Bierdosen gebaut.
Wir betrachteten die Szenerie und Delia flüsterte: »Wo zum Teufel sind wir hier gelandet?«
Wir packten unsere Sachen und marschierten durch den Rauch der Holzfeuer in die Stadt Gaborone, die sich am Fuß einiger felsiger Hügel ausbreitete. Sie ist die Hauptstadt von Botswana, das bis zu seiner Unabhängigkeit im Jahr 1967 unter dem Namen Protektorat Britisch Bechuanaland bekannt war. Architektonisch ist die Stadt ein wilder Mix: Eine breite Straße mit kleinen Lädchen und einigen dreistöckigen Bürogebäuden westlicher Bauart teilt eine Ansammlung von Rundhütten aus Lehm und Stroh, die man Rondavel nennt. Die staubigen Wege führten uns vorbei an Einheimischen in europäischer Kleidung und Europäern in Stoffen, die mit afrikanischen Mustern bedruckt waren.
Eine interessante kulturelle Mischung. Außerdem gingen in Gaborone die Uhren langsamer. Zwei Monate nach unserer Ankunft in Botswana saßen wir hier immer noch fest. Tag um Tag marschierten wir von einer isoliert operierenden Regierungsbehörde zur nächsten und bemühten uns um Aufenthalts- und Forschungserlaubnis. Und wir trafen uns mit Menschen, die vielleicht wussten, wo wir mit unseren Forschungsarbeiten ansetzen sollten. Wir waren fest entschlossen, einen Ort zu finden, wo es keine Zäune gab und das Verhalten der Raubtiere noch nicht von der Gegenwart menschlicher Siedlungen geprägt war.
Aus den Erzählungen konnten wir entnehmen, dass für unsere Studienvorhaben vermutlich die entlegenen Regionen des nördlichen Botswana am ehesten infrage kamen, doch niemand vom Wildlife Department hatte diese unzugänglichen Gebiete je bereist. Da wir keine Guides fanden, schien die Expedition plötzlich viel schwieriger und risikoreicher, als wir ursprünglich angenommen hatten. Und selbst wenn wir den Weg in eines dieser nicht erschlossenen Areale von Botswana fänden, so würden wir doch Lebensmittel, Treibstoff und andere Vorräte über weite Strecken nicht kartiertes Buschland transportieren müssen, um unser Forschungslager dauerhaft zu versorgen. Darüber hinaus stand fast das ganze nördliche Drittel des Landes unter Wasser, weil es dort die heftigsten Regenfälle seit Beginn der meteorologischen Aufzeichnungen gegeben hatte. Die einzige Straße nach Norden war nun schon seit Monaten nicht passierbar.
Eine unserer dringlichsten Aufgaben war es, unter der Menge ramponierter Allradfahrzeuge, die in der Stadt unterwegs waren, eines für uns zu finden. Das Beste, was wir uns leisten konnten, war ein alter Land Rover mit einem eingedellten Dach, dessen trist graue Farbe von Dornbüschen zerkratzt war. Wir kauften den alten »Grey Goose« für 1000 Rand (etwa 1500 US-Dollar), überholten den Motor, bauten einen Reservebenzintank ein sowie hinten flache Lagerkisten. Mit einer Lage Schaumstoff bedeckt konnten die Kisten uns als Bett dienen.
Als wir unsere Graugans endlich fertig ausgestattet hatten, war es März 1974. Wir waren immer noch nicht dazugekommen, mit der Feldforschung zu beginnen, und besaßen nur noch 3800 Dollar. 1500 Dollar würde uns der Flug nach Hause kosten, sollten wir kein Stipendium an Land ziehen. Jede Verzögerung bedeutete, dass wir kostbare Zeit verplemperten. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollten, dass eine Organisation uns finanzierte, bevor uns das Geld ausging, dann mussten wir auf der Stelle ein Gebiet finden, das zu erforschen sich lohnte, und uns schleunigst an die Arbeit machen. Und so brachen wir auf, allen Warnungen, dass wir es nie in den Norden des Landes schaffen würden, zum Trotz. Wir verließen Gaborone und rollten in die Dornstrauchsavanne hinaus.
Einige Meilen außerhalb der Stadt ließen wir unter knochenzermürbendem Rumpeln die einzige asphaltierte Straße Botswanas hinter uns. Während ich Slalom fuhr, um Schlaglöchern und Spurrillen auszuweichen, brachte die schmale Schotterpiste uns tiefer und tiefer ins Buschland. Ich nahm einen tiefen Atemzug und saugte das wilde Afrika in mich ein. Endlich hatte unsere Forschungsarbeit begonnen. Das Gefühl von Freiheit und Abenteuer war berauschend. Ich zog Delia eng an mich. Sie lächelte mich an – ein Lächeln, das alle Spannungen fortwischte, die sich in den langen, frustrierenden Wochen der Vorbereitung aufgebaut haben mochten. Ihr Blick signalisierte mir ihr ungebrochenes Vertrauen, dass wir mit allem fertig werden konnten, was noch vor uns lag. Und dieses Vertrauen aufzubringen war an sich schon eine Herausforderung.
Unser Ziel war Maun. Eine Ortschaft dort gelegen, wo die Wasser des Okawango-Stroms auf den Sand der Kalahari Wüste treffen – rund siebenhundert Kilometer weiter nördlich. Es gab nur diese eine Schotterstraße durch ein Territorium, das nur wenig Unterschlupf bot, wenn man von gelegentlichen Ansammlungen typischer Hütten einmal absah. Aufgrund der Überschwemmung war diese Straße schon seit Wochen nicht mehr befahren worden. Wir schoben uns mit fünfzehn, höchstens fünfundzwanzig Stundenkilometer nach Norden, und die Savanne wurde immer feuchter, bis wir schließlich durch tiefen, schwarzen Schlamm fuhren.
In der Nähe von Francistown, der letzten größeren Ansiedlung im Osten Botswanas, bogen wir nach Nordwesten ab auf die Straße nach Maun, das immer noch mehr als vierhundertachtzig Kilometer entfernt war. Ganze Abschnitte der Straße waren fortgespült worden. Überall, wo sich durch den Regen flache Seen gebildet hatten, ging ich zu Fuß voran, um festen Grund zu finden. Delia folgte im Land Rover. Wir wichen den Untiefen aus und kamen an den Skeletten von Geländewagen vorbei, die im Schlamm stecken geblieben waren wie Dinosaurier in einer Teergrube. Sie steckten dort schon seit Wochen fest. Immer wieder sank unsere Graugans bis zum Unterboden ein. Mit dem Hi-Lift-Wagenheber hoben wir sie an und packten dann Dornbüsche, Steine und Äste unter die Räder. So legten wir ein paar Meter zurück, dann sanken wir wieder bis zu den Achsen ein.
Abends mussten wir uns gegen Schwärme von Moskitos zur Wehr setzen. Wir hockten uns in der Nähe eines Schlammloches nieder und wuschen uns die angetrockneten Krusten von Gesicht, Armen und Beinen. Dann sanken wir auf dem Schaumstoff unserer Lagerboxen im Land Rover in tiefen Schlaf. Wir ließen das Auto einfach mitten auf der Straße stehen. Hätten wir versucht, es am Rand abzustellen, wären wir aus dem Schlammbett wohl nicht mehr herausgekommen. In den Tagen davor waren uns nur zwei oder drei andere Wagen begegnet. Es war also eher unwahrscheinlich, dass uns nachts jemand auf der Schlammpiste überholen musste.
Am Morgen machten wir uns dann wieder auf den Weg. Vom Schlaf noch halb betäubt steuerten wir den Wagen über die Straße, sanken ein, gruben ihn aus und fuhren weiter. An manchen Tagen schafften wir nur eineinhalb oder zwei Kilometer. Aber wir mussten einfach vorwärtskommen. Wir sprachen zwar nicht darüber, aber wir hatten wohl beide die düstere Vorahnung, dass wir, wenn wir es nicht mal schafften, bis nach Maun zu kommen, den Herausforderungen der Feldforschung sicher nicht gewachsen wären. Und ein Scheitern konnten wir uns ganz einfach nicht leisten. Wir hatten in dieses Abenteuer alles investiert, was wir besaßen – und dazu unsere Träume und unseren Stolz. Es gab auch keinen Grund kehrtzumachen. Schließlich lag hinter uns nichts, was auf uns gewartet hätte.
Hin und wieder sahen wir Ziegen, Rinder und Esel, die an den Schlammlöchern tranken. Das waren die einzigen Zeichen tierischen Lebens in der flachen Eintönigkeit der überweideten Dornstrauchsavanne. Es war deprimierend und beunruhigend, dass wir so weit gekommen waren und immer noch keine Herden wild lebender Antilopen gesichtet hatten. Vielleicht hatten wir uns am Ende doch für ein Land entschieden, in dem es nicht mehr allzu viel Wildtiere gab. Sogar damals wussten wir schon, dass ein großer Teil Afrikas von den Herden der Nutztiere zu Tode abgeweidet worden war.
Elf Tage nach unserer Abfahrt von Gaborone hielten wir hohläugig und schlammbespritzt auf der einspurigen Brücke über den Thamalakane-Fluss, an dessen Ufern sich Maun erstreckte. Eine Ortschaft voller Reet- und Strohhütten, Eseln und Sand. Die Hererofrauen hatten ihre üppigen Röcke aus Unmengen verschiedenster Stoffe am smaragdgrünen Flussufer zum Trocknen ausgelegt. Wie riesenhafte Schmetterlinge leuchteten sie dort im wilden Trubel aus Rot, Gelb, Blau, Grün und Purpur.
Delias Augen waren rot, Gesicht und Haar voll grauem Schlamm. Ihre Hände waren zerkratzt, weil sie ständig Steine und Dornbüsche unter den eingesunkenen Wagen hatte packen müssen. Aber sie strahlte mich an und stieß dabei einen lauten Freudenschrei aus. Wir hatten es geschafft!
Auf den Sandwegen zwischen den Rundhütten schlängelten wir uns zum Riley’s durch, einem weitläufigen Gebäude, wo es eine Garage gab, einen Supermarkt und ein Hotel mit Bar. Wir deckten uns ein mit Benzin und Vorräten: Schweineschmalz, Weizenmehl, Maismehl und Zucker. Verderbliche Lebensmittel wie Milch, Brot und Käse waren im nördlichen Botswana nicht erhältlich und bei unserer Ankunft war die Auswahl ohnehin knapp, weil aufgrund der Bodenverhältnisse schon wochenlang kein Lastwagen mehr nach Maun gekommen war. Die Menschen im Ort waren hungrig. Wir sahen weg, wenn Kinder uns bettelnd die Hände entgegenstreckten, beschämt, dass wir ihnen nichts geben konnten, obwohl wir, verglichen mit ihnen, reich waren.
Beamte im Department of Wildlife in Gaborone hatten uns geraten, vor Ort professionelle Jäger zu fragen, wo wir mit unseren Forschungsarbeiten am besten beginnen sollten. Einer der Namen, die wir in unser Notizbuch gekritzelt hatten, war »Lionel Palmer – Maun«. Lionel war im Riley’s, wo wir nach ihm fragten, wohlbekannt. Wir steuerten unseren Land Rover ungefähr fünf Kilometer über sandige Wege und durch noch mehr Schlammlöcher, bis wir vor seinem Anwesen standen. Den Fluss beschirmten riesige Feigenbäume, ihrerseits überwuchert von Bougainvillea in Orange, Rot und Gelb. Maskenbülbüls, Grautokos, Glanzsichelhopfe und eine Unmenge anderer Vögel erhoben sich über dem Laubdach des Gartens.
Lionel Palmer war tief gebräunt, das Haar von grauen Strähnen durchzogen. Er trug Baggyhosen, ein Cowboyhemd und ein Bandanahalstuch. Er trat auf uns zu mit einem Glas Whisky in der Hand. Als ältester und erfahrenster Berufsjäger der Gegend genoss Lionel in Maun hohes Ansehen. Er war berühmt für seine Partys, bei denen nicht selten Möbel auf dem Dach landeten oder ein Land Rover im Feigenbaum – und für seine Trinkfestigkeit in puncto Scotch. Einmal wachte er nach einem mehrtägigen Dauerrausch mit heftigen Schmerzen im Ohr auf. Der Arzt in der Klinik entfernte ihm eine fünf Zentimeter lange Wanderameise – ein rötlich braunes, zylindrisches Insekt mit Flügeln. Das Tierchen hatte sich in Lionels Ohr eingenistet, während er in einem seiner Blumenbeete seinen Rausch ausschlief. Lionel trug es eine Woche lang in einer mit Baumwolle ausgelegten Zündholzschachtel mit sich herum und zeigte es stolz jedem Menschen, der ihm über den Weg lief, ob er ihn nun kannte oder nicht.
Lionel lud uns auf seine Terrasse ein, von der aus man einen wunderbaren Blick über den Fluss hatte. Er konnte uns auf Anhieb einige Areale im nördlichen Botswana nennen, wo die Überschwemmungen nicht so stark gewesen waren und die dort lebenden Raubtiere keinen nennenswerten Kontakt mit Menschen hatten. Eines dieser Areale waren die Makgadikgadi-Pfannen, eine weitläufige Savanne etwa hundertfünfzig Kilometer südöstlich von Maun. Die Pfannen sind die Überreste eines riesigen urzeitlichen Sees, der vor etwa 16 000 Jahren austrocknete.
»Ihr nehmt die Nata Road und fahrt ungefähr hundertdreißig Kilometer bis zu einer Palme, deren Schopf abgebrochen ist. Da sucht ihr nach einer alten Fahrspur, die südlich vom Haupttrail verläuft. Ihr findet dort kein Schild oder so was, aber da beginnt das Reservat. Dorthin fährt eigentlich kein Mensch. Da ist schlicht nichts, nur Kilometer um Kilometer dieses gottverdammten Afrika.«
Die meisten Wildreservate in Botswana sind einfach riesige Areale unerschlossener Wildnis. Es gibt keine befestigten Straßen oder Fast-Food-Stände, Brunnen oder Campingplätze, Toiletten oder andere Annehmlichkeiten des modernen Lebens, wie man sie sonst in Nationalparks und Reservaten findet.
Zwei Tage später stießen wir auf schwache Reifenspuren bei einer Palme ohne Schopf. Wir fuhren von der Straße herunter und ließen alle Zeichen der Zivilisation hinter uns. Und sofort stellte sich das Gefühl ein, in Afrika zu sein, dem wirklichen Afrika, von dem wir immer geträumt hatten. Die ausgedehnte Savanne, ohne auch nur den Anschein einer Straße, einzig durchsetzt von wenigen isoliert stehenden Bäumen. Wir fühlten uns klein und verwundbar angesichts dieser Weite. Es war wunderschön, aufregend – aber auch ein wenig einschüchternd.
Ungefähr fünfzig Kilometer von der Straße entfernt führte uns die Reifenspur, der wir folgten, an den Rand einer weitläufigen Ebene. Dort war die Spur zu Ende. Delia notierte sich die Kompassdaten, die Kilometerzahl des Land Rovers, und sie machte eine Skizze von einem einsamen Dornbaum, den wir vielleicht wiedererkennen würden. Ohne Karte oder Guide, mit nur sechzig Litern Benzin im Tank und wenigen Vorräten machten wir uns auf in die Makgadikgadi.
Die Savanne war recht holprig, das Gras stand hoch und war voll und schwer von reifen Samen. Und es war glutheiß. Für den Rest des Tages schafften wir nicht mehr als fünf Kilometer pro Stunde. Nach und nach verschwand die Schnauze unserer Graugans unter einem dicken, beweglichen Teppich aus Grassamen und Insekten, der die Scheinwerfer und die Motorhaube bedeckte. Jeden halben Kilometer mussten wir aussteigen, um den Kühlergrill des Wagens freizukratzen und den Motor abzukühlen, indem wir Wasser über die Haube gossen.
Am Morgen des zweiten Tages gelangten wir zu einem riesigen Netzwerk tellerförmiger Salzpfannen, die zwischen Grassavanne, Baumgruppen und Palminseln hervorleuchteten. Manche von ihnen waren mit brackigem, nicht trinkbarem Wasser gefüllt. Algen färbten diese Pfützen orange, purpur, grün und rot. Auf anderen schwamm eine dünne Salzkruste. Wir waren am Rand einer fremdartigen Welt – keine Straßen, keine Reifenspuren, keine Menschen. Eine schimmernde Fata Morgana malte die Palmenspitzen an den Himmel.
»Was immer ihr auch treibt, fahrt auf keinen Fall durch die Salzpfannen, sonst geht ihr unter wie ein verdammter Stein«, hatte Lionel uns gewarnt. »Die Salzkruste sieht aus, als ob sie fest wäre, aber das ist sie nicht, vor allem nach dem vielen Regen der letzten Tage. Darunter ist nichts außer Schlamm, der Gott weiß wie tief reicht. Das Game Department hat letztes Jahr in einer dieser Pfannen einen ganzen Jeep verloren. Egal, wie viel Zeit ihr zu sparen glaubt, wenn ihr direkt reinfahrt: Ihr müsst außen rum.«
Während ich also um diese großen unregelmäßigen Vertiefungen herumsteuerte, zeichnete Delia eine Karte unseres Weges. Sie notierte in regelmäßigen Abständen die Kompassdaten und die Anzeige des Kilometerzählers, sodass wir zurück zum »einsamen Dornbaum« finden würden.
Unsere Haut juckte von den Grassamen und Insekten, daher steuerte ich eine der großen Pfannen an, in der sich möglicherweise vom Regen genug Süßwasser gesammelt hatte, um darin ein Bad zu nehmen. Wir kamen von der Anhöhe darüber – als plötzlich der Land Rover unter uns wegkippte. Das Fahrgestell knackte laut wie ein Gewehrschuss. Wir wurden hart gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Der Motor blockierte, vor uns stieg eine rote Staubwolke auf. Als die sich wieder gelegt hatte, lag die Schnauze des Land Rovers fast gleichauf mit dem Boden darunter. Wir waren in ein großes Loch von einem Ameisenbär gestürzt, das unter dem hohen Gras versteckt lag. Ich versicherte mich, dass es Delia gut ging, dann liftete ich den Land Rover und schaufelte locker eine Tonne Sand unter die Räder. Als wir uns endlich aus dieser misslichen Lage befreit hatten, kroch ich unter die Graugans und suchte nach Schäden. Das Fahrgestell hatte einige neue Risse, einen neben einer Motorhalterung. Noch ein Loch und der Motor würde sich lockern. Und doch hatten wir Glück gehabt. Wäre eines der Vorderräder eingebrochen, hätte die Achse brechen können.
Mir war bewusst, dass unsere Chancen, die Makgadikgadi lebend zu verlassen, ausgesprochen gering wären, wenn wir aus irgendwelchen Gründen die Graugans verlören. Ich hatte kein rechtes Vertrauen in meine Fähigkeiten als Mechaniker, und wir konnten uns all die Ersatzteile nicht leisten, die wir auf so einer Expedition eigentlich hätten mitführen müssen. Außerdem hatte niemand eine Ahnung, wo wir waren oder wann wir zurück sein wollten. Lionel wusste nur, dass wir Maun verlassen hatten und in eines der Areale wollten, die er uns genannt hatte.
Wir sprachen nicht über die Gefahren, aber natürlich hatten wir sie immer im Hinterkopf. Wir wuschen uns im brackigen Wasser der Pfannen, und nachdem der Wind uns trocken geblasen hatte, spannte die Haut in unserem Gesicht wie ein Ballon mit zu viel Luft.
Für den Rest des Tages ging ich vor dem Land Rover her und suchte nach Löchern im hohen Gras, während Delia am Steuer saß. Immer wieder landete ich in Nagerhöhlen und hoffte, dass darin keine Giftschlange Quartier bezogen hatte. Wir hatten keinerlei Gegengift mit, da man dieses hätte kühlen müssen.
In der zweiten Nacht kampierten wir neben einem Baum von höchstens zwei Metern Höhe, dem einzigen weit und breit. Irgendwie fühlten wir uns von ihm unwiderstehlich angezogen und hatten seinetwegen sogar unsere Route verlassen. Wir schliefen zwar im Auto, aber der Baum gab uns ein vages Gefühl der Sicherheit. Vermutlich hätte dieses magere Bäumchen unseren frühen Primatenvorfahren ein ähnliches Gefühl vermittelt, als sie vor Millionen von Jahren die Sicherheit der Wälder verließen und sich in die weite Savanne hinauswagten.
Am vierten Tag stiegen wir spätnachmittags eine niedrige Anhöhe hinauf. Ich ging vorne weg und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. »Mein Gott, schau dir das an!« Der Wind trug uns Geräusche und Gerüche von Tieren zu, von Zehntausenden von Tieren. Soweit das Auge reichte, war die Ebene unter uns voll von Zebras und Gnus, die friedlich neben einem großen Wasserloch grasten. Zebrahengste bissen und traten einander im Kampf, wobei sie mit ihren Hufen Staub aufwirbelten. Die Gnus warfen die Köpfe hin und her, tänzelten vor und zurück oder stießen Warnrufe aus. Die riesigen Herden waren unruhig, und bei diesem Anblick lief mir ein Schauder über den Rücken. Selbst wenn wir nie wieder so etwas sehen würden, wog allein dieser Anblick, der zeigte, wie Afrika einst ausgesehen haben musste, all die Monate im Steinbruch und den Verkauf all unserer Besitztümer auf.
Stundenlang beobachteten wir die Tiere und tauschten immer wieder das Fernglas. Und wir schrieben auf, was wir sahen – wie sich die Herden durchmischten und sich bewegten, wie viele Tiere tranken, wie viele kämpften – als hätte damit unsere Forschungsarbeit endlich einen Anfang gefunden. Wir bezogen Stellung auf der Anhöhe, damit wir sehen konnten, ob Geparden oder Löwen sich anpirschten. Als es so dunkel war, dass wir nichts mehr erkennen konnten, machten wir im Auto über dem Kerosinbrenner eine Dose Würstchen warm und diskutierten, ob wir in der Makgadikgadi mit unserer Arbeit beginnen wollten.
Auch am nächsten Tag beobachteten wir die Herden bis zum Abend. Dann aber wurden wir wieder zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen: Wir hatten kaum noch Wasser. Frustriert, weil wir doch endlich Feldforschung betreiben wollten und gern weiter bei den Zebras und Gnus geblieben wären, machten wir uns auf den Rückweg durch die Salzpfannen. Wir kehrten die Kompasswerte um und folgten der schematischen Karte, die Delia von unserer Fahrt nach Osten gezeichnet hatte. Wir fanden den einsamen Dornbaum wieder, konnten uns orientieren und steuerten dann den Boteti-Fluss in zwanzig Kilometer Entfernung an, um Wasser zu tanken.
Dann folgten wir zwei Tage lang wieder der Route, die wir beim ersten Mal genommen hatten. Aber irgendwo lief etwas schief. Eine uns unbekannte Salzpfanne, ein weißer See von eineinhalb Kilometer Breite, erstreckte sich meilenweit nach Norden und Süden. Wir kamen nicht weiter. Auf dem Dach des Land Rovers stehend suchten wir die Gegend ab, um einen Weg darum herum zu entdecken. Vergeblich.
Wir fuhren am Rand der Salzpfanne entlang, zuerst nach Norden, dann nach Süden. Schließlich beschloss ich auszuprobieren, wie tragfähig ihre Oberfläche war. Ich machte mir Sorgen, weil unser Benzinvorrat ebenso zur Neige ging wie unser Wasser. Vielleicht konnten wir trotzdem vorsichtig über die Salzpfanne fahren statt meilenweit um sie herum. Also grub ich mit dem Spaten testweise ein Loch. Der Ton unterhalb der Salzkruste schien erstaunlich trocken und fest. Ganz egal, wie fest ich darauf herumsprang, ich hinterließ keine Spuren. Dann ließ ich sehr vorsichtig die Vorderräder der Graugans in die Pfanne rollen. Die Kruste hielt. Schließlich brachte ich das ganze Fahrzeug auf die Oberfläche, die so hart schien wie Beton. Sie hielt. Wir beschlossen, trotz Lionels Warnung die Überquerung zu wagen.
Ich beschleunigte stark. Ich hoffte, dass die hohe Geschwindigkeit und der Allradantrieb uns über weiche Stellen tragen würden, die weiter draußen möglicherweise auf uns lauerten.
Ich lehnte mich weit übers Steuerrad und behielt die weiße Salzkruste im Auge, um dunkle Flecken sofort auszumachen. Sie wären ein klares Zeichen, dass die Pfanne dort nicht ganz ausgetrocknet war. Aber es gab keine. Es war, als würde man über einen Billardtisch fahren. Allmählich entspannte ich mich. Dann, etwa einen Dreiviertelkilometer vom Rand entfernt, sahen wir Holz und Äste, die in einem merkwürdigen Winkel aus einer Vertiefung in der grauen, rissigen Oberfläche herausstachen. Wir stiegen aus, um nachzusehen. Was konnte für so ein großes Loch verantwortlich sein? Und woher stammte das Holz? Andere Spuren waren nicht sichtbar. Verwirrt blickte ich in das tiefe Loch mit den rissigen Kanten, dorthin, wo die Hölzer zusammenstießen. Da begriff ich. Hier hatte jemand versucht, sein Fahrzeug zu retten. Ich drehte mich zu unserem um.
»Mein Gott! Der Wagen sinkt ein! Los, schnell rein. Wir müssen raus hier!«
Die Räder sanken ganz langsam durch die Salzkruste in eine darunterliegende Tasche voll weichem Ton. Die Oberfläche gab nach. In wenigen Sekunden würde unser Auto einsinken.
Ich versuchte, von der Stelle zu kommen, doch der Motor streikte. Die Räder steckten schon zu tief im Schlamm. Hektisch startete ich neu und legte den niedrigen Allradmodus ein. Der Land Rover bewegte sich, die Räder spritzten den Ton nach allen Seiten. Mühselig hievte sich der Wagen zurück auf die feste Oberfläche. Dann beschleunigte ich eilig. Wir wendeten und fuhren so schnell wie möglich zur Grasbank am Rande der Pfanne zurück. Dort hielten wir und sahen uns ungläubig an, erleichtert die Köpfe schüttelnd. Ich war stocksauer auf mich selbst, weil ich überhaupt versucht hatte, die Salzpfanne zu überqueren. Doch ich hatte uns noch mehr in Gefahr gebracht, als ich den Wagen in der Mitte der Pfanne angehalten hatte. Nachdem wir unsere skizzierten Karten konsultiert hatten, steuerten wir Richtung Norden. Es kostete uns einen ganzen Nachmittag, den Rest der Pfanne zu umfahren.
Am Morgen des vierten Tages unserer Rückkehr in die Makgadikgadi-Ebene erreichten wir endlich deren westlichen Rand und schlüpften unter das kühle, erfrischende Laubdach der Flusswälder. Spinnweben, dicht wie Fischernetze, zogen sich von Baum zu Baum. Ihre haarigen, schwarz-gelben Schöpferinnen krabbelten über unsere Motorhaube, als wir uns durch den schweren Sand Richtung Fluss pflügten. Aus tiefen Schatten heraus beobachteten uns die Kudus.
Schließlich standen wir am Hochufer des Boteti. Tiefblaues Wasser umschmeichelte Lilien, Hyazinthen und andere Wasserpflanzen, die in der schläfrigen Strömung sachte nickten. Auf der Spitze eines riesenhaften Feigenbaumes saßen zwei Fischadler, die ihren Hals streckten und ihre Schreie gen Himmel sandten. Wir liefen das steile Ufer hinunter und stürzten uns ins kühle Wasser.
Nach dem Schwimmen krabbelten wir ans Ufer, wo wir etwas Rotes im Gras liegen sahen. Ein 200-Liter-Fass – ein fantastischer Fund! Wir hatten uns in Maun nach einem solchen Fass umgesehen, aber im nördlichen Botswana waren sie kaum zu bekommen. Schließlich brauchte jeder so große Fässer. Also füllten wir das Fass mit Wasser und rollten es zum Auto. Auf diese Weise würden wir unseren Aktionsradius enorm erweitern, wenn wir entlegene Gebiete erkundeten. Das Fass sah jedenfalls einwandfrei aus. Wir fragten uns auch gar nicht erst, warum es hier entsorgt worden war.
Am späten Nachmittag hörten wir auf einmal heftiges Plätschern vom Fluss her. Nachdem wir wochenlang von Maismehl, Haferschrot und Milchpulver gelebt hatten und nur zwischendrin mal eine Dose mit fettigen Würstchen geöffnet hatten, so bleich und schlaff, dass wir sie »Leichenfinger« nannten, hatten wir beide Lust auf ein dickes, saftiges Stück Fleisch oder Fisch. Frischer Fisch wäre genial! Ich fand eine alte Angelschnur, die der vorherige Besitzer im Land Rover zurückgelassen hatte, bog mir mithilfe einer Kneifzange einen Haken zurecht und machte aus dem glänzenden Stück Blech einer Milchpulverdose einen Köder.
Delia musterte skeptisch meine Bemühungen, Angelzeug zu fabrizieren, und machte sich lieber daran, in unserer dreibeinigen Pfanne Fladenbrot aus Maismehl zu backen. Ich aber ging fischen. Ich schnappte mir am Ufer eine Heuschrecke, steckte sie an den Haken und warf die Schnur ins Wasser. Es war fast schon Abend, und an der Oberfläche des Flusses sprangen unzählige Fische auf und ab. In wenigen Sekunden hatte ich jubelnd eine bildschöne Brasse an Land gezogen und danach noch einen Wels.
Delia panierte die Filets in Mais- und Weizenmehl, bevor sie sie briet. Bald saßen wir am Feuer und stopften uns mit dicken Stücken Maisbrot und zartem weißen Fischfilet voll. Hinterher ließen wir uns am Hochufer des still dahinziehenden Flusses nieder und besprachen unser Abenteuer in der Makgadikgadi. Afrika zog uns immer mehr in seinen Bann.
Am nächsten Tag fingen wir noch mehr Fisch und verzehrten ihn gierig. Dann füllten wir unsere Vorratskanister mit Flusswasser auf und schleppten sie das steile Flussufer hinauf. Nachdem wir das rote Fass gefüllt hatten, legten wir es flach auf das Dach des Land Rovers und zurrten es fest. Um die Mittagszeit waren wir auf dem Weg zurück in die Makgadikgadi, um nach Raubtieren Ausschau zu halten.
Vier Tage später waren wir wieder am »Zebrahügel«, doch die Herden, die wir eine Woche zuvor dort entdeckt hatten, waren mittlerweile weitergezogen. Wir fuhren stundenlang durch die Gegend, ohne ein einziges Tier zu sehen. Und ohne Beute gab es auch keine Löwen, Geparden oder andere Raubtiere. Es war deprimierend. Wir hatten ernsthaft in Erwägung gezogen, uns für unsere Forschungsarbeiten in der Makgadikgadi niederzulassen. Aber da diese Herden und vermutlich auch die Raubtiere so unglaublich mobil waren und keinen festen Standort zu haben schienen, wie sollten wir da Tiere ausmachen und studieren? Also fuhren wir zurück nach Maun, wo wir weitere Ratschläge einholen wollten.
In den nächsten Wochen unternahmen wir Erkundungstrips in die Nxai Pan, die Savuti Marsh und andere Areale in den Außenbezirken des Okawango-Deltas. Marschen, Pfannen und Wälder wiesen durchweg eine faszinierende Vielfalt von Antilopen und Raubtieren auf, doch alles in allem waren diese Gebiete immer noch überflutet. Das Wasser würde unsere Bemühungen massiv behindern. Wenn wir die malopos überquerten, schilfgefüllte, sumpfige Wasserwege, die von einer Palmeninsel zur nächsten führten, lief uns der Boden des Land Rovers voll Wasser und würgte den Motor ab. Wir verbrachten Stunden damit, den Land Rover aus dem schwarzen Schlamm herauszuschaufeln.
Entmutigt kehrten wir nach Maun zurück. Mit jeder erfolglosen Erkundungsfahrt, für die wir Vorräte beschaffen mussten, schwanden unsere mageren Mittel dahin. Und wieder war es Lionel Palmer, der uns den richtigen Tipp gab: »Warum versucht ihr es nicht in der Kalahari? Ich kenne da einen Ort namens Deception Valley. Zumindest aus der Luft sieht es so aus, als gäbe es dort haufenweise Wild. Natürlich habe ich selbst da nie gejagt. Es liegt meilenweit im Wildreservat.«
Auf unserer Karte von Botswana im Maßstab von 1 zu 1 Million sah man auf Anhieb, dass das Central Kalahari Game Reserve eines der größten Wildreservate auf Erden war. Mehr als 80 000 Quadratkilometer unberührte, nicht kartierte Wildnis. Die an den Reservatsgrenzen keineswegs aufhörte, sondern sich noch gut einhundertfünfzig Kilometer in alle Richtungen erstreckte, nur gelegentlich unterbrochen von einer Viehstation oder einem Dorf. Lionel zufolge gab es in diesem Gebiet, das von der Größe Irlands war, keine Straße, kein Gebäude und kein Wasser. Und keine Menschen, abgesehen von einigen indigenen San-Gruppen. Dieses Areal war so abgelegen, dass der Großteil niemals erforscht worden war. Die Regierung von Botswana hatte es nie für die Öffentlichkeit freigegeben. Daher waren dort auch noch nie Forschungsarbeiten zum Wildtierbestand durchgeführt worden. Genau das, was wir die ganze Zeit gesucht hatten – wenn wir es dahin schaffen würden und die Probleme lösen könnten, vor die das Überleben in solch einer entlegenen Gegend uns stellen würde.
Wir kontemplierten eine Weile die nahezu leere Karte der Region und legten dann fest, welchen Weg wir in die Kalahari nehmen würden. Und dass wir das Department of Wildlife nicht über unseren Vorstoß informieren würden. Vermutlich hätte man uns ohnehin keine Erlaubnis gegeben, in solch einer isolierten Region zu arbeiten. Die Behörde würde schon früh genug von uns erfahren.
Unsere Graugans war vollgeladen mit Benzin und anderen Vorräten. Auf dem Dach prangte das rote Fass. So machten wir uns auf in die Kalahari und auf die Suche nach dem Deception Valley. Wir schrieben Ende April 1974. Zwölf Kilometer östlich von Maun fanden wir eine Fahrspur nach Süden zur Samadupe Drift am Boteti. Dort stand das Wasser so niedrig, dass man eine Reihe von Baumstämmen am Grund ausgelegt hatte. Der Fluss plätscherte über die mit Steinen befestigten Rundhölzer und wirbelte um die Schilfbänke herum und davon durch eine prachtvolle Allee von Feigenbäumen. Kormorane tauchten, Blaustirn-Blatthühnchen trotteten von einem Lilienflecken zum anderen. Sporngänse und Reiher zogen über dem Wasser dahin, das Geräusch ihrer Schwingen erfüllte die Luft.
Wir hielten an, um ein letztes Mal zu schwimmen. Ich schnitt Delias schulterlanges Haar ab. Es würde einfach zu viel Wasser kosten, es in der Wüste sauber zu halten. Ihre langen Strähnen fielen ins Wasser, die Strudel zogen sie ein, bis die Strömung sie davontrug. Einen Augenblick lang sah ich ihr lachendes Gesicht im Wasser – so wie sie ausgesehen hatte, als wir uns kennenlernten. Ich hielt kurz inne und strich ihr mit der Hand über die Wange.
Nachdem wir den Fluss überquert hatten, erklommen wir eine steile Anhöhe aus schwerem Sand. Dahinter schrumpfte die Fahrspur zusammen auf zwei Reifenspuren zwischen dichten Akaziensträuchern. Für den Rest des Tages kämpften wir uns durch Hitze, Staub und tiefen Sand. Die Dornbüsche zu beiden Seiten der Fahrspur krallten sich kreischend in den Wagen, sodass uns die Ohren schmerzten. Am späten Nachmittag dann verlor sich die Fahrspur. Wir standen auf einer kleinen Lichtung. Der Wind trieb Steppenhexen an einer zerfallenden Lehmhütte und einem Wassertrog aus Blech für das Vieh vorbei. Wir fragten uns, wo wir falsch abgebogen waren.
Plötzlich materialisierte sich aus den Büschen ein knorriger alter Mann – der nur aus Ellbogen, Knie und Knöchel zu bestehen schien – mit einem knorrigen alten Gehstock. Seine Frau und vier spindeldürre Jungs, gekleidet in Streifen aus Leder, führten ein paar magere Rinder durch die Staubwolken zum Wassertrog.
Ich winkte. »Hello!«
»Hello!«, antwortete einer der Jungs. Alle lachten.
Ach, die sprechen Englisch, dachte ich.
»Could you help us? We’re lost.« Ich stieg aus dem Wagen und faltete unsere Karte auf.
»Hello«, sagte der Junge noch einmal. Dann fielen alle ein: »Hello, hello, hello …«
Ich legte die Karte weg und versuchte es anders.
»Ma-kal-a-ma-bedi?«, fragte ich. Dabei streckte ich die Arme aus und hielt die Handflächen nach oben. Ich hoffte, sie würden den Namen des Zauns verstehen, an dem entlang wir in die Kalahari fahren könnten. Der dünnste und gesprächigste der vier Jungs kletterte auf das Dach des Land Rovers, die anderen drei folgten. Wir lachten und fuhren zurück in die Spur. Die Jungs hopsten auf dem Dach herum, ihre Finger zeigten uns den Weg.
Ein paar Minuten später klopften sie alle zusammen aufs Dach. Ich hielt an. Sie sprangen herunter und deuteten durch den Busch nach Osten. Anfangs verstanden wir nicht. Dann aber, als wir uns direkt neben sie stellten, sahen wir eine schwache Linie, die durch die Savanne zu führen schien. Offensichtlich eine alte Vermessungslinie. Sie verlief nach Osten. Mehr hatten wir nicht. Wir waren wild entschlossen, nicht nach Maun zurückzukehren, bevor wir das Deception Valley gefunden hatten.
Wir dankten den Jungs, gaben ihnen eine Papiertüte mit Zucker und fuhren dann los. »Hello, hello, hello!«, riefen sie uns winkend nach, bis wir im Busch verschwanden.
Früh am nächsten Morgen stießen wir auf den Zaun – verwitterte Holzpfosten und fünf Drahtseile versperrten uns den Weg und zogen sich weit nach Süden und Norden, dass wir kein Ende ausmachen konnten. Wir wandten uns Richtung Süden und Stunden später war der Zaun immer noch da, eine gewaltige Narbe in der Savanne. Schon damals verdross uns das Ding, später aber würden wir allen Grund haben, seinen Anblick leidenschaftlich zu hassen.
In jener Nacht schliefen wir am Zaun. Am nächsten Morgen wühlte sich der Land Rover durch den Sand. Unser Rücken klebte am Sitz, und wir waren bald von einer dicken Schicht Staub und Grassamen bedeckt. Und mit einem Mal hörte der Zaun auf. Nichts als Sand, Dornsträucher, Gras und Hitze. Zwei Reifenspuren führten weiter durchs Gras und wurden dabei immer schwächer … und schwächer … bis sie verblassten wie eine ferne Erinnerung. Nun fuhren wir durch eine meist flache Grassavanne, aus der sich hin und wieder niedrige Sandhügel voll saftig grüner Büsche erhoben. Gelegentlich grüßte eine Baumgruppe. Sollte dies die Kalahari-Wüste sein? Wo aber waren dann die großen wandernden Dünen?
Wir konnten nicht sicher sein, wo wir uns genau befanden. Wir sahen auf der Karte nach und überschlugen, wie viele Kilometer südlich von Maun wir sein mochten. Dann bogen wir nach Westen ab. Wir legten weitere dreißig Kilometer zurück. Wenn wir das Deception Valley dann nicht gefunden hätten, würden wir zurück nach Maun müssen.
Fünfundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig … Gerade, als wir alle Hoffnung aufgeben wollten, kamen wir auf dem Kamm einer Düne an. Unter uns lagen die sanften Abhänge und die offene Ebene des Deception Valley, eines urtümlichen fossilen Flusslaufes, der sich durch die bewaldeten Dünen zog. Herden von Springböcken, Spießböcken und Kuhantilopen weideten friedlich in dem nun mit Gras bewachsenen Flussbett, durch das einst das Wasser strömte. Der blaue Himmel voller weißer Wölkchen wölbte sich hoch über dem Tal. Das Tal war unglaublich friedlich, und genau darauf hatten wir gehofft. Wir schrieben den 2. Mai 1974, fast fünf Monate waren vergangen, seit wir die USA verlassen hatten. Nun hatten wir unseren Platz in Afrika gefunden. Ein Zuhause – für die nächsten sieben Jahre, wie sich herausstellen sollte.
Über die Vorderseite der Düne gelangten wir hinab ins Tal. Wir durchquerten das trockene Flussbett, die Springböcke hoben kaum den Kopf, als wir an ihnen vorbeifuhren. Am westlichen Rand entdeckten wir eine einsame Gruppe von Akazienbäumen, die uns Obdach boten und einen fantastischen Panoramablick. Das war ein guter Platz für ein Lager.
Da wir monatelang unterwegs waren und unsere »Behausung« quasi mit uns führten, fühlten wir uns mittlerweile wie Schildkröten mit einem Panzer aus Stahl. Es war ein herrliches Gefühl, endlich irgendwo Wurzeln zu schlagen.
Es dauerte nicht lange, unser erstes Basislager zu errichten: Wir befestigten unsere Leinensäcke mit Mais- und Weizenmehl in der Krone einer Akazie, um sie vor Nagern zu schützen. Die wenigen Lebensmittel in Dosen, die wir bei uns hatten, packten wir am Fuß des Baumes zusammen. Töpfe und Pfannen baumelten bald von einem der Äste herab. Dann sammelten wir Feuerholz. Wir hatten nur ein ganz kleines Zelt. Daher übernachteten wir für den Rest des Jahres in der Graugans.
Delia machte Feuer und kochte Tee, während ich das rote Fass ablud und es unter den Akazienbaum rollte. Die einzige Wasserquelle im Umkreis von mehreren Tausend Quadratkilometern.
2
Wasser
(mark)
Wer sich getrost von seinen Träumen leiten lässt und das Leben zu leben sucht, das ihm vorschwebt, dem ist ein Erfolg beschieden, wie er ihn gemeinhin nicht gewärtigt … Lustschlösser zu bauen ist kein vergebliches Beginnen; man muss ihnen nur nachträglich ein Fundament verschaffen.
— Henry David Thoreau
Der Druck von oben ist immens. Stunde um Stunde schwitzen sich die Wassermoleküle durch die Rostflecken. An der Außenseite verschmelzen sie: Ein Tropfen wächst. Ist er ausreichend angeschwollen, läuft er über den verbeulten Rand. Dann kann er sich nicht mehr halten und fällt still in eine Furche durstigen Sandes, die ihn aufsaugt. Oben am Rand nimmt ein neuer Tropfen seinen Platz ein.
Tage vergingen. Die Tropfen setzten ihren Marsch fort, durch den Rost, über den Rand, in den Sand. Die Wunde des Fasses öffnete sich stillschweigend immer weiter … die Tropfen folgten schneller, tropf, tropf, tropf versanken sie vor der Sonne verborgen, in dem dunklen Fleck.
Eine beinahe vollkommene Stille umfing mich, als ich die Augen öffnete. Über mir das Dach des Land Rovers. Ein Augenblick der Verwirrung … Wo war ich? Ich drehte mich zum Fenster. Eine knorrige Akazie streckte ihre sich scharf abzeichnenden Gliedmaßen dem erwachenden Himmel entgegen. Dahinter fielen die baumbestandenen Sanddünen sachte ins Flussbett ab. Der Morgen, unser erster im Deception Valley, stieg in den Himmel auf, weit über die Dünen hinaus.
Delia regte sich. Wir lauschten auf die Savanne, die um uns herum erwachte: Eine Taube gurrte in der Akazie, ein Schakal bellte rhythmisch und weit im Norden erklang das mächtige und eindringliche Gebrüll eines Löwen. Ein einsamer Turmfalke schwebte über uns, seine Schwingen trugen ihn über den orange erglühenden Himmel.
Außerhalb des Rovers hob nun ein Grunzen und Schnauben an – das sich ziemlich nah anhörte. Ganz langsam setzten Delia und ich uns auf und spähten hinaus. Unmittelbar vor unserem Lager graste eine Herde von mindestens dreitausend Springböcken, eine kleine Gazellenart mit etwa dreißig Zentimeter langen Hörnern, die sich über dem zierlichen Kopf nach innen wölbten. Das weiße Gesicht war von schwarzen Streifen durchzogen, die von den Augen bis zur Schnauze liefen. Sie wirkten beinahe theatralisch wie Marionetten, wie sie dort das taunasse Gras kauten. Einige von ihnen waren höchstens vier bis fünf Meter von uns entfernt. Einige junge Weibchen musterten uns mit dunklen, feuchten Augen, während sie weiterhin geruhsam ihre Grashalme knabberten. Der Großteil der Herde aber graste und wedelte mit den Schwänzen, ohne uns auch nur eines Blickes zu würdigen. Wir richteten uns auf und lehnten uns an die Vordersitze. Wir konnten vom Bett aus zusehen, wie zwei junge Springbockmännchen spielerisch die Hörner kreuzten.
Obwohl die Herde sich kaum zu bewegen schien, waren die Gazellen innerhalb von zwanzig Minuten fast hundert Meter weitergewandert. Ich wollte Delia gerade meine Beobachtung mitteilen, als sie nach Osten zeigte. Ein Schabrackenschakal, Cousin des amerikanischen Kojoten, nur kleiner und mit einem schlauen, fuchsartigen Gesichtsausdruck und einer schwarzen »Schabracke«, die sich über den ganzen Rücken zieht. Er trottete in unser kleines Baumgeviert und begann, das Lagerfeuer von letzter Nacht zu beschnüffeln. In Afrika gilt der Schakal als Schädling und wird gewöhnlich erschossen, sobald er irgendwo auftaucht. Daher fliehen Schakale auf der Stelle, sobald sie einen Menschen zu Gesicht bekommen. Dieser aber steckte lieber die Schnauze in eine unserer Blechtassen, die wir am Lagerfeuer zurückgelassen hatten. Er packte den Rand mit den Zähnen und stülpte die Tasse über seine Nase. Er beschnüffelte einige unserer Habseligkeiten, bevor er, aufmerksam nach links und rechts schauend, in aller Ruhe aus dem Camp spazierte. Zuvor aber warf er uns noch einen Blick zu, als wolle er sagen: »Ich komme zurück und hole mir später mehr.«
Es ist schwer, die Erregung und Freude zu beschreiben, die wir empfanden. Wir hatten unseren Garten Eden gefunden. Und doch hatten wir Angst, die komplexen Muster des Lebens zu stören, die sich in unserer Umgebung gebildet hatten. Dies war ein Ort, an dem die Geschöpfe noch nicht mit den Verbrechen des Menschen gegenüber der Natur in Berührung gekommen waren. Vielleicht konnten wir uns ja, wenn wir sorgsam die Freiheit dieser Tiere achteten, unbemerkt in diesem uralten Flusstal bewegen und seine Schätze studieren, ohne sie zu zerstören. Wir waren fest entschlossen, eine der letzten unberührten Ecken dieser Erde auch vor uns selbst zu schützen.
Plötzlich ertönte tausendfacher Hufschlag – die Luft erbebte. Die Springbockherde brach auf nach Süden, immer am Flussbett entlang. Ich schnappte mir das Fernglas, während wir uns gleichzeitig aus dem Schlafsack wanden und vom Land Rover ins hohe, feuchte Gras sprangen. Acht Wildhunde setzten den Gazellen nach. Als sie auf einer Höhe mit dem Lager waren, änderten zwei der Raubtiere die Richtung und hielten direkt auf uns zu.
Delia öffnete schleunigst die Heckklappe des Land Rovers, aber da waren die Hunde mit dem golden und schwarz getupften Fell, in dem der Tau glänzte, nur noch fünf Meter entfernt. Ihre wilden, dunklen Augen musterten uns von Kopf bis Fuß. Wir waren zu Salzsäulen erstarrt. Ein paar Sekunden vergingen, während sie uns entgegenwuchsen und mit erhobenem Schwanz und bebenden Nüstern unsere Witterung aufnahmen. Sie reckten die dunklen Schnauzen hoch in die Luft und näherten sich, vorsichtig eine Pfote vor die andere setzend. Delia schob sich auf die Tür zu. Ich drückte ihre Hand – kein guter Moment, um irgendwelche Bewegungen zu machen. Die Hunde waren gerade mal eine Armlänge entfernt und starrten uns an, als hätten sie etwas wie uns noch nie gesehen.
Ein dunkles Grollen kam aus der Brust des einen mit dem goldenen Pelzkragen um den Hals. Sein Körper bebte, und seine schwarzen Nüstern weiteten sich. Dann wandten die beiden Tiere sich einander zu, legten sich gegenseitig die Vorderpfoten auf die Schultern, als würden sie ein Tänzchen wagen. Und gleich darauf waren sie weg und setzten der Meute nach.
Wir zogen uns etwas über, starteten den Land Rover und folgten ihnen. Die Meute leistete Teamarbeit. Sie hatten die Herde in drei Gruppen geteilt, die sie durchs Flussbett verfolgten. Der Anführer hatte einen schutzlosen Jährling im Blick. Nachdem er gut eineinhalb Kilometer gejagt worden war und schon keuchte, fing der Bock an, im Zickzack zu laufen. Der Hund packte die Beute am Hinterbein und zerrte den vierzig Kilo schweren Bock zu Boden. Acht Minuten später war er verzehrt, und die Hunde zogen sich zurück in den Schatten einer Baumgruppe, wo sie für den Rest des Tages bleiben würden. Es war nicht unsere letzte Begegnung mit »Bandit« und seiner Meute.
Als wir zurück im Lager waren, rollten wir unsere Schlafsäcke zusammen, holten Milchpulver und Haferflocken aus dem Vorratsbehälter und spülten sie mit Wasser aus dem Kanister hinunter. Nach dem Frühstück machten wir uns auf, um das trockene Flussbett auf seine Tauglichkeit als Standort für unsere Forschungsarbeiten zu prüfen.