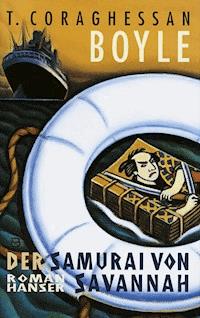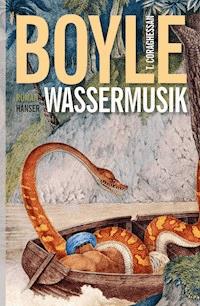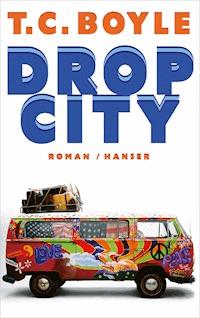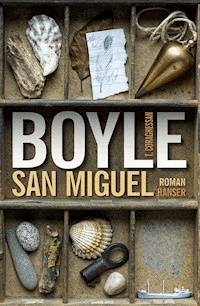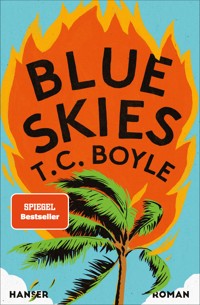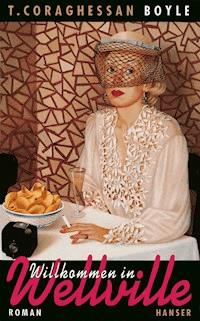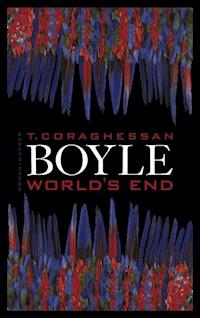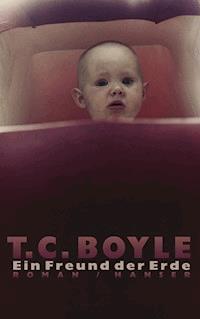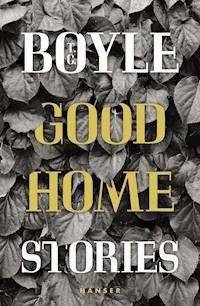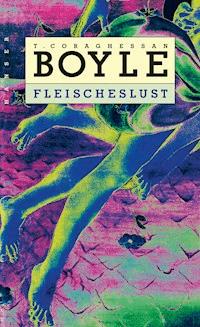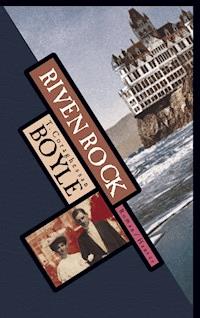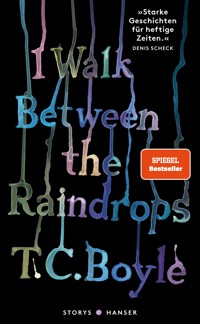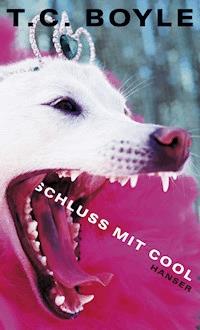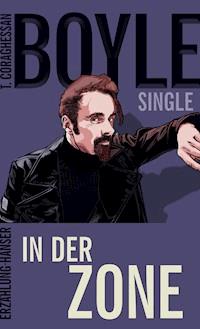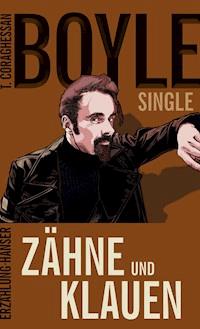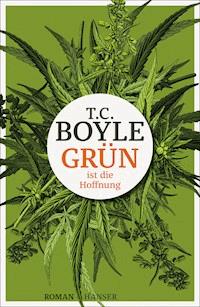Hanser E-Book
T. CORAGHESSAN BOYLE
DER SAMURAI VON SAVANNAH
ROMAN
AUS DEM AMERIKANISCHEN VON ANETTE GRUBE
CARL HANSER VERLAG
Die Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel East is East bei Viking Penguin in New York.
ISBN 3-446-24391-0
© T. Coraghessan Boyle 1990
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München Wien 1992
Satz: Fotosatz Reinhard Amann, Aichstetten
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Für Georges und Anne Borchardt
Wer sich entscheidet, fürchterlich zu leben und fürchterlich zu sterben, der hat ein schönes Leben gewählt.
Yukio Mishima: Der Weg des Samurai
Gebor’n und groß gewor’n im Gestrüpp, Br’er Fox. Gebor’n und groß gewor’n.
Joel Chandler Harris: Uncle Remus
INHALT
ERSTER TEIL TUPELO ISLAND
KLEINIGKEITEN
DIE TOKACHI-MARU
THANATOPSIS HOUSE
HOG HAMMOCK
DAS BIEDERSTE VOLK DER WELT
DIE BIENENKÖNIGIN
FEA PURĒ
HINTER EINER GLÄSERNEN WAND
RUSU
DIE ANDERE HÄLFTE
NOCH IMMER AUF FREIEM FUSS
PARFAIT IN CHROM
HUNDEGEBELL
ZWEITER TEIL OKEFENOKEE
OFFENES GEHEIMNIS
VIER WÄNDE
DAS WEISS DER FISCHE
EIN DSCHUNGEL
WO DIE ERDE ZITTERT
DAS TOR ZUR WILDNIS
BILLIGE SENSATIONEN
DIE MACHT DER MENSCHLICHEN STIMME
HAHA
DRITTER TEIL DER HAFEN VON SAVANNAH
JOURNALISMUS
DIE STADT DER BRÜDERLICHEN LIEBE
ERSTER TEIL TUPELO ISLAND
KLEINIGKEITEN
Im Schwimmen drehte er sich vom Rücken auf den Bauch, schlug mit Armen und Beinen um sich, atmete prustend und schwer und hatte das Gefühl, schon ewig zu schwimmen. Vom Kraulen wechselte er zum Brustschwimmen, dann zum Yokohama-Beinschlag. Erschöpft klammerte er sich an den Rettungsring aus Kork wie ein amorphes Geschöpf der Tiefe, ein bleicher Lappen Haut. Irgendwann in der fünften Stunde dachte er an Suppe. An miso-shiru, Reistopf, eine dünne, nach Meer stinkende Brühe, die seine Großmutter immer aus Fischköpfen und Aal machte. Und er dachte an Bier – an Flaschen wie goldgelbe Juwelen in einem Bett aus Eis –, und schließlich dachte er an Wasser, nur noch an Wasser.
Als die Sonne unterging, alle Farbe mit sich nahm und eine Wasseroberfläche so glatt und kalt wie gehämmertes Zinn zurückließ, da klebte ihm die Zunge am Gaumen und die innersten Sehnsüchte seiner Eingeweide nagten an ihm wie herrische kleine Tiere. Seine Hände waren aufgedunsen und wund, der Rettungsring scheuerte ihm die Arme auf, Möwen stießen dicht auf ihn herab, um ihn mit professionellem Blick zu fixieren. Am liebsten hätte er aufgegeben. Wäre in den Traum von Bett und Abendessen und Zuhause geglitten, hätte sich Zentimeter um Zentimeter in die Meeresbrühe hineinrutschen lassen, bis der Ring leer dahintrieb und die anonymen Wellen sich über ihm schlossen. Doch er widerstand. Er dachte an Mishima und an Jōchō und an das Buch, das er unter dem jetzt schweren, ausgeleierten Rollkragenpulli um die Brust gebunden trug. Gewickelt in eine Plastikschutzhülle mit Gleitverschluss, befestigt mit schwarzem Isolierband, klebte es an der Stelle, wo sein Herz schlug, und in dem Buch lagen vier komische, kleine, grüne amerikanische Geldscheine.
Wichtige Überlegungen sollte man auf die leichte Schulter nehmen, sagte Jōchō. Kleinigkeiten sollte man ernst nehmen. Ja. Natürlich. Was machte es schon aus, ob er lebte oder starb, ob er ans Ufer gespült wurde und dort ein Topf voll brodelnder Nudeln mit Schweinefleisch und grünen Zwiebeln auf ihn wartete oder ob die Haie ihm die Zehen anknabberten, die Füße, die Waden, die Schenkel? Was wichtig war, das war … der Mond. Ja: der kleine Bogen eines vollkommen geformten Mondes, wie eine Parenthese in den dunkler werdenden Horizont gemeißelt. Weiß und unberührt stieg er auf, schmal wie ein abgeschnittener Fingernagel. So vergaß er seinen Hunger, seinen Durst, vergaß die unzähligen Zähne des Meeres und machte sich den Mond zu eigen.
Gleichzeitig wusste er natürlich genau, dass er es schaffen würde, womit sich Jōchōs Ratschlag wesentlich leichter verdauen ließ. Nicht nur die vielen Vögel – Pelikane, Kormorane und Möwen, die westwärts zu ihren Schlafplätzen davonzogen –, auch die Gerüche der Küste sagten ihm das. Matrosen sprechen vom süßen Duft des Landes, der sie dreißig Meilen weit draußen auf dem Meer aufweckt, wenn er heranweht, er aber hatte ihn auf dieser seiner Jungfernfahrt nie wahrgenommen. Jedenfalls nicht an Bord der Tokachimaru. Erst hier, als er flach auf dem Wasser lag und die zwanzig kurzen Jahre seines Lebens sich aufdröselten wie die Fasern einer ausgefransten Schnur, da spürte er ihn. Auf einmal war seine Nase ein Instrument von scharfer, präzise kalibrierter Empfindlichkeit, Hundehaft und akkurat: Er konnte die einzelnen Grashalme an dem schwarzen Ufer unterscheiden, das da irgendwo vor ihm lag, und er wusste auch, dass dort Menschen waren, Amerikaner, mit ihrem Buttergestank, ihren Töpfen voll Mayonnaise und Ketchup und dergleichen, und dass sich unter ihnen toter, trockener Sand befand und Schlamm, in dem es wimmelte von Krabben und Fadenwürmern und all den unsichtbaren Partikeln der Verwesung, aus dem er sich zusammensetzt. Und mehr noch, viel mehr: der Moschusduft wilder Tiere, der gesunde Gestank von Haustieren, von Hunden und Katzen und Papageien, der metallische Geruch nach Sprühlack und Dieselöl, das etwas süßliche Aroma der Auspuffgase von Außenbordmotoren, der Duft – so schwer und mächtig, dass ihm die Tränen kamen – von nachtblühenden Blumen, von Jasmin und Geißblatt und tausend anderen Dingen, die er noch nie gerochen hatte.
Er war zum Sterben bereit gewesen, und jetzt würde er es schaffen.
Er war kurz davor. Das wusste er. Er stieß mit den Beinen in das dunkler werdende Wasser.
»Sollten wir nicht ein Licht anmachen oder so was?«
»Mmh?« Seine Stimme war ein warmes Murmeln an ihrer Kehle. Er war halb eingeschlafen.
»Positionslampen«, sagte Ruth, ebenfalls ganz leise, fast flüsternd. »So heißen die doch, oder?«
Das Boot schaukelte sanft in der Dünung, sachte und schwingend wie in einer Wiege, wie das große, schwere Bett mit der »Zauberfinger«-Massage in dem Motel, wo sie in ihrer ersten Nacht in Georgia gelandet waren. Eine leichte Brise wehte auch, süß und salzig zugleich, milde, aber doch kräftig genug, um die Moskitos in Schach zu halten. Das einzige Geräusch kam vom Wasser, das das Boot umschmeichelte, ruhig und rhythmisch, ein Plätschern und Fließen, in dem die Melodie eines alten Liedes anklang, das sie seit zehn Jahren vergessen hatte. Die Sterne waren lebendig und wach. Die Flasche mit Champagner war kalt. Er antwortete nicht.
Ruth Dershowitz lag nackt im Bug von Saxby Lights’ fünfeinhalb Meter langem Motorboot. (Eigentlich gehörte das Boot seiner Mutter, so wie alles in und um das Große Haus auf Tupelo Island.) Saxby lag ausgestreckt neben ihr, die Wange schläfrig gegen ihre Brust gedrückt. Jedes Mal wenn das Boot in ein Wellental sackte, entfachte die Reibung seines modischen Stoppelbarts winzige Feuer, die bis hinunter in ihre Zehen loderten. Fünf Minuten vorher hatte Saxby vor ihr gekniet, hatte ihre Hüften auf der breiten, flachen Planke des Sitzes zurechtgeschoben, ihre Schenkel gestreichelt, sodass sie sich öffneten, und war in sie eingedrungen. Zehn Minuten davor hatte sie zugesehen, wie er im schwindenden Licht einen Ständer bekam, während er auf der Ruderbank vor ihr saß und vergeblich versuchte, eine Luftmatratze aufzublasen, damit sie es bequem hätten. Sie hatte ihn beobachtet, nachdenklich und erregt, bis sie schließlich raunte: »Lass es gut sein, Sax – los, komm schon!« Und jetzt war er eingeschlafen.
Eine Zeit lang horchte sie auf das Wasser und dachte an gar nichts. Und dann stieg das Bild von Jane Shine, ihrer Feindin, vor ihr auf, doch sie verscheuchte es mit einer Vision des eigenen, unausweichlichen Triumphes, ihre noch unstrukturierten Erzählungen kristallisierten zu Kunst, eroberten Literaturmagazine und erstaunten die Welt, und dann dachte sie an das Große Haus, dachte an ihre Schriftstellerkollegen, an die Bildhauer und Maler und an die schieläugige Komponistin, deren Musik wie der schleppende Tod in einer Metronomenfabrik klang. Eine Woche war sie jetzt schon mit ihnen zusammen, die erste Woche eines unbefristeten Aufenthalts – einer Serie von Monaten, die nun in ihrer Fantasie zum Leben erwachten: Monate mit kleinen Koboldgesichtern und eingezogenen Köpfen, beim fröhlichen Bockspringen hinein in eine ruhmreiche, grenzenlose, sonnenhelle und mietfreie Zukunft. Keine Servierjobs und keine Zeilenschinderei mehr, nie wieder Restaurant-Kritiken, Banalitäten für Käseblätter wie Parade oder Cosmopolitan-Peinlichkeiten über Safer Sex, Sex in der Dusche oder »Frühstück bei ihm zu Hause«. Sie konnte so lange bleiben, wie sie wollte. Für immer.
Sie hatte jetzt Verbindungen.
Der Gedanke lullte sie ein, und ehe sie sich’s versah, driftete sie davon, wurde vom Champagner, der Nacht, die wie eine Decke war, und dem wohligen Schaukeln des Bootes in die verschwommenen Gefilde des Unbewussten gezogen, und bald streiften weiße Meeresgeschöpfe durch ihren Traum. Sie trieb im Wasser, und auf einmal schoss ein Dutzend blasser Wesen wie Torpedos auf sie zu, sie schrie auf … aber es war alles gut, sie lag in Saxbys Boot, die Sterne blinkten, und sie war wach – einen Augenblick lang –, ehe sie in den Traum zurückglitt. Delfine, nur Delfine waren es, das sah sie jetzt, und sie spielten mit ihr, stupsten ihr die Flaschenschnauzen zwischen die Beine und hoben sie auf ihre glitschigen Stromlinienschultern … aber dann ging etwas schief, und sie war wieder allein im Wasser, und da war noch etwas anderes: ein Schatten stieg aus der Tiefe auf, düster und schnell, und rempelte sie an, mit einem so festen Stoß, dass sie aufwachte. »Sax?« Zuerst glaubte sie, sie seien mit einem anderen Boot kollidiert, weil sie kein Licht gemacht hatten – ihre Gedanken waren noch etwas wirr –, »Sax? Hast du das auch gespürt?«
Saxby hatte einen festen Schlaf. Einmal in Kalifornien, da hatte er weitergeschlafen, obwohl der Radiowecker sich dreimal einschaltete, ein Erdbeben die Bilder von den Wänden schüttelte und die Marschkapelle der Universität auf der Wiese hinter seiner Wohnung eine Probe abhielt. »Wie?« fragte er, »häh?« und hob dann langsam den Kopf von ihrer Brust. »Gespürt? Was denn?«
Aber dann erstarrte Saxby plötzlich. Sie lag auf dem Rücken und betrachtete ihn, als seine Muskeln sich mit einem Mal anspannten und er verblüfft »Was zum Teufel?« knurrte, und da blickte auch sie auf und sah direkt in die Augen einer Erscheinung. Gespenstisch und unvermutet stieg im fahlen Mondschein über dem Heck ein Gesicht auf. Es dauerte einen Moment, aber dann begriff sie: Das war ein Mensch. Ein Mensch, der sich an ihr Boot klammerte, mitten in der Nacht draußen auf dem Peagler Sound. Sie sah ihn, ja, die Haare hingen ihm in die Augen, seine Züge hatten etwas Eigenartiges, sie sah seinen verwirrten, erschöpften Gesichtsausdruck, der sich nun wie in Zeitlupe zu einer Miene des Entsetzens wandelte. Er stieß ein Quietschen aus – ein Quietschen, das die kleinlichen Grenzen von Sprache und Kultur transzendierte –, und dann, ehe sie noch Zeit hatte, sich ihrer Nacktheit bewusst zu werden, war er wieder verschwunden.
Im nächsten Augenblick waren sie und Saxby auf den Füßen, kämpften sich in ihre Kleider und verhedderten sich mit Armen und Beinen, weil das Boot schwankte und schaukelte. »Verdammt!«, fluchte Saxby, der mit der einen Hand seine Shorts zusammenhielt und mit der anderen an der Ankerleine zerrte. »Du blöder Scheißkerl! Komm sofort zurück!«
Wer es auch gewesen war – Gespenst, Voyeur, Scherzbold, Schiffbrüchiger oder Surfer in Seenot –, er hatte nichts dergleichen im Sinn. Im Gegenteil: Er war auf der Flucht. Ruth hörte ihn durchs Wasser pflügen, und jetzt, da sie sich abrupt aufsetzte und nach ihrem T-Shirt tastete, nahm sie ihn auch schemenhaft wahr: Der dunkle Keil seines Kopfes teilte das schwarze Wasser, etwas Weißes blitzte auf – eine Rettungsweste? ein Surfbrett? –, und die Gischt, in der das Plankton phosphoreszierte, zog hinter ihm einen Chimärenschweif.
Fluchend wuchtete Saxby den Anker ins Boot und schleuderte ihn in den Kiel. Ein Gestank nach Schlamm, nach kotiger Verwesung, stieg ihr in die Nase. »Was ist mit dem Typen bloß los?« fauchte Saxby, und seine Hände zitterten, als er den Außenborder anwarf. »Ist das ein Perverser, oder was?«
Ruth saß am Bug und blickte immer noch dem Schatten des fernen Schwimmers nach. »Er sah so« – sie wusste gar nicht, was sie sagen wollte, noch war ihr nicht klar, was ihr an ihm Besonderes aufgefallen war –, »er sah irgendwie merkwürdig aus.«
»Allerdings«, knurrte Saxby, als der Motor aufheulte, »chinesisch oder so.« Und dann gab er Gas, das Boot drehte sich um seine Achse, und sie schossen davon, dem Schwimmer hinterher.
Der Wind fing sich in Ruths Haar, als sie die Shorts anzog. Ihr Herz hämmerte. Sie war durcheinander. Was war passiert? Was taten sie eigentlich? Es blieb keine Zeit zum Nachdenken. Unter ihr klatschten die Wellen gegen das Boot, sie klammerte sich an die Sitzbank und spürte die Gischt im Gesicht. Gleich hatten sie den hektischen Schwimmer eingeholt, da fuhr sie zu Saxby herum und schrie auf.
Auf einmal hatte sie Angst vor Saxby, zum ersten Mal in all den Monaten, die sie ihn nun kannte. Er war ein anständiger, netter, ruhiger Typ, der Campari mit Soda trank und dem seine großen Füße peinlich waren, das wusste sie, dennoch ließ sich unmöglich voraussagen, wie er in einer Situation wie dieser reagieren würde. »Du Dreckskerl!«, fauchte er, und sie sah im kalten Mondlicht, wie er die Zähne zusammenbiss. Einen Moment lang stellte sie sich vor, wie der unglückliche Schwimmer von der glatten, schimmernden Faust des Bootsrumpfes platt gewalzt wurde. »Nein!«, schrie sie, aber als sie mit der dunklen, um sich schlagenden Gestalt im Wasser auf gleicher Höhe waren, nahm er das Gas weg.
»Jetzt wollen wir uns dieses Arschloch mal ansehen«, sagte Saxby und ließ die Taschenlampe aufleuchten.
Zum ersten Mal sah sie den Störenfried genauer. Da war er, keine zwei Meter vor ihnen kämpfte er mit der Bugwelle des Bootes. Sie sah Strähnen rötlichen Haars, seltsam verzerrte Gesichtszüge, unergründliche Augen, in denen sich Entsetzen spiegelte, und dann schwamm er in voller Panik weg vom Boot, aber Saxby schwang das Ruder herum und folgte ihm. Er drehte durch, dieser Mann da im Wasser, er schlug um sich und keuchte, kämpfte um den Rettungsring, den er hielt, und plötzlich war ihr klar, dass er kurz davor war zu ertrinken. »Er ist am Ersaufen, Sax!«, rief sie. »Vielleicht ist er von einem Schiff über Bord gegangen.« Der Motor sang, Vollgas, dann Leerlauf. Die Wellen klatschten gegen das Boot. »Wir müssen ihn retten.«
Sie wandte sich Saxby zu. Seine Wut war verraucht, sein Gesicht gefasst, ja beinahe zerknirscht. »Ja«, sagte er, »hast recht. Ja, klar.« Und er stand auf, glich mit den Knien die schaukelnden Bewegungen des Bootes aus und hielt die Taschenlampe hoch, als könnte die Kraft des Lichtstrahls den Ertrinkenden an Bord hieven.
»Wirf ihm ein Seil zu«, drängte sie. »Schnell!«
Der blind um sich schlagende Mann im Wasser erinnerte sie an den kleinen, sechzig Zentimeter langen Alligator, den Saxby eines Nachts im Schein einer Taschenlampe mit einem spitzen Stab aufgespießt hatte, draußen am Teich hinter dem Großen Haus. Das Vieh war reglos dahingetrieben, nicht belebter als ein Baumstamm oder Grasbüschel, bis auf das Feuer, das seine Augen im Licht reflektierten, und dann hatte Saxby zugestoßen, und es war zusammengeklappt wie ein Taschenmesser, verschwunden, abgetaucht in die verschlungenen Tiefen, um gleich darauf blitzschnell wieder hochzufahren wie ein Stilett, wild und verletzt und zähneblitzend und sterbend. »Los, pack ihn, pack seinen Arm«, sagte Saxby und steuerte das Boot dicht heran.
Aber der Ertrinkende wollte sich nicht am Arm packen lassen. Er erstarrte, stieß den Rettungsring von sich und brüllte sie an, brüllte ihr ins Gesicht, dass sie das Gold in seinen Zähnen blitzen sah. »Gehn weg!«, brüllte er. »Gehn weg!« Und dann tauchte er unter dem Boot hindurch.
Danach war er verschwunden. Kein Geräusch, keine Bewegung. Der Motor spotzte, das Boot trieb ab. Auspuffgase hüllten sie ein, bitter und metallisch.
»Total bekloppt«, stellte Saxby fest. »Muss ein Entsprungener aus Milledgeville sein oder so.«
Sie antwortete nicht. Ihre Finger krallten sich in das bleiche, gesplitterte Holz des Dollbords, bis sich die Knöchel weiß färbten. Sie hatte noch nie jemanden sterben sehen, hatte noch nie einen Toten gesehen, nicht einmal ihre Großmutter, die netterweise während ihrer Europareise dahingeschieden war. Etwas stieg in ihrer Kehle hoch, ein dicker Klumpen aus Kummer und Bedauern. Die Welt war verrückt. Eben noch hatte ihr Geliebter sie im Arm gehalten, alles war ruhig und still gewesen, die Nacht über sie gebreitet wie eine Decke … und jetzt war ein Mensch tot. »Sax«, sagte sie flehend zu ihm, »kannst du nicht irgendwas tun? Kannst du ihm nicht nachschwimmen und ihn retten?«
Saxbys Miene war unergründlich. Sie kannte jede Faser von ihm, kannte die Punkte, wo sie ihn verletzen und wo sie ihn beglücken konnte, sie konnte ihm die Seele herausreißen, sie mit den Händen auswringen und zum Trocknen aufhängen wie ein Taschentuch. Aber das hier war etwas Neues. Sie hatte ihn noch nie so gesehen. »Scheiße«, sagte er schließlich, und jetzt wirkte er verängstigt, das war in Ordnung, diesen Zustand erkannte sie wieder, »da ist ja kein Schwein zu sehen. Wie soll ich ihm nachschwimmen, wenn ich ihn nicht mal sehe?«
Sie sah den Strahl der Taschenlampe, der ziellos über die Wasserfläche huschte, und dann hörte sie etwas, ein leises Plätschern, den sachten Schlag von spritzendem Wasser. »Da drüben!«, rief sie, und Saxby fuhr mit der Lampe herum. Einen Moment lang sahen sie gar nichts, dann kam das Ufer mit seinem kurzen dunklen Bart aus Strandgras ins Blickfeld, wie ein Dia, das man in den Projektor schiebt. »Da!«, schrie sie, und da war er, der Schwimmer. Er stand jetzt, das Meer klatschte gegen seine Gürtelschlaufen, ein nasses weißes Hemd hing an ihm herunter wie ein Lappen.
»He!«, keifte Saxby, jetzt wieder wütend und aufgebracht. »He, du da? Ich rede mit dir, du Penner! Was glaubst du eigentlich –?«
»Psst!«, warnte ihn Ruth, doch zu spät: Der Fremde war schon wieder weg, von der Vegetation verschluckt, trampelte durch das Schilf wie ein angeschossenes Reh, unerkannt. Das Meer lag wieder unbewegt im Schein der Lampe. Das Bild war leer. In diesem Augenblick trieb der Rettungsring ins Blickfeld, knapp außerhalb ihrer Reichweite, in einem Knäuel aus Seetang und Plastikmüll. »Lass mich mal –« Sie streckte sich keuchend danach aus, aber Saxby kam ihr entgegen und fuhr mit dem Boot ein Stück näher heran. Und dann hatte sie ihn, den aus dem Wasser gefischten Schatz, der nun triefend in ihrem Schoß lag.
Sie drehte den Ring um, und da standen sie, die knallroten Schriftzeichen, die den Namen Tokachi-maru bezeichneten. Natürlich konnte sie das nicht lesen, trotzdem war es wie eine Erleuchtung. Saxby stand über ihr und starrte den Rettungsring an, als wäre es ein Fang von unschätzbarem Wert. Das Licht erfasste ihren Schoß, eine leichte Brise wehte den Duft der Küste heran. »Ja«, sagte sie dann, »chinesisch.«
DIE TOKACHI-MARU
Hiro Tanaka war jedoch ebenso wenig Chinese wie sie. Er war ein Japaner vom Geschlecht der Yamato – mütterlicherseits jedenfalls, da gab es keinen Zweifel –, und er hatte die Tokachi-maru unter erschwerten Umständen verlassen. Tatsache war, er war von Bord gegangen. Gesprungen, um genauer zu sein. Nicht dass er sich in ein Barmädchen verschossen hätte oder sternhagelvoll in einer dunklen Gasse zusammengesunken wäre, während sein Schiff den Anker lichtete: Nein, er hatte einen vorsätzlichen, todesverachtenden Sprung ins Nichts getan. Wie sein Idol Yukio Mishima, und zuvor dessen Idol, Jōchō Yamamoto, war Hiro Tanaka ein Mann von Entschlusskraft. Als er von Bord ging, setzte er sich über kleinliche Wortklauberei hinweg: Er ging gleich über Bord.
Am fraglichen Tage pflügte die Tokachi-maru auf nördlichem Kurs an der Küste Georgias entlang, mit einer Ladung von Traktorenteilen, DAT-Kassettenrekordern und Mikrowellenherden unterwegs nach Savannah. Es war ein Tag wie jeder andere, der Wind war kräftig, die Sonne brannte sich in den Himmel, der 12.000-Tonnen-Frachter bügelte die Wellen glatt, als wären es Falten in einem Hemd. Bis auf sechs Mann saß die vierzigköpfige Crew bei einem Mittagessen nach westlicher Art (Corned Beef mit Ölsardinen, Rührei und Pommes frites, alles friedlich vereint in einem einzigen Topf und verfeinert mit Steaksoße und scharfem Senf). Kapitän Nishizawa war in seiner Kabine und schlief den als Aperitif genossenen Sake aus, Steuermann Wakabayashi und der Erste Maat Kuma befanden sich im Kartenraum beziehungsweise am Steuerruder, die Leichtmatrosen Ueto und Dorai hatten Wache, und Hiro saß im Arrest.
Genauer genommen saß Hiro in einem Lagerraum auf dem dritten Deck. Dieser war mit sechs Quadratmetern ungefähr so groß wie die Wohnung, in der er mit seiner Großmutter gelebt hatte, ehe er auf der Tokachi-maru angeheuert hatte, und wurde von einer einzigen flackernden 40-Watt-Glühbirne erhellt. Man hatte Hiro eine Holzschüssel und Stäbchen zur Deckung seines Nahrungsbedarfs gegeben, einen Eimer, in den er sich entleeren konnte, und zum Schlafen einen Futon, den er auf dem kalten Stahlboden ausgebreitet hatte. Belüftung gab es keine, und der kleine Raum stank nach Desinfektionsmittel und dem Schweröl, das Tag und Nacht in den schweren Dampfturbinen verfeuert wurde. Zwanzig Mops, zwanzig Eimer und sechzehn Besen hingen an Schraubhaken von den Wänden. Diverse Gegenstände – Farbkratzer, leere Sapporo-Bierkisten und ein einzelner, teerbespritzter Nike-Turnschuh – lagen dort, wo der letzte hohe Seegang sie verstreut hatte. Die Tür war von außen verriegelt.
Obwohl Hiro ein gewissenhafter, wohlerzogener und friedfertiger Mensch war, so still und bedächtig, dass er unter seinen Schiffskameraden nahezu unsichtbar wirkte, saß er gefangen in dieser grässlichen Stahlkammer, bekam eine strenge Diät aus zwei Bällchen weißem Reis und einer Blechtasse Wasser täglich, und all dies wegen eines für ihn eigentlich untypischen Aktes der Auflehnung: Er hatte sich dem ausdrücklichen Befehl eines Vorgesetzten widersetzt. Der Vorgesetzte war Steuermann Wakabayashi gewesen, ein Überlebender der Schlacht von Rarotonga, dem heute noch Schrapnell im verlängerten Rücken, in den Armen, Beinen, Füßen und der Schädelbasis steckte und der infolgedessen ein etwas hitziges Temperament besaß. Er hatte Hiro ausdrücklich Befehl erteilt, davon abzulassen, die Luftröhre des Ersten Kochs Chiba zusammenzupressen, der zu dieser Zeit unter dem vollen Gewicht des ergrimmten Hiro hilflos um sich tretend auf dem Boden der Kombüse lag. Und das war nicht wenig, denn mit seinen ein Meter achtundsiebzig wog Hiro, der übermäßig gerne aß, gut an die neunzig Kilo. Chiba dagegen, der übermäßig gerne trank, wog weniger als ein nasser Lappen.
Es war eine chaotische Szene. Der Zweite Koch, Moronobu Unagi, der einmal im Streit um eine Flasche Suntory-Whisky einem Leichtmatrosen das Gesicht verbrüht hatte, kreischte wie ein Papagei: »Mord! Mord! Mord! Er bringt ihn um!« Der Erste Maschinist, ein stiller, in sich gekehrter Mann Mitte siebzig mit Plattfüßen und schlecht sitzendem Gebiss, zerrte ohne viel Erfolg an Hiros Schultern, und ein halbes Dutzend Matrosen stand johlend drum herum. Steuermann Wakabayashi in seiner makellos weißen Uniform kam in die Kombüse gestürmt, wo die Streithähne ineinander verkeilt auf dem Boden lagen, erteilte Hiro mit Stentorstimme besagten Befehl, wurde jedoch sofort darauf in einen Kessel mit klarer Brühe geschleudert, da gerade in diesem Moment das Schiff in ein Wellental zu tauchen geruhte. Die Suppe – es war ein 80-Liter-Kessel – verbrannte Hiro den Rücken, ergoss sich über den Boden und tränkte Chiba, der ohnehin für drei stank, mit der aromatischen Essenz von eingekochtem Fisch. Hiro aber lockerte seinen Griff keinen Zentimeter.
Und was hatte einen so sanften Mann zu einer so verzweifelten Tat bewogen?
Direkter Anlass war ein Pfannengericht aus gekochten Eiern gewesen. Hiro, der auf der Tokachi-maru unter dem betrunkenen, stinkenden Chiba und dem betrunkenen, schleimigen und aalglatten Unagi als Dritter Koch angeheuert hatte, bereitete nämlich ein nishiki tamago als Vorspeise für das Abendessen zu. Zu diesem Zweck musste er hundert hart gekochte Eier von der Schale befreien, Eigelb und Eiweiß vorsichtig trennen, beides fein hacken, gut würzen und dann wieder – ganz behutsam – miteinander vermischen und mehrere Stahlpfannen mit einer ein Zentimeter dicken Schicht davon auslegen. Das Rezept hatte Hiro von seiner Großmutter gelernt – er wusste auch noch etwa dreißig weitere auswendig –, doch in den sechs Wochen, seit das Schiff Yokohama verlassen hatte, war dies das erste Mal, dass er kochen durfte. Üblicherweise fungierte er nur als sous-chef, Laufbursche und Küchensklave, schrubbte Töpfe, polierte Gasherde, putzte Berge von aufgetauten Kalamari, Tintenfischen und Bonitos, hackte Seetang und wusch Weintrauben, bis ihm die Finger wund wurden. An diesem speziellen Nachmittag aber waren Chiba und Unagi unpässlich. Zur Feier von O-bon, dem buddhistischen Ehrenfest für die Geister der Ahnen, hatten sie seit dem Frühstück Sake getrunken, und Hiro war sich selbst überlassen geblieben, während sie sich abmühten, mit den Schatten der Verblichenen in Verbindung zu treten. Er arbeitete hart. Arbeitete voll Stolz und konzentriert. Acht Tabletts lagen vor ihm, alles aufs Feinste zubereitet. Als letzten Schliff streute er schwarze Sesamsamen über die Speise, so wie seine Großmutter es ihm beigebracht hatte.
Das war ein Fehler. Denn in diesem Augenblick, gerade als er den Streuer über das letzte Tablett hielt, kamen Chiba und Unagi in die Kombüse getorkelt. »Idiot!«, kreischte Chiba und schlug ihm den Streuer aus der Hand, sodass er gegen den Gasherd flog. Hiro wandte das Gesicht ab und ließ den Kopf hängen. Durch seine Sandalen hindurch, tief unter den Fußsohlen, konnte er das ta-dum, ta-dum, ta-dum der Schiffsschrauben spüren, die sich schäumend im kalten grünen Wasser drehten. »Niemals«, tobte Chiba, dessen eingesunkene Brust und fleischlose Arme bebten, »niemals darfst du schwarzen Sesam für nishiki tamago nehmen.« Er wandte sich an Unagi. »Oder hast du so was schon je gehört?«
Unagis Augen waren Schlitze. Er rieb sich die Hände, als freute er sich auf eine seltene Köstlichkeit, und nickte kurz. »Niemals«, sagte er gedehnt, wartete, wartete noch, »außer vielleicht bei Ausländern. Bei gaijin.«
Jetzt blickte Hiro auf. Das wahre Motiv für seine Explosion, der Grund für all seine Qualen im Leben, war soeben an die Oberfläche getreten.
Chiba trat dicht an ihn heran, sein Affengesicht hassverzerrt, Spucketropfen auf der Oberlippe. »Gaijin!«, stieß er hervor. »Langnase! Ketō! Bata-kusai!« Und dann öffnete er die geballte Faust, betrachtete einen Augenblick lang seine Finger und versetzte Hiro ohne Vorwarnung einen üblen Handkantenschlag auf die Nase. Dann nahm er sich das nishiki tamago vor. In wildem Wirbel arbeiteten seine dürren Handgelenke und eckigen Ellenbogen, als er wie ein Wahnsinniger ein Tablett nach dem anderen auf den Boden kippte. »Dreck!«, brüllte er dabei. »Hundescheiße! Schweinefraß!« Unagi betrachtete Hiro währenddessen durch halb geschlossene Lider und grinste.
An diesem Punkt verlor Hiro die Beherrschung. Oder vielmehr verlor er nicht direkt die Beherrschung, sondern er attackierte seinen Peiniger – wie Mishima gesagt hätte: – in einer »Explosion von purem Handeln«. Das nishiki tamago bedeckte den Boden, auf dem großen Suppenkessel schepperte der Deckel, Unagi grinste, Chiba spie Beschimpfungen, die Zeit blieb einen Augenblick lang stehen, während das Klappern des letzten Tabletts in der Luft verhallte, dann stürzte der Erste Koch vornüber in die gehackten Eier, und Hiros Finger schlossen sich fest um seine Kehle. Chiba keuchte, die Truthahnhaut an seinem Hals färbte sich rot unter Hiros weißen, weißen Fingern. Unagi schrie: »Mord! Mord! Mord!« Und die ganze Zeit über drückte Hiro zu, achtete nicht auf das Gejohle, die brühend heiße Suppe, Chibas stinkenden Atem und sein Gesicht, das unter ihm wie eine Blutblase anschwoll, kümmerte sich nicht um Wakabayashi und den Ersten Maschinisten, kämpfte wie ein tollwütiger Hund gegen die acht Männer an, die nötig waren, um ihn von seinem Peiniger zu trennen. Ihm war alles egal, er fühlte keinen Schmerz, und Jōchōs Worte dröhnten in seinem Kopf: Taten von wahrer Größe lassen sich nicht in gewöhnlicher Geistesverfassung vollbringen. Man muss zum Fanatiker werden und zum Sterben lustvoll bereit sein.
Aber er starb nicht. Statt dessen landete er in der behelfsmäßigen Gefängniszelle, wo er die Wände anstarrte und Schweröldämpfe einatmete, während er auf den Hafen von Savannah und den Japan-Air-Flug wartete, der ihn in Schande zurück nach Hause bringen würde.
Gaijin. Langnase. Butterstinker. Das waren die Schimpfnamen, die er sein Leben lang hatte ertragen müssen, derentwegen er sich bei seiner Großmutter auf dem Spielplatz ausgeweint hatte, mit denen er in der Grundschule gehänselt und später verächtlich gemacht worden war, ausgesondert und gepiesackt, bis er von der Handelsmarineschule vertrieben wurde, die seine Großmutter für ihn ausgesucht hatte. Ausländer, so nannten sie ihn. Denn seine Mutter war zwar aus Japan – eine Schönheit mit festen Beinen, großen Augen und einem bezaubernden Lächeln trotz eines vorstehenden Zahns –, aber sein Vater war es nicht.
Nein. Sein Vater war Amerikaner. Ein Hippie. Ein junger Mann auf einem zerknitterten und abgegriffenen Foto: Haare bis auf die Schultern, ein Bart wie ein Mönch, Katzenaugen. Nicht einmal seinen Namen kannte Hiro. Obāsan, löcherte er seine Großmutter, wie war er denn, wie groß war er, wie hieß er? »Dogu«, sagte sie, aber das war nicht sein richtiger Name, es war ein Spitzname – Doggo – nach einer Figur aus einem amerikanischen Comic. »Groß«, sagte sie manchmal, »mit kleinen, getönten Augengläsern und einer langen Nase. Behaart und schmutzig.« Dann wieder erzählte sie, er sei klein gewesen, schmächtig, fett, breitschultrig, oder dass sein Haar weiß gewesen und er am Stock gegangen sei oder dass er Jeans und einen Ohrring getragen habe und so schmut- zig und behaart gewesen sei (schmutzig und behaart war er immer, in jeder Version), dass man hinter seinen Ohren hätte Rüben anbauen können. Hiro wusste nicht, was er glauben sollte – sein Vater war wie ein Gespenst in einem Kindermärchen, überlebensgroß am Morgen, kleiner als ein Fingerhut am Abend. Gern hätte er seine Mutter gefragt, aber seine Mutter war tot.
So viel jedenfalls wusste er: Der Amerikaner war nach Kioto gekommen, in seinen Hippiekleidern, mit der altmodischen Brille und den Ringen am Finger, um sich dem Zen zu widmen und jemanden zu finden, der ihn die koto spielen lehrte. Wie alle Amerikaner war er faul, vollgekifft und undiszipliniert und verlor daher bald das Interesse am harten Zen-Regiment des Betens und der Meditation, strich aber weiter durch die Straßen von Kioto, in der vagen Hoffnung, doch noch die Grundbegriffe der koto zu erlernen, um diesen Stil nach Amerika zu importieren, so wie die Beatles die Sitar aus Indien mitgebracht hatten. Natürlich war er in einer Band – jedenfalls war er es gewesen –, und das merkwürdige Instrument hatte ihn begeistert. Fast zwei Meter lang, mit dreizehn Saiten und beweglichen Bünden, klang es anders als alles, was er je gehört hatte, ein sirrender, fremder Ton, eine Zither von der Größe eines Alligators. Natürlich würde er sie elektrisch verstärken und flach auf einen Tisch legen, wie eine pedal steel guitar, und dann würde er die Schultern in Bewegung setzen und seinen ungeschorenen Kopf hin und her werfen, ekstatisch an den Saiten zupfen und das Publikum zu Hause zum Staunen bringen. Aber die koto war teuflisch schwer zu spielen, und er brauchte einen Lehrer. Und einen Job. Er hatte keine Arbeit und kein Geld mehr, und sein Studentenvisum lief demnächst ab.
Und hier kam Sakurako Tanaka ins Spiel.
Hiros Mutter war intelligent, sehr intelligent, hatte beim Schulabschlusstest eins der besten Ergebnisse ihrer Klasse erzielt – sodass sich ihr unter Umständen sogar die Tore der erhabenen Tokyo University geöffnet hätten –, sie war bezaubernd, hübsch, temperamentvoll und mit neunzehn Jahren eine Aussteigerin. Sie wollte nicht auf die Todai oder die Kyoto University oder sonst wohin. Sie wollte keine Karriere bei Suzuki oder Kubota oder Mitsubishi machen, und ganz bestimmt hatte sie nicht vor, in der Küche oder im Kinderzimmer begraben zu werden. Ihr wahrer Wunsch, ein verzweifeltes Sehnen, das an ihr nagte wie Hunger, wie die Schlaflosigkeit, die ihre Nächte aushöhlte und ihre Tage leer brannte, war es, amerikanische Rockmusik zu spielen. Live. Mit ihrer eigenen Band. »Ich will Sachen von Buffalo Springfield spielen, von den Doors, Grateful Dead und Iron Butterfly«, sagte sie zu ihrer Mutter. »Ich will singen wie Janis Joplin und Grace Slick.« Ihre Mutter, Hausfrau in einer Hausfrauennation, war strikt dagegen. Diese Musik war fremd, eine Teufelsmusik, schräg, sinnlich und unrein, und der rechte Platz für eine junge Frau war im Haus, bei Mann und Kindern. Sakurakos Vater, ein Angestellter, der sein Leben lang für den Traktorenhersteller Kubota gearbeitet hatte, der stets nur mit seinen Kollegen essen ging, Golf spielte und in Urlaub fuhr und für den schon die Grabstelle auf dem Firmenfriedhof reserviert war, explodierte bereits bei der bloßen Erwähnung von Rockmusik.
Schließlich ging Sakurako von zu Hause fort. Sie nahm ihre ausgeblichenen Jeans und ihre Gitarre und ging nach Tokio, wo sie die Clubs in den Bezirken Shibuya, Roppongi und Shinjuku abklapperte. Es war das Jahr 1969. Gitarristinnen waren in Japan so selten wie Mangos in Sibirien. Innerhalb eines Monats war sie wieder in Kioto und arbeitete in einer Bar. Als Doggo durch die Tür kam, ohne einen Yen, lange Haare und bunte Ketten, in Jeans, Batikhemd und Stiefeln, die Fingerspitzen schwielig von der Reibung der kalten Stahlsaiten seiner Gitarre, da war es um sie geschehen.
Er ließ sich von ihr etwas zu essen geben und sich auf Drinks einladen, und er erzählte ihr von L. A. und San Francisco, von Sunset Strip und Haight-Ashbury und von Jim Morrison. Sie trieb einen sensei für ihn auf, der in Pontochō, der Altstadt von Kioto, die Geishas das samisen und die koto spielen lehrte, und in seiner Dankbarkeit zog er zu ihr. Es war eine winzige Wohnung. Sie schliefen auf einer Matte, rauchten Hippiedrogen und vögelten zum Klang zerkratzter Schallplatten mit Hippiemusik. Hiro machte sich nichts vor. Seine Mutter war eine Bardame gewesen – sie kannte hundert Männer, Koketterie war ihr Geschäft –, und ihr Leben lief wie ein erschütternder Dokumentarfilm in seinem Kopf ab. Sie wurde schwanger, das Zimmer noch kleiner, der Reis schmeckte auf einmal komisch, Essensgeruch durchdrang alle Wände, und dann, eines Tages, war Doggo verschwunden, ließ nichts zurück als das zerknitterte Foto und das Geräusch von gezupften Stahlsaiten, das durch die leeren Räume ihrer Einsamkeit hallte. Sechs Monate später wurde Hiro geboren. Weitere sechs Monate danach war seine Mutter tot.
Und deshalb war Hiro ein Halbblut, ein happa, eine Langnase, ein Butterstinker – und zudem noch ein Waisenknabe –, für immer ein Fremder in der eigenen Gesellschaft. Und mochten die Japaner auch eine reine Rasse und geradezu fanatisch intolerant gegen Mischehen sein – die Amerikaner, das wusste er, waren ein Volk aus vielen Rassen, lauter Mischlinge und Mulatten und noch schlimmer – oder noch besser, je nachdem. In Amerika konnte man ein Teil Neger, zwei Teile Serbokroate und drei Teile Eskimo sein und dennoch erhobenen Hauptes durch die Straßen gehen. Wenn die eigene Gesellschaft eine geschlossene war, so war die amerikanische dagegen weit offen – das wusste er, er hatte Filme gesehen, Bücher gelesen, LPs gehört –, und jeder konnte dort tun und lassen, wozu er Lust hatte. Amerika war gefährlich, das schon. Verbrechen, Verkommenheit und Individualismus gärten dort. Aber in Japan war er aus der Schule geflogen – er galt weniger als die burakumin, die Ureinwohner, die den Abfall einsammelten, weniger als die Koreaner, die man im Krieg als Sklaven hergebracht hatte.
Und so heuerte Hiro auf der Tokachi-maru an, dem klapprigsten und rostzerfressensten Kahn, auf dem die japanische Flagge wehte; er wählte sie, weil sie Kurs auf die USA nahm und er dort an Land gehen wollte, um sich alles selbst anzusehen, die Cowboys und die Nutten und die wilden Indianer, vielleicht würde er in einem schneeweißen, geräumigen Ranchhaus sogar seinen Vater finden und mit ihm ein paar Cheeseburger verspeisen. Und so wurde Hiro Dritter Koch anstatt der Offizier, der er geworden wäre, wenn sie ihn die Handelsmarineschule hätten beenden lassen, musste die Unflätigkeiten von Chiba und Unagi und all den anderen ertragen – sogar hier, sogar auf See war er davor nicht sicher –, und so handelte er nach Mishima und Jōchō, schlug seine Feinde und landete dafür gedemütigt in der Arrestzelle, wo er mit dem Knurren und Flehen seines leeren Magens und zwei Bällchen Reis pro Tag leben musste.
In seiner Not dachte er Tag und Nacht an Essen, schwelgte darin, träumte davon, verherrlichte es. Am Tag seiner Flucht erträumte er sich ein Frühstück: eine miso-Suppe mit Auberginen und Sojabohnenquark, gedünstetem Rettich, rohen Zwiebeln, Senfreis. Und Mittagessen – nicht den westlichen Fraß, den Chiba zusammenbraute, um damit anzugeben, dass er einmal auf einem Frachter aus Tacoma/Washington gefahren war, sondern ein Gericht aus Eiern und Reis – tamago meishi –, das seine Großmutter ihm immer bereitet hatte, wenn er aus der Schule gekommen war, oder die süßen Plätzchen aus Bohnenmasse und Gerste, die sie ihm oft beim Bäcker gekauft hatte, oder die köstlichen sōmen-Nudeln, von denen sie in ihrem eisernen Topf riesige Mengen herumrührte. Von diesen Nudeln träumend, starrte er mürrisch auf die an den Wänden hängenden Mops, als er die schweren Schritte seines Wärters auf den Stufen der Kajütstreppe hörte.
Sie näherten sich dem Hafen von Savannah, und Hiro wusste, dass er sehr bald handeln musste. Tagelang hatte er sich in den Weg des Samurai vertieft und die Worte von Mishima und Jōchō auswendig gelernt, und nun war er bereit. Das Buch – mit den komischen, kleinen grünen Geldscheinen und dem Foto seines Vaters sicher zwischen den Seiten verstaut – klebte in dem Plastik-Uterus an ihm, mit Tentakeln aus schwarzem Isolierband, das ihm sein Freund Ajioka-san in der Nacht zugesteckt hatte. In den Händen hielt er einen festen Mopp aus Eichenholz, dessen Fransen schwer mit dem Wasser vollgesogen waren, das sie ihm zum Waschen gegeben hatten.
Die müden, schlurfenden, fußlahmen Schritte von Noboru Kuroda, dem Tölpel, der den Offizieren das Quartier scheuerte und sie bei Tisch bediente, verstummten vor seiner Tür. Hiro trat zurück, sah im Geist die schiefen Schultern und den eingefallenen Brustkorb vor sich, die zwei linken Hände und die ewig verdutzte Miene von »Moment-noch«, wie sie den alten Kuroda hinter seinem Rücken nannten, und er lauerte atemlos, als sich der Schlüssel im Schloss drehte. Wie im Fieber sah er zu, wie sich der Türknopf drehte und die Tür aufschwang, und dann griff er an, den Mopp eingelegt wie eine Lanze. Gleich darauf war alles vorbei. Kurodas müder alter Kiefer klappte vor Überraschung auf, der nasse Mopp traf ihn mitten in den Solarplexus, und er stürzte auf das zerschlissene Linoleum, keuchend und prustend wie ein der schläfrigen Tiefe entrissener Thunfisch. Hiro bedauerte kurz den Verlust der Reisbällchen, die nun an Kurodas Hemd klebten, doch für Reue war jetzt keine Zeit. Behände stieg er über den stöhnenden Alten und stürmte hastig die Kajütstreppe hinauf, denn in seinen Adern pochte die Freiheit.
Unter ihm, auf dem zweiten Deck, saß die Mannschaft beim Essen, beäugte kritisch die Teller und pickte aus der Mixtur aus Dosenfleisch, Eiern und Kartoffeln, mit der Chiba sie gestraft hatte, mühsam einzelne Sardinenstückchen heraus. Über ihm waren die Schiffsaufbauten: Auf dem vierten Deck lagen das Dienstzimmer und die Räume mit der Elektrik und dem Kreiselkompass, auf dem fünften der Funkraum, auf dem sechsten die Kapitänskajüte, wo Kapitän Nishizawa auch jetzt wieder seinen Sake-Rausch ausschlief, und schließlich kam die Brücke. Vor der Brücke ragten die beiden Nocks in die luftige Leere hinaus, hingen wie ausgebreitete Schwingen beiderseits des Schiffes über dem Wasser. Eigentlich waren es Laufstege, die von unten durch Stahlstreben gestützt wurden; von dort konnte man an klaren Tagen zehn Meilen weit sehen. Diese Stege waren Hiros Ziel.
Polternd rannte er die Treppe hinauf, am Dienstzimmer vorbei und weiter, vorbei am Funkraum und an der Kapitänskajüte, rasch und entschlossen. Er flüchtete nicht blindlings, ganz und gar nicht: Er hatte einen Plan, wie ihn Mishima, in seinem Kommentar zu Jōchō, empfohlen hatte. Man kann sich für eine Handlungsweise entscheiden, sagte Mishima, aber man kann nicht immer den Zeitpunkt wählen. Der Moment der Entscheidung dräut in der Ferne und holt einen ganz plötzlich ein. Sollte das Leben dann nicht darin bestehen, sich für diesen Moment der Entscheidung bereitzuhalten? So war es. Und er war bereit.
Weiter rannte er die Stufen empor, vorbei am Kartenraum, aus dem ihn Steuermann Wakabayashi erst zornig anfunkelte, um ihm dann hinterherzusetzen, vorbei am Ruderhaus, in dem der Erste Maat Kuma stocksteif vor dem Rad stand, und hinaus auf das Backbordnock, wo Leichtmatrose Dorai die herannahende Gestalt anglotzte, als hätte er noch nie zuvor einen Mann gesehen, der sich aufrecht auf zwei Beinen bewegt. Und dann, den wutschnaubenden Wakabayashi hinter sich und den reglosen Dorai vor sich, hielt Hiro inne, um sein Taschenmesser zu ziehen. Erinnerungen an all die amerikanischen Filme über tätowierte Straßengangster und die Finten ihrer Messerkämpfe schossen Dorai durch den Kopf, und er wich ein paar Schritte zurück, aber das Messer war gar keine Waffe. Es wurde zum Werkzeug. Mit zwei raschen Schnitten durchtrennte Hiro das Seil, mit dem der weiße Rettungsring an der Reling befestigt war, und während Wakabayashi über das Deck herangetrampelt kam und Dorai sich verängstigt duckte, sprang Hiro ins Leere hinaus.
Es waren einundzwanzig Meter von der Brücke bis zur Wasseroberfläche, aber von oben sah es eher aus wie einundfünfzig. Hiro zögerte keinen Augenblick. Er flog durch das Empyreum wie ein Kunstspringer, bevor er den Fallschirm öffnet, wie ein Adler, der aus seinem Horst herabstößt, doch hielt ihn nichts in diesem lieblosen Element, und das Meer raste ihm entgegen wie ein Bett aus Beton. Er schlug mit den Füßen zuerst auf, ließ den Rettungsring fahren, aber trotzdem riss die Wucht des Aufschlags ihm beinahe den festgeklebten Jōchō vom Körper. Als er wieder an die Oberfläche trieb und seine Lungen gierig die ach so wohltuende Luft einsogen, war die Tokachi-maru schon weit weg, schob sich über den Horizont wie ein zerfließender Berg.
Bei voller Kraft brauchte das Schiff fast zwei Meilen oder dreieinhalb Minuten, bis es zum Stillstand kam. Natürlich würden sie ihn suchen, das wusste Hiro, so wie er wusste, dass in diesem Moment die gesamte Besatzung auf dem Deck herumwuselte und »Mann über Bord« brüllte, aber er wusste auch, dass der engste Kreis, den das Schiff beschreiben konnte, fast eine Meile im Durchmesser maß. Er machte kraftvolle Schwimmstöße, seine Füße wirbelten das salzige Nass auf, die Arme hämmerten auf die Wellen ein. Er dachte nicht daran, sich direkt westwärts zu wenden und auf die ferne Küste zuzuhalten – damit rechneten sie wohl –, sondern er orientierte sich am Sonnenstand und schwamm genau nach Süden, in die Richtung, aus der sie gekommen waren.
Das Wasser war warm und tropisch und schimmerte wie tausend Juwelen. Er betrachtete die Vögel über sich, betrachtete die Wolken. Er klammerte sich an den Rettungsring und machte Beinschläge. Und die See trug ihn, umarmte ihn, hielt ihn im Arm wie ein lange verschollener Vater.
THANATOPSIS HOUSE
Ruth beobachtete den ganzen Morgen lang, wie sich das Gewitter zusammenbraute. Um halb sieben war es so dunkel, dass sie beinahe das Wecken verschlief, und sie zog sich im Halbdunkel Shorts und Oberteil an. Um sieben kam sie zum Frühstück herunter und nahm wie üblich ihren Platz am Stillen Tisch ein, und auch hier schien es, als wäre die Nacht noch nicht ganz vorbei. Owen Birkshead, der Geschäftsführer der Kolonie, hatte die Lampen in den Ecken eingeschaltet, aber draußen vor den Fenstern war alles grau und verschwommen. Im Innern war es stickig und schwül, die Luft so dicht, dass man sie fast zurechtstreichen konnte wie eine Daunendecke. Es kam noch kein Donnergrollen, kein Blitzstrahl oder Regenschauer, aber sie spürte das Gewitter mit jener tiefen, physischen Intuition herannahen, die sie mit dem Molch unter dem Stein und der in ihrem Netz lauernden Spinne verband. Natürlich konnte sie mit niemandem darüber reden, konnte nicht einfach sagen: »Sieht nach Regen aus«, oder: »Jetzt geht aber bald was los.« Nein. Sie saß, aus eigenem Entschluss, am Stillen Tisch.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!