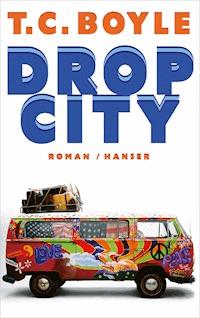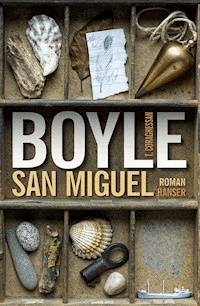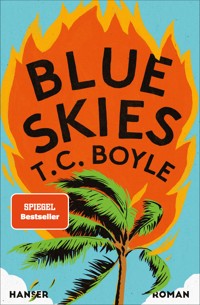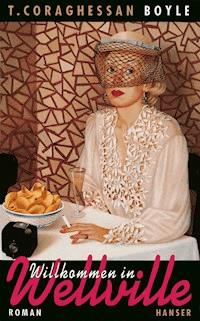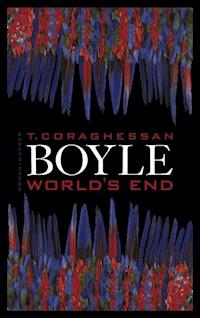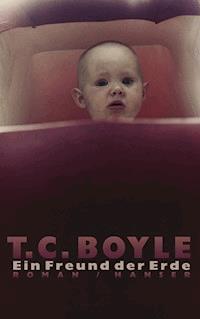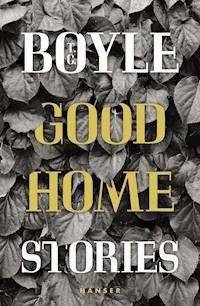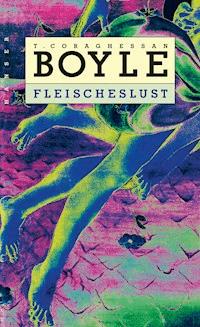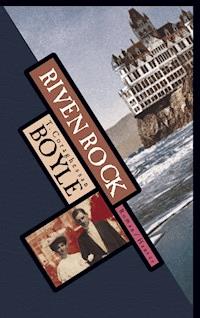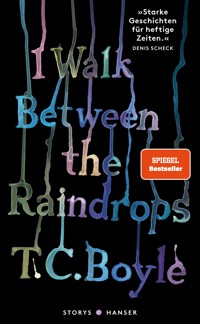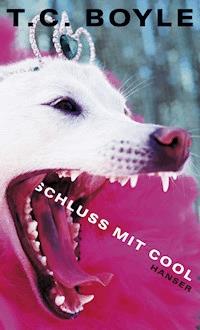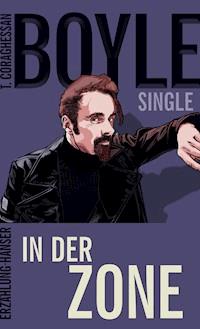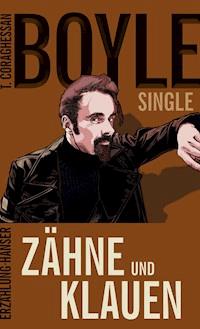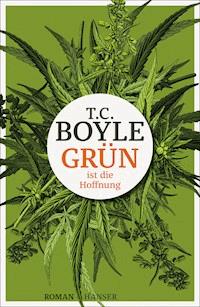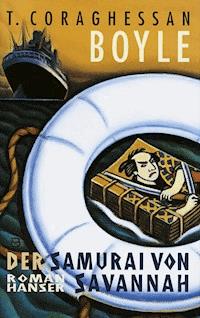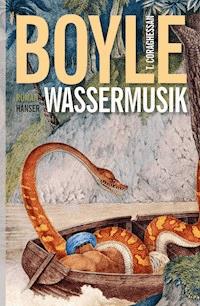
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Boyles "Wassermusik" 1981 erschien und noch niemand den merkwürdigen Namen Coraghessan aussprechen konnte, war trotzdem sofort klar, dass dieser Roman das Zeug zum Kultbuch hatte. Boyle erzählt darin die weitgehend wahre Geschichte des schottischen Forschers Mungo Park, der im 18. Jahrhundert als erster Weißer den Verlauf des Niger erkundete. Zur Seite stellt er ihm die frei erfundene Figur des Ned Rise, einen englischen Grabräuber und Galgenstrick, der mit dem Entdecker im tiefsten Afrika die wildesten Abenteuer besteht. Außerdem dabei: ein phantastisches Panoptikum von Hexen und Schlägern, Kannibalen, Huren, Glücksrittern. Sein legendärer Erstlingsroman nun in einer fulminanten Neuübersetzung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Hanser E-Book
T. Coraghessan Boyle
WASSERMUSIK
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Dirk van Gunsteren
Carl Hanser Verlag
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1981
unter dem Titel Water Music bei Little, Brown and Company in Boston.
Das Pope-Zitat auf S. 25 entstammt der Übersetzung von Johann Jacob Bodmer, Zürich 1747
das Dante-Zitat auf S. 391 der von Karl Witte, Berlin 1916.
ISBN 978-3-446-24575-4
© T. Coraghessan Boyle 1980, 1981
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2014
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung des Motivs »Die Königsschlange« von Aloys Zötl, 1867
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Karte: Peter Palm, Berlin
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
INHALT
EinsDer Niger
ZweiDer Yarrow
DreiNiger Redux
Coda
Dieses Buch ist den Mitgliedern des Klubs
der Geschichtenerzähler freundschaftlich zugeeignet:
Alan Arkaway, Gordon Baptiste, Neal Friedman, Scott Friedman,
Rob Jordan, Russell Timothy Miller und David Needleman.
Und es ist auch für Dich, K. K.
Lauscht Kinder trockener Gefilde
von den Fingern des Harfenspielers
Regen.
W.S.MERWIN, The Old Boast
APOLOGIE
Die treibende Kraft hinter diesem Buch ist eher ästhetischer als historischer Natur. Ich habe mich der geschichtlichen Hintergründe bedient, weil sie für mich ein Quell der Freude und Faszination sind, und nicht, weil ich historisch verbürgte Ereignisse wahrheitsgetreu literarisch verarbeiten oder rekonstruieren wollte. Ich habe absichtlich Anachronismen eingestreut, Wörter und Terminologien erfunden und die Schilderungen meiner Originalquellen ausgeschmückt und ergänzt. Wo immer die historischen Fakten den Erfordernissen der Phantasie entgegenstanden, habe ich sie bewusst und reinen Gewissens verändert und meinen Zwecken angepasst.
T. C. B.
EinsDER NIGER
Verzage nicht! Bald schon ist’s wahr,
Und du sitzt auf dem Kopfe –
Hoch oben in dem schönen Haar,
In ihrem festen Zopfe.
ROBERT BURNS, An eine Laus
EIN WEICHER WEISSER UNTERLEIB
Während die meisten jungen Schotten seines Alters Röcke lüpften, Furchen pflügten und die Saat ausbrachten, stellte Mungo Park seinen nackten Hintern vor al-Hadsch Ali ibn Fatoudi, dem Emir von Ludamar, zur Schau. Es war das Jahr 1795. In Windsor Castle bespuckte George III. die Wände, in Frankreich verpfuschte das Directoire die Staatsführung, Goya war taub und De Quincey ein verdorbenes präpubertäres Bürschchen. George Bryan »Beau« Brummell strich seinen ersten gestärkten Hemdkragen glatt, der junge Ludwig van Beethoven, ein Vierundzwanzigjähriger mit buschigen Augenbrauen, sorgte in Wien mit seinem Zweiten Klavierkonzert für Furore, und Ned Rise trank im Pig & Pox in der Maiden Lane mit Nan Punt und Sally Sebum eine Runde Wuppdich nach der anderen.
Ali war Maure. Er saß im Schneidersitz auf einem Damastkissen und musterte die bleichen, bebenden Backen mit der Miene eines Feinschmeckers, der in seiner Vichyssoise eine Fliege entdeckt hat. Seine Stimme war wie Sand. »Umdrehen«, sagte er. Mungo war Schotte. Er kniete mit halb heruntergezogener Hose auf einer Strohmatte und sah über die Schulter zu Ali. Er war auf der Suche nach dem Niger. »Umdrehen«, wiederholte Ali.
Der Entdecker besaß zwar ein freundliches, entgegenkommendes Wesen, doch sein Arabisch war recht lückenhaft. Als er auch auf die zweite Aufforderung nicht reagierte, trat Dassoud – Alis Scherge und menschlicher Schakal – vor und schwang eine aus einem halben Dutzend Gnuschwänzen verfertigte Peitsche. Engelsflügeln gleich sausten die buschigen Schweife mit mächtigem Schwung durch die Luft. Vor Alis Zelt betrug die Temperatur zweiundfünfzig Grad. Der grob gewebte Zeltstoff war aus Ziegenwolle. Im Inneren herrschten fünfundvierzig Grad. Die Peitsche fuhr herab. Mungo drehte sich um.
Auch vorn war er weiß – weiß wie ein Bettlaken, weiß wie ein Schneesturm. Ali und seine Entourage staunten abermals. »Seine Mutter hat ihn in Milch gebadet«, sagte einer. »Zählt seine Finger und Zehen!« rief ein anderer. Am Zelteingang drängten sich Frauen und Kinder, Ziegen meckerten, Kamele röhrten und paarten sich, jemand pries Feigen an. Hundert Stimmen überlagerten einander, es war wie ein Gewirr von Fußwegen, Gassen, schmalen und breiten Straßen – welche war die richtige? –, und allesamt sprachen sie dieses rätselhafte, schnelle, harte Arabisch, die Sprache des Propheten. »La-la-la-la-la!« schrie eine Frau. Die anderen stimmten ein, in gellendem Falsett. »La-la-la-la-la!« Mungos ebenfalls weißer Penis schrumpfte und verschwand.
Jenseits der kahlen Zeltwand befand sich das Lager von Benaum, Alis Winterresidenz. Vierhundertfünfzig versengte, ausgedörrte Kilometer weiter lag das Nordufer des Nigers, eines Flusses, den keines Europäers Auge je erblickt hatte. Nicht dass die Europäer kein Interesse gehabt hätten. Herodot forschte bereits fünfhundert Jahre vor Christus nach seinem Verlauf und kam zu dem Schluss, er sei sehr groß. Aber ein Zufluss des Nils. Al-Idrisi bevölkerte seine Ufer mit seltsamen mythischen Wesen: Da waren die wurmartigen Fesselfüßer, die nicht liefen, sondern krochen und die Sprache der Schlangen beherrschten, da waren die Sphingen und Harpyien und die Mantikoren mit Löwenkörper und Skorpionschwanz und einer unangenehmen Vorliebe für Menschenfleisch. Plinius der Ältere malte den Niger in goldenen Farben und gab ihm seinen schwarzen Namen, und Alexander geriet in höchste Erregung, als seine Kundschafter ihm vom Fluss der Flüsse berichteten, wo edle Männer und Frauen in Lotosgärten säßen und aus Schalen von getriebenem Gold tränken. Und nun, am Ende des Zeitalters der Aufklärung und an der Schwelle zum Zeitalter der Rendite, wollte Frankreich den Niger, und England, Holland, Portugal und Dänemark wollten ihn ebenfalls. Den neuesten und zuverlässigsten Informationen zufolge – zu finden in der Geographia des Ptolemäus – verlief der Niger zwischen Nigritia, dem Land der Schwarzen, und der Großen Wüste. Wie sich herausstellte, hatte Ptolemäus den Nagel auf den Kopf getroffen. Nur hatte es noch nie ein Weißer geschafft, die Gluthölle der Sahara oder den miasmatischen Fiebergürtel des Gambia zu überleben und die Vermutung des Gelehrten zu bestätigen.
Doch dann, im Jahr 1788, kam eine Gruppe berühmter Botaniker, Geografen, Schürzenjäger und anderer Wahrheitssucher in der St. Alban’s Tavern an der Pall Mall zusammen und gründete die Gesellschaft zur Erforschung und Erschließung Afrikas. Der Norden des Kontinents stellte kein Problem dar. 1790 war er vermessen, kartografiert, etikettiert, seziert und verteilt. Westafrika jedoch barg nach wie vor Geheimnisse. Und das Herz dieser Geheimnisse war der Niger. In ihrem Gründungsjahr rüstete die Gesellschaft eine von John Ledyard angeführte Expedition aus. Sie sollte von Ägypten aufbrechen, die Sahara durchqueren und den Verlauf des Nigers erforschen. Ledyard war Amerikaner. Er spielte Geige und schielte. Er war mit Cook über den Pazifik gesegelt, er war in den Anden gewesen und quer durch Sibirien nach Jakutsk gewandert. Ich habe die Welt mit den Füßen bezwungen, sagte er, ich habe die Angst verlacht und der Gefahr gespottet. Ich habe Horden von Wilden getrotzt, ich bin durch sengende Wüsten und frostklirrende Steppen gereist, über ewigen Schnee und stürmische Ozeane, und bin doch unversehrt. So gut meint es mein Gott mit mir! Zwei Wochen nach seiner Landung in Kairo starb er an der Ruhr. Der nächste war Simon Lucas, Dolmetscher für orientalische Sprachen am Hof von St. James’s. Er ging in Tripolis an Land, wanderte über hundert Kilometer in die Wüste hinein, bekam Blasen, Durst und Angst und kehrte zurück, ohne mehr erreicht zu haben, als Ausgaben in Höhe von 1250 Pfund anzuhäufen. Und dann kam Major Daniel Houghton. Er war Ire, bankrott und zweiundfünfzig Jahre alt. Von Afrika hatte er nicht die leiseste Ahnung, aber er war billig zu haben. Ich machs für dreihundert Fund und ne Kiste Scotch, sagte er. Houghton fuhr in einem Einbaum den Gambia hinauf, trank Wasser aus stinkenden Tümpeln, aß Affenfleisch und überlebte dank seiner eisernen Konstitution und der ständigen Zufuhr von Alkohol Typhus, Malaria, Loaose, Lepra und Gelbfieber. Unglücklicherweise banden ihn die Mauren von Ludamar nackt an einen Pfahl auf dem Kamm einer Düne. Wo er dann starb.
Mungo stand auf und wollte sich die Hose hochziehen. Dassoud schlug ihn nieder. Die schrillen Schreie der Frauen stachelten die Menge an. »Friss Schwein, Christ!« riefen die Leute. »Friss Schwein!« Ihre Haltung gefiel Mungo nicht. Auch stellte er ungern seinen Hintern in gemischter Gesellschaft zur Schau. Aber es war nichts zu machen: Beim leisesten Anzeichen von Widerstand würden sie ihm die Kehle durchschneiden und seine Knochen von der Sonne bleichen lassen.
Plötzlich hielt Dassoud einen Dolch in der Hand, schmal wie ein Eisstichel, dunkel wie Blut. »Ungläubiger Hund!« schrie er, und die Adern an seinem Hals traten hervor. Unter der Kapuze seines Burnus hervor sah Ali düster und gleichgültig zu. Die Temperatur im Zelt stieg auf zweiundfünfzig Grad. Die Menge hielt den Atem an. Dassoud richtete die Spitze der Klinge auf den Entdecker und plapperte in seinem Kauderwelsch wie ein verrückter Anatom, der über die Eigenarten des menschlichen Körpers referiert. Die Dolchspitze näherte sich, Ali spuckte in den Sand, Dassoud peitschte die Menge auf, Mungo erstarrte. Dann piekte ihn die Klinge – nur ganz sacht – in den Bauch, wo er am weichsten und weißesten war. Dassoud lachte rauh wie ein ausgetrockneter Bach. Die Zuschauer pfiffen und johlten. In diesem Augenblick schob sich ein grauhaariger buschrin mit Stroh im Bart und einer leeren Augenhöhle durch die Menge und stieß Dassoud beiseite. »Die Augen!« heulte er. »Seht euch die Augen dieses Teufels an!«
Dassoud sah hin. Das sadistische Lächeln wich einem Ausdruck des Entsetzens und der Empörung. »Die Augen einer Katze«, zischte er. »Wir müssen sie auslöschen.«
AUFSTEHEN!
Ned Rise erwacht und hat Kopfschmerzen. Er hat Gin getrunken – auch bekannt als »Wuppdich«, »blauer Hauer«, »Fluch« –, Verderber und Zerrütter der niederen Klassen, klar wie Säuferpisse und scharf wie Wacholdersaft. Er hat Gin getrunken und weiß nicht recht, wo er sich befindet, ist aber einigermaßen sicher, dass er die Halbstiefel mit den löchrigen Sohlen, die behaarten Fingerknöchel und das zimtrote Cape erkennt, auf die sein Blick als erstes fällt. Ja: dieses Cape, diese Hände und Stiefel, der Riss in der Hose – all das ist ihm vertraut. Überaus vertraut sogar. Also, lautet sein Schluss, gehören diese Dinge Ned Rise, und daher müssen der gequälte Kopf und die höllisch schmerzenden Augen, mit denen er all dies, wenn auch unvollkommen, wahrnimmt, in irgendeiner Verbindung zu ihnen stehen.
Er setzt sich auf und kommt nach langem Innehalten auf die Beine. Wie es scheint, hat er auf einem schmutzigen Strohhaufen geschlafen. Und auf seinem Hut. Er bückt sich, um ihn aufzuheben, schwankt und findet mit einem entschlossenen Rülpsen das Gleichgewicht wieder. Der Hut ist hinüber. Für einen Augenblick bleibt er stehen und sieht gedankenvoll vor sich hin. Etwas hämmert in seinem Hinterkopf. Dann lässt er seinen Blick mit halb geschlossenen Augen durch den Raum schweifen und fühlt sich dabei ein bisschen wie ein Entdecker, der seinen Fuß auf einen neuen Kontinent setzt.
Kein Zweifel, er ist in einem Keller. Ein Boden aus gestampftem Lehm, Besen und Eimer, Mauern aus unbehauenen Steinen. An der hinteren Wand zwei Reihen versiegelter Fässer: Madeira, Portwein, Maduro, Bordeaux, Rheinwein. In der Ecke ein Häufchen Kohle. Ist dies etwa das Schattenreich unter dem Pig & Pox? In diesem Augenblick stellt Ned fest, dass er nicht allein ist. Andere, möglicherweise menschliche Gestalten liegen auf Stroh, das hier und da auf dem Boden verteilt ist. Er hört Schnarchen, ein Röcheln und Gurgeln wie von Regenwasser in einer Gosse. Die innig miteinander verbundenen Gerüche nach Urin und Erbrochenem hängen schwer in der Luft.
»Ah, schon auf den Beinen?« Eine fast kahle Alte, ihr Gesicht ein Memento mori, steht hinter einer über zwei große Fässer gelegten Planke. An ihrer Unterlippe hängt ein dünner Goldring wie eine Spuckeblase. »Tja, dann guten Morgen der Herr«, sagt sie. »Ha-haa! Gut geschlafen? Wie wärs mitm Gläschen, damit der Tag richtig anfängt?« Zwei Zinnmaße, so groß wie Eierbecher, und ein Tonkrug stehen auf dem Brett und sehen aus wie ein Stilleben. Unter der behelfsmäßigen Theke liegt eine Sau; ihre breite Schnauze ist von einem umgekippten Nachttopf verdeckt. Hogarth hätte die Szenerie gefallen. Ned fragt sich, was gestern nacht eigentlich passiert ist.
Unvermittelt kreischt die alte Hexe, als würde sie erdolcht, ein langgezogenes, rasselndes Einziehen von Luft: »Iiiiih!« Das Hämmern in Neds Kopf verwandelt sich in eine Reihe von Trommelwirbeln, in Donnergrollen, das Dröhnen einer großen Basstrommel. Doch halt: Die Alte hat keinen Schlaganfall – sie lacht. Und jetzt hustet sie bellend und schlägt auf die Theke, bis in ihrem Mundwinkel gelber Schleim erscheint und als zäher Faden auf das Holz tropft. »Hats ...« keucht sie, »hats dir die Sprache verschlagen, Firsichbacke?«
An der Wand hinter ihr hängt ein Schild, die Buchstaben sind mit spastischer Hand gekrakelt:
BETRUNKEN FÜRN PENNY
HACKEVOLL FÜR ZWEI
SAUBERES STRO UMSONST
Ned schnippt mit dem Daumennagel an seinen Schneidezähnen. »Scheiß auf dich und deine Mutter und deine grindige Brut, du skrofulöse Nutte mit deinen Hängetitten!« ruft er und fühlt sich gleich besser.
»Iiiiih!« kreischt sie. »Kein Schlückchen von Mutter Genevers Lixier? Gestern nacht hats dir noch ganz gut geschmeckt ... Lass mich maln Blick auf deine Männlichkeit werfen – Mutter hat genau das, was du brauchst.« Schmierig grinsend hebt sie die Röcke: Die dürren Beine und der vergilbte Haarbusch sind wie der Höhepunkt eines Schauerromans.
Linkerhand führt eine wacklige Treppe zu einer Tür, durch deren Ritzen Ned das kalte Licht des frühen Morgens sehen kann. Er verflucht sich dafür, dass er seinen Atem an diese verrückte Hexe verschwendet hat – schließlich hat er am Nachmittag noch Geschäftliches zu erledigen –, und geht die schwankende Treppe hinauf zur Tür.
»Iiiiih!« kreischt die Alte. »Pass nur gut auf deine Sachen auf, mein Süßer!«
Ned reckt den Mittelfinger, hüllt sich in sein zimtfarbenes Cape und reißt die Tür zur Maiden Lane und zum Tageslicht auf. Aus der Tiefe hinter ihm schrillt es wie eine verstimmte Viola: »Gib acht, gib acht, was der Henker mit dir macht!«
BEVOR MEIN AUGENLICHT VERGEHT
Der Apparat zur Auslöschung der Augen besteht aus zwei Messingbändern und erinnert an einen auf dem Kopf stehenden Keuschheitsgürtel. Ein Band umfängt den Schädel auf Augenhöhe, das andere führt wie ein Scheitel quer darüber hinweg. Außerdem verfügt die Konstruktion über zwei Schrauben, an deren Enden konvexe Scheiben befestigt sind. Das Ganze war ursprünglich im neunten Jahrhundert für al-Kaid Hassan ibn Mohammed hergestellt worden, den blinden Pascha von Tripolis. Durch seine Behinderung verunsichert, verfügte der Pascha, jeder, der sich in seine Gegenwart begeben wolle, müsse sich zuvor die Augen eindrücken lassen. Er war ein sehr einsamer Mensch.
Das Gerät funktioniert nach dem Prinzip des Schraubstocks. Man dreht an den Schrauben, bis die konvexen Scheiben auf den Augen liegen, dann werden sie, Umdrehung für Umdrehung, angezogen, bis die Hornhaut zerplatzt. Simpel, unerbittlich, endgültig.
Schweigen hat sich über die Menge gesenkt. Eben noch waren die Zuschauer am Rand der Hysterie, haben geschwatzt und gejohlt wie der Pöbel bei der Stierhatz oder einer Kuriositätenschau. Doch jetzt: Stille. Fliegen sägen durch die heiße, unbewegte Luft, und wenn draußen eine Ziege oder ein Kamel in den Sand pisst, klingt es wie das Rauschen eines Wasserfalls. Sandalen scharren, ein Mann kratzt sich den Bart. Viele verbergen das Gesicht hinter einem Stück Stoff, um sich vor dem Blick des Entdeckers zu schützen. Dassoud und der Einäugige stehen da, die Arme in die Hüften gestemmt, und sehen ihn ernst an.
Mungo begreift die wesentlichen Elemente des Geschehens nicht ganz. Er ist einigermaßen sicher, wenigstens ein Wort erkannt zu haben: unya, das Wort für »Auge«, an das er sich aus Ouzels Grammatik des Arabischen erinnert (»Wir heben die unyas zum Himmel, wo Allah wohnt«). Aber was in aller Welt gibt es über Augen zu diskutieren? Auch die plötzliche Stille findet er verwunderlich. Aber es ist heiß, verdammt heiß, und es gelingt ihm kaum, sich zu konzentrieren. Tatsächlich hat er eine solche Hitze noch nie erlebt, ausgenommen vielleicht im Schwedischen Bad am Grosvenor Square. Joseph Banks, Schatzmeister und Direktor der Afrikagesellschaft, hat ihn eines Tages dorthin eingeladen, um ein paar Details der Expedition zum Niger zu besprechen. Auf heißen Steinen, die glühten wie flüssige Lava – so jedenfalls kam es ihm vor. Ein Diener schlug sie mit Birkenzweigen und bearbeitete ihre Nieren und Rückenpartien mit harten Handkanten. Sir Joseph schien das Ganze belebend zu finden. Der Entdecker dagegen verlor beinahe das Bewusstsein. Tatsächlich überkommt ihn in diesem Augenblick das gleiche Schwindelgefühl wie damals. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass er nicht nur mit Hitze und Sandflöhen, mit Ruhr und Fieber, sondern auch mit Entkräftung zu kämpfen hat. Die Mauren haben ihm den Proviant, das Pferd und den Dolmetscher genommen und offenbar beschlossen, ihn auf eine strenge Diät zu setzen. Zu streng, seiner Meinung nach: Seit zwei Tagen hat er keinen Bissen gegessen.
Und so fühlt sich Mungo trotz der kritischen Situation und der fremden, feindseligen Gesichter ringsum mit einemmal wie beschwipst – beinahe, als hätte er zuviel Bordeaux oder Starkbier getrunken. Er sieht sich um, sieht die unsteten Blicke und gerunzelten Stirnen, die Bärte und Burnusse, die Prophetenmäntel und Pilgersandalen, und plötzlich beginnen diese harten, bedrohlichen Mienen zu schmelzen, verlieren ihre Konturen und zerfließen wie Wachsfiguren. Die ganze Veranstaltung ist eine Maskerade, jawohl. Dassoud und der Einäugige sind Akrobaten oder Feuerschlucker, und der gute Ali ist bloß Grimaldi der Clown. Aber jetzt setzen sie ihm etwas auf den Kopf ... Ist das ein Helm? Soll er etwa für sie in die Schlacht ziehen? Oder sind sie endlich zur Besinnung gekommen und wollen für eine Krone Maß nehmen?
Unter seiner metallenen Haube grinst der Entdecker dümmlich. Seine Augen sind grau. Grau wie die Eisfinger, die sich an einem frostigen Morgen tastend über die Gumpen des Yarrow strecken. Ailie hat sie einmal mit den Liebesbrunnen bei Galashiels verglichen, und als er sich rücklings auf das Heidekraut sinken ließ, fischte sie zwei Pennies aus ihrer Börse und legte sie ihm auf die Augenlider. Gloucesters Augen, heißt es, waren grau. Ödipus’ Augen waren schwarz wie Oliven. Und Miltons Augen ... Miltons Augen waren wie zwei Häher, die im Schnee scharrten. Dassoud weiß nichts von Shakespeare, Sophokles oder Milton. Seine kräftigen Hände drehen an den Schrauben. Der Entdecker grinst. Ahnungslos. Entsetzt über seine wahnsinnige Gelassenheit wendet sich das Publikum panisch zur Flucht. Er hört sie rennen, das Klatschen ihrer Sandalen auf der ausgedörrten Erde ... aber was ist das? Er hat anscheinend irgendwas im Auge ...
SCHÖNHEITSCHIRURGIE
»Stopp!«
Mungo kann nichts sehen (die Haube scheint eine Art Visier zu haben, und jedesmal, wenn er es hochschieben will, hält jemand sein Handgelenk fest), doch die Stimme erkennt er sofort. Das ist Johnson. Der gute alte Johnson, sein Führer und Dolmetscher, der ihm zu Hilfe kommt.
»Stopp!« wiederholt Johnsons Stimme, dann stürzt er sich kopfüber in einen Strudel arabischer Glottale und Frikative. Dassoud antwortet etwas, ergänzt durch eine mit hoher Stimme vorgetragene Aneinanderreihung von Grunz- und Bekräftigungslauten des Einäugigen. Dann Johnsons Erwiderung und schließlich, aus der Ecke, Alis harte, rauhe Stimme. Er hört einen Schlag, und Johnson geht auf der Matte neben dem Entdecker zu Boden.
»Mr. Park«, flüstert Johnson. »Was machen Sie bloß mit diesem Ding auf dem Kopf? Wissen Sie nicht, was die mit Ihnen vorhaben?«
»Johnson, guter alter Johnson. Wie schön, deine Stimme zu hören.«
»Die wollen Ihnen die Augen eindrücken, Mr. Park.«
»Wie bitte?«
»Der Oberschakal hier sagt, Sie haben die Augen einer Katze – was man hierzulande offenbar nicht gut findet, denn die sind gerade dabei, sie Ihnen einzudrücken. Ich bin eben noch rechtzeitig dazwischengegangen, sonst wären Sie jetzt so blind wie ein Bettler, darauf würde ich wetten.«
In Mungos Kopf wird es langsam klar wie an einem dunstigen Morgen, wenn es auf Mittag zugeht. Im Verlauf dieses Prozesses wird er zunehmend erregt, bis er schließlich aufspringt, an der Metallhaube zerrt und blökt wie ein verirrtes Kalb. Dassoud streckt ihn mit einem Schlag zu Boden. Die Gnupeitsche fährt ein paarmal nieder, und dann ruft er auf arabisch nach einem weiteren Folterinstrument. Mungo hört tappende Füße, das Rascheln der Zeltbahn und dann, ganz nah, den Schrei eines Menschen in Todesangst. Er scheint von Johnson zu kommen. Der Entdecker erschrickt und zerrt mit vermehrter Kraft an der Haube – dabei kommt er sich vor wie ein Zehnjähriger, der seinen Kopf durch die Stäbe eines Eisengitters gesteckt hat. »Johnson«, stößt er hervor, »was haben sie mit dir gemacht?«
»Noch nichts. Aber sie lassen gerade einen zweischneidigen bilbo holen.«
Endlich löst sich die Haube und hüpft vom Kopf des Entdeckers wie der Korken aus einer Flasche Sekt. Mungo blinzelt und sieht sich um. Ali, Dassoud und der Einäugige hocken plappernd und gestikulierend in der Ecke. Die Leute sind verschwunden, und die Zeltklappe ist geschlossen. Ein riesiger Schwarzer mit Turban und gestreiftem Gewand hat sich, die Arme verschränkt, davor aufgebaut. »Einen bilbo? Was hat das zu bedeuten?« flüstert Mungo.
»Das bedeutet, dass wir zwei kluge Äffchen sein werden: Wir werden nichts Böses sehen und nichts Böses sprechen. Die finden, ich habe die Zunge eines Neuntöters, Mr. Park. Und darum wird sie jetzt abgeschnitten.«
ALIAS KATUNGA OYO
Was Johnson betrifft: Er gehört zum Volk der Mandingo, dessen Siedlungsgebiet sich vom Oberlauf der Flüsse Gambia und Senegal durch den größten Teil des Nigertals bis zu der legendenumrankten Stadt Timbuktu erstreckt. Seine Mutter nannte ihn nicht Johnson. Sie nannte ihn nach seinem Großvater väterlicherseits Katunga – Katunga Oyo. Mit Dreizehn wurde Johnson von Hirten vom Stamm der Fulbe entführt, als er in einem Maisfeld bei seinem Heimatdorf Dindiku mit einer zarten jungen Sylphide den Eintritt ins heiratsfähige Alter feierte. Das zarte Mädchen hieß Nili. Die Fulbe fackelten nicht lange. Ihr Anführer, der an Nilis Gesichtstätowierungen und anderen körperlichen Merkmalen Gefallen fand, machte sie zu seiner persönlichen Konkubine. Johnson wurde an einen slati verkauft, einen reisenden Sklavenhändler, der ihm Fußfesseln anlegte und ihn, zusammen mit zweiundsechzig anderen, zur Küste trieb. Neunundvierzig kamen an. Dort wurde er an einen amerikanischen Sklavenhändler verkauft, der ihn im Laderaum eines Schoners mit Kurs South Carolina ankettete. Als das Schiff in den Hafen von Charleston einfuhr, war der Junge neben Johnson, ein Bobo aus Djenné, seit sechs Tagen tot.
Zwölf Jahre war Johnson Feldarbeiter auf der Plantage von Sir Reginald Durfeys, einem englischen Baronet. Dann wurde er zum Hausdiener befördert. Drei Jahre später besuchte Sir Reginald die amerikanischen Kolonien, fand Gefallen an Johnson und nahm ihn als seinen Kammerdiener mit nach London. Das war 1771. Die amerikanischen Kolonien hatten sich noch nicht losgesagt, in England war die Sklaverei erlaubt, in den Adern Georges III. zirkulierten bereits die aufrührerischen Porphyrine, die ihn eines Tages den Verstand kosten würden, und Napoleon erstürmte die Palisaden seines Laufstalls.
Johnson, wie Sir Reginald ihn taufte, begann in der Bibliothek von Piltdown, dem Landsitz der Durfeys, ein Selbststudium. Er lernte Griechisch und Latein. Er las die Klassiker. Er las die Modernen. Er las Smollett, Ben Jonson, Molière und Swift. Er sprach von Pope, als hätte er ihn persönlich gekannt, er machte sich über Richardsons kindische Romane lustig und war von Fielding so begeistert, dass er versuchte, Amelia ins Mandingo zu übersetzen.
Durfeys war fasziniert. Nicht nur von Johnsons virtuoser Beherrschung der Sprache und seiner Kenntnis der Literatur, sondern auch von seinen Erinnerungen an den dunklen Kontinent. Es kam so weit, dass der Baronet keinen Schlaf fand ohne einen Becher warme Milch mit Knoblauch und Johnsons beruhigenden Basso profundo, der von strohgedeckten Hütten erzählte, von Leoparden, Hyänen, feuerspeienden Vulkanen, von schweißglänzenden Schenkeln und Hintern, so schwarz wie ein Traum im Mutterbauch. Sir Reginald zahlte ihm einen großzügigen Lohn, und nach seiner Freilassung im Jahr 1772, als die Sklaverei abgeschafft wurde, bot er ihm eine stattliche Leibrente, falls er weiterhin sein Kammerdiener bleiben wollte. Johnson erwog das Angebot bei einem Glas Sherry in Sir Reginalds Schreibzimmer. Dann grinste er und schlug dem Baronet eine Aufstockung vor.
Wenn das Parlament tagte, verlegte Sir Reginald seinen Wohnsitz nach London und nahm Johnson und zwei livrierte Lakaien mit. London war eine reife Tomate. Johnson war eine Makkaroni. Mit Zylinderhut und in tailliertem Gehrock und seidener Kniehose stolzierte er mit den Spitzen der Londoner Gesellschaft durch die Bond Street. Bald war er Stammgast in diversen Kaffeehäusern, gab schlagfertige Antworten und lernte, aus dem Stegreif bissige Epigramme zu dichten. Eines Nachmittags nannte ihn ein Gentleman mit rotem Gesicht und Backenbart einen »verdammten Hottentotten-Nigger« und forderte ihn zum Duell. Am nächsten Tag, bei Morgengrauen und in Anwesenheit der Sekundanten, schoss Johnson dem Gentleman eine Kugel ins rechte Auge. Der Gentleman war auf der Stelle tot, und Johnson wurde erst eingesperrt und sodann verurteilt, am Halse aufgehängt zu werden, bis dass der Tod eintrat. Sir Reginald machte seinen Einfluss geltend. Die Strafe wurde in Deportation umgewandelt.
Und so wurden Johnson im Januar 1790 erneut Fußfesseln angelegt, was seine Strümpfe ruinierte. Man brachte ihn an Bord der H.M.S. Feckless, die er erst in Gorée wieder verließ, einer Insel vor der Westküste Afrikas, wo er als gemeiner Soldat Dienst tun sollte. Als er an Land ging, durchfuhr ihn ein uralter Schauer. Er war zu Hause. Zwei Wochen später – er war zur Nachtwache eingeteilt – requirierte er ein Boot, paddelte zum Festland und verschmolz mit der Schwärze des Urwalds. Er kehrte nach Dindiku zurück, nahm Nilis jüngere Schwester zur Frau und machte sich daran, das Dorf aufs neue zu bevölkern.
Er war siebenundvierzig. Sein Haar war grau meliert. Die Bäume reichten bis zum Himmel, und der Tagesanbruch kam wie eine Decke aus Blumen. Nachts hörte man das Quieken der Schliefer und das hustende Brüllen der Leoparden, tagsüber das träge, schläfrige Summen der Bienen. Seine Mutter war inzwischen eine alte Frau, ihr Gesicht war faltig und vertrocknet wie die Gesichter der mumifizierten Leichen, die er in der Wüste gesehen hatte – der Leichen von Sklaven, die es nicht geschafft hatten. Sie drückte ihn an die knochige Brust und schnalzte mit der Zunge. Es regnete. Die Äcker trugen reiche Ernte, die Ziegen wurden fett. Er lebte in einer Hütte, ging barfuß, wickelte Brust und Lenden in ein paar Meter Tuch und nannte das seine Toga. Er gab sich ganz den Sinnesfreuden hin.
Es dauerte keine fünf Jahre, und zu Johnsons Haushalt gehörten nicht nur drei Frauen und elf Kinder – und mithin vierzehn Mäuler, die gestopft werden wollten –, sondern auch diverse Hunde, Affen, Streifenhörnchen und Skinke. Dennoch konnte man nicht behaupten, dass er sich krumm schuftete – nein, er nutzte vielmehr seine Reputation als Mann des Wortes. Dorfbewohner brachten ihm eine Kalebasse voll Bier oder einen halben Kudu und baten ihn als Gegenleistung um ein paar niedergeschriebene Worte. Jeder trug am Handgelenk oder um den Hals einen safi – einen Lederbeutel, so groß wie eine Brieftasche. Diese safis enthielten Fetische, magische Gegenstände, die Unheil abwehren konnten: Ein sauer eingelegter Ringfinger schützte vor dem Biss der Puffotter; eine Haarsträhne bewahrte vor Verwundungen auf dem Schlachtfeld; die Moschusdrüse der Zibetkatze half gegen Lepra und Frambösie. Den größten Zauber jedoch wirkte Logos. Das geschriebene Wort verlieh Weisheit, Potenz und Überfluss in Zeiten der Not. Es förderte neuen Haarwuchs, heilte Krebs, machte Frauen willig und tötete Heuschrecken. Johnson erkannte sehr bald das Marktpotential seiner Schreibkünste. Er brauchte nur einen Knittelvers hinzukritzeln und bekam dafür drei Pfund Honig oder einen Monatsvorrat Getreide. Zwei goldene Fußreifen für seine jüngste Braut bezahlte er mit einem Zitat von Pope:
Drey Pfeifgen schenk ich dem, der häßlichtst flennend
Der Pavianen Zunft beschämen kann,
Und diese Trommel dem, des heischrer Baß
Das brüllende Clarin der Esel dämpfet.
Sie war fünfzehn und bewies ihre Wertschätzung recht deutlich. Johnson legte die Hände in den Schoß und genoss. Alles war so erfreulich wie eine schöne Geschichte. Das wiedergewonnene Paradies, dachte er.
Eines Nachmittags kam ein Bote aus Pisania, der britischen Handelsniederlassung am Gambia. Er brachte einen Brief aus England, versiegelt mit dem Wappen derer von Durfeys (eine wiederkäuende Ziege). England ... Die Klubs, die Theater, Covent Garden und Pall Mall, die Schleifen der Themse, die Art, wie das Licht am späten Nachmittag in die Bibliothek von Piltdown fiel – all das war ihm mit einemmal wieder präsent. Er erbrach das Siegel.
Piltdown, 21. Mai 1795
Mein lieber Johnson,
falls dieser Brief Dich erreicht, findet er Dich, wie ich hoffe, bei guter Gesundheit. Ich muss gestehen, dass wir die Nachricht von Deiner Flucht aus Gorée mit großer Freude aufgenommen haben. Vermutlich bist Du inzwischen mit einigen dieser honighäutigen Sirenen, von denen Du mir immer vorgeschwärmt hast, vollkommen verbuscht, wie?
Aber zur Sache: Mit diesem Brief will ich Dir einen gewissen Mungo Park ankündigen, den jungen Schotten, den wir beauftragt haben, ins Innere Deines Landes vorzudringen und den Verlauf des Nigers zu erforschen. Wenn Du einverstanden bist, Mr. Parks Führer und Dolmetscher zu sein, darfst Du Dein Honorar selbst bestimmen.
In geografischem Eifer
Sir Reginald Durfeys, Bart.
Gründungsmitglied der Gesellschaft
zur Erforschung und Erschließung Afrikas
Johnsons Honorar war eine Shakespeare-Gesamtausgabe in Quartbänden, so wie sie in Sir Reginalds Bibliothek standen. Er packte eine Tasche, ging zu Fuß nach Pisania, fand den Entdecker und setzte eine Vereinbarung über Art und Umfang seiner Dienste auf. Der Entdecker war vierundzwanzig. Sein Haar hatte die Farbe und Beschaffenheit von Maisbart. Er war eins fünfundachtzig groß und ging, als wäre an seinem Rücken ein Stock festgeschnallt. Er reichte Johnson seine große, weiche Hand. »Johnson«, sagte er, »es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen.« Johnson war eins fünfundsechzig groß und wog fünfundneunzig Kilo. Seine Haare sahen aus wie ein Staubwedel, er war barfuß, und in seinem rechten Nasenflügel steckte eine kurze goldene Nadel. »Das Vergnügen ist ganz meinerseits«, sagte er.
Zu Fuß machten sie sich auf den Weg. Flussaufwärts, bei Frukabu, hielt der Entdecker an, um ein Pferd zu kaufen. Der Besitzer des Pferdes war ein Mandingo-Salzhändler. »Wirklich ein Spottpreis«, sagte der Händler, »für ein so lebhaftes Fohlen.« Das Tier war hinter einer Strohhütte am Dorfende angebunden. Es stand inmitten einer Hühnerschar, fraß Disteln und sah sie blinzelnd an. »Hervorragendes Gebiss«, sagte der Händler. Das Pferd war nicht größer als ein Shetlandpony, auf einem Auge blind und so ausgemergelt, wie es sehr alte Männer sind. Seine rechte Flanke war mit offenen Geschwüren, grün von Schmeißfliegen, übersät, und von den Nüstern tropfte eine gelbliche, an dünnen Haferbrei gemahnende Flüssigkeit. Am vielleicht schlimmsten aber war, dass das Tier unter Altersflatulenz litt und gewaltige Gaswolken ausstieß, welche die Sonne auslöschten und die Erde in eine Sickergrube verwandelten. »Rosinante!« witzelte Johnson. Der Entdecker verstand die Anspielung nicht. Er kaufte das Pferd.
Mungo ritt, Johnson ging zu Fuß. Sie durchquerten ohne Zwischenfall die Königreiche Wulli und Bondu, mussten jedoch, als sie das Reich Kaarta betraten, feststellen, dass König Tiggitty Sego Krieg gegen das Nachbarreich Bambara führte. Der Entdecker schlug vor, nach Norden auszuweichen, durch das Reich Ludamar. Zwei Tage nachdem sie die Grenze überschritten hatten, wurden sie von dreißig berittenen Mauren umzingelt. Die Mauren sahen aus, als hätten sie soeben ihre Mütter gekocht und verspeist. Sie waren mit Musketen, Dolchen und Krummsäbeln bewaffnet – Krummsäbel, so kalt und grausam wie der Sichelmond, Klingen, die sich weniger zum Stoßen, um so besser aber zum Schlagen eigneten und mit einem einzigen Hieb einen Arm oder ein Bein abtrennen, eine Schulter zerschmettern oder einen Kopf spalten konnten. Ihr Anführer, ein Hüne mit Kapuze und einer gestrichelten Schmucknarbe auf der Nase, trabte zu ihnen und spuckte in den Sand. »Ihr kommt mit in Alis Lager in Benaum«, sagte er. Johnson zupfte an den Gamaschen des Entdeckers und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Die Pferde stampften und tänzelten. Mungo sah in die grimmigen Gesichter, lächelte und verkündete auf englisch, er nehme die Einladung mit Freuden an.
FATIMA
Ein Junge stürzt ins Zelt, in der Hand den zweischneidigen bilbo. Dassoud grinst boshaft, Johnson erschauert. Mungo rappelt sich auf, zieht die Hose hoch und schließt den Gürtel. »Ich möchte wissen, welches Verbrechen man uns –« setzt er an, doch Dassoud schlägt ihn nieder. In diesem Augenblick kommt ein zweiter Junge ins Zelt gerannt, mit einer Nachricht für Ali. Dassoud wendet sich wieder den anderen zu – es entbrennt eine hitzige Diskussion. Finger werden gespreizt, Arme geschwenkt, Bärte gerauft. Der Entdecker erkennt nur ein einziges, immer wieder gesprochenes Wort. Es ist wie eine Anrufung: Fatima, Fatima, Fatima. Ohne die Palavernden aus den Augen zu lassen, zupft er verstohlen an Johnsons Toga. »Johnson«, flüstert er, »was ist los?«
Johnsons Augen sind weit aufgerissen. »Psst!« macht er.
Ali erhebt sich. Der Einäugige nimmt das Damastkissen, Dassoud wirft den bilbo wütend auf den Boden, und dann stapfen die drei aus dem Zelt. Der Entdecker und sein Führer bleiben mit dem nubischen Wächter zurück. Und mit den Sandflöhen.
»Psst, Johnson«, flüstert Mungo. »Was hat es mit dieser Fatima auf sich?«
»Ich habe keinen Schimmer. Aber was es auch sein mag – es ist bestimmt nichts, was einem vor Glück die Sinne raubt.«
DER TEIG GEHT AUF
Lässig tritt Ned Rise durch die Tür der Kaschemme auf die Straße, wischt mit der Hand über seine Kleider und klopft den zerdrückten Hut am Oberschenkel aus, als ihn ein Schlag auf die Nase unvermittelt niederstreckt. Während er wie ein durchlöcherter Ballon zu Boden sinkt, trüben Angst, Schmerz und Schreck seine Wahrnehmung. Einmal auf dem Bürgersteig angekommen, ertappt er sich dabei, dass er den satten Mahagoni-Schimmer der Reitstiefel bewundert, die sich mit choreografischer Präzision heben und senken und ihm Tritte in die Weichteile verpassen. Er stöhnt. Würgt. Kotzt. In den Stiefeln stecken die behenden Füße von Daniel Mendoza, Faustkämpfer, Jude, Ex-Boxchampion von London, Freund und Gefährte von George Bryan »Beau« Brummell. Mendoza ist unglaublich aufgedonnert: gestärkter Leinenkragen, scharlachrote Weste, gestreifte Hose und Stiefel aus Saffianleder. Neben ihm steht ein dandyhaftes Schnöselchen von zwölf, dreizehn Jahren und hat das Mendozas Jackett aus blauem Samt zusammengefaltet über den angewinkelten Unterarm gelegt wie ein Oberkellner die Serviette. Mendozas Gesicht ist gerötet. »Ha!« ruft er. »Chinesische Seide, wie?«
Auf dem Kopfsteinpflaster murmelt Ned eine Kombination aus Rechtfertigung, Leugnung und Flehen um Vergebung.
»Holländischer Satin, zwölf Pennies der Meter!« schreit Mendoza. »Und du Schweinskopf hast Beau sechs Pfund für ein Halstuch aus echter und unverfälschter chinesischer Seide, direkt von den Webstühlen Pekings abgeknöpft. Ha? Hab ich recht?«
Ned macht sich auf den nächsten Tritt gefasst. Dieser trifft ihn knapp unterhalb der linken Achselhöhle.
Mendoza, ein Messer in der Hand, beugt sich über ihn. Sein kleiner Page hat ein Gesicht wie ein Engel. Es beginnt zu schneien. »Ich werd dich mal von dieser Last befreien«, sagt Mendoza und durchschneidet die Schnur von Neds Geldbeutel, »als kleine Wiedergutmachung für den Kummer, den du meinem Freund gemacht hast.« Dreimal in rascher Folge bohrt sich Mendozas Stiefelspitze in Neds Milz – ein Organ, von dem dieser bis eben gar nicht wusste, dass er es besaß. »Und dass mir das nicht noch mal vorkommt, Arschgesicht. Sonst mach ich dich zum Krüppel wie Turk Nasmyth in der zweiten Runde auf der Bartholomew Fair. Verstanden?« Ned hört das Zischen von Samt auf Batist und dann das Stakkato sich entfernender Schritte – zwei Paar Füße. Der Schnee fällt wie Knochenmehl, und die Luft ist scharf wie die Lanzette eines Baders.
Ned kommt mühsam hoch und wischt sich mit dem Handrücken über den Mund. Er grinst. Ihm ist übel vom Gin, seine Nase, die Nieren, die Milz und die Achselhöhle schmerzen, man hat ihn überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt, aber er grinst. Er grinst, weil er daran denkt, was für ein Gesicht Mendoza machen wird, wenn er feststellt, dass der Geldbeutel nur ein halbes Pfund Flussand, zwei Kupferknöpfe und einen Schweinezahn enthält. Prüfend greift er sich zwischen die Beine, und sein Grinsen wird breiter: Sein Schatz ist in Sicherheit. Ein Streifen Musselin, mit Tannenharz an Hintern und Bauch befestigt, hüllt seine Genitalien ein, und darin liegen, geborgen wie in einem Nest und gewärmt vom weichen Fleisch seiner Eier, zweiundzwanzig Goldguineen, der Ertrag von einer Woche Tricks und Betrügereien. Ned hat vor, sie zu investieren und zu mehren.
Im Vole’s Head bestellt Ned gebratenen Speck, Lammkoteletts, Pfannkuchen, hartgekochte Eier, Zunge, Schinken, Toast, Taubenpastete und Orangenmarmelade – »und ein großes Bier zum Runterspülen«. Dann schickt er einen Jungen zu einem der Pfandleiher gegenüber von Whites Spielhalle. Er soll ihm Kleider holen, »die einem Gentleman angemessen sind«, komplett mit Schnallenschuhen, Halstuch und Zylinder. Die Füße des Jungen sind in Lumpen gehüllt, er trieft aus Augen, Mund und Ohren, und Skorbut hat ihn um sämtliche Zähne gebracht. Ned gibt ihm eine halbe Krone als Botenlohn.
Der Wirt des Vole’s Head ist ein gewisser Nelson Smirke, ein großer Klotz von einem Mann. Er hat die Krätze, und sein Kopf ist an den Seiten kahl und von einem wirren Schopf gekrönt. Der Gesamteindruck gemahnt an ein Gemüse: Smirke hat verblüffende Ähnlichkeit mit einer riesigen Rübe. »Ah, Smirke«, sagt Ned und wendet sich der Taubenpastete zu. »Nimm dir einen Stuhl, mein Freund – ich hab da einen Vorschlag.« Smirke setzt sich und faltet die großen Hände auf dem Tisch. »Ich will nicht lang rumreden«, sagt Ned. »Heute abend brauche ich das Pimperzimmer, von acht bis drei, vier Uhr morgens. Du kriegst zwei Guineen und stellst keine Fragen.«
»Was wird das? ne Party?«
»Ganz genau, ne Party.«
»Und diesmal zerreißt mir keiner die Kissen und pinkelt in die Teekanne wie letztes Mal?«
»Smirke, Smirke, Smirke«, sagt Ned und schnalzt mit der Zunge. »Hast du denn gar kein Vertrauen zu mir? Es handelt sich hier um eine Zusammenkunft von Gentlemen.« An der Wand hinter ihm hängt der Kopf eines Rehbocks. Kohlen glühen im Kamin. Ned legt die Gabel beiseite, schiebt die Hand in die Hose und gräbt nach Gold. Er holt tief Luft, reißt den Musselin ab (und ein paar Haare aus) und wühlt in seinem Schatz.
»Gentlemen, dass ich nicht lache«, sagt Smirke. »Ich weiß doch, mit was für Säufern, Kanaken und anderm Abschaum du dich rumtreibst, Ned Rise.«
Zwei Guineen landen klirrend auf dem Tisch, Musik in Smirkes Ohren. Er deckt sie mit einer fetten Hand zu. Ned sieht dem Wirt in die Augen, stopft sich einen Pfannkuchen in den Mund, verschlingt ihn wie ein ausgehungerter Flüchtling. Er faltet eine Scheibe Schinken zusammen, stopft sie in den Mund und schiebt ein Ei hinterher. »Drei«, sagt Smirke, »und wir sind im Geschäft.« Ned hustet, irgendwas ist ihm in die Luftröhre geraten. Er wirft eine dritte Münze auf den Tisch. Smirke steht auf. Er zeigt mit seinem dicken Zeigefinger auf die Stirn des Impresarios und knurrt: »Keinen Ärger in meinem Haus, sonst reiß ich dir die Leber raus, ich schwörs.«
Halb acht. Ned steht an der Tür zum Pimperzimmer, herausgeputzt wie ein junger Lord. Aus einiger Entfernung und im Zwielicht des Korridors könnte man ihn fast für einen ehrbaren Bürger halten. Aus der Nähe erweist sich das als Trugbild. Da ist zunächst einmal sein Gesicht. Ganz gleich, wie und aus welchem Winkel man es betrachtet, ob bei Licht oder im Schatten, in erregtem oder gelassenem Zustand – es ist und bleibt das Gesicht eines Klugscheißers. Das Gesicht eines Flegels, der im Unterricht die Stiefel auf das Pult legt, alte Damen in Brand steckt und Tinte trinkt. Das Gesicht eines jungen Burschen, der auf der Straße herumlungert, den Obsthändler terrorisiert, Opium raucht, in Gin badet und die Welt zu seinem Nachttopf macht. Das Gesicht eines jungen Zuhälters, der etwas Unanständiges, ja Schweinisches, arrangiert hat und nun im Vole’s Head am Strand vor der Tür zum Pimperzimmer steht. Und dann wäre da noch seine Kleidung. Die Nadelstreifenhose und das taillierte Jackett sitzen wie der Alptraum eines Schneiders, und der Kragen ist derart mit Sherry, Braten-, Ketchup- und Worcestersauce bespritzt, dass er wie das Fell eines heulenden Urwaldtiers aussieht, außerdem ist er bereits jetzt so schlaff wie ein Handtuch. Die goldene Uhrkette? Poliertes Kupfer. Die Ausbuchtung in seiner Westentasche? Ein Stein, der so tut, als wäre er eine Taschenuhr. Die Strümpfe sind in Wirklichkeit Wollsocken, und die Blume im Knopfloch ist aus buntem Papier. Doch all das verblasst im Vergleich zu seinem Cape – weiße Sterne auf zimtfarbenem Grund –, das die Schultern des Impresarios umhüllt wie ein Zigeunerzelt.
Dennoch gehen die Geschäfte ausgezeichnet. Die Herrschaften kommen zu zweit, zu dritt oder auch ganz allein durch den schmalen Korridor, drücken ihm goldene Guineen oder silberne Sovereigns in die Hand und verschwinden im Pimperzimmer. Ned vertraut das Geld der Beutelbank an. Und grinst wie ein biederer Bürger. Von drinnen ertönen Laute ausgelassener Geselligkeit: Gläser klirren, Stühle knarzen, Har-har und Ho-ho. Smirkes Stichwort. Er erscheint am Ende des Korridors, trägt ein Tablett voller Gläser in der fleischigen Hand, und ihm voraus eilen zwei Schankmädchen wie Gischt auf einem Wellenkamm. »Schafft eure Hurenärsche da rein, seht zu, dass die Gläser immer voll sind, und haltet die Herrschaften bei Laune, sonst reißen die mir, beim Zaches, noch die Bude ein«, brüllt er. Die Mädchen schieben sich kichernd an Ned vorbei und werden mit Applaus, Johlen und wilden Pfiffen begrüßt. Smirke bleibt an der Tür stehen. »Das muss man dir lassen, Ned: Du hastn regelrechtes Händchen für trinkfeste Gentlemen. Die haben jetzt schon ein halbes Fässchen Scotch und dreiundfünfzig Flaschen Wein intus.«
Ned grinst breit und gerissen. »Hab ichs dir nicht gesagt, Smirke? Überlass das alles dem lieben Neddy. Ich mach dich reich.«
Von drinnen ertönt eine Stentorstimme, die Stimme eines Temperaments, so schroff wie ein Gebirgsmassiv: »Zu trinken! Gottverdammt und – verflucht sei die Jungfrau noch vor der Hure – wo bleiben die Getränke!« »Ja, zu saufen!« brüllt ein anderer. »Jaaah!« Die Rufe wirken wie heiße Drähte, die man an Smirkes Rückgrat gelegt hat. Er erbebt, strafft sich, zuckt, seine Muskeln verkrampfen sich, die Gläser nähern sich klirrend dem Rand des Tabletts. Dann reißt er, guter Soldat, der er ist, die Tür auf und stellt sich dem Schirokko, der ihm entgegenweht und den Geruch von Schweiß, Sperma, verschüttetem Bier und Urin mitbringt. Seine Augen sind klein wie Erbsen. »Bei Gott, Ned Rise, wenn das hier ein Reinfall wird, dann –«
»Reißt du mir die Leber raus?«
»Dann mach ich Frikassee daraus!« brüllt Smirke und wirft sich ins Getümmel.
Ned knallt die Tür zu und zieht einen Flachmann hervor. Es war ein verdammt anstrengender Tag. Erst der Ärger mit den Zimmerleuten und der Bühne. Dann die Werbung. In Ermangelung von Mitarbeitern hat er die Tafeln für die Sandwichmänner selbst beschriftet.
FÜR HERRN VON RANG,
DIE SICH LANGWEILEN VOR LAUTER GEDULD
Eine neue Art von Unterhaltung
Im Vole’s Head, heute abend, 8 Uhr
EIN BESONDERER KITZEL
Heute abend im Vole’s Head
KOMMEN SIE ZUM BALL DER VOJÖRE
Vole’s Head, heute abend, 8 Uhr
Und dann musste er Billy Boyles und zwei anderen Figuren je einen Shilling bezahlen, damit sie mit den Tafeln vor Spielklubs und Herrengeschäften herumliefen. Erkundigungen sollten sie im Flüsterton beantworten und sich mit Details möglichst zurückhalten. Aber wie er Boyles kennt, hat dieser Vollidiot es überall herumposaunt, bis auch der letzte Constable und Magistratsbeamte davon Wind bekommen hat. Sorgen, nichts als Sorgen. Und das war erst der Anfang. Den ganzen Nachmittag musste er nicht nur die Zimmerleute zur Eile antreiben und Smirke beschwichtigen, sondern auch Nan und Sally auf jenem schmalen Grat der Betrunkenheit halten, wo sie einerseits bei guter Laune blieben, andererseits aber nicht so hinüber waren, dass sie nicht auftreten konnten. Und dann die heikelste Aufgabe: Er musste Jutta Jim, den schwarzen Nigger aus dem Kongo, von Lord Twit, seinem Herrn und Meister, ausleihen. Twit wollte drei Guineen und die feste Zusage, dass sein hochgeschätzter Kammerdiener vor Morgengrauen »und im Vollbesitz seiner Kräfte« zurück sein würde. Scheiße. Die ganze Sache – der Ärger, die Anspannung, die langen Stunden erzwungener Nüchternheit – hat ihn fast den letzten Nerv gekostet. Sein Kopf fühlt sich an wie ein Furunkel, und das einzige, was dagegen hilft, ist Gin.
Und so steht er also im trübe beleuchteten Korridor, trinkt aus dem Flachmann, träumt vor sich hin und streicht liebevoll über den Beutel voll Gold unter seinem Sack (zweiunddreißig zusätzliche Guineen bis jetzt) ... als er mit einemmal an die Holztäfelung gedrückt wird. Unter seinem Kinn ist eine Hand, und eisenharte Finger umschließen seine Kehle. Er riecht Lavendel, sieht eine gerüschte Manschette. Mendoza.
»Wenn die Darbietungen nicht unterhaltsam sind, brech ich dir die Arme und Beine wie Streichhölzer, du kleiner Scheißer. Wie du siehst, hab ich Beau mitgebracht, und ich hoffe sehr, dass der Junge was Hübsches zu sehen kriegt, was Erbauliches, verstanden?« Die Finger lockern ihren Griff, und das Kinn des Impresarios kehrt – unterstützt von der Schwerkraft des Planeten – in seine Ruhestellung zurück. Ned blinzelt und sieht neben dem Boxchampion ein dandyhaftes Bürschchen von siebzehn, achtzehn Jahren stehen und verächtlich grinsen. Seine Augen haben die Farbe von Honig, sein Haar ist kunstvoll gekräuselt wie das eines coiffierten Pudels und sein Leinenhemd so weiß, dass es blendet. »Lass doch diesen armseligen Wicht, Danny«, näselt er, hält inne, um eine mit Edelsteinen besetzte Schnupftabaksdose aus der Tasche zu ziehen, eine Prise auf den Handrücken zu tupfen und sie mit einer eleganten Kopfbewegung zu inhalieren. Als er aufsieht, durchbohrt sein Blick Ned wie ein Fleischspieß. »Von Freunden nimmst du doch sicher keinen Eintritt, wie?«
Ned grinst, bis es weh tut. »Nein«, sagt er. »Keinen Eintritt.«
Mendoza reißt die Tür auf, und Beau tritt in den Raum wie ein Schwan, der sich auf einem Bergsee niederlässt. »Schwanzlutscher«, murmelt Ned, so leise und tief in der Kehle, dass er selbst es kaum hören kann. Die Tür fällt ins Schloss. Ned zieht den Stein aus der Tasche und wirft einen Blick darauf. Der Stein ist flach und glatt, fünf Zentimeter im Durchmesser. Jemand hat ein Zifferblatt und Zeiger darauf gemalt. Acht Uhr. Es kann losgehen.
Sally Sebum und Jutta Jim sind auf der Bühne, mitten in ihrem Auftritt. Nan Punt steht in einem wollenen Morgenmantel neben Ned und wartet auf ihr Stichwort. »Ah! Ah! Ah!« macht Sally. »Uh-aah! Aaah! Aaaaaahh!« Jutta Jim steigt von ihr herunter, mit blankem Hintern, pechschwarz und nackt, sein Glied hart und glänzend im Licht der Öllampen. Bleiche Knochen stecken in seiner Nasenscheidewand, Federkiele in den Ohrläppchen, gewundene Schmucknarben bedecken seinen Körper, so dass er aussieht wie eine Reliefkarte des Mondes. Das Publikum hält den Atem an. Langsam, schweigend wendet er sich den Zuschauern zu, sieht einen nach dem anderen an und schlägt dann an seine Brust, die so groß ist wie ein Fass. »Das ist mein Stichwort«, flüstert Nan, schlüpft aus dem Morgenmantel und trippelt mit damenhaften Schritten und voll wie eine Strandhaubitze auf die Bühne. Nachdem sie ein bisschen auf und ab gegangen ist und sich zur Einstimmung den Busen gestreichelt hat, nimmt sie Jims Schwanz in den Mund. Die Zuschauer – die eben noch mit den Füßen gestampft, gepfiffen und Socken, Hüte, Servietten und Besteck auf die Bühne geworfen haben – sind mit einemmal ganz still. Inzwischen wälzt Sally sich von dem einzigen Requisit auf der Bühne, einer mit grünem Samt bezogenen Chaiselongue, und taumelt durch den Vorhang zu Ned, der ihr in den Morgenmantel hilft. »Puuh«, schnauft sie, »der schwarze Kannibale hätt mich am liebsten totgevögelt.« Sie ist schweißgebadet, ihre Schminke ist zerlaufen, die üppigen schwarzen Locken kleben an Hals und Wangen. Ihre Brüste sind rot und weiß und spannen den Stoff wie Gemüse in einem Sack. »Und dann sein Atem! Wien voller Pisspott. Aber er hat ganz schön was zwischen den Beinen, das muss man ihm lassen, diesem Urwaldtier.«
»Freut mich, dass es dir gefallen hat, Sal.«
»Gefallen?« Sie stemmt indigniert eine Hand in die Hüfte. »Meinst du, mir gefällt das, wenn sich ein stinkender Nigger-Barbar mit Mauldampf grunzend und sabbernd über mich hermacht?« Doch dann zwinkert sie ihm zu. »Aber so leicht hab ich keine vier Fund verdient, seit Lord Dalhousie vom Milchpunsch so berallert war, dass er mir seinen ganzen Geldbeutel vorn in mein Satinkleid gesteckt hat.«
Ned lacht. »Und das ist erst der Anfang, Sal. Wir haben am Donnerstag noch ne Vorstellung hier im Vole’s Head und eine am Samstag im Pig & Pox. Und ich sag dir was: Wenn du jetzt noch mal da rausgehst und dein ganzes schauspielerisches Talent zeigst, leg ich zehn Shilling drauf.«
Sie will gerade sagen, dass ihre Mum schon immer gesagt hat, sie soll zur Bühne gehen, wirft aber einen verstohlenen Blick auf das Publikum und kichert. »Ned«, flüstert sie, »das musst du dir anschauen.« Ned schaut es sich an. Sämtliche Zuschauer – Lords und Träger des Hosenbandordens, Marineoffiziere, Kaufleute, Gauner und Pfarrer, ja sogar Smirke – sind vollkommen gebannt, ihre Münder stehen offen, Speichel rinnt über Kinne und Bärte. Jim liegt rücklings am vorderen Rand der Bühne, und Nan reitet ihn wie ein Jockey und setzt keuchend und unzusammenhängende Laute ausstoßend über die Hecken, Zäune und Gräben des Orgasmus. Kein Flüstern, kein Hüsteln oder Schniefen, kein »Ui!« oder »Olala!« – sie hätten nicht mal aufgesehen, wenn der Halleysche Komet das Dach vom Haus gefegt hätte. Manche haben ein Zucken im Gesicht oder in den Gliedern, andere umklammern Hut und Stock, als wären es Zweige am Rand eines Abgrunds. Hier und da fährt ein Taschentuch über eine Stirn, Zähne knabbern nervös an einer Stuhllehne, Füße tappen, Knie wippen. »Ja-huuu!« schreit Nan auf dem Höhepunkt eines wilden Galopps, und der arme Smirke fällt in einem Taifun aus knirschendem Glas vornüber zu Boden. Niemand bemerkt es.
Sally nimmt einen ordentlichen Schluck aus Neds Flasche. Dann lacht sie. Sie lacht, bis sie eine Hand an die Rippen drücken muss.
»Was ist so komisch?« fragt Ned.
»Also«, stößt sie prustend hervor, »entweder trägt man jetzt wieder Hosenbeutel, oder irgendwer hat ihnen die Pimmel in Hefeteig gepackt.«
DER SAHEL
Der Sahel ist ein Streifen semiarides Land, der sich wie ein Gürtel durch Westafrika zieht, vom Atlantik im Westen bis zum Tschadsee im Osten. Nördlich davon liegt die Große Wüste, in seinem Süden sind die tropischen Regenwälder Zentralafrikas. Im Norden geht das Land erst in ausgedörrte, gebleichte Steppe und dann in die Ergs und Dünen der Großen Wüste über. Im Süden wird der Sahel zur Savanne, die sich in der Regenzeit von Juni bis Oktober in ein wogendes Meer von blaugrünem, saftigem Gras verwandelt. In diesen Monaten zieht al-Hadsch Ali ibn Fatoudi mit seinen Ziegen- und Rinderherden, seinen Leuten, Zelten, Frauen und mit Milch gefütterten Pferden nach Norden, bis an die äußerste Grenze der Vegetation. Im Süden ist er von November bis Juni, wenn der grausame Harmattan mit Klauen aus Flugsand aus der Wüste angefegt kommt und alle Feuchtigkeit aus der Luft, den Pflanzen, den Augen und Kehlen seiner Herden und ihrer Hirten saugt. Die traurige Wahrheit ist: Alis Herden überweiden die nördliche Sahelzone. Seine Rinder fressen das Gras, bevor es Gelegenheit hatte, Samen zu treiben, und die Ziegen reißen es mit den Wurzeln heraus. Jedes Jahr zieht Ali ein wenig weiter nach Süden, hier ein paar Kilometer, dort ein paar Kilometer. In zweihundert Jahren wird Benaum in der Wüste liegen. Die großen Ergs Iguidi und Chech fließen mit dem Wind und treiben hierhin und dorthin, sie strecken Zungen, Finger, Arme aus, sie winken und belagern.
Machen wir uns nichts vor: Das Leben im Sahel ist kein Picknick. Kargheit, Not und Launen der Natur fühlen sich hier wie zu Hause. Da gibt es Jahre, in denen der Regen nicht kommt und die melodisch blökenden Herden Denkmäler aus Knochen für die Sonne errichten. Es gibt Brunnen, die versalzen, Sandstürme, die einem den Bart von den Wangen reißen. Es gibt die Hyänen, die in der Nacht Ziegen und Zicklein holen, sie aufschlitzen und die bepissten Überreste für die Geier und Schakale liegenlassen. Und dann die Wanderung nach Süden: Je weiter man zieht, desto größer wird das Risiko eines Angriffs durch die Fulbe oder die Serawulli. Eine schöne Bescherung: die eigenen Leute in Ketten, das Vieh dahingeschlachtet, Pferde geschändet, Kuskus aufgefressen. Das Leben besteht aus wenig, wohl oder übel. Und das Wenige ist leicht zu transportieren. Das ganze Lager in Benaum – dreihundert Zelte – könnte in einer Stunde verschwunden sein wie eine Fata Morgana.
Ali ist in ständiger Bewegung, und daher ist auch sein Besitz beweglich. Sein Reichtum hat Beine: Kamele, Pferde, Ziegen, Ochsen, Sklaven. Eine Inventur seiner unbelebten Besitztümer würde ergeben, dass er praktisch ein Bettler ist. Der Emir von Ludamar, Herrscher über Tausende Menschen und ein Reich, so groß wie Wales, ein gebildeter Mann und Nachfahr des Propheten, besitzt de facto weniger als ein Hausmädchen in Chelsea. Ein Zelt aus Ziegenwolle, eine jubba zum Wechseln, ein Topf, ein Herd, zwei Musketen, eine undichte Wasserpfeife und ein stumpfer Säbel, der einst Major Houghton gehört hat – das ist so ziemlich alles. Ah, aber seine Pferde: weiß wie der Mond, das Hell und Dunkel des Muskelspiels wie Marmor, die Schweife rot wie eine geöffnete Ader (er färbt sie). Und seine Frauen! Wenn Ali zu beneiden ist, dann um seine Frauen. Für jede seiner vier Frauen würde sich eine Flotte von tausend Schiffen in Bewegung setzen – wenn man denn wüsste, was Schiffe sind.
An Einfluss und Schönheit kommt keine von ihnen Fatima von Jafnu gleich, der Tochter von Bu Khalum, dem Scherif der al-Mu’ta. Fatimas erotischer Zauber wurzelt in einer einzigen Eigenschaft: ihrer Leibesfülle. Gibt es in einer von Dürre geprägten Gesellschaft ein angemesseneres Ideal menschlicher Vollkommenheit? Fatima wiegt hundertzweiundsiebzig Kilo. Wenn sie sich von einer Ecke des Zelts zur anderen begibt, benötigt sie die Hilfe zweier Sklaven. Auf der hundert Kilometer langen Reise nach Dina im Norden hat sie einmal zwei Kamele und einen Bullen in die Knie gezwungen und musste schließlich auf eine Art Schlitten gebettet werden, der von sechs Ochsen gezogen wurde. Ali kehrt aus der Wüste zurück, Blut und Sand in den Augen, und taucht ein in die feuchte Fruchtbarkeit ihres Fleisches. Sie ist ein Quell, ein Brunnen, eine Oase. Sie ist ein Gefäß, das von Milch überfließt, sie ist ein beweglicher Feiertag, eine saftige Weide, eine Rinderhälfte. Sie ist Gold. Sie ist Regen.
Fatima war nicht immer eine Schönheitskönigin. Als Kind war sie dürr – sie hatte zwar starke Knochen und ein enormes Potential, das ja, aber trotzdem war sie so etwas wie ein schlankes, dunkeläugiges hässliches Entlein. Bu Khalum nahm sich ihrer an. Eines Abends trat er mit einer Strohmatte und einem Kissen ins Zelt. Er breitete die Matte in einer Ecke aus, legte das Kissen darauf und befahl seiner Tochter, sich zu setzen. Dann ließ er Kamelmilch und Kuskus bringen. Fatima war verwirrt: Die Reste des Abendessens – Holzschalen, schwarz von Fliegen, ein umgestürzter Krug – lagen noch in der Ecke. Plötzlich bemerkte sie Schatten, die über die Zeltwand tanzten, als würden draußen viele Menschen herumlaufen. Sie fragte ihren Vater, ob er mit seinen Ratgebern sprechen wolle. Er sagte ihr, sie solle den Mund halten. Die Zeltklappe wurde zurückgeschlagen, und ein Mann trat ein. Es war Mohammed Bello, dreiundsechzig Jahre alt, der vertrauteste Freund und Berater ihres Vaters. Er war nackt. Fatima war vor Scham wie gelähmt. Sie hatte noch nie die Waden eines Mannes gesehen, geschweige denn dieses faltige Fleisch, das wie eine Verirrung der Natur zwischen den Beinen des alten Mannes baumelte. Sie dachte an die knochenlosen, sich windenden Wesen, die man im Schlamm austrocknender Wasserlöcher fand. Sie war elf Jahre alt und brach in Tränen aus.
Mohammed Bello kam nicht allein. Acht weitere Männer, nackt wie Säuglinge, traten stumm in das Zelt. Unter ihnen waren auch Zib Sahman, ihr Pate, und Akbar al-Akbar, der Stammesälteste. Als sich alle gesetzt hatten, brachte ein Sklave eine Schüssel, so groß wie ein Vogelbad. Sie war bis zum Rand gefüllt mit Kamelmilch, es war mindestens ein Wochenvorrat. Ein zweiter Sklave brachte eine noch größere Schüssel voll Kuskus. Die Schüsseln wurden vor sie hingestellt. Kamelmilch ist süß und enthält zahlreiche Nährstoffe; Kuskus ist gedämpfter Weizenschrot und das Grundnahrungsmittel der Mauren. Er ist keineswegs ungenießbar, aber alles hat seine Grenzen. »Iss«, sagte Bu Khalum.
Zunächst verstand sie nicht. All das Essen war doch sicher für die Gäste ihres Vaters bestimmt. Sollte sie sie vielleicht bedienen? Dann fiel ihr ein, dass sie allesamt nackt waren, und wieder begann sie zu weinen. Ihr Vater wurde laut. »Iss, hab ich gesagt!« brüllte er. »Verstehst du kein Arabisch? Bist du taub? Iss!«
Sie sah die acht alten Männer an. Sie saßen im Halbkreis und beobachteten sie. Sie waren noch immer nackt. Und dann kam der größte Schock: Ihr Vater legte seine jubba ab! Ihr Leben lang – bei den Mahlzeiten, beim Zubettgehen, unterwegs – hatte sie von ihm nie etwas anderes gesehen als sein Gesicht, seine Hände und seine Zehen. Und plötzlich stand er nackt vor ihr, ausgestattet mit den gleichen gummiartigen Fleischlappen wie die anderen. Sie war entsetzt. »Iss«, wiederholte er. Sie war benommen. Mit einemmal hatte er eine Rute in der Hand. Er schlug ihr damit zweimal ins Gesicht. Sie schrie auf. Er schlug sie noch einmal. Und noch einmal. »Iss«, sagte er.
Schluchzend trank sie von der Milch. Sie nahm eine Handvoll Kuskus und stopfte ihn sich in den Mund. Aber sie war nicht hungrig. Sie hatte ja gerade gegessen, und zwar mehr als sonst. Ihre Mutter hatte sie getadelt, weil sie so mager und knochig war: Kein Mann werde sie haben wollen, solange sie aussehe wie ein Vogel Strauß. Und darum hatte sie sich bemüht, mehr als sonst zu essen. Jetzt war sie satt – noch einen Bissen, und sie würde sich übergeben. Das Kuskus blieb ihr im Hals stecken.
Bu Khalum war außer sich. Er schlug zu und schrie, bis er im Arm keine Kraft mehr hatte und seine Kehle heiser war. »Du wirst nicht mehr mit den anderen Mädchen spielen, du wirst keinen Unterricht mehr bekommen und auch nicht mehr weben – du wirst gar nichts tun. Du wirst hier sitzen, auf diesem Kissen, und essen, bis du mannbar bist. Du wirst essen und wachsen. Du wirst schön sein. Hast du gehört? Schön!« Mohammed Bello und die anderen sahen zu. Von Zeit zu Zeit nickte einer beifällig. Fatima aß. Sie weinte und aß. »Und wenn du mannbar bist, wirst du weiter essen – Tag und Nacht. Das ist deine Pflicht. Deinem Vater und deinem Mann gegenüber. Auch er wird eine Rute haben!« rief ihr Vater. »Eine Rute wie diese. Und er wird dich damit schlagen, wie ich dich jetzt schlage und morgen schlagen werde und übermorgen und am Tag darauf!« Plötzlich sprangen die alten Männer auf, als hätten sie ein Signal gehört. Fatima hob, den Mund voller Kuskus, den Kopf und erstarrte: Eine schreckliche, unnatürliche Veränderung war über die Männer gekommen. Was zuvor schlaff gewesen war, erschien jetzt hart. Wie runzlige alte Truthähne kamen sie mit aufgerichteten Schwänzen auf sie zu. »Schlagen!« schrie ihr Vater, und sie begannen, pumpende Bewegungen zu machen und sich klatschend und schmatzend zu melken, mit angespannten, versunkenen, geradezu verzückten Gesichtern. Fatima hatte das Gefühl, als wäre sie aus Wachs. Ihr war schwindlig. Sie taumelte und fiel durch Äonen, sie stürzte in einen Spalt, der sich in der Erde auftat, in einen Abgrund. Und im Fallen spürte sie die ersten Tropfen, wie einen Regen.
Nach diesem schrecklichen, traumatischen Abend aß sie. Sie aß unmäßig, sie aß wie rasend, sie konnte nicht genug bekommen. Kandierte Datteln, Lammfleisch, Joghurt, Salzbrocken, Kuskus mit Trockenfisch, Kuskus mit Nüssen, Kuskus mit Kuskus. Im Süden gab es Obst – Tamarinden, Maniok, Wassermelonen –, dünne Brotfladen, Honig von wilden Bienen, Yamswurzeln, Reis, Mais, Butter und Milch, Milch, immer Milch. Ziegenmilch, Kuhmilch, Kamelmilch – sie saugte sogar an der Brust einer stillenden Sklavin. Sie war unersättlich. Sie aß aus Angst, sie aß aus Rache. Sie aß für die Schönheit.
TANTALUS
Er stirbt. Durch den langen, gewundenen Tunnel des Vergehens und Sterbens geht er der Vollendung im Staub der Generationen vor ihm entgegen. Er stirbt, und zwar einfach vor Durst. Und vor Hunger, aber der Durst ist unmittelbarer. Abends geben ihm die Mauren eine Handvoll Kuskus und einen halben Becher mit einer gelblichen Flüssigkeit – sofern sie daran denken. Heute haben sie es vergessen. Sein Magen zieht sich zusammen, Zellen sterben und vergehen wie an den Strand gespülte Quallen. Dann sinkt die Temperatur, und er liegt, in seine Jacke gehüllt, zitternd und schwitzend da – das Fieber ist wie ein innerer Thermostat: an und aus, Sonne und Graupel. Draußen, jenseits des Kreises der Zelte, ist der Schrei der Schakale wie ein Messerstich ins Herz, und die Hyänen versammeln sich, um den Mond einzuschüchtern. Es wird sein Wehklagen und Heulen und Zähneklappern, denkt er. Dann schließt er die Augen.