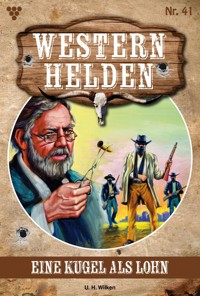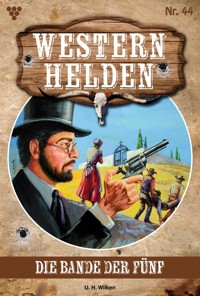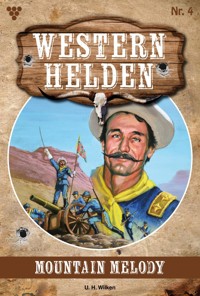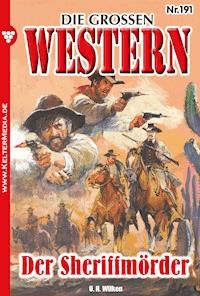
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Wild kläfften die Kettenhunde. Scheue Pferde rissen einen Buggy hinter sich her, streiften den Vordachpfosten an der Ecke zur Nebenstraße und rissen das Dach ein. Krachend überschlug sich der Buggy und wirbelte wie ein Geschoß durch das Storefenster. Sterbend sank der Storebesitzer hinter seinem Ladentresen in die Trümmer und hauchte einsam sein Leben aus. Cheyenne lief in den blutroten Schein der sinkenden Abendsonne. Die Schreie gellten ihm in den Ohren. Weit draußen vor der Stadt hetzten die Banditen ihre Pferde über einen staubigen Hügel und tauchten unter. Hart stieß er sich in den alten brüchigen Stiefeln herum und hörte die heisere Stimme des Sheriffs. Tyrone Moss gab mehrere Schüsse ab und brüllte nach Freiwilligen für sein Aufgebot. Wimmernd kniete eine Frau im verwüsteten Store und sank über dem leblosen Körper ihres Mannes zusammen. Im Bankhaus riefen Männer um Hilfe. Einen Atemzug lang stand der große, hagere Cheyenne still. Viele Gedanken durchzuckten sein Hirn. Eisern beherrschte er sich und überlegte, was zu tun war. Mit raumgreifenden Schritten folgte er den Menschen, die zum Bankgebäude liefen und hineinhasteten. Als er eintrat, wallte ihm noch der beißende Pulverqualm entgegen, konnte er noch den starken Geruch des verbrannten Pulverschleims wahrnehmen. Überall lagen Glassplitter. Männer befreiten die gefesselten Angestellten der Bank. Keiner der Clerks war angeschossen oder auch nur leicht verletzt worden. »Sie kamen wie Kunden rein«, krächzte ein Clerk verstört, »und dann zogen sie ihre Waffen und bedrohten uns und unsere Kunden. Mein Gott, hab' ich gedacht, jetzt ist es aus, jetzt…« Cheyenne kehrte um und trat wieder hinaus. Die Abenddämmerung zog grau und dunstig auf
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 191 –Der Sheriffmörder
Der Blechstern war seine Zielscheibe
U.H. Wilken
Wild kläfften die Kettenhunde. Scheue Pferde rissen einen Buggy hinter sich her, streiften den Vordachpfosten an der Ecke zur Nebenstraße und rissen das Dach ein. Krachend überschlug sich der Buggy und wirbelte wie ein Geschoß durch das Storefenster.
Sterbend sank der Storebesitzer hinter seinem Ladentresen in die Trümmer und hauchte einsam sein Leben aus.
Cheyenne lief in den blutroten Schein der sinkenden Abendsonne. Die Schreie gellten ihm in den Ohren. Weit draußen vor der Stadt hetzten die Banditen ihre Pferde über einen staubigen Hügel und tauchten unter.
Hart stieß er sich in den alten brüchigen Stiefeln herum und hörte die heisere Stimme des Sheriffs. Tyrone Moss gab mehrere Schüsse ab und brüllte nach Freiwilligen für sein Aufgebot.
Wimmernd kniete eine Frau im verwüsteten Store und sank über dem leblosen Körper ihres Mannes zusammen.
Im Bankhaus riefen Männer um Hilfe.
Einen Atemzug lang stand der große, hagere Cheyenne still.
Viele Gedanken durchzuckten sein Hirn. Eisern beherrschte er sich und überlegte, was zu tun war.
Mit raumgreifenden Schritten folgte er den Menschen, die zum Bankgebäude liefen und hineinhasteten.
Als er eintrat, wallte ihm noch der beißende Pulverqualm entgegen, konnte er noch den starken Geruch des verbrannten Pulverschleims wahrnehmen. Überall lagen Glassplitter.
Männer befreiten die gefesselten Angestellten der Bank. Keiner der Clerks war angeschossen oder auch nur leicht verletzt worden.
»Sie kamen wie Kunden rein«, krächzte ein Clerk verstört, »und dann zogen sie ihre Waffen und bedrohten uns und unsere Kunden. Mein Gott, hab’ ich gedacht, jetzt ist es aus, jetzt…«
Cheyenne kehrte um und trat wieder hinaus. Die Abenddämmerung zog grau und dunstig auf die Stadt zu, schob sich wie eine Nebelwand heran und hüllte die ersten Häuser am Stadtrand ein.
Längst war der Seifenschaum auf seinem Gesicht eingetrocknet. Langsam überquerte er die Straße.
Sheriff Tyrone Moss und mehrere Männer kamen ihm entgegen und verschwanden dann im Bankhaus. Vor dem Sheriff’s Office versammelten sich die ersten Freiwilligen.
Hart wuchtete Cheyenne sich in den zerschossenen Lederstuhl und rief nach dem Barbier.
Aufgeregt kam der Barbier heran und hielt in der zitternden Hand das scharfe Rasiermesser.
Argwöhnisch blickte Cheyenne auf die Hand.
»Wenn du mir den Hals durchschneidest, mein Freund, dann beiß ich dich in den Nacken, verstanden?«
»Heaven! Sehen Sie sich diese Schweinerei hier an, Sir!« jammerte der Barbier. »Alles haben sie zerschossen!«
»Reg dich nicht auf. Soviel ich gehört habe, ist keiner getötet worden.«
»Gott sei Dank, Sir! Aber wie können Sie so ruhig bleiben? Die Banditen haben über zwanzigtausend Dollar geraubt!«
Cheyenne lächelte rauh.
»Das ist nicht mein Geld, Barbier. Soll sich Sheriff Moss darum kümmern. Es ist gut, daß niemand zusammengeschossen worden ist. Die Bankgesellschaft wird sicherlich einen erfahrenen Detektiv auf die Spur der Banditen hetzen, wenn Moss sie nicht erwischen sollte. Und jetzt rasierst du mir die letzten Bartstoppeln weg, verstanden?«
Zitternd seifte der Barbier ihn neu ein, dann setzte er das Messer an.
Draußen wurde es nicht ruhig. Männer und Frauen liefen hin und her.
Vor dem Sheriff’s Office rotteten sich immer mehr Männer zu Pferde zusammen.
Tyrone Moss, ein stämmiger und untersetzter Mann mit einem harten Gesicht, buschigen grauen Augenbrauen und hellblauen Augen, kehrte zum Office zurück und stellte sich davor auf dem Gehsteig auf.
»Ich bitte um Ruhe, verdammt!« brüllte er heiser. »Seid endlich still, Leute! He, Smith, halt endlich das Maul! Hört her, Männer!«
Lässig saß Cheyenne im Barber’sShop und lauschte den Worten des Sheriffs. Tyrone Moss sprach von Vergeltung und Rache, von Aufhängen und Vernichtung. Nach seinen Worten hatte die Bank bereits eine Belohnung ausgesetzt.
»Jeder nimmt genug Proviant mit! Vergeßt das Trinkwasser und die Munition nicht! Die Halunken werden während der ganzen Nacht reiten. Das werden auch wir tun – und wir reiten auch am nächsten Tag noch weiter! Wer von euch ein Ersatzpferd hat, der soll es schnell holen!«
Hastende Schritte polterten über die ausgedorrten Planken der Gehsteige und entfernten sich. Reiter kamen am Barbier-Salon vorbei.
»Fertig, Sir«, sagte der Barbier erleichtert und wischte den letzten Seifenschaum von Cheyennes Gesicht.
Cheyenne blieb sitzen und blickte in den mit Seifenschaum bespritzten Spiegel. In den steingrauen Augen war ein nachdenklicher Ausdruck. Er schien den Barbier nicht gehört zu haben. Strähnig hing das sandfarbene schüttere Haar in die Stirn. Die rauhe, wetterfeste Kleidung umgab seinen sehnigen Körper. An den alten Stiefeln steckten stählerne Radsporen. Mürbe hing die lange Lederjacke von den knochigen Schultern. In dem tiefhängenden Halfter ruhte ein schwerer Colt. Die Winchester lehnte am Stuhl.
»Sir, Sie können aufstehen, ich bin fertig.«
»Ja«, murmelte Cheyenne und blieb sitzen. »Hast du eine Flasche Whisky hier, Barber?«
»Wollen Sie sich hier bei mir besaufen, Sir? Zwei Häuser weiter ist der Saloon.«
»Hol die Flasche.«
Achselzuckend ging der Barbier und kam dann mit der Flasche zurück.
Cheyenne biß den Korken heraus, spie ihn gegen den Spiegel und trank dann. Stilles Lächeln geisterte über sein wettergebräuntes Gesicht.
»Wenn man Langeweile hat, soll man zu seinem Frisör gehen, wie?«
»Was meinen Sie damit, Sir?«
»Ich bin erst seit gestern hier, ich kenne das County nicht. Überleg’ doch mal, wo die Banditen sich am besten verbergen könnten. Vierzig Meilen von hier beginnen die Berge.«
»Natürlich, Sir, und dorthin werden die Halunken auch reiten.«
»Das glauben wohl alle hier, wie? Jeder wird an die Berge denken?«
»Ja, Sir. Es gibt kein besseres Versteck für die Banditen.«
»Ich hatte auf dem Weg hierher ein ausgetrocknetes Flußbett durchquert. Wohin führt dieser Arroyo?«
»In südlicher Richtung und über die Grenze von Kansas hinaus. Warum fragen Sie danach, Sir?«
»Nur so, Barber. Ich spür den Wettersturz in den Knochen; es wird wohl bald regnen in Kansas.«
»Ja, und dann steigen die Flüsse über die Ufer. Die Regenfälle hier bei uns sind besonders heftig, Sir.«
Cheyenne nickte vor sich hin.
»Nach Süden also. Da liegt doch das Niemandsland und das Indianerterritorium Oklahoma, das die Indianer Land des roten Mannes nennen?«
»Stimmt, Sir.«
Lächelnd erhob Cheyenne sich und zahlte, nahm die Winchester und betrachtete sich im Spiegel.
»Nach dem Regen werden der Cimarron und der North-Canadian-River zu reißenden Strömen werden, und dann kann niemand rüber, stimmt doch?«
»Ja, Sir.«
Cheyenne strich prüfend über das rasierte Kinn und lächelte sich im Spiegel an.
»Ich seh mal wieder prächtig aus, richtig schön, wie?« meinte er. »Ich könnte mich glattweg knutschen… Adios.«
Sporenklirrend ging er hinaus.
Das Aufgebot verhielt noch vor dem Sheriff’s Office. Alle Männer dachten nur an die Belohnung. Dafür waren sie bereit, die Banditen zusammenzuschießen.
»He, Sie da!« rief Tyrone Moss zu Cheyenne hinüber. »Wollen Sie nicht mitkommen?«
»Ich hab’ was Besseres vor, Sheriff«, entgegnete Cheyenne gelassen. »Viel Glück dem Aufgebot.«
Moss knurrte dumpf und verzog das harte Gesicht, wandte sich von Cheyenne ab und forderte die Männer auf, ihm die Eidesworte nachzusprechen. Murmelnd sprachen sie den Eid.
»Dann los!«
Sie wollten die Pferde herumziehen, als eine Frau herankam. Der Saum des langen Kleides rutschte über den staubigen Boden. Im Dämmerschein war noch zu erkennen, daß sie geweint hatte, daß sie blaß war und heftig zitterte.
»Er ist tot!« sagte sie klagend. »Oh, mein Gott, Hank ist tot!«
Sheriff Tyrone Moss versteifte sich im Sattel.
»Was haben Sie, gesagt, Mrs. Wannagan? Ihr Mann ist tot?«
»Ja!« schluchzte sie und schleppte sich kraftlos heran. »Der Buggy hat ihn im Store zerquetscht! Mein guter, armer Hank, er hatte noch den Warenbestand prüfen wollen, und jetzt, jetzt ist er – tot.«
»Beruhigen Sie sich, Mrs. Wannagan. Meine Frau wird sich um Sie kümmern.« Moss starrte die Männer des Aufgebotes grimmig an. »Jetzt wissen wir, daß es doch einen Toten gegeben hat! Hank Wannagans Tod kommt auf das Konto dieser Banditen! Dafür sollen sie verrecken! Vorwärts!«
Brüllend trieb er das Pferd an. Die Männer folgten schreiend. Einige zerrten Ersatzpferde hinter sich her. Im Galopp raste das Aufgebot in die Nacht hinaus.
Reglos stand Cheyenne am Straßenrand, so allein und auch so zäh wie ein einsamer Wolf.
*
Über Kansas zog ein Unwetter herauf.
Mit ausdruckslosem Gesicht, großen Schritten und hart rasselnden Sporen ging Cheyenne von der Straße und auf den Hinterhof des kleinen Hotels, betrat den Stall und sattelte sein häßliches Pferd. Gedankenversunken streichelte er den Hals des Tieres.
»Das Aufgebot wird viel Zeit verlieren, mein Guter«, sprach er in die Stille des Stalls hinein. »Ich wette mit dir, daß die Bande dem Arroyo folgen wird.«
Dumpf schnaubte das Pferd und wischte mit weichen Nüstern über das verwittert aussehende Gesicht des Mannes hinweg.
Cheyenne zog das Pferd ins Freie, stieg in den Sattel und ritt langsam über den Hof, lenkte den Vierbeiner auf die Straße und verließ die Stadt.
Hell funkelten die Sterne am Himmel von Kansas. Dunkel überzog sich der Horizont. Ein warmer Sommerwind strich über das nächtliche Land. Das hohe Gras wogte hin und her. Später schlugen die Hufe des Pferdes über steinigen Boden, und die Eisen klirrten und schlugen Funken.
Wieder einmal war der Mann Cheyenne allein unterwegs.
Um Mitternacht stieß er auf das ausgetrocknete und steinige Flußbett und ritt daran entlang. Er kannte sein Ziel nicht. Die Banditen hatten sich bestimmt die allergrößte Mühe gegeben, um ihre Spur zu verwischen. Zwanzigtausend Dollar waren nur dann für sie von Wert, wenn sie diese Dollars auch irgendwo ausgeben und sich ein schönes Leben machen konnten.
Nur sekundenlang hatte Cheyenne zwei, drei Gesichter erkennen können. Jene Gesichter waren auf keinem Steckbrief zu finden.
Cheyenne war kein Kopfgeldjäger und kein Staatenmarshal.
Er war ein Mann, der aus dem Nichts kam – ein Mann der Wüste, der Berge und der endlosen Ebenen.
Ein Mann der vielen Legenden, die ihn unsterblich machten.
Vorsichtig lenkte er sein Pferd über den steilen Uferrücken hinweg und in den Arroyo hinein.
Hier saß er ab und kniete nieder, betrachtete forschend den Boden und rutschte auf den Knien umher. Nicht die kleinste Kleinigkeit entging ihm. Mit dem Zeigefinger berührte er die kleinen Steine, blies den Staub weg und richtete sich schließlich auf.
Lächeln huschte über das Gesicht.
Es gab für ihn keinen Zweifel, die Banditen waren hier entlanggeritten. Sie hatten sich viel Zeit genommen, um die Spuren zu löschen. Aber sie sollten das Aufgebot unter Führung des Sheriffs Tyrone Moss nicht unterschätzen. Unter jenen Männern befand sich ein Oldtimer, der einst als Trapper durch die Wildnis gezogen war – und dieser alte Mann konnte verteufelt gut Spuren lesen.
Lucky Lobo.
*
»Was siehst du, Lucky Lobo? Kannst du was erkennen?«
Angespannt beugte Tyrone Moss sich nach vorn und starrte vom Sattel aus auf den krummen Rücken des bärtigen und knochigen Trappers.
Lobo richtete sich nicht auf, kroch auf allen Vieren umher und antwortete auch nicht. Die Männer des Aufgebots hörten ihn hüsteln und murmeln, kichern und grunzen. Er schien mit den Steinen im Sand spielen zu wollen, und einmal roch er am Boden und schnüffelte dabei wie ein Jagdhund, der eine Spur aufgenommen hatte.
»Was soll das, Lucky Lobo?«
Der Alte ruckte herum, kniete vor den Reitern und verzog das faltige Gesicht, strich über den verfilzten Bart und verengte die kleinen grünschimmernden Augen, die ihm den Beinamen Lobo eingebracht hatten.
»Hier hat ein Gaul gepißt, Moss.«
»Na, und? Muß ja jeder mal, wie?«
Lucky Lobo stand auf und schritt gebeugt durch den Arroyo, kletterte den Hang empor und zog sich in den Sattel seines Pferdes.
»Die Banditen sind im Arroyo weitergeritten, Moss.«
»Was? Das ist doch idiotisch, Lucky Lobo! Da unten im steinigen Flußbett können sie nicht schnell reiten, die Gäule würden sich die Beine brechen oder zu lahmen anfangen.«
Lobo schüttelte den Kopf.
»Die Dreckskerle haben es gar nicht so eilig, Moss. Die lassen sich viel Zeit, weil sie glauben, schlau genug zu sein. Yeah, im Arroyo kommen sie nur langsam vorwärts, aber bald wird es regnen, dann wird sich der Arroyo mit Wasser füllen, dann müssen sie raus aus dem Flußbett. Reiten wir weiter, Moss, immer nach Süden.«
»Und wenn sie vorher den Arroyo verlassen sollten?«
»Das würden wir sehen. Ihr könnt oben entlangreiten, ich reite unten im Arroyo.«
Das Aufgebot ritt weiter nach Süden. Lucky Lobo lenkte sein Pferd durch den Arroyo und starrte unentwegt zu Boden.
Er trachtete nach zwanzigtausend Dollar. Damit könnte er sich einen schönen Lebensabend machen. An die Belohnung dachte er kaum, sie war ihm auch zu niedrig.
Noch war nichts vom Unwetter zu hören. Weit blieb das Weideland hinter den Reitern zurück. Die ersten öden Staubschüsseln waren zu sehen. Manche Hügelhänge waren eingestürzt, und die Hügel sahen wie zerklüftete Felsen aus. Der Mond tauchte das Land in bleiches Licht. Klagend kläfften Kojoten auf windigen Anhöhen und huschten vor den Reitern davon.
Die Männer des Aufgebots wollten töten.
Tyrone Moss hatte sie mit seinem Banditenhaß angesteckt.
Lucky Lobo aber hüllte sich in Schweigen.
*
Im Raum eines kleinen Farmhauses flackerte blakend eine Petroleumlampe und warf ihren unruhigen Schein auf das zerfurchte Gesicht eines Mannes, der schnell gealtert war. Die Gesichtsmuskeln waren erschlafft, in den Augen war ein Ausdruck von weltlicher Entrücktheit.
Im Hintergrund ruhte ein junger Mann auf einem harten Lager und hatte die Arme unter dem Kopf verschränkt.
Draußen am Talrand, hinter den im Nachtwind rauschenden Laubbäumen heulte durchdringend ein Wolf.
»Er ist wieder da, Dad.«
Leise klang die Stimme des Sohnes durch die Stille.
»Ja, Billy«, murmelte der Farmer und starrte ins Licht, »er ist allein, er hat sein Rudel verloren…«
»Denkst du noch immer daran, Vater?«
Geschmeidig erhob der junge Mann sich und kam an den Tisch, setzte sich und berührte die rauhe Rechte seines Vaters.
Robert Warren blickte seinen Sohn ernst an.
»Ja, ich denke noch immer an sie, aber ich bin nicht wie der Wolf, Billy – ich hab’ das Rudel nicht verloren, ich habe es verlassen!«
»Ein Jahr ist es schon her, Dad. Vergiß endlich die alte Zeit.«
Lächeln faltete Robert Warrens Gesicht.
»Gut, Billy, ich will’s versuchen. Ich hab’s damals für dich getan, für uns beide. Du bist jetzt neunzehn Jahre alt. Ich hab’ dich aus Kansas-City zurückgeholt, um nicht allein zu sein – und auch deshalb, weil ich dich brauche, weil nur wir beide es schaffen können, aus dieser kleinen Farm was zu machen. Weißt du, ich träume von unserer Farm. Eines Tages wird daraus eine große Farm werden mit vielen Feldern und reichen Ernten. Das ist ein schöner Traum.«
»Das wird nicht ein Traum bleiben, Dad.«
Wieder hörten sie den Wolf heulen. Ruhelos streifte das alte Tier am Talrand entlang und witterte nach unten, wo in einem kleinen Stall Federvieh eingesperrt war.
»Ich werde mal rausgehen, Dad. Vielleicht kann ich den Wolf erwischen. Er macht uns das Vieh und die Pferde verrückt.«
»Nein, Billy!«
Der alte Warren hielt seinen Jungen am Arm fest. Starr sah er in Billys dunkelblaue Augen.
»Was ist mit dir, Dad?« flüsterte Billy. »Warum soll ich es nicht versuchen? Der Wolf kommt fast jede Nacht.«
Horchend saß Robert Warren am Tisch und ließ den Hemdsärmel seines Sohnes nicht los. Wie geistesabwesend starrte er auf die Tür.
»Der Wolf ist wie ich, Billy«, sprach er dumpf. »Laß ihn leben, mein Junge! Wenn du ihn tötest, dann tötest du auch irgend etwas in meinem Herzen.«
»Das verstehe ich nicht, Dad…«
»Ist es so schwer zu verstehen, Billy? Nein, mein Junge. Weißt du, ich habe die Wildnis geliebt, das freie Land, und ich habe immer freisein wollen. Ich war vielen Wölfen begegnet, Billy. Heute bin ich selber ein alter und narbiger Wolf, der lahm geworden ist. Nein, erschieße ihn nicht, Billy!«
»Ja, Vater, wenn du es willst? Aber ich werde trotzdem mal hinausgehen und nach den Pferden sehen, ja?«
Der alte Warren nickte und atmete erleichtert auf. Er sah seinem schlanken schwarzhaarigen Sohn nach. Leise schlug die Tür hinter Billy zu. Die Schritte entfernten sich über den sandigen Hof.
Billy sah nicht, wie sein Vater nach vorn sackte, und er hörte auch nicht die Worte, aber er wußte, daß sein Vater von einigen Männern »Paps« genannt worden war, daß jene Männer in ihm so etwas wie einen Vater gesehen hatten.
Es gab keine Lüge zwischen Robert Warren und seinem Sohn.
Langsam öffnete Billy das Stalltor und trat ein, klopfte gegen die Flanken der beiden Pferde und sah dann in den Hühnerstall. Alle Tiere waren unruhig.
»Er tut euch doch nichts, er hat alte morsche Zähne, die abbrechen würden, wenn er zubeißen würde.«
Billy ging hinaus, drückte das Stalltor zu und warf den Querbalken in die Halterung zurück, drehte sich dann um und erstarrte jäh.
Am Rande des Hofes duckte sich ein alter grauer Wolf.
Grüne Lichter blickten Billy an. Das bleiche Mondlicht ließ die Augen funkeln. Staub haftete am Fell des Wolfes.
Leises dumpfes Knurren kam aus der Brust des Tieres.
»Geh, verschwinde!« krächzte Billy. »Hau ab!«
Im Stall keilten die Pferde aus. Das Dröhnen ließ den alten Robert Warren aus dem Haus kommen. Der Farmer entdeckte sofort den Wolf und ging mit schweren, erdhaften Schritten auf ihn zu.
»Komm, lauf nicht weg«, sagte er dabei. »Wenn der Hunger deine Eingeweide zerreißt, dann sollst du was zu fressen bekommen.«
»Dad!« rief Billy besorgt. »Geh nicht näher ran!«
»Laß nur, Billy, er tut mir nichts, er weiß, daß wir beide nur noch ein paar Jahre vor uns haben.«
Aber Billys Sorge stieg. Er liebte seinen Vater über alles und bekam Angst um ihn.
»Bleib doch stehen, Dad! Er hat böse Augen!«