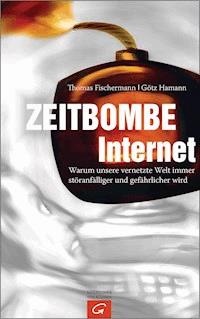9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Auf einer Expedition durch den Amazonaswald hat Thomas Fischermann den Schamanenlehrling Dzuliferi Huhuteni kennengelernt. Der Sohn eines der letzten Jaguarschamanen will das Erbe seiner geheimnisvollen Kultur antreten. Seit Jahrhunderten sind die Huhuteni für ihre unerklärlichen Heilungen schwerer Krankheiten bekannt, doch es heißt auch, dass sie nur durch Gedankenkraft ihre Feinde töten können. Dzuliferi erzählt in diesem Buch seine Geschichte und die seines Volkes, aber auch von der vorrückenden Moderne, bewaffneten Goldgräbern, Holzfällern und Drogenschmugglern, die zunehmend in diesem Teil des Waldes gesichtet werden. Die außergewöhnliche Stimme des Schamanenlehrlings gewährt erstmals tiefe Einblicke in eine ursprüngliche Welt voller Magie und altem Wissen – die so bedroht ist, dass es sie vielleicht schon bald nicht mehr gibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Auf einer Expedition durch den Amazonaswald hat Thomas Fischermann den Schamanenlehrling Dzuliferi Huhuteni kennengelernt. Der Sohn eines der letzten Jaguarschamanen will das Erbe seiner geheimnisvollen Kultur antreten. Seit Jahrhunderten sind die Huhuteni für ihre unerklärlichen Heilungen schwerer Krankheiten bekannt, doch es heißt auch, dass sie nur durch Gedankenkraft ihre Feinde töten können. Dzuliferi erzählt in diesem Buch seine Geschichte und die seines Volkes, aber auch von der vorrückenden Moderne, bewaffneten Goldgräbern, Holzfällern und Drogenschmugglern, die zunehmend in diesem Teil des Waldes gesichtet werden. Die außergewöhnliche Stimme des Schamanenlehrlings gewährt erstmals tiefe Einblicke in eine ursprüngliche Welt voller Magie und altem Wissen – die so bedroht ist, dass es sie vielleicht schon bald nicht mehr gibt.
Zum Autor
Thomas Fischermann, geboren 1969, ist Redakteur der ZEIT. Seit 2013 lebt er abwechselnd in Rio de Janeiro und Hamburg und verbringt besonders viel Zeit auf Expeditionen im Amazonasgebiet. Er wurde unter anderem mit dem Deutschen Journalistenpreis ausgezeichnet. Sein Buch »Der letzte Herr des Waldes« war ein Besteller.
Thomas Fischermann
Der SohndesSchamanen
Die letzten Zauberer am Amazonas kämpfen um das magische Erbe ihrer Welt
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Haupterzähler erhebt in diesem Buch allerlei Beschuldigungen gegen Einzelpersonen und Personengruppen bis hin zum Mord. Solche Vorwürfe sind nicht unbedingt wörtlich zu verstehen. Sie sind Teil der dortigen Kultur und wurden deshalb im Buch belassen, ohne dass wir den Wahrheitsgehalt in letzter Konsequenz prüfen konnten, was wir aufgrund der genannten ethnologischen Besonderheiten auch nicht mussten.
Originalausgabe 2021
Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Kerstin Lücker
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie, Zürich
Umschlagfotos: Giorgio Palmera / Fotografi Senza Frontiere
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-28042-0V002
www.heyne.de
Für Elsa,
Agnes,Hermann und Joseph
Inhalt
1 Wir waren Zauberer
2 An den Ursprung der Welt
3 Estrago – Fluch aus einer anderen Zeit
4 Die Welt entstand in Hipana
5 Manhene – der Wind, das Gift und die Berge
6 Wirf ihn in den Fluss!
7 Heeri – das Licht einer anderen Sonne
8 Ich erschlug eine Ratte und tötete einen Mann
9 Kuwé Duwákalumi – hinaus in die Welt
10 Wovon willst du hier leben?
11 Malikai – Rückkehr der Zauberer
12 Walimanai Ihriu – für die Ungeborenen
13 Inyaime – böse Seelen denken nur an Mord
14 Mit den Augen eines Schöpfers
15 Kuwai – die Musik des Lebens
16 Über dieses Buch
17 Danke
Glossar
Endnoten
Verwendete Literatur
1Wir waren Zauberer
Wenn du zaubern1 willst, musst du erst sterben. Dann darf in deinem Körper kein Leben mehr sein. Du sinkst zu Boden und fühlst, wie das Blut deine Adern verlässt, und du spürst deine Arme und Beine nicht mehr. Bald liegst du einfach so herum, wie ein Stück Holz, und es ist besser, wenn deine Verwandten dich nicht sehen. Sonst machen sie sich Sorgen und weinen um dich. Unser Angehöriger ist gestorben!, klagen sie. Er liegt wie ein Toter da und bewegt sich nicht mehr!
Aber du, der Zauberer, hast keine Angst. Du weißt, dass ein neues Leben in dich fährt und dass ein anderes Blut deinen Körper durchströmt. Es ist das Blut unserer Götter, der Saft der Pflanze Pariká, die für die Menschen wächst, damit sie reisen können. Weil du keinen Körper hast, darfst du hinauf in die Andere Welt. Dort leben die Götter und die unsterblichen Seelen2, aber auch du bist willkommen, weil du gestorben bist. Unsere Seelen können viele Welten besuchen, nur unsere Körper halten uns zurück.
Deine toten Augen erblicken die Sonne eines alten Himmels, deine lahmen Beine tragen dich durch die Häuser der Toten. Du kannst sie um Rat und Hilfe bitten, und wenn du viel Mut hast, steigst du bis zu unserem Gott Kuwai hinauf. Vielleicht gelingt es dir, seinen mächtigen Pelz zu umarmen, dann erlangst du große Macht.
Wenn du ein Zauberer bist, kannst du mehr erreichen als gewöhnliche Menschen. Vielleicht wird ein Angehöriger in deiner Familie krank? Dann kannst du ihn heilen, du reist zu Kuwai und reißt eine Arznei aus seinem Fell. Kuwai wird dir helfen, wenn er es will, denn er herrscht über alle Krankheiten der Welt. Vielleicht hast du Feinde in deiner Familie oder im Nachbardorf? Dann wirst du ihnen gefährlicher als jeder große Krieger, denn du findest tödliche Waffen auf deinen Reisen in die Andere Welt. Von dort aus kannst du sogar in die Zukunft und die Vergangenheit blicken, weil du die Welt so siehst, wie sie ist. In deinem Volk bringen die Menschen dir Respekt entgegen. Mächtige Zauberer werden zu Häuptlingen3 gemacht.
Mein Name ist Dzuliferi, und ich spreche hier aus einer Position der Autorität. Nicht jeder in dieser Gegend kann dir solche Auskünfte erteilen, aber ich bin in den Huhuteni-Clan geboren, was mir gewisse Kenntnisse und ein gewisses Ansehen verschafft. Wir sind der erste Clan des Baniwa-Volks, Kinder der Sonne, Großenkel des Vogels Inambú4. Es gibt viele Baniwa, aber nur wenige Huhuteni. Seit vielen Generationen bringen wir die Malirinai hervor, die Jaguarschamanen, die echten Pajés der alten Art. Wir waren Zauberer, sind es immer gewesen. Als ich noch ein Kind war, arbeiteten in meinem Heimatdorf dreiMalirinai, aber nur mein Vater hat bis heute überlebt. Die Leute unternehmen Bootsreisen von mehreren Tagen, bloß um meinen Vater zu sehen.
Aber da hast du es schon, da fangen die Probleme an. Mein Vater ist nicht mehr der Gleiche wie früher. Siehst du, wie die Kleider um seinen Körper schlottern? Seine Arme und Beine sind dürr geworden, sein Tabak ist schwach, und anständige Mengen Pariká verträgt er nicht mehr. Manchmal liegt er tagelang in seiner Hängematte herum. Was sollen wir mit diesem Greis gegen die Krankheiten ausrichten? Wie sollen wir unsere Feinde besiegen?
Seit Jahren schon kommen Landvermesser in unsere Gegend, und Politiker, die mit uns Geschäfte machen wollen. Einige haben Interesse am Holz, andere wollen nach Gold oder Diamanten graben. Sie locken die jungen Leute in die Städte, und die Regierung in Brasilia sagt dazu: Für uns Indianer5 ist das der richtige Weg. Wir sollen uns an der allgemeinen Kultur orientieren und mehr wie die Weißen leben. Einigen meiner Verwandten gefällt das sogar gut, auch einigen Leuten aus meinem eigenen Dorf. Ich habe eine andere Meinung darüber. Ich frage mich, was in den Städten aus uns werden soll. Ich finde, wir sollen auch weiter so leben dürfen wie früher. Jeder soll das für sich entscheiden können. Mit meinem Vater habe ich mich deshalb viel gestritten.
»Sie sind ein Lehrer für uns!«, sagte ich ihm. »Können wir nicht unsere Kräfte nutzen, um unsere Feinde zu bekämpfen, und die Welt wieder so erschaffen, wie sie war?«
Aber mein Vater hat lange geschwiegen. Er behielt sein Wissen und seine Macht für sich und verriet uns Söhnen davon nichts. Die Jahrzehnte vergingen, und demnächst bin ich selber ein alter Mann. In ein paar Tagen wollen wir meinen 60. Geburtstag feiern. Von der Anderen Welt habe ich wenig gesehen, zu ein paar Ausflügen war ich dort, ein paar Reisen in meinen Träumen. Mein Vater hat immer gesagt, dass er Gründe für sein Schweigen hat. Bei der Ausbildung zum Maliri könnte ich sterben. Er sagte, dass ich zu schwach für die Pflanze Pariká sei, dass ich beim Bier und beim Schnaps bleiben solle, aus Gründen der Sicherheit.
Aber wie könnte ich damit einverstanden sein?
»Die Zukunft unseres Dorfes hängt an mir und meinen Brüdern«, erwiderte ich ihm. »Du wirst bald sterben, und dann muss es eine neue Generation von Zauberern geben. Wir wollen die Krankheiten heilen und unser Dorf verteidigen. Ich mache mir Sorgen um meine Töchter und Söhne.«
Und dann, im Jahr 2009, hat mein Vater uns alle überrascht.
2An den Ursprung der Welt
Im Juni 2017 stand ich in einem klimatisierten Büro in der Amazonas-Kleinstadt São Gabriel da Cachoeira und starrte auf einen Felsen. Ich sah ihn am Ufer eines Flusses stehen, er schien von beachtlicher Größe zu sein, und im Hintergrund erhob sich ein Wasserfall. Das Poster in den Diensträumen der indigenen Selbstverwaltung6 war schon alt, und seine Druckfarbe hatte sich grünlich verfärbt, aber die Oberfläche des fotografierten Felsens war deutlich zu erkennen. Zeichneten sich da Reliefspuren ab? Sollten das Schlangen, Schnecken oder Blumen sein? Was bedeuteten die vielen runden Punkte, die unbekannte Bildhauer, mal zu Gruppen sortiert, mal nebeneinander aufgereiht, in den Fels geschlagen hatten?
Mit etwas Fantasie konnte ich mir eine Sternenkarte vorstellen, vielleicht blickte ich aber auch auf ein überkommenes Kalender- oder Zählsystem. Der Bildunterschrift auf dem Poster war zu entnehmen, dass der Reliefstein am Ayari-Fluss steht, und von dem hatte ich schon viel gehört. Der Ayari ist ein gewundener Transport- und Reiseweg, der Hunderte Kilometer weit durch den tiefsten Amazonaswald führt. Die Bootsleute der Region meiden diesen Fluss, weil sie seine tückischen Felsen und unberechenbaren Stromschnellen fürchten, aber mit einem Kanu oder einem schmalen Boot kann man auf dem Ayari weit kommen.7 Der Weg führt von Brasilien bis nach Kolumbien, über den Äquator hinweg.
Das Foto des Felsens bannte meinen Blick, weil ich damals auf der Spur einer schwer glaubwürdigen Geschichte war. Der brasilianische Amazonasexperte und Dokumentarfilmer Davilson Brasileiro hatte mich nach São Gabriel gelockt und allerlei fantastische Versprechungen gemacht. Er erzählte von einer uralten Zaubererfamilie, die tief im Regenwald lebt und die wahlweise schwerste Krankheiten heilen oder mit bloßer Gedankenkraft ihre Feinde töten kann.
Ich hatte mit Davilson schon seit 2013 mehrere große Regenwald-Expeditionen unternommen, erst für das ZEIT-Magazin und dann für ein Buch mit dem Titel Der letzte Herr des Waldes8, das den Widerstandskampf eines jungen indigenen Kriegers dokumentiert. Jetzt wollte Davilson unbedingt diese Zauberer treffen. Er berichtete von greisen Schamanen, Malirinai genannt, die aus Amazonaspflanzen eine der stärksten Psychodrogen der Welt herstellen. Er sprach von Goldschätzen, blutigen Initiationsriten und ungeklärten Todesfällen im Regenwald.
Ach ja, und außerdem hätten Archäologen am Ursprungsort dieses geheimnisvollen Volkes, an einem Amazonasfluss namens Ayari, jahrtausendealte Reliefzeichnungen und Höhlenmalereien entdeckt. Die Symbole könnten sie nicht recht entziffern und ihre Herkunft nicht genau erklären. Die Malirinai sagen, dass es Wegweiser der Götter für ihre Seelenreisen sind.
Mir klang das zu sehr nach einem kitschigen Fantasyroman. Aber immerhin schien es solche Felsen zu geben.
Die Aussicht auf eine Begegnung mit dieser alten Amazonaskultur interessierte mich aber noch unter anderen Gesichtspunkten. In den vergangenen Jahren hat sich die Zerstörung des Regenwalds erneut dramatisch beschleunigt. 2019 und 2020 gingen erschreckende Bilder von Großbränden am Amazonas um die Welt: von Flammenmeeren im Regenwald, heimatlos gewordenen Volksgruppen und wilden Tieren auf der Flucht. Die Zerstörung war zu erwarten, denn die Regierungen von Brasilien, Venezuela, Kolumbien, Bolivien und anderen zuständigen Staaten unternehmen kaum etwas Wirksames gegen den Vormarsch der Holzfäller, Goldgräber und der brandrodenden Viehwirte. Allein in Brasilien, wo der Großteil des Amazonasgebiets liegt, ist seit den Sechzigerjahren ein Fünftel des ursprünglichen Regenwalds den Kettensägen zum Opfer gefallen.9 Ein weiteres Fünftel gilt als beunruhigend stark ausgedünnt. Viele indigene Völker bangen um ihr Überleben, weil sie den Eindringlingen im Wege stehen. Menschenrechtsorganisationen melden Jahr für Jahr schreckliche Morde an aufrechten Häuptlingen und gewaltsame Angriffe auf ihre Dörfer.10
Von der 40.000-Einwohner-Kleinstadt São Gabriel aus wacht die indigene Selbstverwaltung FOIRN über ein Indianerschutzgebiet von der Größe Österreichs. Diese Region ist bisher noch außergewöhnlich unberührt geblieben. Wenn man sie auf Satellitenfotos betrachtet, blickt man auf gleichmäßiges, sattes Dunkelgrün, ein Meer von Baumkuppen, das hin und wieder von kleinen Berggruppen und gewundenen Flüssen unterbrochen wird.
Der Anblick ist untypisch, denn die meisten Satellitenbilder aus dem Amazonasgebiet sehen heute anders aus. Wo der Vormarsch der Eindringlinge beginnt, erkennt man auf den Aufnahmen zunächst ein paar fein verästelte Lehmstraßen im Regenwald. Ein paar Jahre später kommen größere Schneisen hinzu, und bald macht man wachsende Siedlungen für Sägewerksarbeiter aus. Irgendwann erblickt man dann die Karomuster von Vieh- und Weidebetrieben, die überall auf den abgeholzten Flächen entstehen. Diese Verwandlung geht heute so schnell voran, dass manche Klimaforscher dem Amazonasgebiet nur noch wenige Jahre geben, bis sein fragiles Ökosystem unter der Belastung kollabiert. Sie sagen voraus, dass dann eine weitgehende Versteppung einsetzt, die auch erhebliche Folgen für das Erdklima haben wird.11
Im äußersten Nordwesten aber, rings um São Gabriel, kann man den Amazonaswald noch so wie vor der großen Vernichtung erleben. In dieser satten Naturlandschaft mit ihrer überbordenden Vegetation, ihrem schwülheißen Klima und ihrem Soundtrack aus Tierstimmen und Insekten begreift man schnell: Den Wert des Regenwalds kann man nicht nur in Kilotonnen Holz ausdrücken, in seiner Aufnahmefähigkeit für das Klimagas CO2 oder in seiner Funktion als gigantischer Wasserschwamm, der das Weltklima mit reguliert. Das Roden und Brandschatzen in diesem Teil der Welt setzt auch eine unwiederbringliche Wissensquelle aufs Spiel.
Ich traf auf meinen Reisen Naturwissenschaftler, die geradezu panisch damit beschäftigt sind, noch schnell ein paar Tier-, Pilz, Pflanzen- und Mikrobenspezies zu erforschen. Sie wissen um die riesige Artenvielfalt in dieser Region – und sie befürchten, dass in ein, zwei Jahrzehnten nur noch wenig davon übrig bleibt und dass dann alles Wissen über diese Spezies verloren geht.
Die bedrohte Artenvielfalt ist neben der allgemeinen Klimabedrohung in der breiten Öffentlichkeit zu einem viel diskutierten Thema geworden,12 und Menschen mit einem Herz für den Umweltschutz ist seine Bedeutung leicht zu vermitteln. Doch auch hartgesottene Pragmatiker, die aus wirtschaftlichen Gründen eher eine Erschließung des Amazonaswalds durch moderne Infrastruktur befürworten, lassen sich bisweilen für die Vorteile der Artenvielfalt erwärmen: Entdeckungen im Amazonaswald haben in den vergangenen Jahrzehnten das Leben der Menschen immer wieder bereichert und Milliardenindustrien geschaffen, deren Erträge über jede denkbare forstwirtschaftliche oder bergbauliche Nutzung hinausgehen.13
Ein frühes Beispiel ist die Kautschukpflanze, die im 19. Jahrhundert die Massenproduktion von Dampfmaschinendichtungen und Autoreifen möglich machte. Ein jüngeres sind ACE-Inhibitoren für die Blutdrucksenkung, die auf der Basis eines Amazonas-Schlangengifts entwickelt wurden. Sie sind aus der modernen Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht mehr wegzudenken und haben wohl Millionen Menschen das Leben gerettet. Scouts von Pharma- und Industrieunternehmen, mit denen ich vor Ort sprach, waren sich im Grunde alle einig: In der Vielfalt des Biosystems am Amazonas stecken noch zahllose Entdeckungen dieser Art, aber sie sind bloß noch möglich, solange der Wald existiert.
Wenn westliche Forscher im Amazonaswald ihre Entdeckungen machen, stoßen sie regelmäßig darauf, dass ihnen irgendein indigenes Volk schon zuvorgekommen ist. Sie begegnen Schamanen oder Dorfältesten, die aus diesen Naturstoffen Heilmittel, Waffen, Gifte oder Werkstoffe für die Landwirtschaft machen. Das entsprechende Wissen geben sie mündlich in Erzählungen und Liedern weiter, Generation für Generation, über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hinweg.
Auch deshalb zog es mich 2017 nach São Gabriel. Ich stellte mir vor, dass ich mit den Helden aus Davilsons Geschichten solche Fragen besprechen könnte: Wie viel altes Wissen, zum Beispiel über Naturheilmittel, schlummert noch in ihrer Kultur? Oder: Wissen die Malirinai vom Rio Ayari etwas, das westlichen Forschern nicht bekannt ist? Über die Huhuteni und ihre Heilerfähigkeiten hatten schon frühe Amazonasreisende voller Bewunderung berichtet, zum Beispiel der deutsche Forscher Theodor Koch, der 1903 auf dem Ayari-Fluss unterwegs war.14 Der Besucher aus der hessischen Ortschaft Grünberg berichtete davon, wie »die Indianer« das Augenlicht seines Expeditionsteilnehmers Schmidt von einer schweren Entzündung befreiten. »Schließlich, als alle Mittel aus meiner Reiseapotheke nichts helfen, kurieren ihn die Indianer in kurzer Zeit, indem sie ihm den Saft einer gewissen Schlingpflanze in die Augen träufeln«,schrieb Koch vor mehr als 100 Jahren.
Davilson und ich flogen in die brasilianische Amazonasmetropole Manaus und fuhren mit einem Passagierdampfer 850 Kilometer den Rio Negro hinauf. Wir bezogen zwei fensterlose Zimmer im Deus-me-Deu-Hotel, was in der portugiesischen Sprache so viel wie »Gott hat es mir gegeben« bedeutet. Das Gästehaus von Gottes Gnaden verfügt über einen finsteren Treppenaufgang, extrastarke Klimaanlagen und einen Balkon mit Blick auf die belebte Hauptstraße. Von dort aus konnten wir klar erkennen: Ein Ort für Indianer-Romantiker ist São Gabriel nicht.
Die Kleinstadt am Rand des Regenwalds hat zwei kleine Häfen, eine Flugpiste, zahlreiche Tankstationen und Reparaturbetriebe für Schiffe und Boote. Mehrere Einheiten des Militärs unterhalten ringsherum Kasernen und Übungsplätze. Das liegt daran, dass São Gabriel Grenzgebiet ist. Kolumbien und Venezuela liegen – für amazonische Verhältnisse – nicht weit entfernt. Bewaffnete Drogenschmuggler reisen manchmal durch die Stadt, und in den Wäldern sind Rebellengruppen aus Kolumbien unterwegs.
Entlang der Hauptstraße haben drei Banken ihre Geldautomaten aufgestellt, es gibt mehrere Supermärkte, Behördengebäude und ein Internetcafé. Die Läden bieten ihre Waren ausgesprochen teuer an, was ihre Besitzer damit begründen, dass alles über den Fluss herangeschafft werden muss. Immerhin verkaufen sie sämtliche Güter des täglichen Bedarfs: Buschmacheten, Angelschnüre, Gummistiefel, Hängematten, Spitzhacken für Goldgräber. Es gibt ein Fachgeschäft für E-Gitarren und Kettensägen. In einer Markthalle bieten Familien, die mit dem Kanu anreisen, Waren aus ihren Dörfern feil: Maniokmehl, geflochtene Körbe, Pfefferschoten, exotische Kräuter und Früchte, Paka-Fleisch und mit Speeren erlegte Fische. Zu ihren Delikatessen gehören Soßen aus Maniokgift, die durch einen Fermentationsprozess genießbar gemacht werden und die Fischsuppen eine exotisch-säuerliche Note geben. Sie verkaufen essbare Ameisen, die beim Draufbeißen wie Beeren zerplatzen. Ihre fetten Köpfe enthalten eine nährreiche, eiweißhaltige Paste.
Wir verbrachten viel Zeit in dieser rauen und farbenfrohen Welt, aber an die Malirinai aus Davilsons Geschichten kamen wir monatelang nicht heran. Stattdessen wurden wir erst mal, trotz guter Referenzen, von den örtlichen Behördenvertretern misstrauisch überprüft. Ein Armeegeneral befahl uns in seine Kaserne und klopfte uns im freundlichen Tonfall auf verdeckte Interessen ab: Waren wir ausländische Spione, die es auf die Goldvorkommen in diesem Gebiet abgesehen hatten?15 Oder waren wir – schlimmer noch – Umweltschutzaktivisten?
Die Indianerschutzbehörde FUNAI und die indigene Selbstverwaltung FOIRN, bei der das Poster des geheimnisvollen Felsens hing, unterstützten uns hilfreich, aber ohne eigenes Interesse an der Sache. Ihre jungen, aufstrebenden Funktionäre wollen vom Schamanismus eigentlich nichts wissen, ihre Anliegen sind moderner Natur. Sie setzen sich für mehr Rettungshelikopter für die entlegenen Dörfer ein und für mehr Ärzte auf den Krankenstationen der Stadt, sie wollen besseres Lehrmaterial für die Schulen und anständige Löhne für indigene Kunsthandwerker. Die Mehrheit der Völker in dieser Region ist schon Mitte des vorigen Jahrhunderts zum Christentum konvertiert, angeleitet von katholischen und evangelischen Erweckungspastoren, die die alten Rituale, Heilungstechniken und Weltanschauungen als Teufelszeug betrachteten. Selbst bei der FOIRN sind die Funktionäre Christen.
Doch endlich, bei einem Wiederholungsbesuch, erhielten wir eine Nachricht von denMalirinai. Informanten kündigten uns an, dass ein besonders angesehener Schamane aus dem Huhuteni-Clan, Manuel da Silva Baniwa, in der Kleinstadt erwartet werde. »Mandú« da Silva gilt bei seinem Volk als ein Jaguarschamane, also als ein voll ausgebildeter Praktiker der alten Schule, der in die Zukunft schauen und besonders schwere Krankheiten heilen kann. Er verbringt einen großen Teil des Jahres bei seiner Tochter, die ein mückenumschwärmtes Häuschen am Flussufer bewohnt, in einem ärmlichen Randbezirk der Stadt. Wir trafen dort einen Greis, dem ein kariertes Herrenhemd locker um den ausgemergelten Körper saß. Er hatte wache Augen und wirkte gebrechlich, ein einziger Zahn war ihm geblieben, der schief aus seinem Unterkiefer ragte. Die Beine des Mannes waren gelähmt. Still hörte er sich unsere Erklärungen an, warum wir seine Kultur kennenlernen wollten, und er lud uns ein, mit ihm auf einem Holzbänkchen zu sitzen.
Über viele Tage hinweg erzählte Manuel da Silva uns von seiner Jugend im Regenwald. Die Familie datiert seine Geburt um das Jahr 1920 herum, im staatlichen Geburtenregister und in den Aufzeichnungen von Anthropologen steht aber 1933. So genau weiß man die Dinge am Amazonas manchmal nicht. Unstrittig ist, dass der heranwachsende da Silva als Zwangsarbeiter durch die Wälder am Oberlauf des Ayari gescheucht wurde, während Europa im Zweiten Weltkrieg versank.16
Die kräftigen jungen Männer seines Volkes wurden damals im Kautschukboom von erpresserischen Händlern zu Schuldknechten gemacht, also mit Darlehen zur Zwangsarbeit verpflichtet, sobald sie gerade mal das Teenageralter erreicht hatten. Sie mussten den Wald im Laufschritt durchqueren, von einem der weit auseinanderstehenden Kautschukbäume zum nächsten, um ihre Rinde anzuritzen und Latexmilch daraus zu sammeln. Die Milch kochten sie auf Feuerstellen zu Gummibällen. Selbst für erfahrene indigene Waldläufer war diese Arbeit wegen der vielen Schlangen, Skorpione und Giftameisen lebensgefährlich.
Da Silva erzählte, wie er sich später bei mehreren Meistern zum Schamanen ausbilden ließ, weil es die Tradition in seiner Familie war. Es sah diese Berufswahl aber auch als einen Weg aus der Knochenarbeit für die Kautschukhändler. Elf Jahre lang verbrachte er bei verschiedenen Lehrern in Brasilien und Venezuela, um ein Malirizu werden. Er lebte während dieser Zeit in Askese, fernab der Gesellschaft und auf eine Minimaldiät beschränkt, die hauptsächlich aus Wasser und Maniokmehl bestand. Nahezu täglich nahm er die Psychodroge Pariká und brach zu Traumreisen in jenseitige Welten auf.
Da Silva ist der Meinung, dass es mit den Malirinai zu Ende geht. Seine eigene Kraft schwinde, erzählte er, und es ließen sich kaum geeignete Nachfolger finden. Der alte Schamane stellte uns seinen Sohn vor, einen Mann von damals Ende 50 in lockerer Stadtkleidung. Er hatte einen sauberen Seitenscheitel durch seine pechschwarzen Haare gezogen, und seine kurzen fleischigen Arme steckten in einem gepflegten Polohemd. Im brasilianischen Personalausweis wird er unter einem weitverbreiteten portugiesischen Namen geführt, als Alberto de Lima da Silva, aber der Vater hat ihn auch in der Baniwa-Sprache getauft. Sein Name Dzuliferi, den man »Dschu-li-we-ri« ausspricht und dabei die zweite Silbe betont, hat im Huhuteni-Clan einen bedeutsamen Klang. Auch der Urschamane aus den Mythen und Erzählungen wird so genannt. Er ist der ältere Bruder des Schöpfergottes Niaperikuli, eine Art Chefverwalter der magischen Kräfte, der in einer dichten düsteren Wolke lebt. Die Wolke wird in den Erzählungen der Huhuteni darauf zurückgeführt, dass Dzuliferi fortlaufend Zigarren qualmt. Wenn ein Schamane seinem Sohn einen solchen Namen gibt, setzt er große Hoffnungen in ihn.
Wir wussten bei diesen ersten Treffen nicht recht, was wir von Alberto alias Dzuliferi halten sollten. Was konnte uns dieser lebenslustige Kerl wohl vom Schamanismus erzählen? Bei unserer ersten Begegnung wollte er sich erst mal Geld von uns leihen, später erzählte er uns von seinen zahlreichen Jobs als Transportfahrer auf verschiedenen Flüssen, als Hilfslehrer in fernen Dörfern und von seinen Erfahrungen in der illegalen Goldgräberei. Alberto bildete in vieler Hinsicht einen Kontrast zu seinem ernsthaften, bedächtig redenden Vater.
Doch gleich vom ersten Tag an übersetzte der Schamanensohn begeistert bei unseren Interviews. Das war eine große Hilfe, weil der Vater das Portugiesische nicht gut beherrscht, in der Baniwa-Sprache drückt er sich sicherer aus. Alberto kannte die Erzählungen seines Vaters bereits genau und konnte sie uns mit großer Präzision erläutern. Er ergänzte auch jede Auslassung seines Vaters gleich um ausschweifende Interpretationen, und hinterher erzählte er noch ganz eigene Geschichten.
Nach einigen Tagen erteilte uns Manuel da Silva seine Genehmigung dafür, unter der Aufsicht Albertos zu den heiligen Stätten der Huhuteni zu fahren, den Ayari-Fluss hinauf. Wir mieteten ein Boot mit einem starken Außenbordmotor, weil wir mehr als 1000 Kilometer zurücklegen wollten, bis an die kolumbianische Grenze und wieder zurück. Für die wochenlange Reise auf dem Fluss luden wir 600 Liter Benzin auf das Deck und viele Pappkisten voller Proviant.
Vom ersten Tag an überraschte uns unser Reisebegleiter durch seine tiefen Kenntnisse all der Orte entlang der Flüsse. Es schien, als könne er jeden Felsen, jeden weißen Sandflecken in einer Flussbiegung und jeden Mangrovenwald mit einem Namen belegen und eine Geschichte dazu aus der Mythenwelt hervorholen. Routiniert navigierte er unser Boot durch die gefürchteten Stromschnellen auf den Flüssen Içana und Ayari, und in den Siedlungen am Uferrand verhandelte er Preise für geräucherte Hühnchen und Fische. Wenn unser Boot wieder mal samt Benzinfässern und Proviantkisten einen Wasserfall hinaufgeschleppt werden musste, heuerte er kräftige Träger und Helfer an.
Alberto wusste genau, an welchen Bächen wir gefahrlos unsere Wasservorräte auffüllen konnten, und er sprach Empfehlungen für Plätze aus, an denen wir zum Übernachten unsere Hängematten aufhängen konnten. An heiligen Orten sagte er lange Beschwörungsformeln auf, um seelische Gefahren abzuwenden. Auf manchen Felsen, erläuterte er, erhöben sich unsichtbare Städte mit Wesen aus anderen Epochen. Ohne die richtige Begrüßung würden sie uns für Feinde halten und sich mit Flüchen wehren. Wir könnten dann schwer erkranken.
Damals ahnten wir schon, was unser Reisebegleiter uns erst später offenbarte: Es war ihm gelungen, den jahrzehntelangen Widerstand seines Vaters zu brechen. Er hatte selber eine Schamanenlehre begonnen. Alberto hofft darauf, dass er trotz seines vorgerückten Alters noch ein Maliriwerden kann, ein Heiler, Gedankenkrieger und Seelenreisender in andere Welten.
Er fühlt sich auch als Wächter eines bedeutsamen Ortes. Seine Familie hat stets am doppelten Wasserfall von Hipana gelebt, einem Naturspektakel im Dreiländereck zwischen Brasilien, Kolumbien und Venezuela. Etliche Amazonasvölker gehen davon aus, dass der Schöpfergott in Hipana die Menschen erschaffen hat und dass sich an diesem Ort die Andere Welt über den Wolken, die Unterwelt der Ungeborenen und unser irdisches Diesseits berühren. An den Wasserfällen findet sich ein ganzes Ensemble bedeutsamer Felsen, ähnlich dem auf dem Foto in São Gabriel. Einige Forscher vermuten, dass sie von weit her nach Hipana geschleppt und mit Reliefzeichnungen versehen worden sind.17
Dieses Buch umfasst Dzuliferis Erzählungen auf unseren Reisen. Der Schamanensohn berichtet über sein ereignisreiches Leben, das ihn schon früh an weit entlegene Orte im Amazonaswald geführt hat, und über die traditionsreiche schamanische Praxis seiner Familie. Auf langen Bootsfahrten und über viele Zigarren vor seiner Dorfhütte erinnert er sich an weise Großväter, freundliche Missionare und feindliche Krieger. Er erzählt davon, wie suspekte FARC-Rebellen, Goldsucher und Drogenschmuggler seit Jahrzehnten sein Dorf besuchen, und auf Ausflügen im Kanu führt er uns an versteckte heilige Orte im Wald. Er demonstriert alle Arbeitsschritte für die Herstellung der Psychodroge Pariká, und er stellt uns die ärgsten Feinde seiner Familie vor: die Schamanen im Nachbarort Pana-Pana, die er ausnahmslos für Hexenmeister und Giftmischer hält.
Albertos Familie lebt heute verteilt über mehrere Dörfer und in der Stadt São Gabriel, aber er selber hat eine Entscheidung gefällt. Er will mit seiner gesamten Verwandtschaft reden, so viele wie möglich nach Hipana zurückbringen und am Ort seiner Kindheit die alten Traditionen neu beleben. Er ist davon überzeugt, dass die Malirinai den Schlüssel zu einem gesunden, glücklichen Leben besitzen und dass die Zerstörung der alten Kultur und des Waldes aufgehalten werden muss. Dafür will er kämpfen, notfalls mit Zauberkraft.
3Estrago – Fluch aus einer anderen Zeit
Du fragst, wo man hier zur Toilette gehen kann. Es gibt aber keine Toiletten in Hipana, es tut mir leid. Wir sind ein kleines Dorf, und niemand hat Kanäle gebaut wie in der Stadt. Für die Toilette gehst du in den Wald. Alle Dorfbewohner machen es so, jeder hat seinen eigenen Platz. Ich schlage vor, du läufst von hier aus etwa 200 Meter weit und suchst dir eine gute Stelle aus. Es gibt auch Leute, denen 100, 30 oder 15 Meter reichen. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Der Wald wächst dicht rings um unser Dorf, also hab keine Sorge, dass du gesehen wirst. Eine gewisse Privatsphäre ist garantiert.
Ich finde es ungefährlich, in den Wald zu laufen, du machst dir zu viele Sorgen. Achte nur auf die Schlangen und Skorpione. Die Tucandera-Ameisen18 sind ein Ärgernis, weil ihr Biss sehr schmerzhaft ist, aber das Fieber dauert meistens nur einen Tag. Kleine Kinder können am Biss der Tucandera sterben, aber erwachsene Menschen halten ihn gut aus. Die Leute werden dich sehen und warnen: Setz dich nicht an diesen Ort! Auf diesem Hügel, unter jener Açaí-Palme wird dich dieTucandera in den Hintern beißen! So bringen sie das auch ihren Kindern bei. Du wirst also genug Hilfe finden, wenn du auf die Toilette gehst. Hab keine Angst, du bist nicht allein. Hier wohnen fast 80 Menschen im Dorf.
Es gibt auch die Möglichkeit, die Tucanderas zu töten. Früher haben die Leute es so gemacht. Da war es üblich, dass ein Mann seinen Toilettenplatz gegen die Ameisen verteidigt, aber heute haben die meisten davor zu viel Angst. Früher habe ich es selber so gehalten, und ich finde es auch nicht schwer: Du erhitzt einen Topf mit Wasser auf dem Feuer und gießt es mit Schwung in das Ameisenloch. Danach rennst du erst mal schnell weg. Die Ameisen krabbeln heraus, um dich anzugreifen, aber später kommen sie nicht mehr zurück.
Bevor du zur Toilette gehst, suchst du dir einen Stock. Damit kannst du ein Loch ausheben, 20 Zentimeter tief sollte es schon sein, und hinterher schüttest du es wieder zu. Wenn später jemand an dieser Stelle vorbeiläuft, wird er nicht merken, dass du dort auf der Toilette warst. Davon bleiben kaum Spuren zurück, nicht mal ein übler Geruch. Aus meiner Sicht ist es eine gute und saubere Vorgehensweise. Auf dem Weg zurück ins Dorf kannst du im Bach baden gehen, das Wasser ist kühl und es erfrischt. Ich komme gerade von dort.
Unsere Fahrt über die Flüsse ist anstrengend gewesen, und ich bin froh, dass ich mich in meinem Heimatdorf ausruhen kann. Aber lass mich dir erst noch den Obstgarten zeigen, den mein Vater angelegt hat. Gleich hinter dem Haus steht der Orangenbaum, der voller reifer Früchte hängt. Ich will sie in den kommenden Tagen pflücken und bringe sie meinem Vater in die Stadt.
Daneben steht ein Brotfruchtbaum, von dem wir Kastanien ernten, die wir in heißem Wasser kochen. Dahinter wächst eine Açaí-Palme, aus deren Beeren du einen Brei zubereiten oder einen Wein ansetzen kannst. Drüben siehst du den kräftigen Baum, an dem die goldgelben Umari-Früchte wachsen, und hier gibt es auch einen Uirapixuna-Strauch. Seine Früchte haben einen großen harten Kern, und das Fleisch unter der Schale ist ganz dünn. Trotzdem ist die Uirapixuna besonders nahrhaft, du kannst die Früchte roh essen oder sie mit Wasser aufgießen. Wir haben Lieder über die Uirapixuna in meinem Volk.
Ich weiß noch, wie mein Vater diese Bäume gepflanzt hat. Damals war ich ein Kind, und ich habe mitgeholfen, alles zu tragen. Wir pflanzten die Setzlinge ins ausgehobene Loch und traten die Erde fest. Dann sahen wir zu, wie sie größer wurden und ihre ersten Blüten und Früchte bekamen. Heute sind diese Bäume sehr groß und alt.
Für mich ist es schön, sie hier zu sehen. Die Bäume sind eine Erinnerung an meine Kindheit im Dorf, aber sie stehen auch für meine eigenen Söhne und Enkel hier und für alle anderen Kinder der Nachbarschaft. In Hipana gibt es keine Beschränkungen, von welchen Bäumen die Kinder Obst ernten dürfen. Sie sollen sich frei bedienen, die eigenen Kinder und die fremden auch. Hipana liegt auf Terra Firme, so wird bei uns der feste Waldboden genannt. Er wird nicht von den Flüssen überschwemmt und eignet sich deshalb für Obstbäume gut. In den kommenden Jahren will ich es wie mein Vater halten und noch viele weitere Obstbäume pflanzen.19
Einige Arten von Obstbäumen müssen wir setzen, andere wachsen von selber draußen im Wald. Sie heißen Patauá, Bacaba oder Açaí do Mato, und jeder darf sich an ihren Früchten bedienen. Du musst bloß wissen, wo diese Bäume stehen, denn die Wege zu ihnen führen quer durch den Wald, also trägt jeder von uns eine Karte mit Obstbäumen in seinem Kopf. Wenn du die Früchte ernten willst, musst du auch wissen, in welcher Woche sie reifen. Bei manchen Sorten ist das nicht leicht.
Der Ucuqui-Baum zum Beispiel ist eine verwickelte Sache. Bei dem irrt man sich oft. In dem einen Jahr hängt er voller Früchte, im nächsten erntest du gar nichts von seinen Ästen. Bei der Uirapixuna ist es ähnlich schwierig und auch beim Uacu. Wenn sie aber Früchte tragen, hat man viel zu schleppen!
Für uns ist es wichtig, alles über das Leben der Obstbäume zu wissen. Wenn die Früchte reif werden, füllt sich der Wald mit Tieren, also ist es ein guter Zeitpunkt für die Jagd. Die Tiere wollen die Früchte essen, auch unsere größte Jagdbeute, der Tapir. Reife Früchte locken viele Vögel an, also kannst du am Flug der bunten Papageien sehen, wie der Zustand der Obstbäume ist.
Ich werde mich ein paar Tage lang in der Hängematte ausruhen. Ich habe sie zwischen den Holzpfosten in diesem Haus befestigt, das ist mein Lieblingsort. Wie du siehst, ist es ausgesprochen gemütlich hier. Links und rechts neben meiner Hängematte laufen Familienmitglieder vorbei, die Frauen, Kinder und Hühner. Von draußen weht der Holzrauch des Herdfeuers herein, weil der Maniokbrei zubereitet wird. Warum sollte mich das beim Schlafen stören? Wir haben immer schon in großen Gruppen von Menschen gelebt.
Die Frauen, die hier die Arbeit verrichten, sind Angehörige meines jüngeren Bruders Eugenio und meines Onkels. Meine Familie hat stets auf dieser Seite des Dorfes gelebt, das Haus meiner Kindheit lag ein paar Schritte von hier. Heute ist davon nichts mehr zu sehen, denn unsere Häuser werden alle paar Jahre neu gebaut. Wir reißen die alten dann ab. Die Sache mit den Häusern ist also ständig im Fluss. Wenn ein Haus gebaut wird, holen wir Holz für die Pfeiler und Streben aus dem Wald. Einige Familien backen selber noch Mauersteine aus Lehm, andere schaffen fertige Steine mit dem Kanu heran, sie kaufen sie in São Gabriel oder Kolumbien. Die Dächer decken wir mit Aluminiumblechen oder Caraná. Die Zweige der Caraná-Palme zu beschaffen ist eine harte Arbeit, aber ich finde, sie lohnt sich sehr. Die Tiere fressen diese Pflanze nicht, und Insekten nisten sich nicht ein. Ein Dach aus Caraná hält bis zu 30 Jahre lang, wenn man es gut pflegt.
Die Familie meines Urgroßvaters hat dieses Dorf begründet, aber damals war das Leben noch anders hier.20 Mein Vater hat uns häufig erzählt, dass es in seiner Kindheit bloß ein einziges großes Langhaus gab, eine Maloca, in der die Familien zusammenwohnten. In der Maloca wurde nicht mal nach Männern und Frauen getrennt, so war es die Sitte in allen Dörfern hier. Dieses Haus war an der Front und der Rückseite mit Holz beschlagen und in bunten Farben bemalt, mit allen Mustern und Zeichen, die für die Huhuteni eine Bedeutung haben. Meine Vorfahren trugen noch keine Bermuda-Badehosen und T-Shirts, sondern Gürtel aus Baumwolle, an denen eine Art Unterhose befestigt war. Für die Männer und die Frauen war es in etwa gleich. Natürlich haben alle ihre Körper bemalt, in roter und schwarzer Farbe, wir trugen solche Bemalungen damals noch jeden Tag.
Als ich sieben oder acht Jahre alt war, lief ich noch splitternackt durchs Dorf. Wir hatten keine Schule und konnten den ganzen Tag lang spielen. Die meiste Zeit haben wir an den Wasserfällen verbracht, sie liegen ja nur wenige Schritte weit weg. Überall im Dorf kannst du ihr Tosen hören. Ich weiß nicht mehr, wie viele Tausende Male ich dort schon ins Wasser gefallen bin! Mit acht Jahren hat man ja noch keine Angst. Aus heutiger Sicht war es ein Glück, dass keiner von uns Jungen gestorben ist. Wir lernten, mit einem Kanu den See oberhalb der Fälle zu überqueren, von einer Seite zur anderen, ohne dass die Strömung uns wegriss. Mir hat das immer viel Spaß gemacht. An einigen Stellen steht das Wasser fast still, und das Boot bewegt sich nicht, also musst du es kräftig mit dem Ruder anschieben. An anderen Stellen erfasst die Strömung das Boot, und du musst mit dem Ruder dagegenhalten. Ein paarmal habe ich mein Kanu auch verloren, dann stürzte es den Wasserfall hinab. Aber ich konnte gut schwimmen und rettete mich an Land.
Na schön, wenn ich mich recht erinnere, bin ich schon zusammen mit dem Kanu hinabgestürzt, und mein Jugendfreund Plinio auch. Es ist schwierig, über ein Boot die Kontrolle zu behalten, wenn mitten in der Strömung das Ruder bricht. Aber am Wasserfall passten mein Vater und mein Großvater auf uns auf. »Seid vorsichtig«, riefen sie jedes Mal. »Das ist ein Wasserfall und kein Kinderspiel! Da sind schon viele zu Tode gekommen!«
Wir waren jung und nahmen nichts davon ernst. Wir wussten ja auch, dass mein Großvater, mein Onkel und mein Vater alle Arten von Verletzungen wieder richten konnten. Einmal ist ein Junge, der zehn Jahre alt war, beim Klettern aus dem Abiu-Baum auf den Dorfplatz gestürzt. Phommm! hat es da gemacht. Von oben aus der Spitze ist er herabgefallen, und alle im Dorf haben den Aufprall gehört. Wir rannten herbei, und der Junge lag einfach da, er schien tot zu sein. Mit einem Schwall kaltem Wasser haben wir ihn wieder aufgeweckt. Seine Beine waren hässlich gebrochen, die Knochen traten an beiden Oberschenkeln durch die Haut, auch sein Arm stand in einem fürchterlichen Winkel ab.
Mein Vater versammelte uns Kinder und sprach mit uns. Er gab uns Maniokbrei und fragte, wie das passieren konnte. Er erklärte uns, wie wir die Äste beim Klettern besser anfassen können und dass wir immer noch einen zweiten Ast greifbar haben sollen. Dann hat mein Vater mit den anderen zwei Alten zusammen die Formeln gesprochen. Sie haben den Jungen in eine Hütte weit weg vom Dorf getragen, damit sie mit ihm allein sein konnten, und da haben sie die Knochen wieder gerichtet. Gegen die Schmerzen bereiteten sie Kräuter und Schalen der Brotfrucht zu. Sie bestrichen den ganzen Körper mit Brennnesseln, damit der Schmerz auf der Haut zu spüren war und nicht mehr nur in den Beinen. Nach einem Monat lief unser Freund wieder langsam herum, aber den Baum haben die Alten gefällt. Sie haben seine Früchte der Familie des verunglückten Jungen gebracht.
Einmal bin ich selber schwer erkrankt, mir steckte ein Pfeil in der Brust. Es war kein Pfeil von der gewöhnlichen Art, so wie ein Jäger ihn mit seinem Bogen schießt. Mich hatte ein Dornenpfeil getroffen, wie ihn die Zauberer schicken. Ich war etwa 15 Jahre alt und fühlte mich schon drei Tage lang schlapp. Da sah ich im Traum einen Mann mit Pfeil und Bogen, er schoss auf mich, und ich spürte den Schmerz in meiner Brust. Am nächsten Tag fiel mir das Atmen schwer, und ich begann mich zu übergeben. Damals floss aus meinem Magen viel Blut, und ich kann noch hören, wie meine Mutter geschrien hat. Dreimal hat mein Vater versucht, die Krankheit aus mir herauszusaugen, aber dann rief er meinen Onkel herbei. Bei seinem eigenen Sohn erreicht einMalirinicht viel. Die Alten haben viel Pariká genommen, mein Onkel und mein Vater, und am Ende zogen sie gemeinsam den Dornenpfeil aus mir heraus.
Mein Vater ging häufig zur Jagd, und ich lief hinterher. Die Jagdausflüge gefielen mir gut. In unserer Gegend gibt es keine Gefahren im Wald, also kann schon ein Kind in Ruhe alles erkunden und sich umschauen gehen. Das einzige Tier, das einem Menschen gefährlich wird, ist der Jaguar. Natürlich ist auch die Vipernschlange Jararaca ein Problem. Mein Großvater hat mich außerdem noch vor dem Curupira gewarnt, aber so ein Curupira ist mir nie begegnet. Er ist wohl gar kein richtiges Tier, eher ein Geisterwesen im Wald, ein Zauber, ich weiß bis heute nicht genau, was er ist. Jetzt fragst du mich, wie man im Wald solchen Gefahren entgeht? Das ist nicht schwierig, lauf einfach vorsichtig, pass ein bisschen auf.
Wenn du zum Beispiel einer Klapperschlange begegnest, ist es gut, wenn du es rechtzeitig bemerkst. Eine Klapperschlange kann sich aufrichten und dich auf der Höhe der Hüfte zu packen kriegen. Dann beißt sie viele Male hintereinander zu. Gegen die Klapperschlange haben wir keine Medizin, kein Volk hier am Ayari kann den Biss einer Klapperschlange heilen. Ich habe aber lange nicht mehr davon gehört, dass jemand von einer Klapperschlange getötet worden ist. Bei den Verwandten, die an Schlangenbissen sterben, ist normalerweise eine Jararaca schuld. Mein Bruder zum Beispiel ist von der Jararacagetötet worden, ganz in der Nähe hier. Sie hat ihn auf einem Jagdausflug gebissen, und zwei Tage später lebte er nicht mehr.
Mein Vater wusste damals noch nicht, wie man einen Jararaca-Biss heilt, und mit dem Boot braucht man viele Tage bis in die Stadt. In dieser Zeit waren die Malirinai unsere einzigen Ärzte, und mein Vater arbeitete als Heiler und Häuptling zugleich. Es gab keine Krankentransporte mit Schnellbooten und Helikoptern, keine Leute vom Gesundheitswesen, die dich holen kommen, wenn du sie mit einem Funkgerät rufst. Wenn jemand von einer Schlange gebissen wurde oder einen Unfall erlitt, gab es nur die Malirinai. Es war eine schwierige Zeit. Nachdem mein Bruder gestorben war, holte mein Vater Erkundungen ein. Später hat er in einem Nachbardorf einen guten Vorrat an Pflanzen gegen den Jararaca-Biss gekauft.
Wir haben hier immer gut gelebt. Der Wald hing voller Früchte, und wer einen Fisch essen wollte, fing sich einen mit dem Speer, dem Köcher oder der Schnur. Im Ayari kommen nicht besonders viele Fische vor, denn die Flüsse führen in dieser Gegend schwarzes Wasser. Trotzdem waren früher immer genug Fische für alle da. So war es auch mit den Tieren im Wald. Es gab nicht viele, aber sie reichten für uns aus.
Mein Vater hat mir beigebracht, wie man Tiere jagt. Du solltest dir das aber nicht wie einen Schulunterricht vorstellen. Er hat mir nicht viel erklärt und gezeigt, ich habe mir alles abgeschaut. Ich lernte, wie man im Wald die richtigen Orte findet und wie man die Pfade mit einer Machete freischlägt, wenn sie zugewachsen sind. Erst schaut man sich bei seinem Vater alles ab, und später bewältigt man das Jagen allein.
Irgendwann weißt du selber, an welchen Orten du die Tiere aufspüren kannst. Dann jagst du sie mit Pfeil und Bogen, obwohl das meiner Meinung nach etwas für Opas ist, schon mein Vater hat lieber die Flinte benutzt. Ein Blasrohr voll giftiger Pfeile ist etwas anderes, damit jage ich bis heute gern.
An manchen Tagen schießt du eine Beute, an anderen Tagen nicht. Manchmal erwischst du ein großes Tier, manchmal nur einen kleinen Vogel Inambú. Wir Brüder schwärmten einfach aus, die einen jagten, die anderen fischten, und irgendwer brachte immer etwas heim. Meine Mutter war anfangs besorgt, wenn ich über Nacht im Wald zum Jagen blieb, aber mein Vater hat sich nie Sorgen gemacht. »Unser Sohn weiß, wohin er im Wald gehen muss«, beruhigte er unsere Mutter. »Er hat sich noch nie verlaufen. Vielleicht hat er ein Wildschwein angeschossen, und es will nicht sterben. Dann muss er ihm einen weiten Weg lang folgen, bis das Tier müde wird.«
Bei der Jagd wird ein Huhuteni von einem Kind zu einem Mann. Ich war schon frühzeitig gut darin, mir eine Taschenlampe an den Kopf zu binden und auf die Pakas am Uferrand zu zielen. Das Licht stört diese Tiere nicht, sie laufen nicht so leicht weg, sodass die Jagd mit der Taschenlampe ganz einfach ist. Ich schieße am liebsten Pakas und würde sagen, dass das meine Spezialität geworden ist. Ein Wildschwein habe ich nur sehr selten erlegt.
Für den Abend habe ich deine Hütte zurechtgemacht und den Boden gefegt. Im Lehmboden waren ein paar Löcher, die habe ich aufgefüllt und festgetreten, sicherheitshalber, damit sich keine Tiere darin verstecken. Das Dach ist noch dicht, und an den Holzpfosten kannst du deine Hängematte aufknüpfen. Dies ist jetzt dein Haus, es ist ein gutes Haus. Es steht nah an der Klippe, also siehst du den Fluss und die Wasserfälle. Schüttele deine Schuhe aus, bevor du sie anziehst, denn manchmal klettern Skorpione hinein. Denk an die Tucandera-Ameisen und sei vorsichtig, wenn du nachts im Wald deine Hose ausziehst.
Von diesem Haus aus kannst du viel mitbekommen, weil es gleich am Dorfeingang steht. Du wirst jeden sehen, der mit seinem Boot unten anlegt und die Klippe hochsteigt, sie laufen alle bei dir vorbei. Wenn du ins Dorf gehst und nach rechts abbiegst, siehst du die Häuser, die meinen Verwandten gehören. Wir sind alle eine Familie hier. Wenn du nach links abbiegst, kommst du zu den Häusern meiner entfernteren Verwandten, auch ein paar Zugezogene von flussaufwärts wohnen hier.
Wie du siehst, wohnen die Familien alle in einzelnen Häusern. Wir sind nicht mehr wie früher in eine Maloca gepfercht, die katholischen Patres haben vieles verbessert. Sie haben uns so viel beigebracht! Die Patres erklärten, dass wir in kleineren Häusern leben sollten, so wie sie heute hier stehen. Sie haben uns gezeigt, wie man einen großen rechteckigen Dorfplatz anlegt, und sie haben aus Holz ein großes Kreuz und die Kapelle am Dorfplatz errichtet. Wir streichen sie jedes Jahr frisch mit weißer und blauer Farbe an. Gegenüber der Kapelle steht die Dorfschule, aber sie ist eigentlich nur ein Haus, das zwei große Zimmer für den Unterricht hat. Das größte Gebäude am Dorfplatz ist das Langhaus, in dem wir uns alle treffen.
Als die ersten Missionare kamen, führten sie auch die Kleider ein. Ich glaube, dass die Patres irgendwo ein Lager voller Kleider hatten, jedenfalls brachten sie große Mengen Sachen zum Anziehen mit. Hier im Dorf wurden sie für jeden zurechtgenäht und passend gemacht. Sie brachten Kleider für Erwachsene und Kinder, in unterschiedlichen Farben, und am Ende bekam jeder von uns vier oder fünf Kleidungsstücke. Die Patres verkauften diese Kleider nicht, sondern alles wurde verschenkt. Also haben wir die Kleider sehr gemocht.
Es dauerte aber lange, bis wir die Kleider auch angezogen haben. Wir waren ja nicht daran gewöhnt. Vor allem mit den Hosen blieb es schwierig, und bis heute finden einige meiner Verwandten Hosen unbequem. Die Patres sagten, dass wir von nun an immer Hosen tragen sollten, und die meisten im Dorf stimmten ihnen zu. Unser damaliger Häuptling, mein Großvater, war der gleichen Meinung wie die Missionare.
Ich erinnere mich noch daran, dass es gejuckt hat, Kleider zu tragen. Außerdem war es sehr warm. Hosen trocknen nicht gut, wenn man damit aus dem Wasser steigt. Deshalb haben wir in der ersten Zeit die Kleider wieder ausgezogen und auf den Boden geworfen. Aber wenn Pater José21 mit seinem Kanu zu uns kam, kontrollierte er streng die Kleiderfrage, und irgendwann gewöhnten wir uns daran. Nur mein Großvater22, der Häuptling, hatte bis zum Ende keine Lust auf die Kleider. Als ich vielleicht zehn Jahre alt war, sagte er zu mir: »Verdammt noch mal, mein Enkel, dieser Pater José bringt uns ein besseres Leben, aber das ist etwas für euch junge Leute und nichts mehr für mich.«
Irgendwann haben die Patres ihm einen großen Bademantel mitgebracht, weil er ja der Häuptling war. So einen hatte sonst keiner im Dorf. Den Bademantel hat mein Großvater dann immer getragen, und an den Sonntagen, zum Gottesdienst in der Kapelle, zog er sich darunter sogar eine Hose an. Allmählich haben wir uns unserer alten Kleidung, der Gürtel mit der Unterhose dran, geschämt.
Die Patres brachten Bücher nach Hipana, in denen wir sehen konnten, wie das Leben in Brasilien war. Sie erzählten uns von Tiradentes, einem Widerstandskämpfer aus Minas Gerais. Er kämpfte für die Unabhängigkeit gegen die Portugiesen, aber er hatte keinen Erfolg damit, und sie haben ihn getötet. Die Patres hängten Plakate auf, die zeigten, wie man bessere Pflanzen heranziehen kann: Reis, Bohnen und Gemüse, aber das hat bei uns nie gut funktioniert. Wir lernten von ihnen, dass es Wasserklos gibt und dass man sie in der Stadt benutzt. Ich erwähne das, weil dich die Toilettenfrage interessiert. Ihr Weißen grabt nicht gerne Löcher im Wald, das muss eine kulturelle Sache sein. Keiner bei uns kann das verstehen.