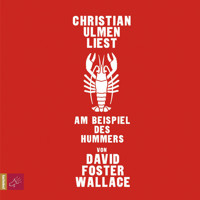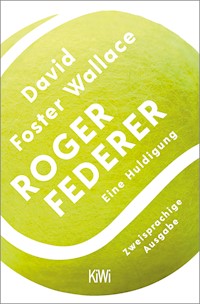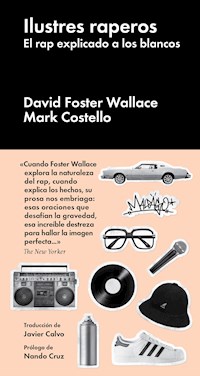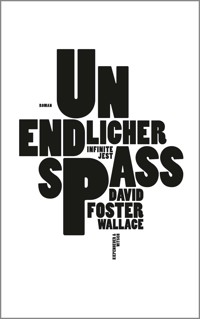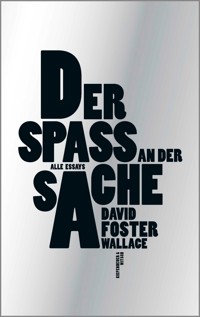
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Eine Kompetenzgranate mit Dauerzündung, die unterhalten, aber nicht unterfordern will« Ulrich Blumenbach. Zum zehnten Todestag des wichtigsten amerikanischen Autors seiner Generation erscheinen alle Essays in einem Band. Gerade die Essays und Reportagen sind für viele Kritiker und Leser Wallace' Königsdisziplin, und in dieser nach Themen geordneten Anthologie sind seine Beobachtungsschärfe und sprachliche Brillanz neu zu entdecken. Neben Romanen und Erzählungen hat David Foster Wallace immer auch Essays geschrieben, mal im Auftrag von Zeitschriften und Zeitungen, mal für Sammlungen. Zu den bekanntesten gehört sicherlich »Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich«, sein berühmter Text über die Reise auf einem Kreuzfahrtschiff, und »Das hier ist Wasser«. Dieses monumentale Buch versammelt alle Sachtexte des großen amerikanischen Autors. Ulrich Blumenbach, der längst zur deutschen Stimme Wallace' geworden ist, hat die Essays in diesem finalen Band nach Themengebieten geordnet: Von Tennis über Ästhetik, Sprache & Literatur, Politik, Film & Fernsehen, die Unterhaltungsindustrie und Leben & Liebe reicht die Bandbreite. So ist Wallace in all seiner Brillanz in diesen höchst unterhaltsamen und klugen Texten aufs Neue zu entdecken und zu bewundern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1840
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
David Foster Wallace
Der Spaß an der Sache
Alle Essays
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über David Foster Wallace
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über David Foster Wallace
David Foster Wallace, 1962 geboren, gilt als einer der wichtigsten Vertreter der amerikanischen Literatur. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. »Unendlicher Spaß«, »Kurze Interviews mit fiesen Männern«, »Der Besen im System« und »Der bleiche König«. David Foster Wallace starb am 12. September 2008.
Ulrich Blumenbach lebt als freier Übersetzer in Basel. Für die Übertragung von Wallace’ Roman »Unendlicher Spaß« wurde er u.a. mit dem Hieronymus-Ring, dem Übersetzerpreis der Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Stiftung und dem Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Er übersetzte außer zwei Reportagen alle Texte aus dem vorliegenden Band, erarbeitete das Konzept, schrieb das Vorwort und verfasste die Anmerkungen.
Marcus Ingendaay studierte nach dem Abitur Anglistik, Germanistik und Theaterwissenschaften an den Universitäten in Köln und Cambridge. Er lebt als freier Schriftsteller und Übersetzer in München. Er erhielt 1997 den Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis sowie 2000 den Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis. Aus diesem Band übersetzte er »Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich« sowie »Am Beispiel des Hummers«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Neben Romanen und Erzählungen hat David Foster Wallace immer auch Essays geschrieben, mal im Auftrag von Zeitschriften und Zeitungen, mal für Sammlungen. Zu den bekanntesten gehört sicherlich »Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich«, sein berühmter Text über die Reise auf einem Kreuzfahrtschiff, und »Das hier ist Wasser«. Dieses monumentale Buch versammelt alle Sachtexte des großen amerikanischen Autors. Ulrich Blumenbach, der längst zur deutschen Stimme Wallace’ geworden ist, hat die Essays in diesem finalen Band nach Themengebieten geordnet: Von Tennis über Ästhetik, Sprache & Literatur, Politik, Film & Fernsehen, die Unterhaltungsindustrie und Leben & Liebe reicht die Bandbreite. So ist Wallace in all seiner Brillanz in diesen höchst unterhaltsamen und klugen Texten aufs Neue zu entdecken und zu bewundern.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Vorwort: Eine Kultur im Selbstgespräch
Tennis
Sportableitungen in der Tornado Alley
Wie Tracy Austin mir das Herz brach
Die professionelle Kunst des Tennisspielers Michael Joyce als Paradigma für allerlei Kram über Individualität, Freiheit, Grenzen, Freude, Groteskes und menschliche Vollkommenheit
Demokratie und Geschäft bei den US Open
Federer aus Fleisch und nicht
Ästhetik, Sprache und Literatur
Fiktionale Zukünfte und die dezidiert Jungen
Das leere Plenum: David Marksons Wittgensteins Mätresse
Maßlos übertrieben
E Unibus Pluram: Fernsehen und Literatur in den USA
Führ dich natürlich auf
Der Finger
Metafernsehen
Schuldbewusste Fiktionen
Ich habe durchaus eine These
Image-Fiction
Die Aura der Ironie
Am Ende der Endstation
Herr Cogito
Joseph Franks Dostojewski
Bestimmt das Ende von Etwas, sollte man doch quasi meinen
Ein paar Bemerkungen zu Kafkas Komik, wahrscheinlich ein paar zu viel
Der Spaß an der Sache
Übersehen: Fünf übel unterschätzte Romane aus den USA > 1960
Rhetorik und das Mathemelodram
Autorität und amerikanischer Sprachgebrauch
HAUPTTHESE DIESES ESSAYS
ANSCHLUSSTHESE ZUR HAUPTTHESE DIESES ESSAYS
*ZUSATZBEISPIEL DER ANWENDUNG DESSEN, WAS DIE HAUPTTHESE DIESES ARTIKELS DEMOKRATISCHEN GEIST NENNT, AUF EIN POLITISCH ÄUSSERST AUFGELADENES PROBLEM, DAS MIT GARNERS ADMAU WEIT MEHR ZU TUN HAT, ALS MAN AUF DEN ERSTEN BLICK MEINEN WÜRDE
*ZUSATZPOTENZIELL DESKRIPTIVISTISCH AUSSEHENDES BEISPIEL GRAMMATISCHER VORZÜGE EINER NICHTSTANDARDSPRACHE, DIE DER REZENSENT TATSÄCHLICH AUS ERSTER HAND KENNT
BEISPIEL DAFÜR, DASS BEGRIFFE WIE RHETORIK, DIALEKT UND GRUPPENZUGEHÖRIGKEIT EINIGE SCHLACHTEN IN DEN AKTUELLEN SPRACHGEBRAUCHSKRIEGEN ERKLÄREN KÖNNEN
NOCH EIN GEBRAUCHSKRIEGEBEZOGENES BEISPIEL, DIESMAL MIT BESONDERER BETONUNG AUF DIALEKT ALS EINEM VEKTOR DER SELBSTDARSTELLUNG MITTELS HÖFLICHKEIT
*ZUSATZ
†ZUSATZ
ZWICKMÜHLE DES ESSAYS: WARUM BRYAN A. GARNER EIN GENIE IST (I)
WARUM BRYAN A. GARNER EIN GENIE IST (II)
WARUM BRYAN A. GARNER EIN GENIE IST (III)
BONUS-OFFENLEGUNG DER QUELLEN VON ALLERLEI FORMULIERUNGEN IN DIESEM ESSAY, DIE IN ANFÜHRUNGSZEICHEN STEHEN ODER GEHÖREN
Die besten Prosagedichte
Vierundzwanzig Wortglossen
Borges auf der Couch
Entscheiderisierung 2007 – ein Sonderbericht
Politik
Hoch, Simba
FAKULTATIVES VORWORT
WEN ES JUCKT
GLOSSAR RELEVANTER WAHLKAMPFTOURBEGRIFFE, MEHRHEITLICH JIM C. UND DEN NETWORKNACHRICHTENTECHNIKERN ZU VERDANKEN
DEUTLICH WEITER HINTER DEN KULISSEN, ALS IHNEN VIELLEICHT LIEB WÄRE
WEN ES JUCKT, OB ES EINEN JUCKT
NEGATIVITÄT
ZÄHNE ZUSAMMENBEISSEN
Von Mrs Thompsons Warte
SYNEKDOCHE
MITTWOCH
LUFT- UND BODENAUFNAHMEN
DIENSTAG
Ich frag ja bloß
Film, Fernsehen und Radio
David Lynch bewahrt kühlen Kopf
1. Welchen Film dieser Essay behandelt
2. Wie David Lynch wirklich ist
3. Unterhaltungen, bei denen David Lynch mitgewirkt und/oder Regie geführt hat und die in diesem Essay erwähnt werden
4. Weitere universalgeniale Taten
5. Schwerpunkt oder »Blickwinkel« dieses Essays in Bezug auf Lost Highway, (nicht besonders subtil) nahegelegt von gewissen Redaktionseminenzen bei Premiere
6. Worum es in Lost Highway zu gehen scheint
7. Das letzte Stück von (6) als Überleitung zu einer kurzen Skizze von Lynchs Genese als heroischer auteur
6a. Worum es in Lost Highway – nach Drehbuch und Rohschnittmaterial – etwas genauer zu gehen scheint
6b. Grob geschätzte Zahl potenzieller Deutungsansätze für Lost Highway
8. Was lynchesk bedeutet und warum das wichtig ist
9. Der Einflussbereich des Lynchesken im zeitgenössischen Kino
9a. Eine bessere Formulierung für das, was ich gerade sagen wollte
10. Zur Frage, ob und inwiefern David Lynchs Filme »pervers« sind
11. Das letzte Stück von (10) als Überleitung zu der Frage, was genau David Lynch von Ihnen wollen könnte
12. Eine eher nichtige Szene von Lost Highway, bei der ich zufällig am Set war
13. Was verschiedene Mitglieder von Team und Produktionsstab, die teilweise Filmakademien besucht haben, über Lost Highway zu sagen haben
14. Abschnitt, der eine Mischung von Extrapolationen aus anderen Abschnitten darstellt, für die sich keine einheitliche Überschrift finden ließ
15. Addendum zu (14) betr. Lynch und Rasse
16. Patricia Arquettes Beschreibung des größten Problems für Bill Pullman und Balthazar Getty betr. der »Motivation« des metamorphotischen Protagonisten von Lost Highway (der, wenn er Bill Pullman ist, »Fred« heißt und »Pete«, wenn er Balthazar Getty ist)
11a. Warum das, was David Lynch von Ihnen will, gut sein könnte
17. Der einzige Teil dieses Essays, der tatsächlich einen »Blick hinter die Kulissen« bietet
9a. Die Kinotradition, der Lynch entstammt, was komischerweise keiner gemerkt hat (mit Motto)
10a. (mit Motto)
Die (gewissermaßen) fruchtbare Bedeutung von Terminator 2
Moderator
(1)
(2)
(3)
(4)
Unterhaltungsindustrie
Hinter sich lassen, was man schon ganz schön weit hinter sich hat
Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Der große rote Sohn
Am Beispiel des Hummers
Leben
Neues Feuerspeien
Das hier ist Wasser
Personen- und Sachanmerkungen
Danksagungen
Nachweis der Erstveröffentlichungen
Ulrich Blumenbachs Übersetzungen für das vorliegende Buch wurden mit mehreren Unterstützungsbeiträgen der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia gefördert.
Marcus Ingendaay übersetzte die Reportagen »Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich« und »Am Beispiel des Hummers«, die anderen Übersetzungen stammen von Ulrich Blumenbach.
Vorwort: Eine Kultur im Selbstgespräch
Zu den Essays von David Foster Wallace
David Foster Wallace war als Journalist berühmt und berüchtigt. Berüchtigt bei den Herausgebern und Redakteuren der Zeitschriften, für die er schrieb, weil er sämtliche Längenvorgaben gnadenlos überschritt und hinterher jedes Wort mit Zähnen und Klauen verteidigte. Berühmt bei der Leserschaft wegen seiner adrenalinintensiven Kickstartprosa und bei seinen Kollegen und Kolleginnen aus Journalismus und Literatur, für die er die Latte des New Journalism oder Gonzo-Journalismus immer höher legte.[1] Wallace begleitete Senator John McCain im Präsidentschaftswahlkampf des Jahres 2000, wie Hunter S. Thompson amerikanische Wahlen in Fear and Loathing in Las Vegas (1971) und Joan Didion in After Henry (1992) verfolgt hatten.[2] Wie die New Journalists praktizierte Wallace eine subjektivere, experimentellere und literarischere Herangehensweise an seine Themen als traditionelle Journalisten.
Wie kam Wallace dazu, Essays und Reportagen zu schreiben? Nach einem depressiven Absturz in Harvard verbrachte er das erste Halbjahr 1990 in Granada House, einem Rehazentrum im Bostoner Stadtteil Brighton für Süchtige im Entzug. Er absolvierte eine Therapie und besuchte Selbsthilfegruppen der Anonymen Alkoholiker. Der Besen im System, sein erster Roman, war drei Jahre zuvor erschienen, und nach monatelangen juristischen Querelen wegen wörtlicher Zitate aus David Lettermans Late-Night-Show war im August 1989 endlich auch der Erzählungsband Kleines Mädchen mit komischen Haaren herausgekommen. Eigentlich wollte Wallace weiter Belletristik schreiben, fühlte sich nach seinem Zusammenbruch aber »noch zu verletzlich, um einen Vorstoß auf einem Gebiet zu wagen, das für sein Wohlergehen so wichtig war«, wie sein Biograf schreibt[3], und verlegte sich daher auf Essays und Rezensionen. Gesellenstücke im nicht literarischen Schreiben hatte er schon vorgelegt: Die ästhetische Programmschrift »Fiktionale Zukünfte und die dezidiert Jungen« war 1988 in der Review of Contemporary Fiction erschienen, Signifying Rappers, das gemeinsam mit Mark Costello geschriebene Buch über Rap, lag vor, auch wenn es erst im November 1990 erscheinen sollte, und schon in der Sommerausgabe der Review of Contemporary Fiction erschien 1990 der lange Rezensionsessay »Das leere Plenum« über David Marksons Roman Wittgensteins Mätresse. Wallace erlangte sein psychisches Gleichgewicht zurück, fand wieder Lust am Schreiben, veröffentlichte im Dezember 1991 in Harper’s Magazine den autobiografischen Essay »Sportableitungen in der Tornado Alley« und ein Dreivierteljahr später im August 1992 »Rabbit Resurrected«, eine leider nie in Buchform nachgedruckte Parodie auf den Stil der Rabbit-Romane von John Updike. Mit diesen Texten hatte er die Redakteure von Harper’s endgültig für sich gewonnen, und als man in der Redaktion von Wallace’ Umzug nach Bloomington erfuhr, wo er im Sommer 1993 eine Stelle an der anglistischen Fakultät der Illinois State University antrat, fragte man an, ob er nicht Lust habe, eine Reportage über die große Landwirtschaftsmesse in Springfield, der Hauptstadt von Illinois, zu schreiben. Mit der Veröffentlichung von »Hinter sich lassen, was man schon ganz schön weit hinter sich hat« in Harper’s im Juli 1994 begann Wallace’ Glanzzeit als Journalist, wohlgemerkt vor seinem großen Ruhm als Romancier, denn auch die Kreuzfahrtreportage »Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich« erschien, bevor die Veröffentlichung des Romans Unendlicher Spaß Wallace 1996 zum Star des literarischen Amerika machte.
Was motivierte die Essays und Reportagen von David Foster Wallace? Welche Schreibhaltung stand hinter seinen Texten? Der Autor ging dorthin, wo es ihm wehtat: auf die Kreuzfahrt, auf der ihn der saturierten Menschheit ganzer Jammer anfasste, auf eine Pornografiemesse (»Der große rote Sohn«) und zu Hasspredigern im Rundfunk (»Moderator«). In den Texten, in denen er seine Eindrücke festhielt und seine Erfahrungen reflektierte, bestätigte er dann aber weder seine – so heimlichen wie ausgesprochenen – Vorurteile, noch klopfte er sich im Bewusstsein seiner intellektuellen und moralischen Überlegenheit auf die Schulter. Er fragte sich vielmehr: Wie weit kann ich mich diesen kulturellen Fremdartigkeiten aussetzen? Bis wohin mache ich mit, und wann wird eine Schmerzgrenze überschritten? Wallace lehnte es ab, sich mit postmoderner Ironie gegen die Zumutungen seiner Lebenswelt abzuschotten. Gegen diesen Sicherheitsabstand des Denkens suchte sein ästhetisches Sensorium vielmehr immer wieder die Konfrontation mit diesen Zumutungen. Mit dem Gestus, aus peinlich und peinigend genauen Selbstbeobachtungen Suchbewegungen ins Allgemeine abzuleiten, knüpfte er an Michel Montaigne als den Begründer des modernen Essays an. Bei Wallace findet man die »Kultur im Selbstgespräch«, von der er in »Hinter sich lassen, was man schon ganz schön weit hinter sich hat« spricht. Seine Essays sind Hirnschrittmacher, in denen die ganze US-amerikanische Gegenwartskultur zur Sprache und mit sich ins Gespräch kommt. Wallace konnte dem Sog des Verbotenen erst nachgeben und ihm dann analytisch nachspüren: dass – und warum – der konservative Politiker John McCain mit seinem Versprechen von Wahrheit und Ehrlichkeit im Wahlkampf verführerisch auch für ihn war; dass – und warum – die Provinzialität einer Landwirtschaftsmesse im Mittleren Westen und die bildungsfernen Amerikanerinnen, mit denen er am 11. September 2001 vor dem Fernseher saß (»Von Mrs Thompsons Warte«), eine Vertrautheit hatten, die auch ihm Zugehörigkeit, ja Geborgenheit vermittelte. Das machte ihn zu einem Solitär in der Literaturlandschaft der Neunzigerund Nullerjahre. Seine Kolleginnen und Freunde, in aller Regel linksliberale Autoren und Autorinnen beider Küsten, hätten wohl stärker betont, dass die programmatischen Äußerungen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten McCain zu Waffenbesitz, zur Abtreibung und zum Kampf gegen Drogen furchterregend waren. Wallace war aber kein Ost- oder Westküstenintellektueller traditionellen Zuschnitts, sondern politisch ein Konservativer, der Ronald Reagan gewählt und Ross Perot unterstützt hatte. Er kam aus dem Mittleren Westen, ›dem Herzen des Herzen des Landes‹, wie das bei William H. Gass hieß, und er hatte ein anderes Anliegen: Er wollte Befindlichkeiten und Mentalitäten verstehen und auf den Begriff bringen, er wollte herausfinden, warum Amerikaner tickten, wie sie tickten. Er wollte herausfinden, wie er selber tickte.
In der Zusammenstellung aller seiner Essays lässt sich die Entwicklungsgeschichte von Wallace’ Denken und Schreiben nachvollziehen: Hatte er in seiner zweiten Programmschrift »E Unibus Pluram« 1993 noch diagnostiziert, die Erzählverfahren des Fernsehens hätten eine ästhetische Krise der amerikanischen Literatur verursacht, so kam er in seinen Werken ab dem Unendlichen Spaß zu dem 2005 in »Das hier ist Wasser« kulminierenden Befund, sie stecke in einer moralischen Krise. Entsprechend änderte sich sein Selbstverständnis als Schriftsteller: Am Anfang seiner Tätigkeit ging es ihm vor allem darum, die beiden Hauptströmungen der zeitgenössischen Literatur zu verabschieden, den Minimalismus Carver’scher Provenienz und den metafiktiven Postmodernismus in der Nachfolge von Thomas Pynchon, Robert Coover und John Barth. Die scheppernden Adepten beider Richtungen hatten seiner Meinung nach deren Innovationspotenzial ausgeschöpft und bedienten nur mehr neue Konventionen. Am Ende seines Lebens dagegen wollte Wallace mit avancierten literarischen Mitteln ein traditionelles Ziel erreichen: Er hatte eine Botschaft. Hal Incandenza, einer autobiografischen Hauptfigur von Unendlicher Spaß, legte er das Postulat in den Mund, »dass das, was sich als hippe zynische Transzendenz des Gefühls ausgibt, in Wahrheit Furcht vor dem echten Menschsein ist«.
Furcht, Einsamkeit und vor allem »die wahre Traurigkeit der Erwachsenen«, die er in »Sportableitungen in der Tornado Alley« schon früh auf den Begriff bringt, sind Leitmotive von Wallace’ Werk. Pornografie ist traurig: »… ein Großteil der kalten, toten, mechanischen Qualität pornografischer Filme ist auf die Gesichter der Darsteller zurückzuführen« (»Der große rote Sohn«). Politik ist traurig: »Moderne Politiker machen uns traurig, tief in uns drin verletzen sie uns auf eine Art und Weise, die sich kaum greifen, geschweige denn beschreiben lässt« (»Hoch, Simba«). Urlaube sind traurig: »Alle diese Kreuzfahrten umgibt etwas unerträglich Trauriges« (»Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich«). Und selbst Tennis ist traurig, die Sportart, die Wallace selbst ausgeübt hatte und über deren Turniere und Stars er immer wieder lange Reportagen schrieb: »Meine Erfahrung der Canadian Open und ihrer Spieler beinhaltete sehr viel Traurigkeit« (»Die professionelle Kunst des Tennisspielers Michael Joyce als Paradigma für allerlei Kram über Individualität, Freiheit, Grenzen, Freude, Groteskes und menschliche Vollkommenheit«).
Die Fragen, wie sich Furcht und Traurigkeit überwinden ließen und wie man über das ›echte Menschsein‹ schreiben könne, ohne eskapistische Fantasien zu liefern oder bloße Satiren auf die heutige Condition humaine zu verfassen, beschäftigten den Autor sein Leben lang. In »Das hier ist Wasser«, der Abschlussrede vor Absolventen des Kenyon College, sagte er 2005: »Die wirklich wichtige Freiheit erfordert Aufmerksamkeit und Offenheit und Disziplin und Mühe und die Empathie, andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, auf unendlich verschiedene Weisen, völlig unsexy, Tag für Tag.« Wallace wurde gelegentlich vorgeworfen, in dieser Rede mit Bleifuß auf dem Moralpedal zu stehen, aber seine Argumentation läuft auf eine Ethik des gesunden Menschenverstands hinaus. Der mit allen Wassern der Philosophie gewaschene Autor entwarf keine hochgezwirbelte Moraltheorie, sondern versuchte, die Frage zu beantworten, wie Menschen bestmöglich zusammenleben können. Diese Grundhaltung durchzieht seine Essays und kann in verblüffenden Zusammenhängen wieder auftauchen, wenn etwa in »Autorität und amerikanischer Sprachgebrauch« der Gedanke laut wird, korrekter Sprachgebrauch habe einen ethischen Aspekt: »Es ist einfach eine Frage der ›Rücksichtnahme‹, schriftsprachliche Regeln zu befolgen … wie es auch eine Frage der ›Rücksichtnahme‹ ist, die eigene Wohnung zu entsiffen, bevor man Gäste empfängt, oder sich die Zähne zu putzen, bevor man zu einem Date aufbricht.«
Wallace’ Essays zeichnen sich ebenso wie seine Romane und Erzählungen durch ihre stilistische Vielfalt aus. Er ist ein Polyphönix, der die Literaturfähigkeit des Alltäglichen sieht – »soll eine Nachtigall nicht singen dürfen, was die Spatzen von den Dächern pfeifen?«[4] –, es aber auch in Umgangssprache bis hin zum Slang abbilden kann. Das anschaulichste Beispiel ist vielleicht die ›Eingeborene Begleiterin‹ in der Messereportage – vorgeblich eine alte Highschool-Liebschaft, faktisch Kymberly Harris, die Tochter von Freunden in Bloomington –, die ihre Fahrt im Zipper, einer Art »Riesenrad auf Amphetaminen«, mit den Worten »Mann, am Ende hab ich echt gedacht, ich geh hops, so geil war das. Diese Wichser« kommentiert und ihren Begleiter, den ängstlichen Autor, mit den Worten »Heul doch, Herzchen« abfertigt.
Politische, ästhetische, ethische und allgemein kulturelle Fragen werden in den Essays oft zugänglicher, persönlicher und verspielter behandelt als in Wallace’ im herkömmlichen Sinn literarischen Werk. Dieses ludische Element lässt ihre Themen aber nicht verludern. Wallace war eine Kompetenzgranate mit Dauerzündung, die unterhalten, aber nicht unterfordern wollte. Das unterscheidet ihn von den Verdummungsstrategen der Spaßgesellschaft, die er in immer neuen Anläufen kritisierte. Niklas Luhmann schrieb einmal, Verständlichkeit dürfe kein Prinzip sein, das etwas verhindert, was gesagt werden kann[5]. Nach dieser Maxime mutet Wallace seinen Lesern und Leserinnen auch präzisionsfrenetische Satzgebilde und philosophische Höhenflüge zu wie die Entfaltung von Wittgensteins Argument der Unmöglichkeit von Privatsprachen in einer schädel- und satzspiegelsprengenden Fußnote in »Autorität und amerikanischer Sprachgebrauch«. Dann wieder gibt es naturlyrische Schilderungen wie die aus dem Pressebus beobachtete Landschaft von South Carolina in »Hoch, Simba« – ein Wahrnehmungsrausch, der an das Prosagedicht am Anfang vom Bleichen König erinnert.
Die Eingängigkeit von Wallace’ essayistischer Prosa, seine Stilmaxime, sang- und sagbar zu machen, was gang und gäbe ist, verdankt ihren Charme auch ihrer Komik, die das formale Gegengift zu der besagten existenziellen Furcht und Traurigkeit darstellt. Nach einer Bemerkung seines Biografen D.T. Max bewunderte Wallace den überdrehten Stil des Rockkritikers Lester Bang, »der seiner Art zu reden wahrscheinlich näher kam als jede andere Prosa«[6] und der etwa auf der ersten Seite des Kreuzfahrtessays aufschimmert:
Ich habe sacharinweiße Strände gesehen, Wasser von hellstem Azur. Ich habe einen knallroten Jogginganzug gesehen, mit extrabreiten Revers. Ich habe erfahren, wie Sonnenmilch riecht, wenn sie auf 21.000 Pfund heißes Menschenfleisch verteilt wird. Ich bin in drei Ländern mit »Mään« angeredet worden. Ich habe 500 amerikanischen Leistungsträgern beim Ententanz zugeschaut. Ich habe Sonnenuntergänge erlebt, die aussahen wie nach einer digitalen Bildbearbeitung, und einen tropischen Mond, der am Himmel hing wie eine fette Zitrone – statt des spröden Gesteinsbrockens unter dem gewohnten US-Sternenzelt.[7]
Komisch sind auch die Gedankenschlaufen, deren Mäandrieren Wallace manchmal mit seinem Markenzeichen ausufernder Fußnoten nachbildet. In »Demokratie und Geschäft bei den US Open« ahmt er formal die Zwanghaftigkeit nach, mit der sein Denken um den lukullischen Overkill auf dem Gelände des Tennisturniers kreist: In Fußnote 32 beschreibt er ausgiebig das gaumenbezaubernde Fast Food, kehrt in den Haupttext zurück und versucht drei Zeilen lang, sich auf das Spiel Sampras – Philippoussis zu konzentrieren, muss dann aber nach dem Muster des nachklappernden ›Was ich dazu aber noch sagen wollte‹ die lange Fußnote 33 anfügen. Das hat schon was von Laurence Sternes Abschweifungen im Tristram Shandy.
Ein drittes Verfahren komischen Schreibens brachte Wallace selbst in einem frühen Interview auf den Punkt: »Ich habe eine schrecklich sentimentale Vorliebe für Gags, für Sachen, die einfach nur komisch sind, und wenn ich die reinstecke, sollen sie manchmal einfach nur komisch sein.«[8] Diesen Humor hatte er als Jugendlicher in der Alltags- und Populärkultur der Sechziger- und Siebzigerjahre vorgefunden, in MAD-Heften, den Comicbeilagen der Wochenendzeitungen, Fernsehserien wie der Addams Family und Gilligans Insel und vielen anderen Formaten. Diese Erscheinungsformen der Komik hatten sich tief in seinem Unbewussten eingenistet, sie bildeten das Fundament und die Substrukturen seines Denkens, und statt sie wie etwa ein Don DeLillo zugunsten der Hochliteratur über Bord zu werfen, integrierte Wallace sie seinen Werken und gab diesen damit eine populärkulturelle Grundierung, weil sie sonst nicht seiner Erfahrungswelt entsprochen hätten, sondern unvollständig und unauthentisch geblieben wären.
Die vorliegende Ausgabe enthält alle Essays und Reportagen, die in den drei amerikanischen Bänden A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again (1997), Consider the Lobster (2005) und Both Flesh and Not (2012) erschienen sind. Sie wurden hier thematisch gegliedert und innerhalb der Themengruppen chronologisch geordnet, um die Entwicklung von Wallace’ Denken nachvollziehbar zu machen. Da Wallace als Jugendlicher das Tennisspiel entdeckte und erst im Studium zur ernsthaften und schreibenden Beschäftigung mit der Literatur fand, stehen seine Essays zu Tennisspielern und -turnieren am Anfang des Bandes. Den Abschluss bildet »Das hier ist Wasser« als die Summa seiner moralischen Reflexionen.
Mit dem Werk von David Foster Wallace vertraute Leser und Leserinnen kennen seine unersättliche Liebe zu Wörtern und ihren Bedeutungen. Unentwegt aktualisierte er eine Datei mit seltenen Begriffen, die er den verschiedensten Quellen entnahm, lernen wollte und mit Kurzdefinitionen versah. Eine Auswahl aus dieser Vokabelliste erscheint zwischen den einzelnen aus dem Nachlass herausgegebenen Essays in Both Flesh and Not, und ich habe sie hier durch deutsche Ausdrücke und Definitionen von vergleichbarer Seltenheit und Abstrusität zwischen den Essaygruppen ersetzt.
Ulrich Blumenbach
Tennis
Sportableitungen in der Tornado Alley
Als ich aus meiner Schachtelstadt im Farmland von Illinois wegzog, um an der Alma Mater meines Dads in den schrecklichen, in den Himmel ragenden Berkshires von West-Massachusetts zu studieren, entwickelte ich Knall auf Fall einen Mathematikjieper. So langsam verstehe ich, wie es dazu kam. Bei Leuten aus dem Mittleren Westen evoziert und kathartisiert Unimathe das Heimweh. Ich war in Vektoren, Linien, sich kreuzenden Geraden und Rastern aufgewachsen – und, am Maßstab des Horizonts gemessen, vor breiten Kurven geografischer Kraft, dem bizarren topografischen Abflussstrudel einer Unmenge vom Eis glatt gebügelten Land, das auf Platten ruht und rotiert. Das Land hinter und unter diesen breiten Kurven an der Naht von Himmel und Erde konnte ich nach dem Augenschein vermessen, lange bevor ich die Infinitesimalrechnung als Erleichterung und Integrale als Schemata kennenlernte. Mathe an einer hügeligen Uni im Osten war ein Erwachen; Erinnerungen wurden zerlegt und in Licht getaucht. Infinitesimalrechnung war im Wortsinn ein Kinderspiel.
Am Ende meiner Kindheit lernte ich Tennisspielen auf den Asphaltcourts eines kleinen öffentlichen Parks, herausgeschnitten aus einem Ackerland, das zu viel Stickstoffdünger abbekommen hatte, um noch beackert werden zu können. Das war in meiner Heimatstadt Philo, Illinois, einer winzigen Ansammlung von Getreidespeichern und Levittown-Normhäusern aus der Nachkriegszeit, deren Bewohner Ernteversicherungen, Stickstoffdünger und Herbizide verkauften und bei den jungen Akademikern der Universität im nahe gelegenen Champaign-Urbana Grundsteuern eintrieben. Die Population dieser Akademiker schwoll in den florierenden Sechzigerjahren so an, dass seltsame semantische Gespanne wie »Farm- und Schlafstadt« plötzlich klar und deutlich wirkten.
Im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren war ich ein fast großartiger Juniortennisspieler. Ich verdiente mir die ersten Wettkampfsporen bei kleinen Landclubturnieren in Champaign und Urbana, wo ich die Kinder von Anwälten und Zahnärzten aufmischte, und nach kurzer Zeit gingen ganze Sommer dafür drauf, in aller Frühe zu irgendwelchen Turnieren in Illinois, Indiana und Iowa kutschiert zu werden. Mit vierzehn bekleidete ich Rang 17 der Western Section der United States Tennis Association (»Western« war der knarzend veraltete USTA-Begriff für den Mittleren Westen; weiter im Westen lagen die Southwest, Northwest und Pacific Northwest Sections). Mein Flirt mit dem Spitzentennis hatte weniger mit echter sportlicher Begabung zu tun als vielmehr mit einem schrägen Faible für intuitive Mathematik und mit der Stadt, in der ich lernte und trainierte. Sogar nach den Standards der Juniorenturniere, bei denen ja jeder Hinz und Kunz ein potenzielles Wunderkind ist, war ich ein ziemlich untalentierter Tennisspieler. Mein Ballgefühl war okay, aber ich war weder groß noch schnell, hatte eine fast schon konkave Brust, so dünne Handgelenke, dass ich sie mit Daumen und kleinem Finger umfassen konnte, und einen Tennisball konnte ich auch nicht härter oder aggressiver schlagen als die meisten Mädchen meiner Altersgruppe. Dafür konnte ich »die Bälle verteilen«. Das war eine Tennisfloskel mit einer ganzen Reihe von Bedeutungen. In meinem Fall hieß sie, dass ich meine Grenzen kannte, die Grenzen dessen, worin ich stand, und mich daran anpasste. Unter schlechten Bedingungen lief ich erst zu meiner Höchstform auf.
Nun sind die Bedingungen in Central Illinois aus mathematischer Perspektive interessant und aus Tennisperspektive schlecht: Sommerhitze und die Feuchtigkeit nasser Fäustlinge; grotesk fruchtbarer Ackerboden, der Gras und breitblättriges Unkraut aus schierem Übermut durch den Asphalt der Courts brechen lässt; Mücken, die von Schweiß leben, und Moskitos, die sich in den Ackerfurchen und den alle Felder einkastelnden, von Konferven überwucherten Drainagegräben vermehren; Abendtennis ist praktisch unmöglich, weil die Natriumlampen Motten und Schnaken anziehen, die kleine Planeten um jeden Lichthof bilden und den ganzen beleuchteten Court mit spastischen kleinen Schatten überflattern.
Aber vor allem der Wind. Der größte Einzelfaktor für die Qualität des Freiluftlebens in Central Illinois ist der Wind. Es gibt in der Gegend unzählige Witze über verkrümmte Wetterfahnen und schiefe Scheunen, und der Bundesstaat kennt mehr Spitznamen für Windsorten als Schlittenhunde für Schnee. Der Wind hatte eine Persönlichkeit, eine (miese) Laune und offenbar auch eine Geschäftsordnung. Er blies das Herbstlaub in interpolierte Linien und Kreisbögen von solcher Regelmäßigkeit, dass man sie für Handbücher über die cramersche Regel und Kreuzprodukte von Vektoren im dreidimensionalen Vektorraum hätte fotografieren können. Er formte den Winterschnee zu blendenden Schlagstöcken, die liegen gebliebene Autos begruben und Bürger nötigten, nicht nur ihre Auffahrten, sondern ganze Häuserseiten freizuschaufeln; in Central Illinois fängt ein »Schneesturm« erst dann an, wenn es zu schneien aufhört und der Wind einsetzt. Die meisten Leute in Philo kämmten sich nicht die Haare, denn was soll das nützen? Frauen steckten ihre Frisuren mit solcher Regelmäßigkeit mit diesen Plastikfahnen fest, dass ich dachte, bei einer wirklich eleganten Coiffure gehöre das einfach dazu; Mädchen an der Ostküste, die draußen mit offenen Haaren herumliefen, wirkten schamlos und nackt auf mich. Wind, Wind usw. usf.
Meine Bekannten, die nicht aus dem Mittleren Westen kommen, dampfen ihn immer zu leerer Flachheit ein, schwarzem Boden und Feldern mit grünen Wedeln oder Bartstoppeln, sanften Anhöhen und Abhängen, die jede Topologie zum sadistischen Unterfangen des Skizzierens von Quadriken machen und Autobahnschneisen so monoton und tot, dass sie Autofahrer zum Wahnsinn treiben. Wer aus Indiana / Wisconsin / Northern Illinois kommt, denkt bei ›Mittlerer Westen‹ an Agrarwissenschaft, Warentermingeschäfte, die Entfahnung von Mais, Unkrautjäten mit der Machete in den Sojabohnenfeldern, Basecaps mit den Logos von Saatgutunternehmen, nordische Typen mit Apfelbäckchen, Cider, Schlachtfeste und Footballspiele, bei denen weiße Nebelbänke unter den Helmen hervorwölken. In diesem komischen Mittelstück aber, wo Champaign-Urbana, Rantoul, Philo, Mahomet-Seymour, Mattoon, Farmer City und Tolono liegen, wird das Leben im Mittleren Westen vom Wind geprägt und verformt. Wettermäßig liegt unser Städtchen im östlichen Aufwind dessen, was ich einen Atmosphärologen in braunem Tweed mal eine thermale Anomalie habe nennen hören. Irgendwas von wegen südwärts rotierenden Böen von den Großen Seen in Mesalliancen mit schwülem südlichem Zeug aus Arkansas und Kentucky und einem Spritzer verquerer Zephyre aus dem Mississippital drei Stunden weiter westlich. Chicago nennt sich Windy City, aber dieser riesige Windschutz in Stadtform hat keinen blassen Schimmer, was ein Wind ist, der wirklich keinen Spaß versteht. Und Meteorologen können den Einwohnern von Philo auch nichts Neues sagen, denn die wissen nur zu gut, dass es in Wahrheit daran liegt, dass es im Westen von uns bis zu den Rockies praktisch nichts Hohes gibt und dass verquere Zephyre und Windsbräute Brisen, Böen, Thermiken, Fallwinde und was nicht alles draußen über Nebraska und Kansas vereinen und nach Osten treiben, so wie sich Flüsse zu Strömen, Strahlen und militärischen Fronten zusammentun, wie Lawinen anwachsen und dann die Ochsenpfade der Pioniere in umgekehrter Richtung entlangbrausen und unseren ungeschützten Ärschen den Marsch blasen. Am schlimmsten war es im Frühjahr, in der Tennissaison der Jungen-Highschools, wenn die Netze straff gebläht wurden wie stolz knatternde Fahnen und ein schlecht geschlagener Ball einfach zum östlichsten Zaun geblasen wurde und das Spiel auch auf mehreren Nachbarcourts unterbrach. An übel windigen Tagen brachten ein paar von uns Seile mit und erklärten Rob Lord, unserem fünften Mann im Einzel, einem Strich in der Landschaft, wir müssten ihn festbinden, damit er sich nicht in ein Geschoss verwandle. Der Herbst war üblicherweise nur halb so schlimm wie das Frühjahr, ein ständiges tiefes Tosen und das starke Klackern ganzer Laubkontinente, die zu erzwungenen Kurven arrangiert werden – ein auch nur ansatzweise mit diesem Megaklackern vergleichbares Geräusch sollte ich erst wieder hören, als ich mit neunzehn Jahren in der Fundy Bay von New Brunswick meine erste hohe Flutwelle brechen hörte, die dann über den Strand aus rundgeschliffenen Kieselsteinen ins Meer zurückgesogen wurde. Die Sommer waren manisch und böig und ungefähr ab August dann oft totenstill. An manchen Augusttagen erstarb der Wind einfach, und das war überhaupt keine Erleichterung; die Stille trieb uns die Wände hoch. Jeden August erkannten wir aufs Neue, wie sehr der Klang des Windes in Philo zum Soundtrack des Lebens gehörte. Der Klang des Windes war für mich Stille geworden. Wenn er verschwand, war ich dem Rauschen des Bluts im Kopf und dem akustischen Funkeln all der Trommelfellhärchen ausgeliefert, die wie ein Alkoholiker im Entzug zitterten. Nachdem ich nach West-Massachusetts gezogen war, sollte es Monate dauern, bevor ich im Memmenflüstern des Windklangs von Neuengland richtig schlafen konnte.
Der durchschnittliche Außenstehende findet, Central Illinois sei ideal für Sport. Aus der Luft gesehen, erinnert der Boden an ein Brettspiel: pingelig präzise Vierecke graubrauner oder khakifarbener Anbauflächen, geteilt und durchschnitten von rechtwinkligen Teerstraßen (für die Landwirtschaft sind Straßen eher Hindernisse als Wege). Im Winter erinnert die Landschaft immer an Mannington-Badezimmerfliesen – weiße Vierecke, wo sonst nichts ist (Schnee), schwarze, wo sich Bäume und Büsche im Wind vom Schnee befreit haben. Im Flugzeug denke ich, wenn ich die Landschaft sehe, immer an Monopoly, Das Spiel des Lebens oder ein Laborlabyrinth für Ratten; ebenerdig sehen die säuberlich angeordneten Futtermais- oder Sojabohnenfelder mit ihren so kerzengerade gepflügten Ackerfurchen, wie sie nur ein Allis Chalmers mit Sextant hinkriegt, mehrspurig aus wie Aschenbahnen für Sprinter oder Schwimmbäder nach Olympianorm, Doppelkreuze für ernsthaftes Ballspiel, reichlich versehen mit Winkeln und Bahnen für ernsthaftes Tennisspiel. Mein Teil des Mittleren Westens sieht immer eigens festgelegt aus, wie geplant.
Die Stärken der Landschaft sind auch ihre Schwächen. Weil das Land so eben scheint, scheren sich die Architekten von Vereinen und Parks meist nicht darum, es wirklich einebnen zu lassen, bevor es dann für Tenniscourts planiert wird. Daraus ergibt sich eine ganz leichte Abschüssigkeit, die nur Spielern auffällt, die sehr viel Zeit auf den Courts verbringen. Da Tennisplätze aus Sonnen- und Augengründen grundsätzlich nordsüdlich ausgerichtet werden und weil das Gelände in Central Illinois ganz sanft ansteigt, wenn man sich Richtung Indiana nach Osten bewegt, zur kaum spürbaren geologischen Wasserscheide, deretwegen sich Flüsse im Osten des Staats wieder gegen ihre eigenen Zuflüsse wenden, scheint die Vorhandhälfte der Courts für einen Rechtshänder, der nach Norden sieht und spielt, immer leibhaftig bergauf zu liegen – bei einem Turnier in Richmond, Indiana, kurz hinter der Grenze nach Ohio, fiel mir mal auf, dass die Neigung umgekehrt war. Der Boden, der so humusreich ist, dass die Farmer Geld dafür bekommen, die Märkte nicht mit ihm zu überschwemmen, sorgt auch dafür, dass auf Sandplätzen Tollkraut, Disteln und Ausfallgetreide sprießen, und auch Asphaltplätze bröckeln unter dem Aufwärtsdruck von breitblättrigem Unkraut, Saatgut vom Schrot und Korn echter Pioniere, das sich von knapp zwei Zentimetern Stein und Dichtmasse nicht beirren lässt. Mit einigen wenigen wirklich bestens in Schuss gehaltenen Ausnahmen in den wohlhabenden Gegenden von Illinois bilden die Courts daher ihre eigenen Grünzonen, und Grasbüschel, Spalten und Pfützen austretenden Sickerwassers gehören für den Spieler einfach zur Beschaffenheit der Spielfläche. Irgendwie fangen die Risse auf dem Court immer neben dem Aufschlagfeld an und mäandrieren dann ins Feld zur Aufschlaglinie. Die schwarzen Risse treiben in ihren Taschen Blätter, und besonders vor dem Hintergrund des Waldgrüns, im Gegensatz zum Scheunenrot der Flächen hinter den Auslinien, verleihen sie den Courts, wenn man sie von hinten und oben betrachtet, das gespenstische Aussehen flussreicher Gebiete von Illinois.
Von oben sieht ein 23,77 m x 8,23 m großer Tenniscourt mit seinen schlanken Rechtecken der Doppellinien, die sich an seiner ganzen Länge entlangziehen, wie ein Pappkarton mit aufgefalteten Klappen aus. Das an den Netzpfosten 1,06 m hohe Netz unterteilt den Court der Breite nach in zwei Hälften; die Aufschlaglinien unterteilen diese Hälften noch einmal in Rück- und Vorderfelder. Mittlere Aufschlaglinien vom Mittelstreifen im Netz zu den Aufschlaglinien unterteilen die beiden Vorderfelder in je zwei Aufschlagfelder mit Seitenlängen von 6,40 m x 4,115 m. Die genau definierten Sektoren und Grenzlinien sowie die Tatsache, dass Bälle – vom Wind und exotisch angeschnittenen Schlägen mal abgesehen – nur in geraden Linien fliegen können, machen Lehrbuchtennis zu einer Angelegenheit der ebenen Geometrie. Das ist Billard mit Bällen, die nicht stillhalten. Schach im Laufschritt. Tennis verhält sich zu Artillerie und Luftangriffen wie Football zu Infanterie und Stellungskriegen.
Ich brachte für das Tennisspiel zwei außergewöhnliche Gaben mit, die mein mangelndes körperliches Talent ausglichen. Gut, drei. Erstens schwitzte ich immer so stark, dass ich bei jedem Wetter gut belüftet war. Nun ist übermäßiges Schwitzen kein reiner Segen und vollbrachte nicht direkt Wunder für mein Sozialleben an der Highschool, es ermöglichte mir aber, an einem Julitag mit Temperaturen wie in einem türkischen Hammam stundenlang zu spielen, ohne schlappzumachen, solange ich zwischen den Matches genug Wasser trank und Salziges aß. Ungefähr ab dem vierten Spiel sah ich immer aus wie eine Wasserleiche, aber ich bekam keine Krämpfe, musste nicht brechen und kippte nicht um – im Gegensatz zu den blitzblanken Jugendlichen aus Peoria, denen nie auch nur der glatt gezogene Scheitel verrutschte, bis sie dann plötzlich die Augen verdrehten und auf den flirrenden Zement knallten. Ein wichtigerer Vorteil war, dass ich mich zwischen geraden Linien äußerst wohlfühlte. Nichts von dieser komischen geometrischen Klaustrophobie, die aus talentierten Junioren nach einer Weile sprunghafte Zootiere machen kann. Ich fühlte mich am wohlsten, wenn ich in scharfe Ecken, spitze Winkel und präzise Halbierungen eingewebt war. Das war umweltbedingt. Philo, Illinois, bildet ein schiefes Raster: neun in Nord-Süd-Richtung verlaufende gegen sechs nordöstlich-südwestliche Straßen und einundfünfzig hinreißende Schiefkreuzecken (die Tangens der Ost- und West-Kreuzungswinkel hätten sich über das Integral ihrer Sekanten berechnen lassen!) um eine zentrale Allmende im Schnittpunkt dreier Straßen herum, auf der ein Panzer stand, dessen Geschützrohr nach Urbana im Nordwesten zeigte, sowie ein erstarrter, am Brückenkopf bei Salerno gefallener Sohn der Stadt, dessen Bronzehand genau nach Norden deutete. Am späten Vormittag warf die Statue des Salerno-Kämpfers einen gedrungenen schwarzen Armschatten auf das Gras, das so dicht wuchs, dass man darauf putten konnte; abends galvanisierte die Sonne sein linkes Profil und warf den anklagenden Schatten seines Arms nach rechts, abgeknickt wie der Winkel eines in einen Teich gehaltenen Stocks. An der Uni ging mir bei einem Test plötzlich auf, dass das Differenzial zwischen der Richtung der ausgestreckten Statuenhand und dem Rotationsweg ihres Schattens von erster Ordnung war. Jedenfalls konnte ich die meisten meiner Kindheitserinnerungen – ob nun an gepflügtes Ackerland, Erntedienst an der RR104W oder das Spiel der scharfen Schatten auf dem Softballfeld der Legion Hall in der Dämmerung – jetzt auf Zuruf rekonstruieren, wenn ich nur über Kante und Winkelmesser verfügte.
Ich mochte den scharfen Kontakt gerader Linien mehr als die anderen Jugendlichen, mit denen ich aufwuchs. Wahrscheinlich lag das daran, dass sie Einheimische waren, während ich als Kind aus Ithaca herverpflanzt worden war, wo mein Dad seinen Doktor gemacht hatte. Also hatte ich, wenn auch nur horizontal und in der Vorbewusstheit eines Säuglings, etwas anderes gekannt, die hohen Hügel und die kurvenreichen Einbahnstraßen von Upstate New York. Ich bin ziemlich sicher, dass ich die amorphe Pampe von Kurven und Schwellungen als Gegenlicht irgendwo in meinem Reptiliengehirn konserviert hatte, denn die Kinder in Philo, mit denen ich raufte und spielte, Kinder, die nie etwas anderes gekannt hatten, konnten im ebenflächigen Grundriss der Stadt nichts Krasses oder Neuweltliches erkennen, zeigten keine Wertschätzung für scharfe Kanten. (Fragt sich bloß, warum ich es für signifikant halte, dass so viele von ihnen beim Militär landeten und im Uniformblau mit rasiermesserscharfen Bügelfalten schicke Rechtsums vollzogen?)
Sofern Sie nicht zu den seltenen Mutanten gehören, deren Virtuosität auf rohen Kräften beruht, werden Sie merken, dass Wettkampftennis wie Poolbillard um Geld geometrisches Denken erfordert, die Fähigkeit, nicht nur die Winkel des eigenen Spiels zu berechnen, sondern auch die Winkel der Reaktionen auf Ihre Winkel. Da die Reaktionsmöglichkeiten quadratisch zunehmen, muss man n Schläge vorausdenken, wobei n eine Hyperbelfunktion ist, die grob durch den sinh vom Talent des Gegners und den cosh der Anzahl der im Ballwechsel erfolgten Schläge beschränkt wird. Da war ich gut drin. Eine Zeit lang war ich fast großartig, weil ich in meine Berechnungen die unterschiedlichen Störungen durch den Wind einbeziehen konnte; ich konnte oktatisch denken und spielen. Der Wind machte aus Geraden nämlich Kurven und das Spiel dadurch dreidimensional. Bei vielen Juniorspielern in Central Illinois richtete der Wind massive Schäden an, besonders in den Monaten April bis Juli, in denen er dringend Lithium brauchte, in denen seine Böen kein Muster hatten, wirbelten, die Richtung änderten, sich legten und wiederauflebten, auf Courtebene in die eine Richtung fegten und drei Meter höher in eine andere. Präzises Denken war gefordert, um Prozente, Schubkraft und Vergeltungswinkel dynamisch zu sehen – eine Präzision, zu deren Abstraktion mithilfe von Kreide an der Tafel unser Trainer und seine ehrenamtlichen Kollegen in den Nachbargemeinden ebenso imstande waren, wie sie einem Schüler das Bein mit Wäscheleine am Zaun festbinden konnten, um beim Training seinen Bewegungsradius einzuschränken, wie sie Schmutzwäschekörbe in verschiedenen Courtecken platzieren konnten, in die wir dann Ball um Ball dreschen mussten, für Übungen und Sprints mit Abdeckband Kästchen in den Courtfeldern markierten – diese ganze theoretische Vorbereitung ging aber sofort den Bach runter, sobald die Tennisschuhe bei einem Turnier erstmals Kontakt mit dem Courtbelag aufnahmen. Der bestgeplante und bestgeschlagene Ball flog oft einfach vom Spielfeld, das war das ganz prosaische Grundproblem. Die Willkür und Ungerechtigkeit der Sache trieb viele Jugendliche fast zum Wahnsinn, und an wirklich windigen Tagen erlebten diese Kids, die in der Regel Talent bis zum Gehtnichtmehr hatten, ungefähr im dritten Spiel vom Match ihren ersten rasenden Wutanfall mit Schlägerwegschmeißen und allem Drum und Dran, und am Ende vom ersten Satz verfielen sie in ein dumpfes Koma, weil sie inzwischen einfach davon ausgingen, von Wind, Netz, Tape und Sonne verarscht zu werden. Ich, den man liebevoll Schnecke nannte, weil ich beim Training immer so ein Lahmarsch war, sah meinen größten Tennisvorteil in einer schrägen roboterartigen Distanzierung von den ungerechten Unwägbarkeiten von Wind und Wetter. Ich könnte unmöglich sagen, wie viele Turniermatches ich im Alter von zwölf bis fünfzehn Jahren gegen größere, schnellere, motorisch geschicktere und von ihren Trainern besser vorbereitete Gegner gewonnen habe, einfach indem ich meine Bälle in den schizophrenen Böen absolut fantasielos in die Mitte vom Court zurückspielte, den anderen mit mehr Rasanz und Schwung spielen ließ und einfach abwartete, bis seine ehrgeizigen, in die Nähe der Linien gezielten Bälle abschmierten und vom Wind über das Grün und die weißen Streifen hinaus ins rote Terrain getrieben wurden, was mir den nächsten schmutzigen Punkt einbrachte. Ich war kein schöner Anblick, mir zuzusehen machte keinen Spaß, und selbst bei tatkräftiger Unterstützung durch den Wind von Illinois hätte ich auf diese Weise kein ganzes Match gewinnen können, wenn mein Gegner nicht irgendwann seinen kleinen Nervenzusammenbruch gehabt hätte, unter der himmelschreienden Ungerechtigkeit eingeknickt wäre, gegen einen schmalbrüstigen »Pusher« zu verlieren, weil auf diesen beschissenen Provinzcourts ein Scheißwind herrschte, der defensive Automatismen belohnte, statt Rasanz und Schwung zu honorieren. Ich war aus gutem Grund ein unbeliebter Spieler. Aber die Behauptung, ich hätte weder Rasanz noch Fantasie ins Spiel gebracht, ist nicht wahr. Akzeptanz hat ihre eigene Rasanz, ein Spieler braucht Fantasie, um Wind zu mögen, und ich mochte Wind; besser gesagt, ich hatte einfach das Gefühl, der Wind hätte eine Daseinsberechtigung, ich fand ihn interessant und war bereit, mein logistisches Terrain auszuweiten, um den verheerenden Effekten entgegenzutreten, die aus Südwest nach Ost wirbelnde Windstöße mit einer Geschwindigkeit von 25–50 km/h auf meine besten Kalkulationen hatten, wie ehrgeizig ich auf Joe Bilderbuchfrisurs Topspin-Drives in meine Rückhandecke reagieren sollte.
Illinois und seine Kombination aus pockennarbigen Courts, unerträglicher Feuchtigkeit und Wind erforderten und belohnten eine zenartige Akzeptanz der Dinge, wie sie auf dem Court nun einmal waren. Ich siegte viel. Mit zwölf wurde ich gelegentlich bei Turnieren jenseits von Philo, Champaign und Danville zugelassen. Chauffiert wurde ich von meinen Eltern oder denen von Gil Antitoi, dem Sohn eines Professors für kanadische Geschichte in Urbana, und die Events hatten die Preisklasse des Central Illinois Open in Decatur, einer Stadt, die vom Getreideverarbeitungskonzern A.E. Staley beherrscht wird und daher dermaßen nach verbranntem Getreide stinkt, dass Jugendliche dort nur mit vor Mund und Nase gebundenen Halstüchern zum Spiel antraten; oder des Western Closed Qualifier auf dem Campus der Illinois State University in Normal; oder des McDonald’s Junior Open in der Maisstadt Galesburg weit im Westen, fünfzig Kilometer vor dem Mississippi; oder des Prairie State Open in Pekin, Versicherungsknotenpunkt und Firmensitz von Caterpillar Tractor; oder der Midwest Junior Clay Courts in einem Schickimicki-Privatclub in Peorias Abklatsch von Scarsdale.
In den nächsten vier Sommern lernte ich den Staat weit besser kennen, als normal oder gesund gewesen wäre, auch wenn das meiste, was ich da zu sehen bekam, nur verschwommene Getreidefelder waren, die am Autofenster vorbeihuschten, wenn ich, aus dem Dösen erwachend, in die abrupten und so schrecklich weiß glühenden Sonnenaufgänge an der Linie zwischen Äckern und Himmel hinausblinzelte (außerdem sah man jede Stadt, in die man unterwegs war, in genau der Sekunde, in der sie hinter der Erdkrümmung auftauchte, und das Einzige, was mich bei Proust später an der Uni wirklich bewegen sollte, war die frühe Beschreibung, wie der Junge eine geometrische Beziehung zum Kirchturm von Combray in der Ferne aufnimmt), immer auf dem Rücksitz von Kombis, durch Samstagssonnenaufgänge und Sonntagssonnenuntergänge. Ich wurde langsam besser; Antitoi genoss die unfaire Hilfestellung einer früh einsetzenden Pubertät und wurde rasant besser.
Mit vierzehn Jahren waren Gil Antitoi und ich in unserer Altersgruppe in Central Illinois die Crème de la Crème, wurden bei Regionalturnieren für gewöhnlich auf Platz 1 und 2 gesetzt und konnten eigentlich alle schlagen, abgesehen allenfalls von ein paar Jugendlichen aus den Vorstädten von Chicago, die zusammen mit einer Fraktion aus Grosse Pointe, Michigan, die regionalen Ranglisten im Mittleren Westen üblicherweise dominierten. In jenem Sommer war der beste Vierzehnjährige der Nation ein Junge aus Chicago, Bruce Brescia (dessen Vorliebe für weiche weiße Tennishüte, kurze Socken mit Hasenschwänzchen an den Hacken und grellbunte Pullunder Neigungen verrieten, deren Natur mir erst nach etlichen Jahren dämmern sollte), aber Brescia und sein Spießgeselle Mark Mees aus Zanesville, Ohio, traten allenfalls bei den Midwestern Clays und ein paar Hallentennisturnieren in Cook County an, weil sie zu viel mit Anlässen wie den Pacific Hardcourts in Ventura, Junior Wimbledon und so Kram zu tun hatten. Ich bin nur einmal gegen Brescia angetreten, 1977 im Viertelfinale so einer Hallenkiste im Rosemont Horizon, und das Ergebnis war nicht schön. Antitoi schaffte es in einem Jahr bei den nationalen Qualifikationsspielen sogar, Mees einen Satz abzujagen. Weder Brescia noch Mees sind Profis geworden; ich weiß nicht, was nach ihrem achtzehnten Geburtstag aus ihnen geworden ist.
Antitoi und ich durchstreiften dasselbe Wettkampfrevier; er war mein Freund, mein Feind und mein Fluch. Ich hatte zwar zwei Jahre vor ihm mit dem Training angefangen, aber mit dreizehn war er größer, schneller und unterm Strich einfach besser als ich, und von da an verlor ich bei fast jedem Turnier im Finale gegen ihn. Im Auftreten, in der Spielweise und der Gestalt im Allgemeinen unterschieden wir uns so sehr, dass wir von 1974 bis 1977 eine epische Rivalität austrugen. Ich war beim Einsatz von Statistiken, Bodenbeschaffenheiten, Sonne, Windböen und einer Art stoischem Hochgefühl so hellsichtig geworden, dass ich als eine Art körperliche Inselbegabung galt, als Medizinjunge der Hitze und des Winds, der einfach ewig spielen und anspruchslosen Lobs einen grotesken Spin verpassen konnte. Antitoi, der von Anfang an unkompliziert gewesen war, drosch einfach auf alles Runde ein, was ihm in die Quere kam, und zielte grundsätzlich in eine der beiden Ecken im Rückfeld. Er war ein Schläger, ich war ein Schaumschläger. Wenn er einen guten Tag hatte, wischte er den Courtboden mit mir auf. Wenn er nicht in Bestform war (und David Saboe aus Bloomington, Kirk Riehagen und Steve Cassil aus Danville und ich verbrachten zahllose Stunden mit Meditationen und Diskussionen über die Variablen von Diät, Schlaf, Liebesleben, Autofahrten und sogar Sockenfarben, die bei der Bestimmung von Antitois aktueller Tagesform zu berücksichtigen waren), lieferten wir uns großartige Matches, richtige Marathon-Windplackereien. 1974 traten wir in elf Finalspielen gegeneinander an, und ich gewann zwei.
Juniortennis im Mittleren Westen war auch meine Initiation in die wahre Traurigkeit der Erwachsenen. Ich besaß inzwischen eine gewisse Hybris in Bezug auf meine taoistische Fähigkeit zur Kontrolle durch Nichtkontrolle. Ich hatte eine Privatreligion des Windes begründet. Ich fuhr sogar gern Fahrrad. Aus offenkundigen Windgründen fährt in Philo kaum jemand Fahrrad, aber ich entwickelte eine Technik, gegen eine steife Brise quasi hin und her zu kreuzen, indem ich in einem Winkel von etwa 120° zu meiner Fahrtrichtung ein großes Buch zur Seite ausstemmte – das beste aerodynamische Profil hatten erwiesenermaßen Bayne & Pughs The Art of the Engineer und Cheiros Language of the Hand –, und mit Fantasie, Schwung und stoischem Hochgefühl konnte ich starken Gegenwind so nicht nur neutralisieren, sondern mir sogar zunutze machen. Auf ähnliche Weise hatte ich mit dreizehn Mittel und Wege gefunden, mich den heftigen Sommerwinden nicht nur zu fügen, sondern mich ihrer in meinen Matches sogar zu bedienen. Ich lobbte den Ball nicht einfach nur die mittlere Aufschlaglinie lang, um eine Fehlerrate für windbedingtes Abdriften zuzulassen, sondern nutzte die Windströmungen ähnlich aus, wie ein Pitcher Spucke nutzt. Ich konnte Bogenbälle in den Seitenwind schlagen, der sie gerade noch drinnen aufkommen ließ; ich hatte einen speziellen Windaufschlag, der so viel Drall hatte, dass der Ball in der Luft in einem Oval von links nach rechts kurvte wie ein gut geschlagener Slider und die Bogenrichtung nach dem Aufkommen dann wechselte. Ich hatte dasselbe instinktive Gefühl dafür entwickelt, wie sich der Ball im Wind verhalten würde, aus dem heraus ein Schaltgetriebefahrer weiß, wann er den Gang wechseln muss. Als Juniortennisspieler gehörte ich eine Weile einer konkreten materiellen Welt an, von der andere Jungen ausgeschlossen waren, hatte ich das Gefühl. Und mit vierzehn Jahren bekam ich dann den Eindruck, betrogen worden zu sein, als so viele dieser unbeirrbar herumfuchtelnden Jungen plötzlich zu Männern heranwuchsen, auf den Oberschenkeln und unter der Nase Flaum bekamen und an den Unterarmen drahtige Adern ausbildeten. Im Sommer nach meinem fünfzehnten Geburtstag waren Kids, die ich im Vorjahr noch mühelos geschlagen hatte, plötzlich übermächtig. 1977 verlor ich in den Halbfinalspielen in Pekin und Springfield, den Turnieren, bei denen ich Antitoi im Finale ’76 noch geschlagen hatte. Es machte mich völlig fertig, als mein Vater mich nach der Niederlage in Springfield gegen einen Burschen aus den Quad Cities mit den Worten trösten wollte, es hätte ausgesehen, als würde ein Junge gegen einen Mann spielen. Und die anderen Jungen spürten, dass etwas mit mir los war, sie witterten einen Zerfall meiner bisherigen Détente mit den Elementen: Meine Fähigkeit, mich der Außenwelt zu fügen und sie zu formen, wurde vom Versagen eines inneren Weckers unterhöhlt, den ich noch nicht verstand.
Ich erwähne das vor allem, weil ein solcher Großteil meiner aus dem Kollektiv bezogenen psychischen Energie im Mittleren Westen von Wachstum und Fruchtbarkeit gespeist wurde. Der agrarwissenschaftliche Blickwinkel war offensichtlich, schließlich beruhte das Steueraufkommen meiner Heimat auf Getreide, Aussaat, Höhe und Ernte. Etwas vom zwanghaften Wiegen, Messen und Planen der Erwachsenen, dieses spezielle Kalkül von Treiben und Wachstum sickerte in unsere Kinderköpfchen mit den Mützen und Kopftüchern auf den jeweiligen Feldern, Rauten und Courts unserer Wahl ein. 1977 war ich als einziger unter meinen Sportsfreunden noch unberührt. (Ich weiß das definitiv, aber weil die Betreffenden heute Lehrer, Terminbörsenhändler und Versicherungsmakler mit schützenswerten Familien und Reputationen sind, werde ich Sie nicht darüber unterrichten, woher ich das weiß.) Als Spät- und Immerspäterzünder fühlte ich mich nicht nur meinem renitenten und unbehaarten Körper entfremdet, sondern irgendwie der gesamten Außenwelt, die ich bis dahin für meinen Mitverschworenen gehalten hatte. Intuitiv wusste ich, dass es ein Ruf der Natur war, zu wachsen und Bartwuchs zu entwickeln, eine äußere Kraft, die über die Produkte von Monsanto und Dow hinaus das Getreide wachsen, die Schweine brunften und den Wind im Frühling nachlassen ließ, sodass man den Dünger von den Sojabohnenfeldern in der Ebene im Norden zwischen uns und Champaign roch. Mein Talent schwand. Ich kam mir unberufen vor. Auf einmal litt ich gegenüber dem, was Kinder unbewusst unter Natur subsumieren, an denselben Ressentiments wie ein Steve Cassil, wenn ein gut überlegter Angriffsschlag die Vorhandseitenlinie lang von einer Bö ins Aus getrieben wurde, oder wie ein Gil Antitoi, wenn ein schicker Kickaufschlag (Gil war der einzige Spitzenspieler von den langsamen, unkrautüberwucherten Stadtcourts, der von Anfang an ein Serve-and-Volley-Spiel praktizierte, weswegen er auch so erfolgreich war, als er an der Westküste später für die California State University in Fullerton auf den glatten Hartplätzen antrat) von der Sonne desavouiert wurde: Er war so groß und bei der Anpassung seiner hohen Bilderbuchaufschläge an den Sonnenstand so stur, dass er beim Aufschlag von der Nordseite der Courts am frühen Nachmittag immer violette Kleckse vor den Augen bekam, und bis zum Punkt taumelte er dann nur herum und ruderte stocksauer mit den Armen. Von Sonnenbrillen auf dem Court hatte damals noch keiner was gehört.
Aber der Knackpunkt ist, mir ging es jetzt so, wie es ihnen schon lange ging. Ich grollte insgeheim wegen meiner körperlichen Verortung im großen Plan, und es war in erster Linie dieses Ressentiment, diese Bitterkeit, eine Art schleichende Wurzelfäule, die dann dazu führte, dass ich mich nach 1977 nie wieder für die Meisterschaften der Western Section qualifizieren konnte und es 1980 nur mit Ach und Krach in die Mannschaft einer Uni schaffte, die kleiner war als die Urbana High, während Kids, die ich erst besiegt und dann beneidet hatte, Tennisstipendien für Purdue, Fullerton, Michigan und Pepperdine bekamen – und Pete Bouton, der 1977 fünfzehn Zentimeter und vierzig IQ-Punkte zugelegt hatte, es sogar in die heiligen Hallen der University of Illinois in Urbana-Champaign schaffte.
›Entfremdung vom Mittleren Westen als Fruchtbarkeitsparadigma‹ mag übertrieben metaphysisch klingen, von Selbstmitleid mal ganz zu schweigen. Schließlich entdeckte ich damals gerade bestimmte Integrale und Stammfunktionen und merkte, dass mein Selbstverständnis von der Sportskanone zum Mathefreak wechselte. Richtig ist aber auch, dass mein Aufstieg und Fall in der Tenniswelt des Mittleren Westens unter der Schirmherrschaft des Peter-Prinzips erfolgte. In meiner Heimatstadt und ihrer Umgebung – wo die Courts etwas Ländliches hatten, die Vereinsbudgets niedrig waren und die Spielbedingungen so extrem, dass die Moskitos wie Trompeten klangen, die Bienen wie Tubas und der Wind wie ein Feuermelder bei Alarmstufe Rot, so extrem, dass wir zwischen den Spielen die T-Shirts wechseln, uns mit den Wasserflaschen Häcksel von den Armen und Hälsen spülen und Salztabletten in Pez-Spendern dabeihaben mussten – war ich tatsächlich fast großartig: Ich konnte den Gegner über den ganzen Platz schicken; ich war in meinem Element. Nur wurden alle wirklich wichtigen Turniere, die Anlässe, zu denen meine ländliche Vortrefflichkeit mir Zugang verschaffen sollte, in einer anderen Wirklichkeit gespielt: Im Arlington Tennis Center, wo die Nationale Juniorenqualifikation für unsere Region stattfand, wurden die Spielfeldbeläge jedes Frühjahr erneuert; das Grün der Spielfelder dieser Anlagen leuchtete so stark, dass es ablenkte, ihre Beläge waren so neu und rau, dass es einem die Füße durch die Schuhe hindurch wund scheuerte, und so bar jedes Makels, jeder Schräge, Ritze und Fuge, dass ich völlig desorientiert war. Auf einem vollkommenen Court zu spielen, war für mich wie Wassertreten, wenn man schon kein Land mehr sieht: Ich wusste nie, wo ich da draußen eigentlich war. 1976 wurde das Chicago Junior Invitational im Bath and Tennis Club von Lincolnshire abgehalten, dessen riesiges Gehege aus sechsunddreißig Courts von verstörend grünen Plastikplanen an allen Zäunen umschlossen wurde, in denen es in Augenhöhe manchmal kleine Schießscharten gab, die einen Witz von Zuschauen boten. Die Planen waren Windschutzvorrichtungen der Marke Wind-B-Gone, die sich die Produzenten bei Cyclone Fence 1971 hatten patentieren lassen. Der schlimmste Teil der unfairen Böen wurde dadurch abgeschirmt, irgendwie raubten sie den Courts dadurch aber auch die Frischluft: Ein Tennismatch in Lincolnshire war, als würde man unten in einem Brunnen spielen. Und wenn bei den richtig großen Turnieren im Mittleren Westen Abendspiele stattfanden, waren die Scheinwerferpfosten mit diesen blauen Elektro-Insektenfallen geschmückt: Keine Mückenwolken schwärmten einem um den Kopf, keine zackigen Mottenschatten konnten mit Bällen verwechselt werden, sondern man hörte nur ein echt unangenehmes Zischen und Brutzeln des Ungeziefers, das da oben aus dem Verkehr gezogen wurde; vom Gestank reden wir lieber nicht. Entscheidend ist, ich war irgendwie nicht mehr derselbe, seit ich keine Abnormitäten mehr manipulieren konnte. Heute glaube ich, dass der Wind, die Insekten und die Schlaglöcher für mich eine Art innere Schranke darstellten, eine persönliche Eingrenzung. Nachdem ich ein bestimmtes Turnieranlagenniveau erreicht hatte, war ich gestört, weil ich mich nicht an das Fehlen anpassungsbedürftiger Störfaktoren anpassen konnte. Wenn das nachvollziehbar ist. Unabhängig von pubertären Versagensängsten und substanzieller Entfremdung stagnierte meine Tenniskarriere im Mittleren Westen, als ich erstmals einen Windschutz sah.
Immer noch seltsam erpicht darauf, vom Wetter zu sprechen, möchte ich anmerken, dass meine Heimatstadt wie eigentlich der ganze Osten von Central Illinois stolz darauf ist, zur meteorologisch so genannten Tornado Alley zu gehören. Auftretenshäufigkeit von Tornados jenseits aller statistischen Proportionen. Ich persönlich habe schon zwei gesehen, bei denen der Wirbel durchgehend vom Boden bis zur Wolkenuntergrenze reichte, und fünf, bei denen der Rüssel noch nicht ganz ausgebildet war. Junge Tornados sind grauweiß und sehen wie Verwirbelungen in den Gewitterwolken aus, nicht, als würden sie aus ihnen herauswachsen oder sich von ihnen lösen. Tornados mit Bodenkontakt sind nur schwarz, weil sie tonnenweise Erde aufsaugen und herumwirbeln. Die absurde Häufigkeit von Tornados in der Gegend meiner Heimatstadt ist, wie ich mir habe sagen lassen, eine Funktion derselben Variablen, die auch unsere zivileren Winde hervorrufen: Wir liegen an Koordinaten, wo Wetterlagen und Luftmassen aufeinanderstoßen. An den meisten Tagen von Ende März bis in den Juni gibt es bei den Fernsehsendern in unserer Gegend sogenannte Tornado Watches (die Sender blenden oben rechts im Bildschirm ein kleines Symbol ein, beispielsweise ein Fernglas für die Beobachter und die Tarotkarte des Turms als Warnung oder so ähnlich). Solange die Watches laufen, ist alles in Ordnung usw. usf., kein Thema. Erst wenn die selteneren Tornadowarnungen erfolgen, d.h., wenn jemand von verlässlicher Nüchternheit die Sichtung eines Tornados bestätigt hat, jaulen die Zivilschutzsirenen los. Die Sirene auf dem Dach der Philo Middle School war von anderer Tonhöhe und Zyklusdauer als die unten im Süden von Urbana, und die beiden ver- und entwebten sich immer in einer kakofonen Threnodie. Wenn die Sirenen ertönten, gingen einheimische Familien in ihre Vorratskeller oder Atombunker (im Ernst); Akademikerfamilien in ihren lichten Fertighäusern mit gepflegten Rasen und Grundmauern aus Steinplatten gingen mit x-beliebigen Maskottchen, die gerade zur Hand waren, an den zentralsten Punkt im Erdgeschoss, nachdem sie sämtliche Fenster im Haus aufgemacht hatten, damit deren Scheiben bei jähem Druckabfall nicht sprangen. Für meine Familie war dieser zentrale Punkt ein Flur zwischen dem Arbeitszimmer meines Dads und einem Wäscheschrank, wo an der einen Wand die Reproduktion einer flämischen Darstellung von Mariä Verkündigung und an der anderen eine aztekische Sonnenmonstranz aus Bronze von guillotinischem Gewicht hing; ich versuchte immer, meine Schwester unter die Monstranz zu bugsieren.
Wenn tatsächlich eine Tornadowarnung kam, wenn man sich im Freien und fern von zu Hause befand – etwa bei einem Tennisturnier in einem gottverlassenen Park am zersiedelten Stadtrand –, sollte man sich immer flach in die tiefste Vertiefung legen, die man ausfindig machen konnte. Da die einzigen ernst zu nehmenden Vertiefungen im Umfeld der meisten Turnieranlagen die an bebaute Felder angrenzenden Bewässerungs- bzw. Drainagegräben waren, konferven- und moskitosprayverklebte Gräben, in denen Mokassinschlangen, wie es schien, immer regelrechte Familientreffen abhielten, die also kurz gesagt Orte waren, an denen sich vernunftbegabte Wesen unter keinen Umständen flach hinlegten, steckte man bei gewarnten Turnieren faktisch also die Schläger in die Hüllen, zog die Reißverschlüsse zu und rannte haste, was kannste zu seinen Liebsten oder auch nur Gernsten, wuselte durcheinander und vermied nach Kräften den Eindruck, man würde gleich die Kontrolle über den Schließmuskel verlieren. Manche Mütter stimmten ein Heulen und Zähneklappern an und drückten Kinderköpfe an den Busen (Mrs Swearingen aus Pekin war berüchtigt dafür, auch wildfremde Kinderköpfe an den respekteinflößenden Busen zu drücken).
Dass ich Tornados erwähne, hat unmittelbar mit dem Thema dieses Essays zu tun. Zum einen waren sie ein realer Bestandteil jeder Kindheit im Mittleren Westen, und als kleinem Kind graute mir geradezu vor ihnen. In meinen frühesten Albträumen traten entweder kilometerhohe Roboter aus Verschollen zwischen fremden Welten auf und schwangen riesige Krockethämmer (fragen Sie lieber nicht), oder sie drehten sich um jaulende Sirenen und tote weiße Himmel, schlanke Monster am Horizont von Iowa, die weniger phallisch als saurierhaft aus dem tief hängenden Himmel ragten und mit solcher Raserei hin und her peitschten, dass sie sich fast auf sich selbst zurückkrümmten und in den Schwanz zu beißen versuchten. Sie wirbelten Häcksel, Staub und Stühle herum; sie blieben am Horizont und kamen nie näher; mussten sie auch nicht.
Auf Tornado Watches und Warnungen reagierten die Einwohner von Philo wie auf den Jungen, der zu oft vor dem Wolf gewarnt hat. Man stumpfte ab. Besonders überflüssig waren die Beobachtungsposten, denn wir sahen die Stürme ja sowieso im Westen aufziehen, und wenn sie meinetwegen über Decatur angekommen waren, ließen sie sich anhand von Wolkenfarbe und -höhe schon klassifizieren: Je größer die ambossförmigen Gewitterwolken, desto höher die Aussicht auf Hagel und Warnungen; der Anblick pechschwarzer Wolken stimmte optimistischer als graue, von seltsamen Perlmutttönen durchschossene; je kürzer der zeitliche Abstand zwischen Blitz und Donner, desto schneller bewegte sich die Sturmfront, und je schneller sie sich bewegte, desto schlimmer: Wie die meisten Dinge, die einem übel mitspielen wollen, sind Tornados schnell und humorlos.
Ich weiß, warum sich meine Obsessionen mit dem Heranwachsen nicht verloren. Für mich sind Tornados Flächenverwandlungen. Wie alle ernst zu nehmenden Winde waren sie unsere kleine Dehnung der Ebene in die z-Koordinate, ein Schritt über die euklidische Monotonie von Furche, Straße, Achse und Raster hinaus. Tornados studierten wir in der Mittelstufe: Ein kanadisches Hoch bewegt sich aus den Dakotas schnurgerade nach Südosten; eine feuchte Warmfront wälzt sich aus Arkansas oder so nach Norden; das Ergebnis ist kein griechisches χ oder gar ein kartesisches Γ, sondern eine Quadratur des Kreises, ein Kringeln der Vektoren, eine Konkavierung der Kurven. Es war Alchemie, angewandter Leibniz. In unserem Teil von Central Illinois waren Tornados jener dimensionslose Punkt, in dem sich Parallelen schnitten, verwirbelten und in die Luft flogen. Sie ergaben keinen Sinn. Häuser explodierten nicht, sondern implodierten. Bordelle wurden verschont, aber die Waisenhäuser nebenan mussten dran glauben. Totes Vieh wurde fünf Kilometer von seiner Silage entfernt aufgefunden, hatte aber keinen Kratzer abbekommen. Tornados sind allmächtig und halten sich an kein Gesetz. Kraft ohne Gesetz hat keine Form, nur Richtung und Dauer. Heute glaube ich, dass ich das als Kind alles wusste, ohne es zu wissen.