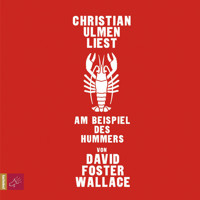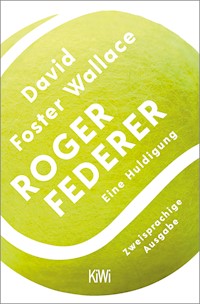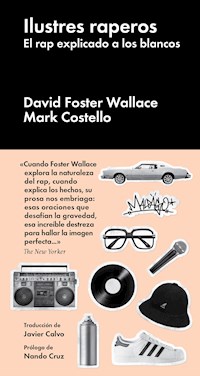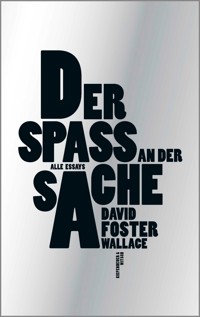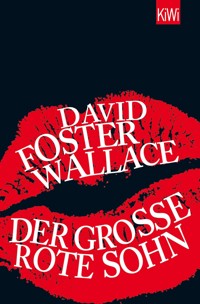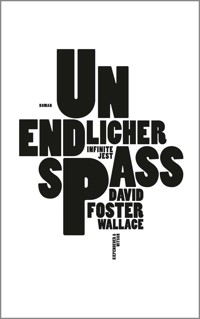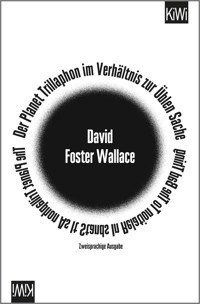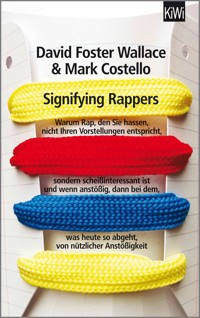9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das lustigste Buch von David Foster Wallace jetzt exklusiv bei KiWi Eine Luxuskreuzfahrt in der Karibik – David Foster Wallace hat das Experiment gewagt und sich an Bord der Zenith begeben. Eine Woche lang hat er alles mitgemacht, was das Bordleben für den erholungsbedürftigen Urlauber bereithält – von der Singleparty, zu der nur Paare kommen, bis hin zum Tontaubenschießen. »Ich habe erwachsene US-Bürger gehört, erfolgreiche Geschäftsleute, die am Info-Counter wissen wollten, ob man beim Schnorcheln nass wird, ob das Tontaubenschießen im Freien stattfindet, ob die Crew an Bord schläft oder um welche Zeit das Midnight-Buffet eröffnet wird.« »Bestes Animationsprogramm« Brigitte »Ein Meisterstück der literarischen Reportage, bis ins kleinste nautische und gruppenpsychologische Detail recherchiert« FAZ
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Foster Wallace David
Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Foster Wallace David
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Foster Wallace David
David Foster Wallace, 1962 geboren, gilt als einer der wichtigsten Vertreter der amerikanischen Literatur.
Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. »Unendlicher Spaß«, »Kleines Mädchen mit komischen Haaren«, »Kurze Interviews mit fiesen Männern«, »Der Besen im System« und »Der bleiche König«. David Foster Wallace starb am 12. September 2008.
Marcus Ingendaay, geboren 1958, übersetzt aus dem Englischen u.a. William Gaddis, William Gass und Martin Amis. Er erhielt 1997 den Übersetzerpreis der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung und 2000 den Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis. 2003 erschien sein erster Roman »Die Taxifahrerin«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eine Luxus-Kreuzfahrt in der Karibik – David Foster Wallace hat das Experiment gewagt und sich an Bord der Zenith begeben. Eine Woche lang hat er alles mitgemacht, was das Bordleben für den erholungsbedürftigen Urlauber bereithält – von der Singleparty, zu der nur Paare kommen, bis hin zum Tontaubenschießen.
»Ich habe erwachsene US-Bürger gehört, erfolgreiche Geschäftsleute, die am Info-Counter wissen wollten, ob man beim Schnorcheln nass wird, ob das Tontaubenschießen im Freien stattfindet, ob die Crew an Bord schläft oder um welche Zeit das Midnight-Buffet eröffnet wird.«
»Bestes Animationsprogramm« Brigitte
»Ein Meisterstück der literarischen Reportage, bis ins kleinste nautische und gruppenpsychologische Detail recherchiert« FAZ
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again
© 1997 by David Foster Wallace
All rights reserved
Aus dem Englischen von Marcus Ingendaay
© 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
© der deutschsprachigen Ausgabe 2002 marebuchverlag
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Sergio Pitamitz/Corbis
ISBN978-3-462-30994-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
1
Heute ist Samstag, der 18. März, und ich sitze im überfüllten Coffee-Shop auf dem Flughafen von Fort Lauderdale und versuche, die vier Stunden Wartezeit zwischen dem Auschecken auf dem Kreuzfahrtschiff und meinem Rückflug nach Chicago totzuschlagen, indem ich all das, was ich im Rahmen der soeben abgeschlossenen Reportage gesehen, gehört und getan habe, noch einmal und in hypnotischer Versenkung Revue passieren lasse.
Ich habe sacharinweiße Strände gesehen, Wasser von hellstem Azur. Ich habe einen knallroten Jogginganzug gesehen, mit extrabreiten Revers. Ich habe erfahren, wie Sonnenmilch riecht, wenn sie auf 21000 Pfund heißes Menschenfleisch verteilt wird. Ich bin in drei Ländern mit »Mään« angeredet worden. Ich habe 500 amerikanischen Leistungsträgern beim Ententanz zugeschaut. Ich habe Sonnenuntergänge erlebt, die aussahen wie nach einer digitalen Bildbearbeitung, und einen tropischen Mond, der am Himmel hing wie eine fette Zitrone – statt des spröden Gesteinsbrockens unter dem gewohnten US-Sternenzelt.
Ich habe mich sogar (wenn auch nur kurz) in eine Conga-Polonaise eingereiht.
Ich muss allerdings zugeben, dass ich wohl lediglich durch eine Art Peter-Prinzip an den Job gekommen bin. Weil nämlich eine gewisse Edelgazette von der Ostküste der Meinung war, mein erster Auftrag, ein formal nicht näher festgelegtes »Feature« über die gute alte State Fair, sei ganz gut gelaufen, haben sie mir diesmal diese superlaue Kreuzfahrt-Geschichte anvertraut, wiederum ohne jeden Hinweis darauf, was genau von mir erwartet wird. Dennoch hat sich für mich persönlich der Druck erhöht; denn betrugen die Spesen für die State-Fair-Story (die Glücksspiel-Verluste nicht eingerechnet) noch schlappe 27,00 Dollar, so müssen sie hier gleich 3000 Dollar hinlegen, bevor auch nur eine einzige – womöglich auch noch »packende« – Zeile auf dem Papier steht. Und wann immer ich mich von Bord aus, über Satellitentelefon, bei ihnen melde, versichern sie mir mit der größten Gelassenheit, ich solle mir nicht so viele Gedanken machen. Mehr kriegt man von diesen Zeitungsleuten nicht zu hören, schon gar kein ehrliches Wort. Alles, was sie wollen, behaupten sie, sei eine persönliche Doku-Postkarte im Breitwandformat. Mit anderen Worten: Junge, lass dich feudal durch die Karibik schippern und schreib einfach auf, was du gesehen hast.
Ich habe jede Menge weißer Ozeanriesen gesehen. Ich habe Schwärme winziger Fische mit fluoreszierenden Flossen gesehen. Ich habe einen dreizehnjährigen Jungen gesehen, der ein Toupet trug. (Die Fluorenz-Fische hielten sich an jeder Anlegestelle bevorzugt zwischen unserer Schiffswand und dem Beton der Kaimauer auf.) Ich habe die Nordküste von Jamaika gesehen. Ich habe die 145 Katzen im Haus von Ernest Hemingway in Key West, Florida, gesehen (gerochen übrigens auch). Ich kenne inzwischen den Unterschied zwischen einfachem Bingo und Prize-O und weiß, was ein Bingo Multi-Bonus ist. Ich habe Camcorder gesehen, für die man eigentlich einen Kamerawagen gebraucht hätte; ich habe Gepäckstücke, Sonnenbrillen und Kneifer in schreienden Neonfarben gesehen, und ich habe festgestellt, dass es über zwanzig verschiedene Marken von Badelatschen gibt. Ich habe Steeldrums gehört und Meeresschneckenbeignets gegessen und war Zeuge, wie eine Frau in Silberlamé einen gläsernen Aufzug von innen flächendeckend vollgekotzt hat. Ich habe im Zweivierteltakt von Siebzigerjahre-Discomusik den Arm gen Saaldecke gereckt, was ich seinerzeit (1977) ums Verrecken nicht getan hätte.
Ich habe erfahren, dass jenseits von Ultra-ultra-Ultramarinblau noch eine Steigerung möglich ist. Ich habe während dieser einen Woche mehr und vor allem besser gegessen als jemals zuvor in meinem Leben, und während ich dies tat, habe ich am eigenen Leib den Unterschied zwischen »Rollen« und »Stampfen« eines Schiffs bei schwerer See erlebt. Ich habe mit eigenen Ohren gehört, wie ein Alleinunterhalter vor Publikum allen Ernstes sagte: »Okay, jetzt aber Scherz beiseite …« Ich habe blasslila Hosenanzüge gesehen, Sakkos von menstrualem Rosa, braun-violette Trainingsanzüge und weiße Freizeitschuhe, die ohne Socken getragen wurden. An den Blackjack-Tischen habe ich professionelle Kartengeberinnen erlebt, die so wunderschön waren, dass man dort gern den letzten Dollar verzockt hätte. Ich habe erwachsene US-Bürger aus dem gehobenen Mittelstand gehört, erfolgreiche Geschäftsleute, die am Info-Counter wissen wollten, ob man beim Schnorcheln nass wird, ob Skeetschießen im Freien stattfindet, ob die Crew ebenfalls an Bord schläft oder um welche Uhrzeit das Midnight-Buffet eröffnet wird. Ich kenne die feinen cocktailogischen Unterschiede zwischen einem Slippery Nipple und einem Fuzzy Navel. Ich weiß, was ein Coco Loco ist. In einer einzigen Woche war ich 1500 Mal Zielobjekt des berühmten amerikanischen Service-Lächelns. Ich hatte zweimal Sonnenbrand, und zweimal hat sich die Haut geschält. Ich habe auf See Tontauben geschossen. Reicht das? Damals schien es nämlich nicht zu reichen. Ich habe den subtropischen Himmel wie ein schweres Tuch über mir gespürt. Ein Dutzend Mal bin ich zusammengezuckt bei jenem alles durchbebenden Darmwind der Götter, der da heißt Nebelhorn. Ich habe die Grundlagen von Mah-Jong in mich aufgenommen, ein zweitägiges Bridge-Turnier verfolgt (in Teilen), gelernt, wie man eine Rettungsweste über einem Smoking anlegt, und beim Schach gegen ein neunjähriges Mädchen verloren.
(Vielleicht sollte man korrekterweise sagen: Ich habe auf See nach Tontauben geschossen.)
Ich habe mit unterernährten Kindern um den Preis für Halskettchen gefeilscht. Ich kenne jede denkbare Erklärung und Rechtfertigung eines Menschen, der 3000 Dollar für eine Karibik-Kreuzfahrt ausgibt. Und ich musste mich schon sehr zusammenreißen, als mir ein echter Jamaikaner original jamaikanisches Gras anbot.
Einmal habe ich vom Oberdeck aus gesehen, wie das niagarahafte Schraubenwasser der Steuerbordschraube die auffällige Rückenflosse eines Hammerhais (nehme ich mal an) umspülte.
Ich habe Reggae als Aufzugsmusik gehört – ein Eindruck, für den mir die Worte fehlen. Ich weiß, was es heißt, wenn man vor der eigenen Toilette Angst hat. Ich habe diesen typischen Seemannsgang bekommen und wäre ihn mittlerweile gern wieder los. Ich habe Kaviar gegessen und war mit dem kleinen Jungen neben mir am Tisch einig: Das Zeug schmeckt voll abgeranzt.
Ich weiß jetzt, was sich hinter dem Begriff »Duty Free« verbirgt.
Ich kenne nun die Höchstgeschwindigkeit eines Kreuzfahrtschiffs in Knoten.[1] Ich habe viele leckere Sachen gegessen: escargots, Ente, Baked-Alaska, Lachs an Fenchel, einen Pelikan aus Marzipan und ein Omelette mit forensischen Spuren von echten oberitalienischen Trüffeln. Ich habe Leute im Liegestuhl allen Ernstes behaupten hören, es sei ja weniger die Hitze als die enorme Luftfeuchtigkeit. Ich wurde, ganz wie versprochen, von morgens bis abends und nach allen Regeln der schwimmenden Hotellerie verwöhnt. Und in dunklen Stunden habe ich Buch geführt über alle Arten von persistierenden Erythemen, Keratinosen, prämelanomischen Läsionen, Leberflecken, Ekzemen, Warzen, Zysten, Bierbäuchen, Cellulite-Fällen, Krampfadern und Besenreisern, Collagenunterspritzungen und Silikonimplantaten, misslungenen Kolorationen und Haartransplantationen, die mir unter die Augen kamen. Kurz, ich habe sehr viele fast nackte Leute gesehen, die ich lieber nicht fast nackt gesehen hätte. Ich war streckenweise so übel drauf wie seit der Pubertät nicht mehr und habe beinahe drei Mead-Kladden vollgeschrieben bei dem Versuch, herauszufinden, am wem es denn nun lag, an ihnen oder bloß an mir. Ich habe Freund- und Feindschaften fürs Leben geschlossen. Dem Hotel-Manager des Schiffes etwa, ein Mr. Dermatis, gehört mein ewiger Zorn, deshalb nenne ich ihn von jetzt an nur noch Mr. Dermatitis.[2] Mein Kellner hingegen hat sich bei mir die höchste Achtung erworben. Und dem Kabinen-Steward in meinem Abschnitt von Deck 10/Backbord, einer gewissen Petra, war ich am Ende regelrecht verfallen. Petra mit den Grübchen und dem breiten, offenen Gesicht, Petra, angetan wie eine Krankenschwester in raschelndem Weiß, stets eingehüllt in eine Wolke jenes norwegischen Zedernduft-Desinfektionsmittels, mit dem sie die Badezimmer wischte, Petra, die mindestens zehnmal am Tag jeden Quadratzentimeter meiner Kabine putzte, dabei aber nie beim eigentlichen Putzen anzutreffen war – ein zauberhaftes Wesen, das zweifellos eine eigene Doku-Postkarte wert wäre.
2
Also noch einmal und diesmal etwas genauer: Vom 11. bis 18. März 1995 unternahm ich freiwillig und gegen Bezahlung eine siebentägige Karibik-Kreuzfahrt (der Katalog spricht hier von einer 7-Night Caribbean oder »7NC« Cruise) an Bord der Zenith[3], einem 47255-Tonnen-Schiff der Celebrity Cruises Inc., einer von den über zwanzig Kreuzfahrtlinien, die von Südflorida aus operieren.[4] Das Schiff mit seiner gesamten Einrichtung zählte, gemessen an den in dieser Branche üblichen und mir jetzt bekannten Standards, zur absoluten Spitzenklasse. Die Küche war exzellent, der Service hervorragend, und sowohl bei den Landgängen als auch dem Animationsprogramm an Bord hatte man nichts dem Zufall überlassen. Das Schiff war so sauber und weiß wie nach einer Kochwäsche. Das Blaue der westlichen Karibik variierte zwischen babyfarben und einem fluoreszierenden Ultramarin, desgleichen der Himmel. Die Lufttemperatur bewegte sich im gebärmütterlichen Bereich. Die Sonne selbst schien auf maximale Annehmlichkeit voreingestellt. Auf zwei Passagiere kamen 1,2 Crewmitglieder. Wie gesagt, eine Luxus-Kreuzfahrt.
Abgesehen von einigen unbedeutenden Varianten für das Nischenpublikum ist der Typus der 7NC-Luxus-Kreuzfahrt das Grund- und Erfolgsmodell schlechthin. Alle Megalines bieten mehr oder weniger dasselbe Produkt an. Dieses Produkt ist weder eine Dienstleistung im herkömmlichen Sinn noch verspricht es von vornherein Spaß pur. (Allerdings zeigt sich rasch, dass die Hauptaufgabe des Cruise Director und seiner Leute darin besteht, genau diese Spaß-Philosophie im Gast dauerhaft zu verankern.) Im Grunde geht es also eher um ein Gefühl, das in einem selbst hergestellt wird und das insofern – als Gefühl eben – nicht mit einer Produktgarantie versehen werden kann. Das gewünschte Gefühl beruht auf einer Mischung aus Entspannung und Stimulation, stressfreiem Relaxen in Kombination mit einem touristischen Rahmenprogramm, das es in sich hat, kompromisslosem Service und Bevormundung, die unter dem Begriff »verwöhnen« läuft. Die Kataloge praktisch aller Megalines sind geradezu durchsetzt von dem Wort verwöhnen. Beispiele: »Lassen Sie sich an Bord verwöhnen wie noch nie zuvor in Ihrem Leben …«, »… und verwöhnen Sie sich in unserem Wellnessbereich mit den verschiedensten Saunen und Whirlpools …«, »Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Sie rundum zu verwöhnen«, »Gönnen Sie sich etwas. Warum lassen Sie sich nicht einmal von der milden Brise auf den Bahamas verwöhnen?«.
Die Tatsache, dass auch für andere Konsumgüter mit jener Verwöhn-Qualität geworben wird, kommt sicher nicht von ungefähr und ist den PR-Agenturen der Megalines auch nicht verborgen geblieben. Sie haben jedoch gute Gründe, voll auf dieses Zauberwort zu setzen, getreu dem Leitsatz »Penetranz geht vor Varianz«.
3
Einige Wochen vor meiner Kreuzfahrt berichteten die Nachrichten in Chicago vom Selbstmord eines sechzehnjährigen Jugendlichen. Der Junge war vom Oberdeck eines Luxuskreuzers (entweder der Carnival- oder der Crystal-Linie) in den Tod gesprungen, der Medienversion nach aus Liebeskummer, als Reaktion auf eine unglückliche Liebelei an Bord. Ich persönlich aber glaube, dass noch etwas anderes im Spiel war, etwas, über das man in einer Nachrichtenstory nicht schreiben kann.
Denn alle diese Kreuzfahrten umgibt etwas unerträglich Trauriges. Und wie bei den meisten unerträglich traurigen Sachen ist die Ursache komplex und schwer zu fassen, auch wenn man die Wirkung sofort spürt: An Bord der Nadir überkam mich – vor allem nachts, wenn der beruhigende Spaß- und Lärmpegel seinen Tiefpunkt erreichte – regelrecht Verzweiflung. Zugegeben, das Wort Verzweiflung klingt mittlerweile ziemlich abgegriffen, doch es ist ein ernstes Wort, und ich verwende es im Ernst. Für mich bedeutet Verzweiflung zum einen Todessehnsucht, aber verbunden mit dem vernichtenden Gefühl der eigenen Bedeutungslosigkeit, hinter der sich wiederum die Angst vor dem Sterben verbirgt. Elend ist vielleicht der bessere Ausdruck. Man möchte sterben, um der Wahrheit nicht ins Auge blicken zu müssen, der Wahrheit nämlich, dass man nichts weiter ist als klein, schwach und egoistisch – und dass man mit absoluter Sicherheit irgendwann sterben wird. In solchen Stunden möchte man am liebsten über Bord springen.
Ich wage einmal die Voraussage, dass der Redakteur die letzten Sätze streichen wird. Aber egal, so viel zur Person muss erlaubt sein. Denn für einen wie mich, der bis zu dieser Kreuzfahrt noch nie auf See gewesen ist, war der Ozean immer gleichbedeutend mit Grauen und Tod. Als Kind lernte ich die Einzelheiten sämtlicher bekannt gewordener Haiangriffe auswendig. Aber nicht einfach nur Angriffe, sondern vornehmlich solche mit tödlichem Ausgang. Beispielsweise den Fall Albert Kogler vor Baker’s Beach, Kalifornien 1959 (Weißer Hai). Oder das Schlachtfest nach dem Untergang der USS Indianapolis, 1945 als Folge eines Torpedoangriffs in philippinischen Gewässern (beteiligt: eine Vielzahl von Arten, laut offizieller Darstellung hauptsächlich Tiger- und Blauhaie).[5] Oder der Hai mit der höchsten Opferrate, 1916 vor Matawan/Spring Lake, New Jersey (abermals ein Weißer Hai; aber sie fingen auch einen Menschenhai, in dessen Gastrointestinaltrakt menschliche Körperteile gefunden wurden (ich weiß sogar, welche und von wem). In der Schule habe ich drei verschiedene Aufsätze über das Kapitel »Der Verstoßene« aus Moby-Dick geschrieben, wo Pip, der Schiffsjunge, über Bord geht und in der unendlichen Leere des Ozeans den Verstand verliert. Und wann immer ich heute als Lehrer vor einer Schulklasse stehe, gebe ich den Schülern Stephen Cranes »Das offene Boot« zu lesen – und verstehe jedes Mal die Welt nicht mehr, wenn die Kids diese Albtraum-Geschichte entweder langweilig oder viel zu reißerisch finden. Dabei möchte ich ihnen doch nur etwas von demselben ozeanischen Grauen vermitteln, das auch ich immer empfunden habe, eine Ahnung vom Meer als urzeitlichem nada, als bodenlosem Nichts, von Tiefen, aus denen feixende, zahnbewehrte Kreaturen zu dir aufsteigen, so schnell, wie eine Feder zu Boden schwebt. Jedenfalls meldete sich auf dieser Luxus-Kreuzfahrt[6] mein atavistischer und lange unterdrückter Hai-Horror-Tick verstärkt zurück und ließ mich wegen der einen (mutmaßlichen) Haiflosse, die ich steuerbords entdeckt hatte, ein solches Theater aufführen, dass mir meine Tischgenossen von Tisch 64 schließlich mit größtmöglichem Takt bedeuteten, ich möge endlich die Klappe halten.
Ebenfalls kein Zufall ist, dass diese 7NC-Luxus-Kreuz-fahrten vor allem ältere Leute ansprechen. Ich meine nicht steinalt-abgelebt, sondern die Altersgruppe der Über Fünfzigjährigen, denen die eigene Hinfälligkeit kein abstrakter Begriff mehr ist. Tagsüber fiel es besonders auf: Die teilentblößten Leiber, die ich auf der Nadir zu sehen bekam, befanden sich in mannigfaltigen Stadien körperlichen Zerfalls. Wie ja das Meer überhaupt eine einzige große Zersetzungsmaschine ist. (Das Wasser, wie ich feststellen musste, so rachenspülungssalzig, sein Gischthauch so korrosiv, dass ich die Gelenke meiner Brille wohl reparieren lassen muss.) Meerwasser zerstört jedes Schiff in erstaunlichem Tempo, verwandelt Stahl in Rost, lässt Farben sich pellen, Lacke bröseln, vernichtet Glanz, überzieht Bordwände mit Muscheln und Algen und einem allgegenwärtigen maritimen Schmodder, der wie der Tod selber scheint. In den Häfen ließ sich das ganze Elend gut beobachten. Der Horror: Kähne, die aussahen wie in Säure und Scheiße getaucht, über und über mit Ausschlag bedeckt, Rost und Schleim, zerfressen von dem, worin sie schwimmen.
Nicht so die Schiffe der Megalines. Sie sind allesamt weiß und sauber, denn ihr Zweck ist nicht zuletzt, den calvinistischen Triumph von Kapital und Industrie über die archaische Zerstörungskraft der See zu repräsentieren. Die Nadir beschäftigte ein ganzes Bataillon von wuseligen Drittweltgestalten, die in ihren blauen Overalls tagein, tagaus das Schiff nach etwaigen Zeichen beginnenden Gammels absuchten. Der Autor Frank Conroy (»Alle Zeit der Welt«) schreibt in einer Art Werbeessay auf den ersten Seiten des Celebrity-Cruises-Katalogs: »Ich betrachtete es als eine Art persönliche Herausforderung, irgendwo an Bord ein Zeichen mangelhafter Wartung zu entdecken, ein angelaufenes Messingteil, eine angestoßene Reling, ein Schmutzfleck auf dem Deck, ein lockeres Kabel, irgendetwas, das nicht hundertprozentig tipptopp war. Endlich, gegen Ende der Reise, fand ich, was ich suchte, ein Gangspill[7] mit einer etwa halbdollargroßen Roststelle auf der Außenbordseite. Allerdings wurde meine Freude über den winzigen Makel jäh unterbrochen, als ein Matrose mit Farbeimer und -roller anrückte. Ich konnte zusehen, wie er die komplette Gangspill frisch anstrich und sich mit einem kurzen Nicken wieder entfernte.«
Denn darum geht es. Ein Urlaub bedeutet Schonung vor den Unannehmlichkeiten des Lebens, und da das Wissen um Tod und Untergang mit ziemlicher Sicherheit unangenehm ist, mag es verwundern, warum der alternative amerikanische Traumurlaub ausgerechnet darin besteht, in eine archaische Todesmaschine gepfercht zu werden. Doch auf einer 7NC-Luxus-Kreuzfahrt arbeitet man geschickt am Traum vom Sieg über eben diesen Tod und Untergang. Eine Methode des Siegs über den Tod besteht in eiserner Ertüchtigung; die überbordenden Wartungsanstrengungen der Nadir-Mannschaft finden ihre plumpe Entsprechung im Aufbauprogramm für die Passagiere: Diät, Fitnessübungen, Megavitamin-Nahrungsergänzungs-Schnickschnack, kosmetische Chirurgie, Frank-Quest-Zeitmanagement-Seminare usw.
Natürlich gibt es, Stichwort Tod, noch eine zweite Möglichkeit. Nicht durch Ertüchtigung, sondern durch Erregung. Nicht durch harte Arbeit, sondern durch gnadenloses Vergnügen. Schier unübersehbar ist der 7NC-Veranstaltungskalender mit seinen Spiel- und Spaßaktivitäten. Bordfeste, Disco und Bühnenshows verbreiten eine permanente Partylaune, kitzeln das Adrenalin, machen müde Knochen munter. Hier spielt die Musik, pulsiert das Leben. Welche unglaublichen Weiterungsmöglichkeiten der Existenz![8] Allerdings wird die Todesfurcht nicht so sehr überwunden als ausgeblendet. »Nach dem Dinner treffen Sie sich mit Ihren Freunden[9] in der Lounge, ehe es heißt ›Vorhang auf für unser Showprogramm!‹. Doch damit nicht genug. Spätestens nach dem begeisterten Applaus wird jemand aus Ihrem Freundeskreis[10] die Frage stellen: ›Und was machen wir jetzt?‹ Wie wäre es mit einem Abstecher ins Kasino oder in die Disco? Oder lieber zu einem ›Absacker‹ in unsere stilvolle Pianobar? Oder was halten Sie von einem Spaziergang auf Deck, unter dem sternglänzenden Nachthimmel? Der Möglichkeiten sind viele, und es wäre nicht verwunderlich, wenn Sie am Ende sagten: ›Warum nicht alles zusammen? Let’s do it all!‹«
Okay, das klingt nicht gerade nach Dante, und dennoch ist der 7NC-Katalog ein geniales und wirkmächtiges Mittel der Verführung. Katalog ist übrigens untertrieben, das Ding ist ein veritables Hochglanzmagazin mit aufwendigem Layout und künstlerisch gestalteten Fotostrecken von niveauvollen, braun gebrannten Paaren[11] unter dem Einfluss eines Grinskrampfs der Verzückung. Alle großen Kreuzfahrtlinien geben solche Kataloge heraus, und sie sind im Grunde austauschbar. Im Mittelteil findet man eine Aufstellung der verschiedenen Routen und Reiseangebote. Auf einer 7NC-Standardversion geht es entweder in die westliche Karibik (mit Jamaika, den Kaiman-Inseln, Cozumel), in deren östlichen Teil (Puerto Rico, Jungferninseln) oder in Gewässer namens »Deep Caribbean« (mit Martinique, Barbados, Mayreau). Außerdem gibt es auch zehn- oder elftägige sogenannte »Ultimate Caribbean Packages«, sie führen an so ziemlich jeden exotischen Küstenstreifen zwischen Miami und dem Panama-Kanal. Eine detaillierte Preisliste[12], Pass- und Zollbestimmungen und allgemeine Reisehinweise beschließen den Katalog.
Der Anfangsteil hingegen ist derjenige, der einen wirklich packt: diese Fotos, diese kursiv gesetzten (ausschließlich begeisterten) Zitate aus Reiseführern und Fachpresse, diese Traumkulissen und lyrischen Schilderungen der Celebrity-Cruises-Erlebniswelt! Man kann sagen, was man will, aber diese Hefte machen Lust auf mehr. Allein die goldunterlegten Hypertext-Kästen, in denen Sachen stehen wie EINFACH DIE SEELE BAUMELN LASSEN oder ENTSPANNUNG WIRD IHNEN ZUR ZWEITEN NATUR … oder DEN ALLTAGSSTRESS VERGESSEN. Solche Versprechungen weisen auf einen dritten Weg metaphysischer Todesverdrängung, den die Nadir ihren Passagieren zu bieten hat, einen Weg, der ohne Ertüchtigung oder Erregung auskommt und der die eigentliche Verheißung einer 7NC darstellt.
4
»Allein an der Reling zu stehen und den Blick aufs Meer hinausschweifen zu lassen, hat eine ungemein beruhigende Wirkung. Während Sie wolkengleich über den Wellen schweben, fällt jeglicher Ballast von Ihnen ab, und es scheint, als lächle die ganze Welt Ihnen zu. Nicht nur die Mitreisenden, nein, auch die Mannschaft. Als der Steward Ihnen freudig den Drink reicht, erwähnen Sie die vielen fröhlichen Gesichter unter der Crew. Der Steward erklärt Ihnen, dass jeder Celebrity-Mitarbeiter persönlich dafür Sorge trägt, dass es Ihnen – als ihrer aller Ehrengast – auf dieser Reise an nichts mangelt.[13] Dies sei auch der Grund, fügt er hinzu, dass er sich nicht vorstellen könne, jemals woanders zu arbeiten als auf diesem Schiff. Ihnen genügt ein Blick hinaus aufs Meer, um ihm von ganzem Herzen zuzustimmen.«
Der 7NC-Katalog von Celebrity Cruises schwelgt in der dritten Person Plural. Und das nicht ohne Grund. Die 7NC-Erlebniswelt wird nämlich nicht nur einfach beschrieben, sondern geradezu heraufbeschworen. Die heimliche Verführung liegt nicht so sehr darin, dass der Text die Fantasie anregt, sondern dass er Fantasien konstruiert. Natürlich handelt es sich letztlich nur um Werbung, aber diese Werbung besitzt einen eigenartig autoritären Zug. Normale Werbung zeigt attraktive Menschen, die in einer produktbezogenen Situation fast schon unerlaubt viel Spaß haben, und der Konsument darf sich durch den Kauf des Produkts in diese heile Welt hineinfantasieren. Normale Werbung schmeichelt der Entscheidungsfreiheit des Konsumenten insofern, als sie den Kauf des Produkts zur Bedingung für seinen Eintritt in eine Fantasiewelt macht. Im Grunde werden nur Fantasien verkauft, aber ein konkreter Bezug zu dieser Fantasiewelt fehlt ebenso wie ein direktes Versprechen. Normale Werbung, soweit sie sich an Erwachsene richtet, ist im Kern also höchst zurückhaltend.
Man vergleiche dies mit dem Druck, den die 7NC-Kataloge auf den Konsumenten ausüben, die fast gebieterische Ansprache in der dritten Person Plural und eine Detailversessenheit, die sogar die Reaktion des Konsumenten vorausnimmt (»Sie werden sagen: ›Dem kann ich nur von ganzem Herzen zustimmen.‹« Oder: »Sie werden sagen: ›Warum nicht alles zusammen? Let’s do it all!‹«). In diesen Katalogen erspart man dem Konsumenten die Fantasiearbeit, denn die hat der Katalog bereits geleistet. Solche Werbung schmeichelt zwar nicht der Entscheidungsfreiheit des erwachsenen Konsumenten, ja, ignoriert sie noch nicht einmal, sondern ersetzt sie.
Diese autoritäre, beinahe fürsorgliche Werbung enthält ein Versprechen eigener Art, ein teuflisch buhlerisches Versprechen, das in gewisser Weise schon wieder ehrlich ist, da auf der beworbenen Kreuzfahrt tatsächlich mit allen Mitteln an seiner Erfüllung gearbeitet wird. So wird einem beispielsweise nicht versprochen, dass man auf einer Kreuzfahrt viel Spaß haben kann, sondern dass man ihn haben wird,