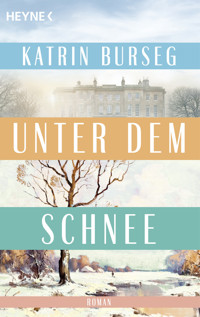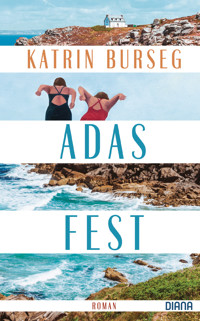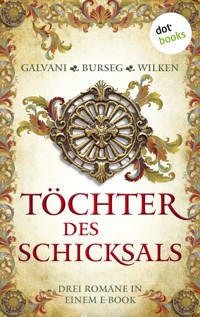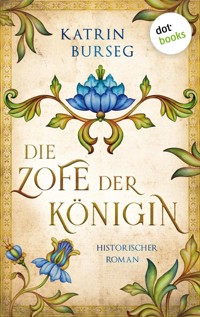Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mutig erkämpft sich eine Frau ihren Weg in der Welt der Männer und Herrschenden: Der Historienroman »Der Sternengarten« von Katrin Burseg als eBook bei dotbooks. Schloss Gottorf bei Schleswig, 1640. Nach dem Tod ihrer Eltern und dem Verschwinden des Bruders muss Sophie ihr Schicksal selbst in die Hände nehmen: Am Hof von Friedrich III. erhofft sie sich eine Anstellung, um die Kunst des Gartenbaus zu erlernen –das ist ihr allerdings nur als Mann möglich. Zunächst scheint ihr die Täuschung zu gelingen und die wahnwitzigen Pläne des Herzogs, ein riesiges Planetarium als achtes Weltwunder zu errichten, verlangen ihr alles an Raffinesse und Erfindungsgeist ab. Doch als sie sich in Farid verliebt, wird ihre Position am Hof immer gefährlicher: Der junge Perser ist für den Herzog nichts weiter als ein Souvenir der letzten Orientexpedition, aber wenn Sophie enttarnt würde, hätte sie weniger Rechte als er. Schon bald drohen die Geheimnisse ihrer Vergangenheit Sophie einzuholen – und stellen sie vor eine schicksalshafte Entscheidung … »Eine herrliche Zeitreise ins Barock«, empfiehlt die TV Movie, »Eine tolle Mischung aus Historie und Drama«, sagt die Zeitschrift Tina. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der bewegende historische Roman »Der Sternengarten« von Katrin Burseg. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schloss Gottorf bei Schleswig, 1640. Nach dem Tod ihrer Eltern und dem Verschwinden des Bruders muss Sophie ihr Schicksal selbst in die Hände nehmen: Am Hof von Friedrich III. erhofft sie sich eine Anstellung, um die Kunst des Gartenbaus zu erlernen –das ist ihr allerdings nur als Mann möglich. Zunächst scheint ihr die Täuschung zu gelingen und die wahnwitzigen Pläne des Herzogs, ein riesiges Planetarium als achtes Weltwunder zu errichten, verlangen ihr alles an Raffinesse und Erfindungsgeist ab. Doch als sie sich in Farid verliebt, wird ihre Position am Hof immer gefährlicher: Der junge Perser ist für den Herzog nichts weiter als ein Souvenir der letzten Orientexpedition, aber wenn Sophie enttarnt würde, hätte sie weniger Rechte als er. Schon bald drohen die Geheimnisse ihrer Vergangenheit Sophie einzuholen – und stellen sie vor eine schicksalshafte Entscheidung …
Über die Autorin:
Katrin Burseg, geboren 1971 in Hamburg, wuchs auf einem über hundert Jahre alten Bauernhof in Schleswig-Holstein auf. Ihr Faible für Geschichte und Romane ließ sie Kunstgeschichte und Literatur studieren, bevor sie als Journalistin arbeitete. Sie hat mehrere historische Romane veröffentlicht und erhielt für ihren Roman »Liebe ist ein Haus mit vielen Zimmern« 2016 den Delia Literaturpreis für Liebesromane. Mit ihrem Roman »Unter dem Schnee« erreichte sie 2021 ein großes Publikum. Katrin Burseg, die auch unter den Pseudonymen Karen Bojsen und Karen Best veröffentlicht, mag alte Bäume und Spaziergänge am Wasser, sie hört gerne klassische Musik und liebt die überraschenden Abenteuer beim Schreiben. Mit ihrer Familie lebt sie in Hamburg und an der Nordsee.
Die Autorin im Internet: www.katrinburseg.de
Bei dotbooks veröffentlichte sie bereits ihre historischen Romane »Die rebellische Königin« und »Die Zofe der Königin« sowie unter den Namen Karen Best den Roman »Unter den wilden Sternen Australiens«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2024
Copyright © der Originalausgabe 2013 Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock.
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98690-899-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der Sternengarten«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Katrin Burseg
Der Sternengarten
Historischer Roman
dotbooks.
»Non est mortale quod opto.«
»Was ich begehre, ist nicht sterblich.«
Herzog Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf
Prolog
Amsterdam. Zuversichtlich und stolz erhoben sich die Häuser der Schönen in ihrem Rücken. Dächer, Türme und Flaggen kündeten vom Selbstbewusstsein der reichen Stadt. Paläste, Kirchen und der Grachtengürtel aus schimmernden Kanälen schmückten das Bild der Kapitale. Und die Handelsmetropole wuchs – überall stachen Winden und Kräne wie Fabelwesen in den schiefergrauen Himmel.
Sophie spürte ein Zittern, das durch ihren Körper fuhr, und sie atmete schwer. So weit also war sie gekommen! Doch das war erst der Anfang. Die Reise würde sie noch weiter führen, über das Meer, durch die Wüste, in den Sonnenaufgang hinein, bis nach Persien. Bis nach Isfahan.
Isfahan – die Perle der Welt! Sie hörte seine Stimme, Liebe und Zuneigung schwangen darin. Die Sehnsucht ließ sie zusammenzucken, sie stolperte, suchte einen Halt. Ihr Blick fiel auf die Teekisten, die sich auf dem Kai stapelten. Seufzend setzte sie sich auf eine davon und zog den schweren Beutel auf ihren Schoß. Das Buch war darin, ihre Aufzeichnungen und Notizen über das Gottorfer Mirakel, das geheime Wissen über das noch junge Wunderwerk. Auf den Wassern des IJ schwamm das Mittagslicht, von den Reflexionen des Meeresarmes geblendet schloss sie für einen Moment die Augen.
»Unterwegs?« Die fremde Stimme klang freundlich, fast besorgt. Ein Schatten fiel auf sie herab.
Sophie öffnete die Augen. Ein älterer Herr stand vor ihr, auf einen geschnitzten Gehstock gestützt. Der schon sprichwörtliche Reichtum der Amsterdamer Kaufleute kleidete ihn in ein teures Gewand, Fuchsfell säumte den Kragen. Unter dem dichten, grauen Bart lugte ein Pfeifchen hervor, der Seewind trug den Rauch davon. Er sah sie unverwandt an. Sein neugieriger Blick ließ für einen Moment den jungen Burschen aufleben, der er einst gewesen war.
»Ja, Mijnheer.« Sie nickte zaghaft und zeigte auf das Handelsschiff der Kompanie, das rechts vor ihnen lag. Ungeduldig flatterte die rot-weiß-blaue Flagge am Heck des Seglers. »Morgen legen wir ab ...«
»Hunger?« Aus einem Beutel, der an seinem Gürtel hing, zog der Alte ein Stückchen Kuchen hervor. Er zwinkerte listig. Der Duft nach Zimt, Anis und Piment stieg ihr in die Nase.
»Danke.« Sie zitterte, als sie nach dem braunen Kuchen griff. Sanft legte er die Süßigkeit in ihre Hände, dann ließ er sich umständlich an ihrer Seite nieder.
»Isfahan also«, brummte er und deutete wieder auf den Segler, der sich an den Festmacherleinen auf und ab bewegte. »Bin auch zur See gefahren, als ich noch jünger war. Für die Kompanie ... Damals habe ich Gottes wunderbare Welt gesehen. Aber Isfahan ...« Er zog an seiner Pfeife. »Was für eine Pracht! Die Moscheen, der kaiserliche Platz, der große Schah Abbas nannte ihn Naqsch-e Dschahān – den Plan der Welt.«
Der Plan der Welt. Sophie nickte, sie hatte davon gehört. Er hatte ihr davon erzählt, von der gewaltigen Moschee des Schahs, von ihrer weiten Kuppel, den farbigen Fayencen und Mosaiken, die sie schmückten. Die Ornamente zeigten Blumenmotive, Pflanzenranken und Kalligrafien heiliger Texte. Und dann die Farben: Türkis, Kobalt, Lapislazuli und Ocker wechselten einander ab. Die glänzende Oberfläche der Kuppel spielte mit den auf sie fallenden Sonnenstrahlen. Der Schmuck, die Farben, das flirrende Licht erzeugten einen Rausch. Wie Musik – so hatte er es ihr beschrieben. Er hatte die Sehnsucht nach Isfahan nie ganz verloren.
»Es ist wie ein Blick in das Paradies.« Die Stimme des Alten klang wehmütig, er zog noch heftiger an seiner Pfeife. »Der Mensch wird daran erinnert, dass er Kostbares in seinem Inneren trägt.«
Sophie schwieg, eine Böe zerrte an ihren Kleidern, tollkühn und lachend segelten die Möwen mit dem Wind. Wieder schloss sie die Augen. Dann, wie eine mächtige Welle, rollten Bilder über sie hinweg. Plötzlich sah sie den Sternenglobus vor sich, das Gottorfer Wunderwerk, seinen himmlischen Glanz. Nie zuvor war ein Projekt derartigen Ausmaßes gewagt worden. Als seien sie etwas Lebendiges, zogen Sterne ihre Kreise darin. In ihrem Kopf hörte sie das Wispern der Zeit. Wie in einem Buch blätterte sie in ihren Erinnerungen und suchte nach dem Beginn dieser merkwürdigen Reise, die ihr Leben bislang gewesen war.
Schleswig. Das war ihr Fixpunkt, jetzt sah sie ihre Heimatstadt vor sich, die vom Frost überzogene Silhouette. Ja, dachte sie, so hatte alles angefangen, damals, zu einer anderen Zeit. Ein Kind war geboren worden in jener entsetzlichen Winternacht, von der man heute noch sprach. Ein Sturm aus Nordost hatte Schnee vor sich hergetrieben, der die Felder mit einer Kruste aus Eiskristallen überzog. Und auf der Schlossinsel in der Schlei hatte sich ein Ungetüm gegen die Kälte gestemmt: Schloss Gottorf, mit vier Flügeln und drei Geschossen, Trutzburg und Hauptsitz der Herzöge von Schleswig-Holstein-Gottorf, war dem Schneesturm trotzig begegnet. Silbernes Licht drang aus den Fenstern, Eisblumen rankten auf den bleigefassten Scheiben und von den Traufen des Gemäuers wuchsen Zapfen aus Eis in die Nacht – funkelnd, wie Lanzen aus geschliffenem Glas.
Noch mehr Bilder strömten auf Sophie ein. Und nun, während sie am Ufer des Ijsselmeeres saß, ihre Augen wieder öffnete und über das Wasser blickte, musste sie daran zurückdenken. Sie konnte sich nicht gegen die Erinnerungen wehren. Und sie wollte auch nicht allein sein mit diesen Bildern.
»Wollen Sie eine Geschichte hören, Mijnheer?«, flüsterte sie und drehte sich zu dem Alten. Sie sah seinen wachen Blick, die Güte darin. Ohne seine Antwort abzuwarten, begann Sophie zu sprechen. Sie erzählte von der Geburt des Kindes und von seinen fürstlichen Eltern. Von den Astrologen, die dem Neugeborenen Glück prophezeit hatten und von dem prunkvollen Tauffest, das der Welt die Bedeutung des Hauses und des kleinen Fürstentums vor Augen führen sollte.
»Eisstückchen trieben auf dem heiligen Wasser, als man den Täufling über die bronzene Schüssel hielt«, sagte sie und sah dabei das Schimmern der Kerzen und die Pracht des Schleswiger Doms vor sich. »Hofprediger Jacob Fabricius zitterte in seinem dünnen Ornat, trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, das Taufwasser einen Moment in der Hand anzuwärmen, bevor er das Köpfchen des jungen Herzogs damit benetzte und das Sakrament der Taufe vollzog. Der fürstliche Erbe erhielt den Taufnamen Friedrich – ein ebenso großer wie vielversprechender Name, der sowohl bei den Gottorfer Herzögen als auch im Königshaus der dänischen Verwandten beliebt war.«
Auch das Volk, das dem Spektakel vor dem Dom gefolgt war, hatte dem Täufling und seinen fürstlichen Eltern fröstelnd Respekt gezollt. Als sich ein Sonnenstrahl durch die schwere, eisgraue Wolkendecke verirrt und die Kutsche der herzoglichen Familie für wenige Sekunden golden überzogen hatte, war ein Raunen durch die Menge gegangen. Gott habe ihnen in einem unbedachten Moment einen Engel auf die Erde hinabgesandt, hatten die Leute ehrfürchtig geflüstert und der Frost hatte ihre Worte in flüchtigen Wolkenbildern davongetragen.
»Der junge Herzog Friedrich wuchs in dem Bewusstsein auf, dass Familie und Untertanen Großes von ihm erwarteten«, fuhr Sophie fort. Sie sah, dass der Alte ihren Worten fasziniert lauschte. »Der Junge war wissbegierig und hell, schon früh begann die religiöse Erziehung des Kindes, danach folgten die antiken Autoren, die lateinische und griechische Sprache. Das Wissen des Altertums, die sieben freien Künste, stand ebenso auf dem fürstlichen Stundenplan wie die Theologie, die Königin aller Wissenschaften. Wie es Sitte war, schickte Herzog Johann Adolf seine beiden ältesten Söhne auch auf eine Reise ins Ausland, um dort ihre Erziehung zu vollenden.«
Die Reisegesellschaft war im Mai anno 1615 gen Süden aufgebrochen, über Frankfurt, Worms und Speyer reisten die Fürstensöhne nach Straßburg und Paris. Nie waren die beiden jungen Kavaliere freier gewesen, nie hatten sie sich glücklicher gefühlt, doch ein Brief aus dem Norden hatte ihr seliges Dasein jäh beendet. Denn auf Schloss Gottorf war der erst einundvierzigjährige Herzog Johann Adolf verstorben. Sobald der junge Herzog die Nachricht empfangen hatte, legte er Trauerkleidung an und erteilte seinen ersten Befehl. Die Zeit der sorglosen Tagträumereien war beendet. Unter seinem Kommando machte die Reisegesellschaft sich auf den Rückweg nach Schleswig.
»Im Dezember 1618 erkannten die Ritter Herzog Friedrich ohne vorangegangene Wahl als ihren neuen Landesherrn an und huldigten ihm«, fuhr Sophie fort. »Friedrich III., der Erbe von Norwegen, Herzog von Schleswig, Holstein, Stormarn und Dithmarschen, Graf von Oldenburg und Delmenhorst, war bereit, die Welt mit Gottes Hilfe zu erobern.«
Sophie holte tief Luft, sie zitterte im Wind. Frierend schlang sie das wollene Tuch fester um ihren Körper.
Der Alte schüttelte den Kopf. »Komm Meisje ...«, sagte er und fasste sie sanft am Arm. »Komm heute Nacht mit zu mir. In meiner Stube gibt es einen Ofen. Und noch mehr Kuchen und heißen Wein. Und dann erzählst du mir, wie du in diese Geschichte geraten bist.«
Buch 1Herzogtümer in Schleswig und Holstein
1640–1645
Anno 1640
Kapitel 1
Das Schwert sauste hinab und traf den Mann im Nacken. Mit einem glatten Schnitt trennte es den Kopf vom Körper. Blut schoss aus dem Hals und der Kopf des Hingerichteten rollte vom Block in den Sand. Die Augenbinde rutschte nach oben. Während der Scharfrichter ungerührt sein Schwert reinigte, traf der starre Blick des Toten die Menge.
Es war vorbei. Doch die Menschen auf dem Richtplatz am Schloss brachen an diesem Tag nicht in Jubel aus. Sie schwiegen betroffen.
»Ein guter Schlag«, wisperte einer der Männer, die sich vor Sophie drängten. »Die Engel des Herrn haben seine Seele bereits empfangen.«
»Vor ein paar Jahren hat er sich noch wie ein König aufgeführt«, flüsterte ein anderer. »Erinnerst du dich, wie die Gesandten des Herzogs nach Persien aufbrachen? Ein prächtiger Zug war das damals, mehr als achtzig Männer. Und Otto Brüggemann führte sie an. Stolz und eitel ritt er an der Spitze der fürstlichen Gesellschaft.«
Sophie spitzte die Ohren. Vorsichtig drückte sie den Säugling in ihren Armen an die Schulter und stützte sein Köpfchen.
»Sein Stolz hat ihm das Genick gebrochen.«
»Ach was, der Halunke hat den Herzog betrogen.« Mit einer Kopfbewegung wies der Mann, der als Erster gesprochen hatte, auf Herzog Friedrich, der die Hinrichtung von einem Podest aus verfolgt hatte.
Soeben stand der Herrscher auf und wechselte ein paar Worte mit seinem Kanzler. Im nächsten Moment winkte er den Scharfrichter zu sich. Sophie sah, dass man dem Henker etwas in die Hand drückte. Im klaren Licht der Mittagssonne leuchtete das Gesicht des Herzogs auf. Sophie dachte, dass sich Erleichterung darauf spiegele. Dann wandte sich der Landesherr ab. Von seinem Gefolge und Lieblingshund begleitet, zog Herzog Friedrich sich in sein Schloss zurück.
»Der Scharfrichter bekommt zwölf Taler für den Schlag, kein schlechter Lohn.« Ein Dritter mischte sich in das Gespräch ein. Langsam kehrte wieder Leben in die Menge zurück. Nachdem der Herzog den Platz verlassen hatte, begannen die Schaulustigen sich zu zerstreuen.
»Ein Pappenstiel.« Der Erste schüttelte den Kopf und ergriff erneut das Wort. »Die Persienreise hat den Herzog wohl mehr als Hunderttausend Taler gekostet. Sechs lange Jahre – und alles umsonst. Der Orienthandel hat Schleswig noch immer nicht erreicht, und die Wasser der Ostsee werden sich wohl nie mit den Fluten der Westsee zusammenführen lassen.«
Die Männer kamen in Fahrt. Sophie betrachtete sie genauer. Die Herren trugen Jacken aus festem, dunklem Tuch und hohe Stiefel aus Leder. Unter den Kappen quoll halblanges Haar hervor und in jedem Gürtel steckte ein Dolch oder Schiffsmesser. Tabakrauch hüllte die Gruppe in eine Wolke bescheidenen Wohlstands. Sophie kannte die Männer nicht, doch sie nahm an, dass es sich um Kaufleute handelte. Vielleicht kamen die drei aus dem nahen Flensburg?
»Aber die Idee ist gut und der Herzog wird sich hoffentlich nicht entmutigen lassen«, widersprach der Zweite und in seinen satten, schweren Körper kam Bewegung. »Friedrichs Männer sind immerhin über die Kaspi-See bis nach Isfahan gekommen, seine Gesandten haben mit dem russischen Zaren und mit dem Schah von Persien verhandelt. Und der Gedanke, einen durchgängigen Wasserweg von Ost nach West zu schaffen, den auch die größten Schiffe noch befahren können, drängt sich doch förmlich auf. Mit kleinen Kähnen könnte man ja heute schon bis zum Flemhuder See und zur Eider fahren. Und von dort einen Kanal bis zur Levensau zu bauen, ist nicht unmöglich. An der Eider könnte dann Friedrichstadt zum Umschlag- und Stapelplatz für den Orienthandel werden und wir würden den Holländern ihren Reichtum wohl streitig machen.«
Der Kaufmann wandte sich um, wobei sein Blick auf Sophie fiel, die ihr neugieriges Gesicht schnell zur Seite drehte und zu Boden sah. »Man stelle sich vor«, fuhr er fort, »ein Schiff aus dem russischen Ladoga, beladen mit Pelzen, schillernder Seide und anderen Kostbarkeiten aus dem Orient, fährt die kürzere Route über die Kaspi-See, überquert die Ostsee, fährt die Eider hinab und gleich weiter in die Westsee bis nach Amsterdam, London oder Manchester, um dort englisches Tuch und Eisenwaren zu laden. Warum soll das nicht gehen? Alles ist möglich.«
Seine Begleiter drehten sich ebenfalls um und nickten nachdenklich, während sie über die Süderbrücke hinunter auf die Stadt blickten.
»Das wäre ein Segen für das Land«, nahm der Dritte den Faden wieder auf. »Die Zolleinnahmen brechen weg«, murrte er. »Viele Händler suchen sich kleinere Orte und unbekannte Furten, wo sie ihre Waren ohne Zoll anlanden können oder die Zöllner gegen eine kleine Gefälligkeit beide Augen zudrücken. Ochsenzoll, Brückenzoll, Hafenzoll, Sundzoll ...«, zählte er verdrießlich auf. »Den ehrlichen Kaufleuten langen König und Herzog immer tiefer in die Tasche, während die Gauner sich auf Schleichwegen vor allen Abgaben drücken.«
»Du hast recht, so kann es nicht weitergehen. Uns bleibt ja kaum noch etwas in der Börse.« Nachdenklich spielte der Kaufmann mit dem kalt schimmernden Dolch in seinem Gürtel, dann schaute er auf Sophie. Sein Blick wanderte über ihren Körper, der in einem abgetragenen Kleid aus Nesselstoff steckte, und streifte die nackten Füße in den viel zu großen Holzpantinen, bevor er auf dem Bündel in ihren Armen ruhen blieb. »So kann es nicht weitergehen«, murmelte er noch einmal kopfschüttelnd. Im Davongehen schob er dem Mädchen mit einem freundlichen Nicken eine Münze in die Hand.
Begeistert und bestürzt zugleich starrte Sophie auf das Geldstück. Auf dem halben Taler prangte das Bild des dänischen Königs, sie erkannte das markante Profil. Der Herr musste sie für eine Bettlerin gehalten haben. Heiß stieg ihr die Schamesröte ins Gesicht, doch dann lachte sie auf, und ihre grünen Augen blitzten.
»Das ist unser Glückstag«, flüsterte Sophie, übermütig drückte sie ihre kleine Schwester an sich. Mit tänzelnden Schritten machte sie sich auf den Rückweg in die Stadt, deren Häuser sich dunkel vor der schimmernden Furt der Schlei abhoben.
Als die Kleine in ihrem Arm zu wimmern begann, steckte sie ihr den Zipfel ihres langen Zopfes in den Mund. Gierig begann das Kind an den Haaren zu saugen, während Sophie sich in Gedanken ausmalte, was sie auf dem Markt vor dem Rathaus alles kaufen könnte. Schon seit Tagen hatten sie kein frisches Brot mehr im Haus gehabt.
Kapitel 2
Obwohl er weit gereist war, beeindruckte ihn der Globussaal immer wieder. Unzählige Landkarten, Seekarten, Himmelskarten und kostbare Globen verschiedenster Größe und Ausführung rangelten miteinander um die Aufmerksamkeit des Betrachters. Gedankenverloren strich Adam Olearius mit der Hand über die pergamentene Oberfläche einer Erdkugel, auf der sich die Fixpunkte der großen Reise ausbreiteten: Über die Ostsee, via Reval, Riga, Moskau und Samara entlang der Wolga waren sie über das Kaspische Meer bis nach Isfahan gekommen. Die Reisegesellschaft hatte Stürme und Schiffbruch, Krankheiten und feindliche Angriffe überstanden, und doch waren Mut und Forscherdrang der fürstlichen Gesandten nicht belohnt worden. Im Gegenteil: Die Reise war ein Fehlschlag gewesen. Die Delegation unter Leitung des Hamburger Kaufmanns Otto Brüggemann hatte unterwegs kostbare Geschenke und, schlimmer noch, das Beglaubigungsschreiben für den Zaren verloren. Außerdem war Brüggemann, überheblich und zu keinem Kompromiss bereit, der denkbar schlechteste Verhandlungspartner in diesen fremden Welten gewesen. Weder in Moskau noch in Isfahan hatte er erreicht, wozu er ausgesandt worden war. Im August des vergangenen Jahres war die hoffnungslos zerstrittene Gesandtschaft wieder nach Schleswig zurückgekehrt.
Müde wischte der Hofgelehrte sich über die Augen, er hatte diese Nacht nicht schlafen können. Die letzten Stunden vor der Hinrichtung war er in Brüggemanns Zelle geblieben, um ihm beizustehen. Gemeinsam hatten sie für seine Seele gebetet. Nun war der Reisegefährte gerichtet, der Herzog hatte den Kaufmann für das Fiasko verantwortlich gemacht.
Vor Gericht hatte Brüggemann tatsächlich gestanden, Geheimverhandlungen mit den Persern geführt und Gelder des Herzogs veruntreut zu haben. Die Richter hatten Tod durch den Strang gefordert, doch der Herzog hatte das Urteil durch einen Gnadenakt gemildert: Man hatte Brüggemann nicht wie einen gemeinen Mörder und Lumpen aufgeknüpft, sondern er war schnell und wohl auch schmerzfrei durch das Schwert gestorben.
Olearius blickte auf. Der Herzog schien nun ganz ruhig. Nichts erinnerte mehr an die Last der Niederlage, die den Fürsten in den vergangenen Monaten niedergedrückt hatte. Hoch aufgerichtet, die Schultern unter Seide und Brokat verborgen, strahlte der Herrscher Stärke und Gelassenheit aus. Olearius fragte sich, warum er ihn zu sich zitiert hatte. Wollte Herzog Friedrich ihn nun gleichfalls aus seinen Diensten entlassen? Ertrug er die Gegenwart seines Gesandtschaftssekretärs nicht mehr, weil dieser für das Scheitern so vieler Hoffnungen stand? Wollte er nicht mehr an den größten Misserfolg seiner Regentschaft erinnert werden?
Unschlüssig suchte Olearius den Blick des Kanzlers, der sich hinter einem Kartentisch verschanzt hatte und dort auf weitere Anweisungen wartete. Johann Adolf Kielmann runzelte die Stirn und schüttelte ratlos den Kopf, während Herzog Friedrich ihnen immer noch wortlos den Rücken zukehrte und mit einem Fernrohr aus dem Fenster über die Schlossgärten und den Burggraben zur Schlei hinabschaute. Der lange Arm der Ostsee hatte schon die alten Wikinger beheimatet.
Olearius seufzte auf, wieder heftete er seinen Blick auf den Herzog. Seine Augen brannten vor Müdigkeit und Enttäuschung und er musste sich beherrschen, um nicht erschöpft in Tränen auszubrechen.
Hatte der Herzog nicht verstanden, dass die Gesandten eben nicht mit leeren Händen zurückgekehrt waren?
Er dachte an den Schatz seiner Aufzeichnungen, die sich noch in seinem Gepäck befanden. Hunderte Kladden mit Notizen und Skizzen über den Reiseverlauf. Er hatte in ihnen die fremden Völker beschrieben, denen sie unterwegs begegnet waren, ihre Eigenarten, Sitten und Gebräuche. Er hatte – nicht ohne Herzklopfen – eine russische Sauna und ein persisches Mausoleum besucht und war auch geistesgegenwärtig genug gewesen, während eines Scharmützels einen Pfeil, der gerade noch an seinem Ohr vorbeigesaust war, zur Erinnerung einzustecken. Einen längeren Aufenthalt in der persischen Stadt Schemacha hatte er genutzt, um von einem jungen Mullah die Sprache zu lernen.
Er hatte genaue Karten ihrer Route nach Isfahan angefertigt, das Kaspische Meer vermessen und war sicher, alle künftigen Orientreisenden mit wertvollen Kenntnissen ausstatten zu können, wenn, ja wenn er die Früchte seiner Anstrengungen publizieren könnte.
Olearius schüttelte den Kopf. Stand er mit seinen einundvierzig Jahren wieder ganz am Anfang? Musste er etwa die Stelle als Hofastronom im kalten Moskau annehmen?
Während ihm diese Gedanken im Kopf herumgingen, drehte der Herzog sich um. Für einen Moment weiteten sich seine schilfgrauen Augen vor Überraschung, als hätte er vergessen, dass er den Kanzler und seinen Hofgelehrten zu sich bestellt hatte. Dann nickte er ihnen zu. »Mit dem heutigen Tage ist die persische Affäre beendet«, sagte er und in seiner Stimme schwang der drohende Unterton mit, man möge ihn nie wieder auf das Abenteuer ansprechen. »Das Tor zum Orient wird uns wohl vorerst verschlossen bleiben.«
Resigniert breitete der Herzog die Arme aus, seine großen, kräftigen Hände schoben alle Erinnerungen von sich. »Es scheint der Wille des Herrn zu sein, dass einzig und allein die Niederländer mit ihrer Ostindischen Kompanie von den unermesslichen Schätzen des Morgenlandes profitieren. Seide und Gewürze zuhauf – mögen die Amsterdamer an ihren Reichtümern ersticken.«
Olearius bemerkte, wie der Kanzler erleichtert ausatmete. Dessen massiger Körper kam in Bewegung. Kielmann war von Anfang an gegen die teure und riskante Expedition gewesen. Nun musste er sich mit den Forderungen herumschlagen, die Russen und Perser an das Herzogtum stellten.
»Wie wollt Ihr die Schulden begleichen, die Euch Brüggemann und seine Spießgesellen hinterlassen haben?«, wagte er, seinen Herrn ein letztes Mal an das finanzielle Desaster der Unternehmung zu erinnern. Kielmanns Stimme klang heiser wie ein verstimmtes Instrument. Voller Verachtung streifte dessen Blick Olearius, doch das weiche, fließende Gesicht kaschierte die Schärfe seiner Gedanken.
Der Herrscher schnaubte. »Wir werden die Steuern erhöhen. Wir müssen die Steuern erhöhen, die Zölle, die Abgaben ...«
»Ihr könnt das nicht schon wieder über den Kopf des Adels hinweg entscheiden, Durchlaucht.« Kielmann schüttelte den Kopf, er sah aus, als hätte man ihm einen Schlag versetzt. Schwer stützte er sich auf den Kartentisch. »Die Steuerbewilligung ist nach wie vor ein Privileg der Stände, Ihr benötigt die Zustimmung der Ritter auf einem Landtag, Durchlaucht. Ihr könnt den Adel nicht zu gewöhnlichen Untertanen degradieren. Die Lasten des Krieges haben ihm bereits vieles abverlangt. Die Ritterschaft wird sich das nicht mehr gefallen lassen.«
Gespannt wartete Olearius auf die Reaktion des Herzogs. Der Kanzler spielte auf die Verpflichtungen an, die der dänische König dem Land wegen seines außenpolitischen Ehrgeizes auferlegt hatte. Die Schicksale Friedrichs und seines Onkels, König Christian IV. von Dänemark und Herzog von Holstein-Glückstadt, waren eng verbunden. Auf der Seite der Lutheraner hatte der alte König im Großen Krieg die kaiserlich-katholische Liga angegriffen. Und König Christians Niederlage gegen die kaiserliche Armee von 1626 hatte auch die beiden holsteinischen Herzogtümer schwer getroffen. Die Truppen der Liga waren durch den Norden bis nach Jütland gezogen und hatten Tod und Verwüstung hinterlassen, obwohl Herzog Friedrich neutral geblieben war und den Kaiserlichen sogar Festungen zur Verfügung gestellt hatte. Friedrichs Untertanen waren Opfer der komplizierten staatsrechtlichen Gemengelage geworden. Doch wer sollte sich noch auskennen? Selbst Olearius schüttelte darüber den Kopf.
Die Bevölkerung außerhalb der befestigten Städte war besonders gequält worden und das besetzte Land musste das siegreiche Heer ernähren. Auch mancher Adelssitz war beim Vormarsch der Kaiserlichen in Flammen aufgegangen, darunter das prächtige Schloss Breitenburg der Familie Rantzau, deren in ganz Europa berühmte Bibliothek von den Siegern geplündert und fortgeschleppt worden war.
Nachdem der Dänenkönig anno 1629 in Lübeck einen maßvollen Frieden mit dem Kaiser geschlossen hatte und die Kämpfe sich nun überwiegend im Süden des Deutschen Reiches abspielten, hatten die Herzogtümer im Norden sich wieder etwas erholen können. Dennoch waren die Zeiten unruhig, und immer wieder flackerten die Flammen des Krieges am Horizont auf.
Herzog Friedrich schwieg, dann drehte er seinem Kanzler brüsk den Rücken zu, unter der kostbar verzierten Brokatjacke arbeiteten die Schultermuskeln. Unvermittelt wandte er sich an Olearius. »Wie ich hörte, seid Ihr nicht mit leeren Händen zurückgekehrt?«
Verdutzt blickte Olearius den Herzog an. Seit seiner Rückkehr an den Hof hatten sie kaum ein Wort miteinander gewechselt, der Prozess hatte die ganze Aufmerksamkeit des Herrschers beansprucht. Sprach Herzog Friedrich etwa von seinen Aufzeichnungen?
»Eure fürstliche Durchlaucht?« Olearius räusperte sich verlegen. Wenn nur diese bleierne Müdigkeit nicht wäre, dachte er. Er hatte das Gefühl, dass sein Verstand sich von seinem Körper gelöst hatte, das Denken fiel ihm unendlich schwer. Obwohl er den selbstherrlichen und eitlen Brüggemann nie hatte leiden können, hatte er es doch als seine christliche Pflicht betrachtet, ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten.
»Die Frau, die Ihr Euch aus Reval mitgebracht habt ...«, der Herzog zwinkerte nun spöttisch. »Ich hörte, Ihr hättet sie geheiratet.«
»Catharina ...« Olearius atmete erleichtert aus. »Ihr habt recht, Durchlaucht. Ich bin nicht mit leeren Händen zurückgekehrt.« Vage wies er auf die Globen und Karten, die den Saal schmückten. »Ich habe eine Frau gefunden und ...«
Olearius schwieg einen Moment, um die Bedeutung seiner Worte zu unterstreichen. »Und ich habe eine Fülle von Aufzeichnungen mitgebracht, bedeutsame Aufzeichnungen, die sich wunderbar in die herzogliche Bibliothek einfügen und Euch als Förderer dieser Expedition auszeichnen würden.«
Herzog Friedrich kniff die Augen zu Schlitzen zusammen. Über den buschigen Brauen kräuselte sich die Stirn. Trotz seiner verschwenderischen Kleidung und der exquisit gearbeiteten Stulpenstiefel wirkte er für einen Moment wie ein einfältiger Lakai, der den Wunsch seines Herrn nicht zu deuten wusste. »Ihr wollt Eure Reisenotizen publizieren?«
Olearius nickte und bemerkte, dass er vor Aufregung schwitzte. Verräterisch wie Wangenröte schoss es ihm aus allen Poren.
Ich muss den Herzog vom Wert meiner Arbeit überzeugen, dachte er. Ich muss an seinen Verstand appellieren und seine Eitelkeit kitzeln.
»Mit einem Bericht über die Reise nach Russland und Persien betreten wir Neuland, Durchlaucht«, fuhr er fort. »Die Persische Reise wird Euch in ganz Europa bekannt machen und Euren Ruhm mehren. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich in Eurem Auftrag gewonnen habe, sind doch der eigentliche Schatz dieser Reise. Auch wenn die Expedition ein wirtschaftlicher Fehlschlag war, könnt Ihr sie immer noch zu einem wissenschaftlichen Erfolg machen. Ganz Europa wird davon sprechen.«
Herzog Friedrich schüttelte den Kopf, dann drehte er ihm wieder den Rücken zu und trat erneut ans Fenster. Sorgsam richtete er das Fernrohr auf einen Punkt jenseits der fürstlichen Gärten aus und schaute konzentriert durch das Instrument.
Olearius spürte einen Stich in seinem Magen. Übelkeit kroch in ihm hoch. Ich bin zu schnell vorgeprescht, schalt er sich enttäuscht. Ich habe den Herzog verstimmt.
Er wusste, dass es geschickter gewesen wäre, dem Herrscher seinen Vorschlag als dessen eigene Idee zu verkaufen. Mit etwas mehr Geduld, Witz und Charme wäre dies sicherlich gelungen. Aber die komplizierten, höfischen Rituale und Umgangsformen lagen ihm fern und sein unruhiger Geist strebte nach schnellen, klaren Entscheidungen.
Wütend blickte Olearius zu Boden und wischte sich verstohlen den Schweiß von der Stirn. Er ahnte, dass Kielmann ihn von der Seite beobachtete, und meinte, dessen Triumph wie ein kaltes Messer zwischen den Rippen zu spüren. Der Kanzler würde sich mit Händen und Füßen gegen weitere Ausgaben in der persischen Sache wehren.
»Ihr habt recht, Olearius«, drang plötzlich die dunkeltönende Stimme des Herzogs an sein Ohr.
Überrascht blickte Olearius auf und das Herz des Gelehrten begann zu klopfen. Das Blut rauschte in seinen Ohren.
Hatte er sich etwa getäuscht? Narrte ihn die Müdigkeit, hörte er Stimmen?
Immer noch blickte Herzog Friedrich starr durch das Fernrohr.
»Ich werde mir Euren Vorschlag durch den Kopf gehen lassen.«
Er hatte sich nicht getäuscht, der Herzog sprach zu ihm.
»Ich wollte mich eigentlich in einer anderen Angelegenheit mit Euch unterhalten, aber vielleicht lässt sich das eine mit dem anderen ja auch verknüpfen? Wir werden sehen ...«
In einer anderen Angelegenheit ...? Der Herzog sprach in Rätseln. Olearius hörte, wie der Kanzler erregt die Luft ausstieß. Ein empörtes Schnaufen echote durch den Raum und verfing sich unter der gewölbten Decke des Saals.
Neue Projekte? Das vertrug sich ganz gewiss nicht mit der strapazierten Kasse des Herzogs.
»Wir werden sehen«, murmelte der Landesherr noch einmal, ein fast euphorischer Klang schwang in seiner Stimme mit. »Ich werde eine Nacht darüber schlafen, morgen werde ich Euch rufen lassen.«
Als Olearius den Globussaal verließ, meinte er, dass die Globen in seinem Rücken miteinander zu tanzen begonnen hätten. Erd- und Himmelssphären rotierten, und leise wie der Flügelschlag der Engel erklang die nur von Weisen vernehmbare Sphärenmusik in seinen Ohren.
Kapitel 3
Die Sonne hatte ihren höchsten Punkt erreicht. Auf dem Markt am Rathaus spendeten Segeltuchplanen über den Ständen Schatten. Heringe und Meerforellen, Zander und Aale, die am Morgen aus der Schlei gezogen worden waren, lagen in Eichenholzkisten und warteten auf Käufer. Hin und wieder zuckte ein schillernder Leib empor, als überkäme den Fisch die Erinnerung an das wilde Leben in den Tiefen der Ostsee. Dunkles Brot verströmte seinen köstlichen Duft, schwere Käselaibe schwitzten auf den Tischen. Bäuerinnen aus dem Umland boten ihre Feldfrüchte an, dazu frische Eier, Milch und Rahm, aus hohen Kannen geschöpft.
Sophie atmete tief ein. Bekannte und auch fremde Düfte – von Gewürzen etwa, die im Bauch eines Handelsschiffes aus dem fernen Orient gekommen waren – stiegen ihr in die Nase, und eine Welle des Wohlbehagens durchströmte ihren Körper. Was sollte sie kaufen? Unschlüssig drehte sie die Münze in der Hand, während sie an den Ständen vorbeischlenderte und vertraute Gesichter grüßte. Sie liebäugelte mit einem Laib Brot und einem Stück kräftig geräucherten Schinkens, das in der Sonne glänzte. Schon lief ihr das Wasser im Mund zusammen, und sie versuchte auszurechnen, wie viel Geld ihr dann noch bliebe.
Der Protest der Schwester riss sie aus ihren Gedanken. Unschlüssig blieb sie stehen. Die Kleine hatte Hunger. Das Kind quengelte und spuckte empört den Haarzipfel aus. Wenn es nicht bald die Milch der Amme bekäme, würde es sich in einen schreienden Kobold verwandeln.
Sophie fürchtete die mitleidigen Blicke der Marktbesucher, seufzend drängte sie sich durch die Menschen und verließ den Markt.
Nur wenig später überquerte Sophie die Brücke zum Holm und tauchte in die schmalen dunklen Gassen der Fischersiedlung ein. Vor den Hütten der Fischer hingen Netze zum Trocknen in der Sonne. Nur vor dem Haus der Amme schaukelten Kräuter, zu Sträußen gebunden, in der leichten Brise, die vom Wasser hinauf durch die Gassen zog.
Johanna Michels bündelte die Kräfte der Natur in ihren getrockneten Gebinden. Ampfer, Wegerich, Kamille, Schleierkraut oder Brennnessel – aus Blättern und Beeren, Wurzeln oder Rinden, die sie im Wald oder am Feldrand sammelte, trocknete und im Mörser zerstieß, fertigte sie Kräutermischungen, die gegen viele Beschwerden und Krankheiten halfen. Sogar der Bürgermeister schickte seine Magd zur Michels, wenn er einen Aufguss gegen die sauren Magensäfte benötigte, und auch viele weitere Schleswiger Bürger vertrauten dem Wissen der Kräuterfrau, das ihre Mutter und Großmutter an sie weitergegeben hatten.
Johanna half bei Geburten und kurierte Hühner, die keine Eier mehr legen wollten. Ihre Kräuter verkaufte sie zusammen mit kleinen, handgeschriebenen Zetteln, auf die sie ein Gebet oder einen Bibelspruch notiert hatte, um den Zorn der Kirche nicht auf sich zu ziehen. Noch immer gab es Hexenprozesse und heilkundige Frauen waren den Ratsherren und Kirchenmännern suspekt.
Sophie klopfte an die Tür und trat ein. Das winzige Fachwerkhaus in einer Gasse zwischen Friedhof und Schlei bestand lediglich aus einem Raum, in dem Johanna lebte und arbeitete. Ein dunkler Vorhang trennte eine Ecke, in der sie ihre Patienten empfing, vom Rest des Zimmers ab. Tisch und zwei Stühle sowie eine Truhe aus Eichenholz, Kochgeschirr und ein schmaler Wollteppich waren ihr gesamter Besitz, ein Spiegel fehlte.
Über eine schmale Leiter erreichte man eine zweite Ebene, dort schlief Johanna auf einer Matratze aus Stroh. Überall hingen getrocknete Kräuterbündel und in zahlreichen Töpfen und Leinensäckchen wurden die fertigen Mischungen und Essenzen bis zum Verkauf aufbewahrt.
Das Zimmer war leer, doch über der Feuerstelle köchelte ein Kessel mit Suppe. Sophie stieg der scharfe Geruch von Bärlauch in die Nase, die Amme musste in der Nähe sein.
»Johanna!«, rief Sophie und wiegte die Schwester, die nun lauter schrie, in den Armen.
»Im Garten ...«, drang Johannas Stimme durch die dünnen Lehmwände. Sophie atmete erleichtert aus und trat aus dem dunklen Zimmer ins Sonnenlicht hinaus. Links und rechts schlossen sich die Hütten der Nachbarn an, doch hinter dem Häuschen lag noch ein Stückchen Grün, kaum größer als ein Marktstand. Ein Apfelbaum wuchs dort, er war Johannas ganzer Stolz. Im Herbst trug er duftende Früchte, unter derer süßen Last sich die Äste wie Weidenruten bogen. Johannas Apfelgelee, das sie mit Gewürzen verfeinerte, war auf dem Markt begehrt – genauso wie der Apfelwein, den sie heimlich vergor und unter der Hand verkaufte.
Wo das Sonnenlicht es zuließ, baute Johanna außerdem Kraut und Gemüse an. Drei Hühner und ein Hahn scharrten zwischen den Beeten und unter dem Apfelbaum war eine Ziege angekettet. Johanna nahm sie mit auf ihre Wanderungen in die Wälder, sie folgte ihr wie ein Hund. Nachts schliefen Ziege und Federvieh im Haus, weshalb es dort – trotz des betäubenden Kräuterduftes – mitunter etwas streng roch.
»Sophie ...«
Johanna saß auf einem Holzklotz und hielt das Gesicht der Sonne entgegen. Das Licht umspielte ihren Körper wie ein blendender Schleier. Funken sprühten aus ihrem kastanienfarbenen Haar, das offen über ihre Schultern fiel. In Erwartung des Kindes hatte sie die linke Brust entblößt. Zarte Haut, weiß wie Rahm, lugte zwischen dem Tuch hervor und das Geschrei der Kleinen ließ die Milch bereits fließen. Winzige Perlen tropften auf das honigfarbene Kleid und sammelten sich dort für einen Moment, bevor der Stoff die Flüssigkeit aufsog.
Fordernd streckte Johanna die Arme nach dem Kind aus, und Sophie legte ihr die Schwester an die Brust. Fasziniert beobachtete sie, wie sich die Lippen des eben noch schreienden Bündels um die dunkle Brustwarze schlossen und das Kind gierig zu trinken begann.
»Du bist spät«, erntete Sophie einen vorwurfsvollen Blick der Amme. Entschuldigend legte das Mädchen einen Arm um Johanna und ließ sich neben ihr ins Gras sinken.
»Ich war oben am Schloss, auf dem Richtplatz.«
»Du hast dir die Hinrichtung angesehen? Aber Sophie ...«
Sophie musste sich nicht zur Seite wenden, um zu wissen, dass Johanna missbilligend den Kopf schüttelte.
»Vater hätte es mir erlaubt«, verteidigte sie sich trotzig. »Ich bin alt genug.«
»Man ist nie alt genug, um dem Tod zu begegnen.«
Johanna schwieg und Sophie lehnte sich dankbar gegen ihre Beine. Sie spürte die Wärme, die von Johannas Körper ausging, und schloss entspannt die Augen. Schläfrig ließ sie ihre Gedanken treiben, bis sie das Bild ihrer Mutter gefunden hatte. Ein lächelndes Gesicht erschien auf dem Samtgrund der Erinnerung, Szenen ihrer Kindheit, Trost und Sehnsucht zugleich.
Sophie wusste, dass die Mutter unter einem kalten Stein auf dem Friedhof gegenüber lag, doch wenn Johanna ihre Schwester stillte, war es so, als könnte sie deren Umarmung spüren. Für einen Moment vergaß sie das Unglück, das mit der Geburt der Schwester über die Familie gekommen war. Ein kurzes, seliges Innehalten, das den Fiebertod der Mutter ausblendete.
»Sophie?« Johanna stupste sie mit den Füßen in die Seite. »Alles in Ordnung?«
»Hm ...« Noch wollte sie sich nicht aus ihren Träumen reißen lassen. Der Vater hatte das Neugeborene nach dem Unglück zu Johanna gebracht. Es war bekannt, dass die Kräuterfrau sich verwaister Säuglinge annahm, nach dem Tod ihres einzigen Kindes vor ein paar Jahren kümmerte sie sich immer wieder um verlassene Stillkinder. Ein schreiendes Bündel und ein Tee aus Anis, Kümmel, Fenchel und Bockshornklee ließen ihre Milch jederzeit fließen.
»Hast du etwas von deinem Vater gehört?« Johanna ließ nicht locker und Sophie verabschiedete sich wehmütig von ihrem Tagtraum.
»Nein«, schüttelte sie den Kopf. »Eigentlich hätten sie vorgestern zurück sein müssen. An der Schiffbrücke beim Zoll wissen sie auch nicht, was los ist. Die Zöllner sagen, Viehhändler Schröder hätte ihnen einen Schwung Ochsen für diese Woche angekündigt. Die Hälfte sollte mit dem Schiff nach Wismar weitergehen, der Schiffer wartet schon ungeduldig im Hafen. Der Rest soll über Kiel nach Süden getrieben werden.«
»Am Wetter kann es nicht liegen.« Johanna nahm das Kind von der Brust und hielt es einen Moment in die Höhe, bevor sie es an die andere Seite legte. »Die Treiber könnten sich keine besseren Bedingungen wünschen. Seit mehr als zehn Tagen hat es nicht geregnet, trotzdem ist es nicht zu heiß für die Ochsen. Und das Wetter ist stabil. Schau, die Schwalben fliegen hoch.«
Johanna wies auf die winzigen, dunklen Körper, die wie Pfeile durch das weite Himmelsblau jagten.
Sophie nickte. »Vielleicht bleiben sie länger als geplant draußen auf der Heide«, murmelte sie wenig überzeugt, denn der Viehhändler galt als zuverlässig. Nach dem Tod der Mutter hatte der Vater ihren Bruder zum ersten Mal mit auf den Viehtrieb genommen, während sie sich um die Schwester und die kleine Hütte oben am Lollfuß kümmern sollte.
Sie vermisste ihren Bruder, Christian war der ältere von ihnen, wenn auch nur um wenige Minuten. Er war mehr als ihr Zwilling, mehr als ein Abbild ihrer selbst – flachsblond und sommersprossig. Sie waren doppelt und doch eins. Er war das Gegenstück ihrer Seele, ihr zweites Ich, Gleichklang und Spiegel. Sie liebte ihn wie die Wellen den Wind und das Wasser den Strand.
Nach dem Tod der Mutter hatten sie wortlos Trost in der Nähe des anderen gesucht, so wie sie sich schon beim Tod ihrer zwei Geschwister Halt gegeben hatten, die Gott nur wenige Tage nach der Geburt zu sich gerufen hatte. Nun, mit fast zwölf Jahren, waren sie das erste Mal getrennt. Auch wenn der Vater ihnen versprochen hatte, dass der Ochsentrieb nur wenige Wochen dauern sollte, ahnte Sophie: Ihre Kindheit endete in diesem Sommer.
»Meinst du, es ist etwas passiert?« Ängstlich drehte Sophie sich zu Johanna und blinzelte gegen die Sonne, deren Strahlen durch die Krone des Apfelbaums sickerten. Lichtpunkte tanzten vor ihren Augen und geblendet schloss sie die Lider. Sie sah nicht, dass Johanna ihrem Blick auswich.
»Nein, nein«, murmelte Johanna leise und küsste das Kind in ihren Armen auf das noch flaumige Haar. »Dann wüssten die Schleswiger längst Bescheid. Es ist doch ein gutes Zeichen, dass sie noch keinen Suchtrupp losgeschickt haben. Die Händler wissen alle, dass die Zeit auf der Trift langsamer vergeht als für die Wartenden daheim. Vielleicht sind die Tiere erschöpft, und die Treiber gönnen ihnen ein wenig Ruhe, bevor es auf die letzte Etappe geht?«
Sophie riss ein Büschel Gras aus, steckte sich den kräftigsten Stängel in den Mund und sog daran.
Der Ochsenhandel war harte Arbeit, schwer und voller Risiken. Die Viehhändler und Treiber lebten gefährlich. Schon beim Einkauf der Ochsen in Jütland fing es an. Hatten die Männer einen günstigen Preis ausgehandelt? Waren die Ochsen überhaupt gesund und hielten sie den Strapazen des Treibens stand, oder hatte man sie sich mit Wasser vollsaufen lassen, damit sie wohlgenährt aussahen? Konnte man sie zu einem guten Preis auf den Märkten im Süden weiterverkaufen? Und kam man mit allen Tieren dort an, oder begegnete man unterwegs einer Räuberbande oder, schlimmer noch, einer Meute hungriger Söldner, die sich noch immer im Land herumtrieben?
Und dann das Leben auf den unbefestigten Straßen: im heißen, staubigen Sommer, im Winter, bei Nebel, Regen und Schnee ohne ein festes Dach über dem Kopf. Am Ende des langen Ochsenweges, der sich durch Jütland, Schleswig und Holstein bis zur Elbe zog, endete alles rund um die Roland-Statue auf dem Ochsenmarkt in Wedel vor den Toren Hamburgs. Viehhändler, Treiber und andere Marktleute ließen sich dort nieder, Stände, Buden, Zelte, so weit man sehen konnte. Und riesige Ochsenherden, deren Gebrüll wie dumpfes Glockenschlagen über der Stadt hing.
Sophie verstand, dass die Händler den mageren Gewinn nicht auch noch mit dem König, dem Herzog und der Stadt teilen wollten. Wenn die Herrschaften kassiert hatten, blieb meistens gerade noch so viel, dass die Kosten des Treibens gedeckt waren. Und Zollfreiheit war allein das Privileg des Adels. Viele Händler versuchten deshalb, die Zollstation am alten Ochsenweg zu umgehen. Vielleicht gibt es einen neuen Schmuggelweg für die Ochsen?, dachte sich Sophie. Vielleicht hatten die Männer einen Umweg riskiert und waren in einem weiten Bogen um Schleswig herumgezogen?
Sophies Augen wurden schwer und schwerer, bis sie sich nicht mehr gegen den Schlaf wehren konnte. Entspannt sackte ihr Körper zur Seite, das Mädchen zog die Beine an und rollte sich wie eine Katze auf dem Boden zusammen.
Johanna lächelte wehmütig. Vorsichtig zog sie ihren Fuß unter dem schlafenden Mädchen hervor, dann löste sie das Kind von ihrer Brust. Die Kleine war ebenfalls eingeschlafen. Mit einem Seufzer gab sie die Brustwarze frei. Sanft wickelte Johanna den Säugling in ihr Schultertuch und legte ihn seiner großen Schwester in die Arme. Nachdem sie sich vergewissert hatte, dass die Ziege fest angebunden war, scheuchte sie die Hühner leise vor sich her auf die andere Seite des Hauses und hinunter zur Schlei. Ein wenig Ruhe und Schlaf, so meinte sie, war das Beste, was sie den beiden Kindern in diesem Moment schenken konnte.
Die Mädchen lagen ihr am Herzen und Johanna spürte seit Tagen, dass sich Unheil über den verlassenen Seelen zusammenbraute. Als sie über die Schulter in den Garten zurückblickte, zuckte sie zusammen. Dort, wo sich die Köpfe der Kinder ins Gras drückten, flimmerte die Luft violett. Die Lichterscheinung verbreiterte sich, stieg wie ein Kegel auf. Johanna schloss die Augen und versuchte, die Vision zu deuten. Dann seufzte sie auf, denn sie wusste: Gegen die Macht des Schicksals war kein Kraut gewachsen.
Kapitel 4
Die Ritter, die am Nachmittag auf Gut Knoop westlich von Kiel zusammentrafen, waren unbemerkt durchs Land geritten. Lautstark verlangten sie nach einem Krug Bier, um den Staub der Straße die Kehle hinunterzuspülen. Die Männer waren in Sorge, gereizte Worte und finstere Blicke durchquerten den Raum. Während Pferde und Kutschen auf dem Vorplatz im Schatten der Eichen warteten, stritten die Ritter in der Halle der alten Wasserburg um die Zukunft des Landes.
»Ruhe, Männer!«, donnerte Christian Rantzau, der sich als Wortführer des Adels verstand. Er hatte die Herren auf seinem Gut zusammengerufen und versuchte, die Versammlung zu eröffnen. Doch die Männer reagierten nicht. Sie standen mit roten Köpfen und geballten Fäusten in Gruppen zusammen und diskutierten.
»Verdammt ...« Wütend sprang der junge Rantzau auf einen Tisch und ließ die Peitsche knallen.
Das machte Eindruck. Nach und nach verstummten die Männer und blickten den Ritter erwartungsvoll an.
Groß und sehnig, geschmeidig wie ein Jagdhund, mit einem dichten, hellen Schopf, der das entschlossene Gesicht rahmte, war Christian Rantzau eine auffällige Erscheinung. Lediglich die glitzernden Raubtieraugen und die etwas schiefe Nase – das Andenken an eine jugendliche Rauferei – standen in Kontrast zu einem Profil, das in seiner Ausgewogenheit an eine antike Statue erinnerte. Mit seinen sechsundzwanzig Jahren galt Rantzau zudem als hitzköpfig und aufbrausend, doch die Macht seiner einflussreichen Familie verlieh ihm in den Herzogtümern Autorität und den Respekt der Männer.
»Was soll das hier denn nun werden?«, schrie ihm einer aus der Familie Pogwisch entgegen. »Ein Landtag – ohne König und Herzog? Sind die hohen Herren mal wieder in Not? Stehen uns Geldtage ins Haus?«
Die Männer johlten. Alle wussten, Siegmund Pogwisch spielte auf den Missbrauch der Landtage durch die Herzöge an. Vor vielen Jahren hatte der Vertrag von Ripen, der die verzwickte Lage der Herzogtümer regeln sollte, die Tradition der Ständeversammlung begründet und Schleswig und Holstein fest mit der dänischen Krone verbunden. König Christian I. von Dänemark hatte den Rittern damals die Unteilbarkeit der Länder und die innere Selbstständigkeit zugesichert, zum Dank wählten sie ihn anno 1460 zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein-Stormarn.
Als der König wenige Jahre später Geld benötigte, um die Herrschaftsansprüche seines Bruders auf die Herzogtümer abzuwehren, ließ er die Bischöfe, Vertreter der Städte und des Adels zu einer Versammlung einladen.
Christian Rantzau schüttelte den Kopf und versuchte, die Männer wieder zur Ruhe zu bringen. Noch einmal ließ er die Peitsche knallen, was ihm die missbilligenden Blicke der Älteren eintrug. Doch das schüchterte ihn nicht ein. Die Rantzaus zählten schließlich zum Kreis der uradligen Familien in den Herzogtümern. Die Stammreihe des Geschlechts reichte mit Ritter Johann Ranzow, der sich bei Plön niedergelassen hatte, bis in das Jahr 1226 zurück. Schon Christians Großvater Heinrich und dessen Vater Gerhard Rantzau hatten es als Königsberater, Heerführer, kluge Statthalter und ehrgeizige Kunstsammler mit den meisten Hochadligen in Europa aufnehmen können. In der Vergangenheit hatte man sogar von einem Goldenen Rantzauschen Jahrhundert gesprochen. Die Rantzaus besaßen fünfzig Herrensitze in den Herzogtümern, die alle einem Schloss glichen. Und der junge Rantzau strebte nach mehr.
Eigensinnig drückte er das breite Kreuz durch und fuhr sich mit der Zunge über die vor Empörung trockenen Lippen.
»Der Landtag ist unser Privileg, Männer«, donnerte er, um mit seiner Stimme auch bis in den hintersten Winkel der Halle vorzudringen. Wieder pumpte er Luft in seine Lungen. »Die Landesherren dürfen ihre Steuern nur mit dem Einverständnis der Stände erheben. Und wir dürfen uns dieses Recht nicht nehmen lassen. Was ist der König, was ist der Herzog – was sind die hohen Herren ohne uns? Wir ... nur wir, die Ritter, sind das Rückgrat dieses Landes.«
Zustimmendes Gemurmel schlug ihm von seinen Zuhörern entgegen. Jeder der Anwesenden wusste, dass er seinen Stand und seine Privilegien den Urahnen zu verdanken hatte. Die adlige Ritterschaft war ursprünglich aus der Kriegerelite im Dienst des Landesherrn hervorgegangen. Landesverteidigung gegen besondere Rechte, so hatte der alte Rantzau seinem Sohn den für beide Seiten einträglichen Handel einst erklärt. Schon Ritter Johann Ranzow war für seinen Beistand mit Grundbesitz belehnt worden und die Erblichkeit der Ländereien hatte auch die Vererbbarkeit des Adelstitels und der Reichtümer bedeutet. Die adligen Gutsbesitzer besaßen politische Macht im Staat und waren im Landtag mit einer Stimme vertreten. Im Vertrag von Ripen war ihnen zudem zugesichert worden, dass nur derjenige König von Dänemark werden konnte, den sie akzeptierten.
Christian Rantzau holte tief Luft, und das Gesicht des toten Vaters erschien vor seinen Augen, stolz und unbeugsam. »Bis in den Kaiserlichen Krieg hinein kannten der Adel und die freien Großbauern keine wirtschaftlichen Sorgen«, fuhr er fort. »Die Privilegien der Ritterschaft wurden geachtet, aber es kamen kaum neue hinzu. In den unruhigen Zeiten mussten wir die Privilegienlade mit unseren urkundlich verbrieften Rechten sogar nach Hamburg schaffen, hinter den Festungswällen der Stadt war sie sicherer als auf einem unserer Adelssitze. Und wo stehen wir heute?« Er legte eine kurze Pause ein, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Noch einen kaiserlichen Plünderungszug bis nach Jütland hinauf verkraften wir nicht.«
»Die ersten Güter stehen am Rande des Ruins!«, rief jemand dazwischen, und wieder erhob sich zustimmendes Gemurmel, in das sich zornige Rufe mischten.
»Und man hört, dass König und Herzog neue Steuern planen, um ihre Kriegsschulden begleichen zu können. Bald werden sie dazu übergehen, die Steuern ohne unsere Zustimmung zu erhöhen.«
»Na und«, rief einer dazwischen, »die hohen Herren setzen ihren Kopf ja doch durch – ob wir die Steuern nun abnicken oder nicht. Was soll es uns kümmern, wir sind doch von den Lasten befreit.«
Christian Rantzau wollte antworten, doch ein anderer kam ihm zuvor. »Idiot«, schrie Jörg Ahlefeldt erregt. »Siehst du denn nicht, worauf das hinausläuft?«
Als Antwort setzte wildes Stimmengewirr ein, die vom Bier erhitzten Männer machten ihrem Unmut Luft. Wieder griff Christian Rantzau zur Peitsche und ließ die Schnur durch die Luft sausen. Das Fauchen des Lederriemens brachte die Männer zur Besinnung.
»Ahlefeldt hat recht«, schrie er. »Dann werden die Landtage überflüssig, und König und Herzog können ohne uns regieren. Der Adel wird in den Herzogtümern politisch bedeutungslos sein. Schaut doch nach Frankreich, dort sind die Adligen vom König bereits zu Marionetten degradiert. Sie sind nicht mehr als herausgeputzte Laffen und Gecken, die König Ludwig XIV. umschmeicheln. Und auch Herzog Friedrich drängt den Einfluss der Ritterschaft am Hof durch seine Beamten immer weiter zurück. Räte bürgerlicher Herkunft dienen ihm als Ratgeber und es werden ihrer immer mehr ...« Rantzau spuckte aus, gallenbitter war die Verachtung in ihm hochgestiegen, und rasender Zorn brannte in seinen Eingeweiden. Vor sich sah er das hochmütige Gesicht des herzoglichen Kanzlers. Johann Adolf Kielmann, ein bürgerlicher Advokat, schien ihm selbstgefällig zuzuzwinkern.
Die Männer waren herangerückt, in vielen Gesichtern las Christian Rantzau nun Verständnis und Zustimmung. Schnell ging er in die Knie und ließ sich vom Tisch zu den Männern hinabgleiten. Die Ritter umringten ihn wie eine Meute Hunde ihren Herrn, viele klopften ihm zustimmend auf die Schulter.
»Was schlagt Ihr vor?« Zuerst war es nur einer, der sich vorwagte, dann fiel ein zweiter, dann ein dritter ein. Schließlich wogte die Frage durch die Halle, ein surrender Ton, gefährlich und unberechenbar.
»Wir müssen einig sein.« Christian Rantzau erinnerte die Männer an die Losung der Herzogtümer, an die Stärke der Ritterschaft: »Dat se bliven ewich tosamende ungedelt ...«, schrie er und hob die Faust. »Dafür haben unsere Ahnen gekämpft. König und Herzog müssen wissen, dass sie nicht an der Macht der Stände vorbeikommen – weder heute noch morgen. Wir werden für unsere Rechte kämpfen und wir werden uns unsere Privilegien nicht nehmen lassen. Wir müssen wachsam sein: keine neuen Steuern ohne Zustimmung des Landtags! Die Stände müssen sich endlich wieder in Erinnerung bringen. Sonst werden die hohen Herren uns eines Tages kleinmachen, man wird uns keine Festungen mehr anvertrauen und versuchen, uns möglichst viele Güter abzunehmen, um sie an die Bürgerlichen zu verkaufen.«
»Wir werden die Gutsbauern nicht mehr schinden dürfen!«, rief Ahlefeldt zornig dazwischen. »Wer soll unsere Felder bestellen, wenn die Bauern aufbegehren?«
»Nieder mit den Bürgerlichen, nieder mit den verfluchten Beamten ...« Christian Rantzau ließ sich von der Begeisterung der Männer tragen, ihre Zustimmung berauschte ihn.
Es fehlte nicht viel, und das Wort Aufstand hätte feixend auf seiner Zunge getanzt. Ein Gedanke wie ein Fluch – schlimmer noch als Hochverrat und gefährlicher als der Tod.
Kapitel 5
Die sanfte Hügellandschaft, bewaldet und in den Senken von moorigen Partien und Heidekraut durchzogen, lag wie unberührt vor den Männern. Eine tief stehende Sonne warf Schatten auf die Ebene, an einem Tümpel stillten Ochsen ihren Durst.
Während Christian Holz für das abendliche Feuer sammelte, beobachtete er die Tiere. Zu Beginn des Treibens, als sie die gemästeten Ochsen in Jütland übernommen hatten, waren sie ihm rätselhaft und unberechenbar erschienen – eine Horde zotteliger, wiederkäuender Riesen. Doch auf dem Zug nach Süden hatte er festgestellt, dass sich hinter ihrem bedrohlichen Äußeren gutmütige und geduldige Wesen verbargen. Schon nach wenigen Tagen hatte Christian ihr Vertrauen erworben und Freundschaft mit den Tieren geschlossen. Die Ochsen gehorchten seinen Befehlen mit unerschütterlicher Gelassenheit, und ein Blick in ihre dunklen, wehmütigen Augen erzählte ihm von ihrem Bund mit dem Menschen, dem sie seit Urzeiten Gefährten und Nahrung zugleich waren.
Christian dachte, dass die Ochsen ihm näher standen als die meisten Treiber und ihr Anführer, Viehhändler Schröder aus Schleswig. Von Ossen-Schröders ledrig gegerbtem Gesicht hatte er noch nie eine Spur Freundlichkeit ablesen können. Kalt und misstrauisch lauerten seine Augen in dunklen Höhlen, als wäre ihm die Welt niemals freundlich begegnet. Und so war es wohl auch: Das Leben des Viehhändlers war ein ständiger Kampf – gegen die Umstände, die Willkür der Herrscher und die Launen einer gnadenlosen und widerspenstigen Natur. Dennoch begriff Christian nicht, wie die Männer die Kälte des Viehhändlers ertrugen und warum sie vor ihm kuschten wie eine kopflose Herde Schafe. Sogar sein Vater begehrte nicht auf. Erschrocken hatte Christian bemerkt, dass dieser sich nach dem Tod der Mutter in einen in sich gekehrten, von der Welt abgewandten Zweifler verwandelt hatte.
Nein, dachte der Junge, an den Männern lag es nicht, dass er sich vor dem Ende des Treibens fürchtete. Sie waren ihm fremd geblieben. Doch Abschied von den Tieren nehmen zu müssen, deren Gesellschaft die Sehnsucht nach seiner Schwester zwar nicht verdrängt, aber doch betäubt hatte, konnte sich Christian nicht vorstellen.
Sophie ... Beim Gedanken an die Schwester lächelte Christian. Der Sack in seinen Händen füllte sich mit Reisig und toten Ästen, doch vor seinem inneren Auge sah er, wie sie ihn aus der Ferne grüßte. Wenn Sophie bei ihm wäre, würde sie sich jetzt in einem Wettkampf mit ihm messen und gewiss hätte sie ihren Sack zuerst gefüllt und triumphierend zur Feuerstelle zurückgetragen. Christian dachte, dass Sophie den Männern wohl auch eine größere Hilfe wäre, als er es sein konnte. Sie war mutig, viel geschickter und lebhafter als der Bruder – in allem, was sie tat. Sie war selbstbewusst, unbefangen und eigensinnig, schien schneller zu denken, einer inneren Stimme zu folgen und besaß ein Urvertrauen in die Welt. Sie war sein freundlicher Schatten: Jede Gefahr, jedes Unwetter sah sie zuerst heraufziehen. Und wenn Sophie meinte, dass er nicht achtgab, schob sie ihm großzügig das größere Stück Brot auf den Teller.
Christian liebte seine Schwester und er meinte, ihre Gedanken hören zu können. Sophies Liebe stärkte ihn, doch auf dem Viehtrieb und in der Gesellschaft der mächtigen Ochsen hatte er zum ersten Mal gedacht, dass er auch ohne ihren Rückhalt bestehen könnte. Er hatte zu sich gefunden.
Wie würde es sein, nach Schleswig zurückzukehren? Christian malte sich aus, wie er ihr von seinen Erlebnissen berichtete, von der Welt jenseits der Schlei. Unterwegs hatte er vieles über die großen Ochsentriften erfahren, die in jedem Frühjahr durch Jütland und Flensburg, durch Oeversee, Lürschau, Schleswig und Rendsburg nach Süden zogen. Über schimmerndes Kopfsteinpflaster und durch Dünen, durch Eichkrattwälder, Auenlandschaften und Furten wurden die Tiere in großen und kleinen Herden auf die Märkte nach Bramstedt, Itzehoe und Wedel an die Elbe getrieben. Von dort verkaufte man sie in die großen Städte, sogar bis in die Rheinlande und nach Holland.
»Der Ochsenweg ist die wichtigste Verkehrsstraße im Norden«, hatte sein Vater ihm erklärt. »Er verläuft zwischen der Geest im Osten und dem Marschland im Westen und folgt über weite Strecken der Wasserscheide.«
Wohl bis zu fünfzigtausend Ochsen wälzten sich Jahr für Jahr durch die Herzogtümer. Dafür mussten die Händler dem dänischen König Ausfuhrzoll zahlen. Der Herzog von Schleswig-Gottorf und der Graf von Holstein-Schaumburg kassierten Durchfuhrzoll. Und schließlich verlangte die Stadt Hamburg bei der Einfuhr Consummations-Akzise oder bei der Durchfuhr Elbzoll.
Christian dachte, dass er nachts auf seinem Strohsack und an der Seite der Schwester heimlich davon träumen würde, auch den nächsten Viehtrieb begleiten zu dürfen, dass er an den Herausforderungen und Abenteuern wachsen wollte.
In den vergangenen Tagen hatten die Männer gerätselt, wann sie endlich durch Schleswig marschieren würden, um dort einen Teil der Ochsen zu verkaufen. Immer wieder hatte sie der Viehhändler auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet.
»Die Ochsen brauchen noch einen Tag Ruhe«, hatte Ossen-Schröder etwa behauptet. »Sie sollen sich noch ein wenig rund saufen.« Tatsächlich waren die Tiere vom langen Treiben geschwächt und mehr Knochen als Fleisch.
»Heute ist es zu heiß zum Treiben«, hieß es am nächsten Morgen.
Inzwischen hatten die Männer begriffen, dass der Viehhändler nicht mit der gesamten Herde durch Schleswig marschieren wollte. Ossen-Schröder hatte seine Pläne geändert.
Auf Schleichwegen waren sie um die Stadt herum gezogen und warteten nun im Süden auf einen Mittelsmann, der ihnen wohl einen Teil der Herde abnehmen sollte. Dann würde der Viehhändler mit dem Rest nach Schleswig zurückkehren und lediglich auf die Tiere, mit denen er die Hafenbrücke überquerte, Zoll bezahlen.
»Das ist Betrug«, hatte Christians Vater geflüstert, als sein Sohn ihn auf dem nächtlichen Lager nach den Absichten des Viehhändlers befragt hatte. »Aber was soll der Schröder tun? So viele Jahre hat er seinen Zoll gezahlt, ohne zu murren. Dabei sind die Straßen immer unsicherer geworden. Und inzwischen sind die Zölle so hoch, dass kaum noch Gewinn übrig bleibt. Schröder muss ja auch noch uns, seine Treiber, bezahlen. Er wird schon wissen, was er tut.«
Im flackernden Licht des Feuers hatte Christian nicht deuten können, ob da Furcht in den Augen des Vaters stand, doch seine zögerliche Stimme hatte ihm verraten: Ihm war nicht wohl beim Gedanken an die Häscher des Herzogs. Die Männer wussten, dass sie gegen die Gesetze des Landesherrn verstießen. Und Schmuggel wurde streng bestraft, bisweilen sogar mit dem Tod.
Der Sack in Christians Händen war schwer und schwerer geworden, mühsam schleifte er ihn hinter sich her. Noch einige trockene Äste, dann wollte er zu den Männern zurückkehren. Doch plötzlich meinte Christian, Pferdehufe zu hören. Erschrocken ließ er das Holz fallen und drückte sich unter einen Strauch. Waren das die Männer, auf die Ossen-Schröder wartete? Ängstlich lauschte er in seinem Versteck, doch da war zunächst nichts, nur ein dumpfes Rauschen: Das Blut pulsierte in seinen Ohren.
Im nächsten Moment hörte er wieder Hufschläge, Reiter näherten sich im Galopp. Mit flachem Atem kroch Christian tiefer in das Gebüsch hinein und drückte sich auf den Boden ohne auf die Dornen zu achten, die seine Arme und Beine zerkratzten. Die Erde bebte, Sand spritzte auf und kitzelte in seiner Nase, als die Pferde ganz nah an seinem Versteck vorbeiflogen. Bevor er noch an die Treiber denken konnte, drangen Wortfetzen wie Geschosse in sein Bewusstsein vor.
»Ochsen ...«, hörte er. Und dann: »Verdammte Schmuggler ...«
Ein Fluch folgte, die Männer waren vorbei.
Die Männer des Herzogs! Panik ergriff ihn. Christian überschlug, wie viele Pferde er gesehen hatte. Waren es fünf oder sechs? Und: Hatten die Viehtreiber oben auf dem Hügel die Männer noch rechtzeitig bemerkt? Hatten sie ihnen entkommen können? Denn Ossen-Schröder hatte ihnen eingeschärft zu fliehen, sobald die Häscher des Herzogs auf ihre Spur gestoßen wären. Immer und immer wieder.
»Und wenn sie euch erwischen: kein falsches Wort«, das war sein Befehl gewesen, der wie ein Fluch durch Christians Gedanken echote. »Kein falsches Wort oder es wird euch schlecht ergehen.«
Die Angst lähmte Christian. Starr lag er da, kniff die Augen zusammen und presste die Hände auf die Ohren. Er hatte versucht, an etwas Schönes zu denken, an seine Schwester, und nicht daran, was dort oben auf dem Hügel geschah. Tränen quollen zwischen seinen Lidern hervor, er gab keinen Laut von sich.
Vielleicht war eine Ewigkeit vergangen – vielleicht auch nur ein Augenblick. Als er die Hände von den Ohren nahm und die Augen öffnete, hatte es zu dämmern begonnen. Spöttisch sangen die Drosseln ihr Abendlied und ihm war, als verlachten sie ihn und seine Angst.
Die Reiter waren fort. Vorsichtig robbte Christian aus seinem Versteck. Er wagte nicht aufzustehen und lag flach im Gras, so lange bis sein Atem sich beruhigt hatte. In der Ferne meinte er, die Ochsen zu hören. Das Geräusch ihrer Körper, die sich schwerfällig in Bewegung gesetzt hatten. Der Boden zitterte unter ihren Hufen.
Christians Gedanken überschlugen sich: Die Ochsen ... Das waren doch seine Ochsen! Irgendjemand trieb die Herde zusammen. Die Tiere schnaubten unwillig, protestierten, denn sie wollten nicht bewegt werden. Die Ochsen mussten abends ruhen, das Gras wiederkäuen und verdauen, das im Lauf des Tages in ihre Mägen gelangt war. Wären es weibliche Tiere, Kühe, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo sich Gras und wilde Kräuter auf wundersame Weise in sahnige Milch verwandelten.