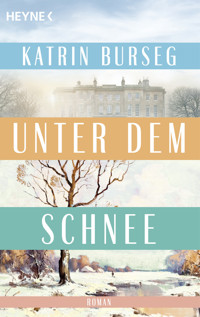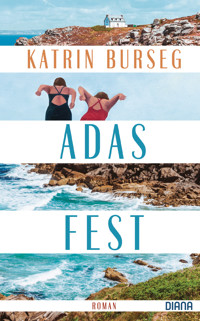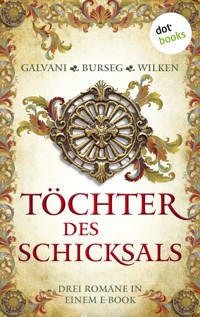
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei mutige Frauen im Schatten der Weltgeschichte: Das Sammelband-Highlight »Töchter des Schicksals« jetzt als eBook bei dotbooks. Frankreich im 16. Jahrhundert: Während das Grauen der Bartholomäusnacht heraufdämmert, wird die schöne Isabelle de Valmy am Königshof immer tiefer in Intrigen verwickelt. Als Spionin der Hugenotten wagt sie ein gefährliches Spiel … Holstein, 1625: Als die junge Magd Wiebke dem König von Dänemark begegnet, wissen beide, dass ihre Liebe unmöglich ist. Und dennoch nimmt Christian sie mit an seinen Hof, wo sie als Zofe seiner Frau dienen soll – und setzt damit das Rad des Schicksals in Gang … Schloss Fontainebleau im 16. Jahrhundert: Nur als Mann verkleidet kann die begabte Freskenmalerin Luisa Paserini am Hof des Königs arbeiten. Während die Inquisition immer mehr Einfluss gewinnt, tanzt Luisa einen gefährlichen Drahtseilakt, der sie alles kosten könnte – auch den Mann, den sie über alles liebt … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Sammelband »Töchter des Schicksals« vereint die drei historischen Romane »Die geheime Königin« von Gabriela Galvani – auch bekannt unter Micaela Jary und Michelle Marly –, »Die Zofe der Königin« von Katrin Burseg und »Die Malerin von Fontainebleau« von Constanze Wilken. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2065
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Frankreich im 16. Jahrhundert: Während das Grauen der Bartholomäusnacht heraufdämmert, wird die schöne Isabelle de Valmy am Königshof immer tiefer in Intrigen verwickelt. Als Spionin der Hugenotten wagt sie ein gefährliches Spiel … Holstein, 1625: Als die junge Magd Wiebke dem König von Dänemark begegnet, wissen beide, dass ihre Liebe unmöglich ist. Und dennoch nimmt Christian sie mit an seinen Hof, wo sie als Zofe seiner Frau dienen soll – und setzt damit das Rad des Schicksals in Gang … Schloss Fontainebleau im 16. Jahrhundert: Nur als Mann verkleidet kann die begabte Freskenmalerin Luisa Paserini am Hof des Königs arbeiten. Während die Inquisition immer mehr Einfluss gewinnt, tanzt Luisa einen gefährlichen Drahtseilakt, der sie alles kosten könnte – auch den Mann, den sie über alles liebt …
Eine Übersicht über die Autorinnen finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
Sammelband-Originalausgabe April 2023
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe von »Die geheime Königin« von Gabriela Galvani 2006 Aufbau Verlagsgruppe GmbH, Berlin; Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe von »Die Zofe der Königin« von Katrin Burseg 2008 fredebold&partner gmbh, dieses Buch erschien dort unter dem Titel »Das Königsmal«; Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe von »Die Malerin von Fontainebleau« von Constanze Wilken 2009 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH; Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-543-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Töchter des Schicksals« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Gabriela Galvani, Katrin Burseg und Constanze Wilken
Töchter des Schicksals
Drei Romane in einem eBook
dotbooks.
Gabriela GalvaniDie geheime Königin
Historischer Roman
Mitte des 16. Jahrhunderts: Schon lange werden die Geschicke Frankreichs im Verborgenen von Diane de Poitiers gelenkt, der Mätresse des Königs. Ihr Wasserschloss wirkt wie ein Ort aus dem Märchen, hinter den Mauern jedoch regieren Intrigen und Ränkeschmiederei – ein gefährlicher Balanceakt, während das Land von Religionsunruhen in seinen Grundfesten erschüttert wird. Als Spionin der Hugenotten gelangt die schöne Isabelle de Valmy an Dianes Hof, um die nächsten Schachzüge der Krone in Erfahrung zu bringen. Ihren protestantischen Glauben darf sie um keinen Fall preisgeben, doch immer mehr verfängt sie sich in dem ebenso seidigen wie tödlichen Spinnennetz des Hofes – und ausgerechnet der Leibwächter des Königs scheint einen Verdacht zu haben, wer Isabelle wirklich ist …
Für meinen Gabriel
Erster Teil
1547
Prolog
Isabelle war überzeugt davon, daß in der Nacht die Geister kamen, um kleine Mädchen wie sie zu erschrecken. Die Spukgestalten rasselten dann mit den Ketten, die sie fesselten, sahen grausig aus mit ihren vom Fegefeuer versengten Haaren und waren größer und mächtiger als alle lebenden Personen, die zum Haushalt gehörten. Ganz genau hatte Isabelle ein solches Wesen zwar noch nicht gesehen, aber immerhin seinen Schatten. Wer sonst sollte die Flammen in den Fackeln zum Flackern bringen und mit unsichtbarer Hand unheimliche Bilder auf die Wände malen?
Ihre Gouvernante ahnte wohl, wie sehr sie sich fürchtete, und hatte deshalb stets darauf geachtet, ein Licht in der Schlafkammer brennen zu lassen, was aber letztlich nur neue Schrecken bei dem Mädchen wachrief. Dennoch war die Umsicht der Bonne sehr fürsorglich, denn die meisten Kinderfrauen würden eine brennende Kerze als Verschwendung und – schlimmer noch – als Zeichen der Verweichlichung betrachten. Doch Isabelle war keine Memme. Sie war ein mutiges Kind, sie ritt wie der Teufel, hatte Talent für die Fechtkunst und konnte nach den ersten Übungsstunden mit Papa sogar schon besser mit der Büchse umgehen als ihre älteren Brüder. Trotzdem hatte Isabelle entsetzliche Angst vor der Dunkelheit – und den Geistern, die sich des Nachts so mühelos zurechtfanden.
Sie war zehn Jahre alt. Eigentlich aus großbürgerlichem Hause, hätte sie in vornehmster Umgebung aufwachsen sollen, doch Isabelle Bohier war in die schlechteren Jahre ihres Vaters hineingeboren. Manchmal fragte sie sich, ob es einen schicksalhaften Zusammenhang mit Papas Schwierigkeiten und dem frühen Unfalltod ihrer Mutter gab. Natürlich war die Erörterung der finanziellen Probleme ihrer Familie nicht für ihre Ohren bestimmt, doch Isabelle ließ sich nichts vormachen, weshalb sie Bruchstücke einer Geschichte zu einem sinnvollen Ganzen zusammengesetzt hatte und realisierte, was die Erwachsenen meinten, wenn Themen berührt wurden, von denen die Kinder nichts wissen sollten. So bemerkte Isabelle eher als ihre Brüder, daß ihr Vater in Schwierigkeiten steckte und seit der Krönung des Dauphins Henri zum König Frankreichs von besonders großen Sorgen geplagt wurde.
Plötzlich spürte Isabelle einen Luftzug über ihr Bett gleiten. Die Schatten an den Wänden ihrer Schlafkammer bewegten sich bedrohlich auf sie zu. Wahrscheinlich hatte sich der böseste aller Geister einen besonderen Schabernack für sie ausgedacht: Er kam durch eine Tür wie ein lebendiger Mensch und schwebte nicht wie ein Gespenst durch die Mauern des mittelalterlichen Gutshauses, in dem sie lebten. Doch Isabelle nahm sich vor, sich nicht einschüchtern zu lassen. Sie würde nicht einmal schreien. Aber sicherheitshalber verkroch sie sich unter ihrer Bettdecke.
»Isabelle, wach auf!« flüsterte der Geist. »Wach auf ... wir müssen fort ...«
Genau das hatte sie immer befürchtet. Daß ein Geist kommen und sie holen würde. Unwillkürlich versuchte sie sich ganz klein zu machen und rollte sich unter dem Plumeau zusammen. Sie biß sich auf die Lippe, um den in ihrem Hals steckenden Schrei zu unterdrücken. Sekunden später schmeckte sie Blut.
»Rasch, ma petite, wach auf«, mahnte eine Stimme, die durch die Fasern der Decke verdächtig nach der Stimme ihres Vaters klang. Aber damit hatte Isabelle gerechnet. Schließlich war zu erwarten, daß sich Geister die Sprache von lebenden Menschen ausliehen, um ihre schrecklichen Ziele zu erreichen. Verzweifelt versuchte sie die Hand abzuschütteln. Da wurde mit einem Ruck die schützende Hülle von ihrem Leib gerissen. »Nun stell dich nicht an. Du mußt aufstehen! Komm schon, Kind!«
Isabelle wagte kaum zu atmen. Sie getraute sich nicht einmal, die Augen aufzumachen, weil sie befürchtete, dann der Fratze eines Dämons ansichtig zu werden. Doch die Faszination, die das Kaninchen beim Anblick einer Schlange erfaßt, nahm auch von Isabelle Besitz. Vorsichtig zwinkernd spähte sie durch ihre langen Wimpern. Die Augen ihres Vaters waren dicht über ihr. Niemand außer ihm besaß diesen gütigen grauen Blick. Nicht einmal ein Geist. Überrascht hoben sich Isabelles Lider. »Papa?« fragte sie mit einer Mischung aus Erstaunen und Erleichterung.
Statt einer Antwort schob ihr Vater seinen Arm unter ihre Schultern und hob sie hoch. »Es ist wichtig, daß wir uns beeilen«, sagte er, und seine Stimme wurde drängender. »Wir müssen fort. Es wird eine weite Reise werden. Ein richtiges Abenteuer. Das wird dir sicher gefallen. Also beeile dich!«
Isabelle stand aber nicht der Sinn nach neuen Aufregungen – die entsetzliche Furcht vor dem Geist genügte für eine Nacht. Bleierne Müdigkeit überfiel sie. »Ich möchte schlafen. Warum können wir nicht morgen verreisen, Papa?«
»Weil es morgen zu spät sein könnte ... Wir fahren jetzt, ma petite, du kannst in der Kutsche weiterträumen.«
»Wo fahren wir denn zu so später Stunde hin? Nach Paris?« Die Aussicht auf einen Ausflug in die Metropole war wohl der einzige Grund, der Isabelle aus dem Bett bringen würde. Sie war noch nie dort gewesen; die einzige Stadt, die sie kannte, war das nahe gelegene Rouen. Ihren Brüdern jedoch war bereits mehrfach erlaubt worden, den Vater auf seinen Reisen zu begleiten. Sie hatten Paris in den glanzvollsten Farben geschildert, und Isabelle wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich alt genug zu sein, um sich selbst von der märchenhaften Pracht der französischen Hauptstadt zu überzeugen.
Doch ihr Vater hatte andere Pläne. »Nein«, erwiderte er, »wir fahren nicht nach Paris. Unser Ziel liegt weit entfernt in einem anderen Land. Wenn alles gut geht, werden wir die Stadt der wahren Religion besuchen, dann wirst du das Meer sehen und in der reichsten Republik der Welt leben. Es wird dir gefallen, aber fasse dich in Geduld, und stelle nicht zu viele Fragen.«
Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Allerdings nicht aus Vorfreude. Sie versuchte im Gesicht ihres Vaters zu lesen, wenigstens in seinen Augen eine Erklärung zu finden, doch er wandte seinen Blick ab. Er stellte sie neben einer Kommode auf die Füße, um nach ein paar Kleidungsstükken zu greifen, welche die Gouvernante gestern abend offenbar bereitgelegt hatte, ohne daß Isabelle dies aufgefallen war. Ungeschickt half Antoine Bohier seiner Tochter beim Ankleiden, die, aus ihrer Welt gerissen, zu keiner vernünftigen Bewegung fähig war und sich wie eine bewegungslose Puppe verhielt.
Seine verklausulierten Worte loderten wie ein vom Wind angefachtes Feuer in ihrem Kopf. Isabelle brauchte nicht weiter darüber nachzudenken, was sie bedeuteten: Die nächtliche Reise stellte eine erhebliche Gefahr dar, und sie würde ihr Zuhause wahrscheinlich für immer verlassen, eine Vorstellung, die sie noch mehr erschreckte als die Bedrohung durch Geister. Sie wollte nicht fort von hier, vom Grab ihrer Mutter, von ihrer Kinderfrau und den vertrauten Dienstboten, von ihrem Pferd und den grünen Hügeln der Normandie.
Unvermittelt kam Leben in ihre Glieder. Mit ihren kleinen, festen Fingern umklammerte sie die Handgelenke ihres verdutzten Vaters. »Wann kommen wir wieder zurück, Papa?«
»Du sollst keine Fragen stellen ...«, hob er verärgert an, dann besann er sich und atmete tief durch, bevor er ruhig antwortete: »Das kann ich dir nicht sagen, ma petite. Ich weiß es nicht. Vielleicht kehren wir niemals heim. Aber Flucht und Verbannung sind allemal ein besseres Los als der Henker. Also beeil dich! Es geht um Leben und Tod.«
Isabelle wagte nicht, weiter in ihn zu dringen. Der Schatten, der sich sekundenlang auf seine Miene gesenkt hatte, genügte, damit sie sich in Bewegung setzte. Sie wollte ihren geliebten Vater nicht traurig sehen. Schlimmer noch, der Mann, den sie für den stärksten Menschen der Welt gehalten hatte, zeigte sich angreifbar und verletzlich. Das Wort »Henker« schockierte sie mehr als alles andere. Natürlich wußte sie, daß Bösewichte gefoltert und Anhänger der Reformation zum Tode verurteilt wurden, aber sie hatte die grausamen Prozessionen durch die Rue du Gros-Horloge zur Hinrichtungsstätte am Marktplatz von Rouen niemals mit der Möglichkeit in Verbindung gebracht, einem Mitglied ihrer Familie könne dergleichen widerfahren.
Obwohl der Vater eine Minute später wieder so souverän wie eh und je erschien, stanzte sich seine Angst vor dem Schafott in ihre Erinnerung an diese letzte Stunde in ihrem alten Heim ein wie ein Siegel in Lack. Merkwürdigerweise machte Papas Furcht Isabelle stark. Es war nicht nur ein sehr weiblicher Beschützerinstinkt, der sich ihrer bemächtigte, sondern auch ein erstes Aufglimmen von Rachegefühlen. Das kleine Mädchen beschloß, es jenen Menschen heimzuzahlen, die Papa derart übel mitspielten und sie selbst ihres Zuhauses beraubten. Mit plötzlicher Klarheit wußte sie, daß die Tage ihrer Kindheit vorüber waren.
»Ich werde mich nie wieder vor Geistern fürchten«, murmelte Isabelle in die Wolle ihrer ungeliebten Winterunterwäsche, die ihre Stimme dämpfte und diesen Entschluß vor den Ohren ihres Vaters verbarg. Doch waren dies keine leeren Worte. Die Dunkelheit hatte ihren Schrecken verloren. Isabelle begann zu begreifen, daß die Lebenden einem mehr antun konnten als die unglücklichen Seelen der Toten.
Zweiter Teil
1559
Kapitel 1
Es war für jeden Reisenden überwältigend, in Paris einzutreffen. Das Durcheinander an Reitern, Fuhrwerken, Postkutschen und Sänften, Booten und Handelsschiffen war atemberaubend. Rechts und links der Seine, aber auch auf dem Fluß selbst, herrschte reger Verkehr. Seit dem Ende des Krieges gegen Spanien schienen die Händler und Kaufleute ihre wegen der Kämpfe versäumten Geschäfte in Windeseile nachholen zu wollen. Und als könnten der König und die Königin den Verlust ihrer Besitzungen in Italien damit kompensieren, schienen beide besessen davon, ihre Hauptstadt in ein Kleinod der italienischen Renaissance zu verwandeln. Das größte Bauvorhaben wurde derzeit im Faubourg Saint-Honoré realisiert: Die alte Trutzburg Louvre wurde zu einem beeindruckenden Palast umgebaut, und auf dem angrenzenden Grundstück einer ehemaligen Ziegelei sollte das prachtvolle Tuilerien-Schloß errichtet werden; daneben entstanden die Häuser von Adligen und reichen Bürgern, die vornehmlich Künstler aus dem Süden mit den Planungen beauftragten. Es wurde jedoch nicht nur gehandelt und gehämmert in Paris – Einheimische und Besucher lebten hier trotz der neuerlichen Preiserhöhungen und den Folgen einer verheerenden Dürre besser als in den meisten anderen Städten der Welt.
Die Luft war erfüllt vom angenehmen Duft der Köstlichkeiten, die an fast jeder Straßenecke von den Pastetenbäckern angeboten wurden. Nirgendwo sonst konnte man so üppig speisen wie in der Kapitale. Das Angebot war vortrefflich: Die Schankwirte boten die köstlichsten Menüs an, und viele Köche, die sich einen Namen gemacht hatten, wurden in Privathaushalte bestellt, um dort für ein paar Testons ein vorzügliches Mahl zuzubereiten. So wirkte Paris wie die Inkarnation jenes sagenumwobenen pays de Cocagne, des Schlaraffenlandes also, das in einer Fabel besungen wurde, und niemanden verwunderte es, wenn ein Reisender behauptete, hier schon Mannasuppe und gebratenen Phönix gekostet zu haben.
Als Gabriel de Montgommery an diesem Märztag in die Hauptstadt zurückkehrte, fühlte er augenblicklich ein heftiges Knurren im Magen. Da er jedoch mittels einer Eilpost ins Hotel des Tournelles, den derzeitigen Wohnsitz des Königs, gerufen worden war, mußte die Befriedigung seiner natürlichen Bedürfnisse warten, wozu auch ein kurzweiliges Tête-à-tête mit einem entgegenkommenden Schankmädchen gehörte. Schließlich war die freie Liebe ein Teil des pays de Cocagne, und der Comte schien die Fleischwerdung jener Kavaliere zu sein, wie sie in den Balladen der Minnesänger beschrieben wurden.
Er war ein hochgewachsener Edelmann von knapp dreißig Jahren, gut aussehend mit einem schmalen, scharf geschnittenen Gesicht und einer geraden Nase, blauen Augen unter dichten Brauen und überraschend sinnlichen Lippen, deren Sanftheit von einem dunklen Schnurrbart verborgen wurde. Sein braunes Haar war gepflegt und kinnlang, und wie alle Höflinge von Henri II. trug er die Farben Schwarz und Weiß, was ihm keine Ernsthaftigkeit, sondern etwas Leidenschaftliches verlieh, wenn ihm wohl auch ein wenig Rot in der Kleidung sehr gut gestanden hätte. Er besaß ein einträgliches Gut in Ducey an der normannischen Küste nahe dem Mont Saint-Michel und war seit nicht allzu langer Zeit verwitwet. Umstände, die ihm ein weitgehend sorgloses Leben bescherten – und eine gewisse Ergebenheit der Damenwelt.
Seit kurzem war Gabriel de Montgommery zum Hauptmann der Schottischen Garde, der traditionellen Leibgarde des Königs, befördert worden. Er war seinem Vater in dieses Amt gefolgt, aber sein hohes gesellschaftliches Ansehen und seine Geschicklichkeit im Turnier befähigten ihn auch dafür. Besonders letztere war wohl für die Entscheidung des Königs verantwortlich gewesen, denn Henri II. liebte die romantisch verklärten Geschichten des Mittelalters und versuchte seine Lebensweise diesen anzugleichen. Er war wie besessen von Ritterlegenden, von Pferden und Wettkämpfen – und von einem einzigen »Burgfräulein«, welches noch dazu eine wesentlich ältere Frau war. Jedenfalls schätzte er Kavaliere, die sich entsprechend dem alten Ehrenkodex benahmen, ihre Kräfte bei bedeutenden gesellschaftlichen Anlässen wie Ritterturnieren oder Jagden miteinander maßen und die Damen gleichzeitig mit dem Charme eines Troubadours unterhielten. Und zu diesem Weltbild paßte ganz eindeutig der gerade vor dem Hôtel des Tournelles einreitende Comte de Montgommery.
Da der alte Königspalast umgebaut wurde, nahm der Monarch während seiner Aufenthalte in Paris vorübergehend Wohnsitz in diesem Anwesen an der Rue Saint-Antoine. Das Hôtel des Tournelles war ein im 13. Jahrhundert errichtetes, mit zahllosen Zinnen und Türmen bewehrtes Gebäude, die ihm seinen Namen gaben. Wie an jedem Ort, an dem sich der König aufhielt, schwirrten Hunderte Höflinge und Bedienstete in seinen Räumen herum wie in einem Bienenstock. Um so überraschter war der Hauptmann, daß er den König allein in dessen provisorischem Arbeitszimmer antraf, nachdem er von einem Lakaien dorthin geführt worden war. Ein Gespräch unter vier Augen versprach interessant zu werden.
»Tretet näher«, forderte der König den Kommandanten seiner Leibgarde auf, der in einer angemessen tiefen Verbeugung neben der Tür verharrt war. Henri blickte nur kurz hoch, um sich gleich wieder dem Schreiben zuzuwenden, über das er zum Trocknen der Tinte Sand zu streuen begann.
Der Comte de Montgommery richtete sich auf und folgte gemessenen Schrittes der Aufforderung. Wie bei jeder seiner Begegnungen mit dem König wunderte er sich auch jetzt über den ungewöhnlich raschen Verfall seines Monarchen. Obwohl erst vierzig Jahre alt, war Henris Gesicht das eines wesentlich älteren Mannes: Es war schmal, und von seinen Nasenflügeln zogen sich tiefe Falten zum Mund, seine Haut war trotz der vielen sportlichen Betätigungen bleich. Seine hellen Augen lagen unter schweren Lidern tief in den Höhlen und über Tränensäcken. Seit längerem lichtete sich das Haar des Monarchen und war von grauen Strähnen durchzogen. Hätte Montgommery es nicht besser gewußt, er hätte annehmen können, daß er einem kränkelnden Menschen gegenüberstand, doch Henri erfreute sich – abgesehen von einer gewissen Schwermut – bester Gesundheit.
Wahrscheinlich, resümierte Montgommery, ließ die Beziehung zu seiner Mätresse den König so schnell altern; Henri paßte sich dem Geburtsdatum der Frau an, die er wie keine andere liebte. Andererseits: Seine Dame hatte im Laufe der Zeit weder einen Funken ihrer Jugend noch ein Quentchen ihrer Schönheit eingebüßt; mit ihren inzwischen sechzig Jahren war Diane de Poitiers eine atemberaubende Erscheinung, der es noch immer gelang, selbst die Königin in den Schatten zu stellen. Daß Catherine de Médicis genauso alt war wie ihr Gemahl und damit ebenfalls zwanzig Jahre jünger als dessen Favoritin, schien beim Konkurrenzkampf der Frauen keine Rolle zu spielen. Arme Catherine! fuhr es Montgommery durch den Kopf. Die Florentinerin suchte in Frankreich wohl noch immer nach dem sagenhaften Schlaraffenland; sie hatte es jedenfalls nie gefunden – und Henri tat nichts, um den Vorhang, der es vor ihr verbarg, auch nur einen Spalt weit zu öffnen.
»Sire«, hob Montgommery erwartungsvoll an.
»Ihr seid schnell«, lobte der König. »Die Eile, mit der Ihr nach Paris gekommen seid, beweist, daß Ihr keine Zeit vertrödelt. Auf Euch ist Verlaß, das ist gut zu wissen.« Er legte eine Kunstpause ein, in der er ebendiese Behauptung noch einmal abzuwägen schien. Schließlich fragte er:
»Seid Ihr über den Friedensvertrag informiert, den wir mit Philipp von Spanien zu schließen beabsichtigen?«
»Ich weiß nur das, was gemeinhin erzählt wird, Sire.«
»Der Krieg muß ein Ende haben«, murmelte Henri wie in einem Selbstgespräch. »Sind nicht schon zu viele edle Männer auf den Schlachtfeldern Italiens gestorben?«
Dies war reine Rhetorik, und er erwartete keine Antwort, sondern fuhr, die stumpfen Augen auf den Brief vor sich gerichtet, fort: »Es mag schon sein, daß Philipp am Ende ist und die Gelegenheit günstig wäre, ihn zu schlagen. Aber wir sind genauso am Ende, nicht wahr? Der Adel ist ausgeblutet und das Bürgertum annähernd bankrott. Wie sollen wir also ohne finanzielle Mittel Rüstungen für unsere Ritter kaufen? Das einfache Volk kann das nicht verstehen. Es will Vergeltung für die Brandschatzungen der Spanier. Diese Haltung ist verständlich, aber nicht von Bedeutung. Wichtig wird sie erst, wenn sich der Oberbefehlshaber unserer Truppen zum Fürsprecher des Volkes macht. Der Friedensvertrag ist deshalb in Gefahr.« Henri richtete seinen Blick auf seinen Hauptmann: »Auf welcher Seite steht Ihr, Comte de Montgommery?«
»Es steht mir nicht zu, Majestät, die Vorschläge der königlichen Ratgeber zu kommentieren. Jedermann weiß, daß der Herzog von Guise den Krieg befürwortet und der Kronfeldherr de Montmorency den Frieden. Erlaubt mir bitte, mir erst eine Meinung zu bilden, bevor ich diese in Worte fasse. Offen gestanden, habe ich die verschiedenen Möglichkeiten noch nicht ausreichend erwogen.«
»In der Tat. Es ist sehr schwierig, sich für den richtigen Weg zu entscheiden«, stimmte der König zu. »Ich wünschte, Gaspard de Coligny wäre an meiner Seite, um das Zünglein an der Waage zu spielen, doch unser Admiral befindet sich seit zwei Jahren in spanischer Gefangenschaft ...«
Er musterte sein Gegenüber, als könnte er durch die Betrachtung seines Äußeren auf dessen Gedanken schließen. Nach einer Weile gab er es jedoch auf, das Innerste seines Hauptmanns ergründen zu wollen. Er fragte: »Was haltet Ihr von einem Fest, Montgommery?«
»Ein Fest, Sire?« gab Gabriel überrascht zurück. Wie alle Höflinge kannte er die Vorliebe des Königs für Tanzveranstaltungen und sportliche Wettkämpfe. Ihm war jedoch nicht ganz klar, welcher Zusammenhang zwischen einem Fest und der Eile bestand, mit der er nach Paris beordert worden war. »Wenn Ihr ein geselliges Beisammensein plant, ist dies eine vortreffliche Idee.«
»Der König von Spanien soll unsere Tochter Elisabeth ehelichen. Natürlich wäre diese Verbindung ein Vertragspunkt, und sie ist das beste Fundament, auf dem der Frieden gebaut werden kann. Die Prinzessin verabscheut Philipp, aber das spielt keine Rolle. Wir feiern trotzdem ein großes Fest mit Musik, Tanz und einem Turnier. Das Volk sollte beteiligt sein und sich ebenso verlustieren können wie die Hofgesellschaft.«
Brot und Spiele, fuhr es Montgommery durch den Kopf. Schon die Römer hatten sich die Gunst ihrer Bürger auf diese Weise gesichert. Ein Fest allein würde jedoch nicht ausreichen, um die Probleme in Frankreich zu lindern. Das einfache Volk forderte bessere Lebensbedingungen, der Adel niedrigere Abgaben für die Staatskasse, das Bürgertum Religionsfreiheit.
»All diese wunderbaren Pläne können aber nur umgesetzt werden, wenn der Friedensvertrag tatsächlich geschlossen wird. Der Herzog von Guise ist ein Spielverderber, der uns jeglichen Spaß vergällt. Und das Volk dazu.« Als sei damit alles gesagt, wandte sich der König wieder dem eben unterzeichneten Brief zu, schüttelte den Sand von dem Papier und faltete es zusammen. Während er das Schreiben versiegelte, sagte er: »Auf Eurem Ritt nach Chenonceau werdet Ihr Zeit haben, über Eure Haltung in dieser Sache nachzudenken.«
Ein Botengang war also der Grund für seinen Befehl. Montgommery konnte ein leichtes Aufatmen nicht verhindern. Es gab wenige Plätze in Frankreich, die er so gerne besuchte wie Schloß Chenonceau in der Touraine. Nicht nur, daß das Anwesen ein wunderschöner Ort zum Verweilen war – es gehörte Henris Favoritin, und Diane de Poitiers war eine exzellente Gastgeberin. Sie unterhielt einen Hofstaat, der glanzvoller war als der von Catherine de Médicis: Die besten Köche des Landes arbeiteten für sie, ihr Weinkeller war ebenso berühmt wie ihre Bibliothek, und die Damen, die zum Haushalt gehörten, waren amüsant, charmant und meistens sehr aufgeschlossen. Unwillkürlich meldeten sich bei Gabriel jene Bedürfnisse zurück, die ihrer Befriedigung harrten. Dabei fiel ihm das liebliche Antlitz einer der Ehrendamen ein, auf die er bei einem Ball vor einigen Wochen ein Auge geworfen hatte. Eine reizende junge Frau, die seinen Avancen durchaus zugeneigt schien. Bedauerlicherweise hatte sich keine Gelegenheit für eine Romanze ergeben; im Rosengarten von Chenonceau sollte dies anders sein, auch wenn es im März noch nirgendwo blühte. Dummerweise war ihm jedoch der Name der Schönen entfallen.
»Ich stehe ganz zu Eurer Verfügung, Sire«, betonte er eilfertig.
»Ich verlasse mich darauf, daß Ihr dieses Schreiben Madame de Poitiers persönlich übergebt. Anschließend erwartet Ihr Instruktionen von Madame und werdet nach diesen handeln, einerlei, was sie Euch aufträgt ... Und hier ist eine zweite Order für den königlichen Stallmeister, damit Euch die besten Pferde zur Verfügung gestellt werden. Nun denn, Comte de Montgommery, macht Euch auf den Weg, und verschwendet keine Zeit!«
Tatsächlich hatte der nicht die Absicht, lange in Paris zu verweilen. Die Anziehungskraft der bezaubernden Ehrendame war erheblich größer als die Aussicht auf ein unbekanntes Schankmädchen. Gerade als er zu einer tiefen Verbeugung vor dem König einknickte, fiel ihm der Name der Umschwärmten wieder ein. Marie. Sie hieß Marie. Eine Katholikin also, denn keine Protestantin würde auf den Namen der Mutter Christi getauft werden. Allerdings würde Diane de Poitiers in ihrem Umfeld ohnehin keine Anhängerin der reformierten Kirche dulden. Gabriel war die Religion einer anziehenden jungen Dame jedoch weitgehend gleichgültig; entscheidend war höchstens, daß Papistinnen leichtlebiger und sinnesfreudiger als die zu strenger Enthaltsamkeit erzogenen Töchter der Hugenotten waren. Der Aufenthalt in Chenonceau versprach demnach verführerisch zu werden.
Kapitel 2
Manchmal dachte Isabelle, alles an ihr sei falsch. Ihr Name war erfunden, ihre Herkunft nichts als schöner Schein und ihr Bekenntnis eine Lüge. Dennoch verfolgte sie ihr Ziel ehrgeizig und ohne sonderlich über die Folgen nachzudenken, frei nach ihrem Religionsführer Jean Calvin, der den Gläubigen verkündete, daß jeder Mensch für sein Tun selbst verantwortlich war und es keine Vorbestimmung im Sinne der katholischen Kirche gab, die als Entschuldigung ausgelegt werden konnte. In erster Linie war Isabelle tatsächlich der reformierten Kirche verbunden, und es war einfacher, den Worten des größten Predigers der französischen Protestanten zu vertrauen, als über den Verrat nachzudenken, dessen sie sich auf die eine oder andere Weise schuldig machte.
Ihr Auftrag war es, die für den Juni geplante erste Synode der Hugenotten in Paris zu sichern. Sie sollte Augen und Ohren offenhalten, um alles in Erfahrung zu bringen, was das Konzil und seine Teilnehmer gefährden könnte. Zu diesem Zweck war aus der leidenschaftlichen Protestantin eine verlogene Katholikin geworden, aus Antoine Bohiers Tochter die respektable Witwe des angeblichen Diplomaten Michel de Valmy und aus einer rechtschaffenen jungen Frau eine durchtriebene Spionin. Binnen weniger Monate war sie von einem Gönner in ihre neue Aufgabe eingewiesen worden; dieser Mann hatte sie bei Hof eingeführt und die richtigen Leute bestochen, um Isabelle als Ehrendame bei Diane de Poitiers unterzubringen.
Es gelang Isabelle rasch, sich bei der Favoritin des Königs unentbehrlich zu machen. Vielleicht fand Diane deshalb so schnell Gefallen an ihr, weil sich die Frauen auf den ersten Blick nicht unähnlich waren. Beide waren intelligent, stark und mutig, was sich besonders bei den gemeinsamen Ausritten zeigte. Diane ritt jeden Morgen aus – und nahm es dabei mit den tapfersten Rittern auf. Daß sie in Isabelle eine ebenso kühne Begleiterin gefunden hatte, war für sie ein glücklicher Zufall; für die Agentin war es der erste Schritt, sich das Vertrauen der königlichen Mätresse zu erschleichen. Und um dieses zu erringen, war Isabelle sogar bereit, regelmäßig die heilige Messe zu besuchen.
Allerdings ging es ihr in Wahrheit nicht um ihren Glauben. Isabelle nahm die verwerflichsten Sünden und größten Gefahren auf sich, weil sie einen persönlichen Rachefeldzug führte. Mehr noch als Henri II. machte sie dessen Geliebte für die Schmach verantwortlich, die ihrem Vater widerfahren war. Diane hatte ihre begehrlichen Finger vor zwölf Jahren nach Schloß Chenonceau, dem früheren Anwesen der Familie Bohier, ausgestreckt und Isabelles Vater damit ebenso wie seine Tochter um eine Heimat, gesellschaftliches Ansehen, persönliche Sicherheit und viel Geld gebracht. Als Isabelle schließlich einem Mann begegnet war, der eine geeignete Person zur Unterbringung bei Diane gesucht hatte, schien die Gelegenheit günstig, für all das Vergeltung zu üben, was ihrem Vater und letztlich ihr selbst angetan worden war.
Deshalb schlich sie nun um die Favoritin herum. Sie hielt die Augen offen, belauschte Gespräche und machte sich beliebt, immer in der Hoffnung, sich nur ja keine Information entgehen zu lassen, die für ihren Gönner und die gemeinsame wie auch ihre eigene Sache von Nutzen sein konnte. Viel hatte sie bislang jedoch nicht in Erfahrung gebracht. Nicht einmal Dianes Einstellung zum Friedensvertrag mit Spanien war ihr bekannt. Dabei war jedem Mitglied der Hofgesellschaft klar – und natürlich auch Isabelle –, daß von Dianes Meinung letzten Endes auch die Entscheidung des Königs abhing. Denn der hing seit nunmehr dreiunddreißig Jahren in abgöttischer Liebe an dieser Frau – sie war seine Lehrmeisterin, Beraterin, Freundin, Vertraute und Geliebte.
Diane de Poitiers’ politischer Einfluß war enorm. Eine Tatsache, die durch das Eintreffen eines Boten aus Rom um die Mittagszeit unter Beweis gestellt worden war. Der Soldat der Schweizergarde hatte die Standarte des Vatikans getragen und ein Schreiben vom Pontifex persönlich überbracht. Papst Paul IV. wandte sich in einer Depesche an die berühmteste Mätresse Frankreichs – nicht an den König und auch nicht an dessen italienische Gemahlin. Eine beeindruckende Dokumentation, wahrscheinlich mit brisantem Inhalt. Zum ersten Mal seit ihrer Einweisung als Spionin fühlte Isabelle sich ernsthaft gefordert – und hatte nicht die geringste Ahnung, wie sie vorgehen sollte, um den Brief in die Hände zu bekommen.
Nachdem sich die Favoritin mit ihrem Sekretär zu einer Besprechung in die Bibliothek zurückgezogen hatte, wanderte Isabelle nervös im Flur auf und ab. Die Absätze ihrer Pantoffeln klapperten auf dem mit schwarzen und weißen Fliesen ausgelegten Boden. Um diese Stunde brauchte sie sich nicht vorzusehen. Am Nachmittag schwirrten so viele dienstbare Geister durch die Räume von Chenonceau, daß Isabelle eher die Aufmerksamkeit des Personals erregt hätte, wenn sie auf Zehenspitzen herumgelaufen wäre.
Die Zimmertür war zu dick. Isabelle konnte nur Bruchstücke dessen wahrnehmen, was im Inneren gesprochen wurde. Wortfetzen, die kaum zuzuordnen waren, drangen an ihr Ohr. Etwas deutlicher hörte sie, als von der Nichte des Herzogs von Guise gesprochen wurde, was nicht sonderlich überraschend war, denn von Mary Stuart war andauernd die Rede. Erst neulich hatte Isabelle das absurde Gerücht aufgeschnappt, die siebzehnjährige Königin von Schottland und Ehefrau des französischen Thronfolgers sei derart liebestoll, daß der erst 15 Jahre alte, von schwacher Gesundheit gezeichnete François ob soviel Leidenschaft ernsthaft zu kränkeln begann. Allerdings konnte sich Isabelle kaum vorstellen, daß sich die kühle Diane an derartigem Geschwätz beteiligte – schon gar nicht in Gegenwart des klugen, zurückhaltenden Nicholas Fouquet. Es ging also um Politik – und da spielte Mary Stuart im Kampf um Frankreichs Interessen eine wesentliche Rolle.
Konnte es sein, daß sich der Papst mit Hilfe der Favoritin in die britische Thronfolge einmischen und die kürzlich inthronisierte Protestantin Elizabeth als Königin von England absetzen wollte? fragte sich Isabelle. Wenn sich die französische Territorialmacht dank der Ansprüche Marys auf die Krone Englands ausdehnen könnte, würde der Einflußbereich der Papisten wieder zunehmen und ...
Plötzlich drang Dianes stimmgewaltiger Wutausbruch klar und deutlich durch die Tür: »Es kann nicht sein, daß die beiden Herrscher der größten katholischen Reiche ihre Waffen gegeneinander richten, während bereits zwei Drittel aller Franzosen zu Ketzern geworden sind!«
Isabelle mußte an sich halten, um ihren Protest nicht laut herauszuschreien. Sie wußte, Dianes Behauptung war eine infame Lüge. Von irgendeiner Kanzel war diese Zahl gepredigt worden – genauso, wie ständig falsche Anschuldigungen gegen die Reformierten unter das Volk gestreut wurden. Alles nur, um die katholischen Franzosen gegen die evangelischen Brüder aufzuwiegeln.
Während Isabelle sich mit tiefen Atemzügen zu beruhigen versuchte, machte sie sich klar, daß Diane stets nur an das Wohl des Mannes dachte, der sie abgöttisch liebte. Isabelle hatte in den vergangenen Wochen begriffen, daß die Favoritin den Thron in Gefahr sah, obwohl kein Protestant jemals die Macht des Königs angezweifelt hatte. Doch ließ sich damit sehr leicht Dianes leidenschaftlicher Haß erklären – sie versuchte, Henri zu schützen.
Erschreckenderweise fühlte Isabelle Mitleid in sich aufsteigen. Außer ihrem Vater hatte sie noch nie einen Mann so geliebt, daß sie für ihn zu kämpfen bereit gewesen wäre. Andererseits war es der verzweifelte Wunsch, die Ehre ihres Vaters zu verteidigen, der sie eines Tages vielleicht auf dem Scheiterhaufen enden ließ. Ihre Gefühle mochten denen Dianes deshalb nicht ganz unähnlich sein. Doch Verständnis war das letzte, was Isabelle für die Favoritin des Königs empfinden wollte. Schließlich zerstörte Dianes Liebe gnadenlos das Leben anderer Menschen, während Isabelles Rachegelüste sehr persönlicher Natur waren und nur sie selbst und die Person etwas angingen, gegen die sie ihren Feldzug führte. Sie redete sich ein, daß sie durch ihre Handlungsweise keinen Unschuldigen in Gefahr brachte.
Da ihr nicht einfiel, was sie sonst tun sollte, drückte Isabelle mutig die Türklinke herunter. Sie hatte absichtlich nicht geklopft, um Diane bei einer kompromittierenden Äußerung zu ertappen. Eine Erklärung für ihr unhöfliches Verhalten würde ihr schon noch einfallen. Doch Diane schien sich wieder gefaßt zu haben. Als Isabelle eintrat, sagte die mächtigste Frau des Landes im Plauderton: »Italiens Kultur ist es, die Frankreich prägen sollte, nicht unsere Opfer auf den italienischen Schlachtfeldern. Selbst den Erbauer von Chenonceau hat es im Piemont dahingerafft. Der arme Bohier sollte niemals zu Gesicht bekommen, was er so großzügig plante ...«
Die Erwähnung ihres Großvaters ließ Isabelle für einen Moment erstarren. Im nächsten Augenblick weiteten sich ihre Augen vor Überraschung. Ihr bot sich ein höchst ungewöhnliches und zudem unerwartetes Bild: Diane saß an ihrem Schreibtisch, während auf einem bequemen Stuhl neben dem Kamin Marie de Roger thronte, zu deren Füßen Nicholas Fouquet kniete. Das merkwürdige an dieser Szene war nicht etwa, daß sich Nicholas intensiv mit einem Knöchel Maries befaßte – obwohl dieser Anblick schon seltsam genug war –, sondern die Frage, warum Diane die junge Hofdame zu einem politischen Gespräch bat. Und: Wie war Marie überhaupt in die Bibliothek gelangt? Wenn sie durch die Tür gekommen wäre, hätte sie an Isabelle vorbeigehen müssen, und ein Geist, der durch Mauern schweben konnte, war Marie eindeutig nicht.
Isabelles Blick klebte an der jungen Frau. Mit ihren gerade mal achtzehn Jahren machte die Tochter eines bretonischen Landadeligen ihrem Namen alle Ehre: Sie war eine bezaubernd zarte Erscheinung mit dunkelbraunem, in der Mitte gescheiteltem Haar und einem fein geschnittenen, madonnenhaften Gesicht. Sie wirkte stets ein wenig naiv und an nichts so sehr interessiert wie an der Eroberung eines potentiellen Liebhabers oder gar eines geeigneten Heiratskandidaten, falls ihr Vater diesen in einer der Burgen der Bretagne nicht finden sollte. Jedenfalls hieß es, Mademoiselle de Roger sei in Dianes Haushalt aufgenommen worden, um ein wenig höfischen Geschmack zu erlernen. Der Ausdruck ihrer Augen aber bestätigte Isabelles Gedanken, daß sie es einzig auf die Gunst eines Mannes abgesehen hatte, selbst wenn dieser ein sonst eher zurückhaltender Mensch wie Nicholas Fouquet war.
»Ah, Madame de Valmy!« stellte Diane angesichts der Eintretenden konsterniert fest. »Was verschafft uns die Ehre Ihres Auftritts?«
Ganz offensichtlich war sie verärgert. Zwischen den exakt gezupften Brauen über ihren blauen Augen stand eine steile Falte, was ein Alarmzeichen war, denn Diane vermied in der Regel eine zu starke Mimik. Mit ihren fast sechzig Jahren hatte sie nichts von ihrer Schönheit und ihrer unnachahmlichen Ausstrahlung eingebüßt. Ihre täglichen Ausritte und ein erfrischendes Bad im Fluß trainierten ihren Körper; eine schwarze Maske, die sie bei diesen Gelegenheiten trug, und eine Reihe selbst angefertigter Tinkturen pflegten ihre Haut. Ihr Haar leuchtete nicht mehr so golden wie in ihrer Jugend, aber die feinen grauen Strähnen paßten sich auf wunderbare Weise den Perlen und Diamanten an, mit denen sie ihre Frisur schmückte. Seit dem Tod ihres Ehemannes vor nunmehr achtundzwanzig Jahren trug Diane Halbtrauer, Schwarz und Weiß waren ihre bevorzugten Farben, die ihrem Teint und ihrer Persönlichkeit mehr als jede andere Couleur schmeichelten.
»Pardon«, Isabelle versank in ihren Reifröcken zu einem tiefen Hofknicks, der die Ungeheuerlichkeit ihres Benehmens wettmachen sollte. »Ich ... ich wußte nicht, daß ... daß Ihr hier ... bei einer Besprechung seid«, log sie und schalt sich gleichzeitig für diesen hilflosen Versuch, die Situation zu retten. »Ich war auf der Suche nach ... nach Monsieur Fouquet«, improvisierte sie, die Augen wieder auf das erstaunliche Bild am Kamin richtend.
Dianes persönlicher Sekretär war ein eher unscheinbarer Gelehrter von etwa dreißig Jahren, im allgemeinen sehr freundlich, nicht häßlich anzuschauen – vor allem nicht, wenn er lächelte – und unverheiratet, aber keinesfalls ein Bonvivant; seine ganze Erscheinung drückte Wissen und Intelligenz aus, er war eher Professor als Lebemann. Deshalb wirkte er zu Füßen der schönen Marie so gänzlich unpassend.
Er fing Isabelles verstörten Blick auf und erklärte sachlich: »Mademoiselle de Roger hat sich den Knöchel verstaucht. Glücklicherweise kann ich keinen Bruch feststellen.«
»Stellt Euch vor«, zwitscherte Marie mit der vertrauten Unschuldsmiene: »Mir ist ein Malheur passiert. Beim Spazierengehen bin ich ausgerutscht und kam just vor der Gartentür der Bibliothek zu Fall. Monsieur Fouquet war so freundlich, mich zu retten und unverzüglich zu untersuchen.«
»Wie nett von ihm«, murmelte Isabelle. In ihrem Kopf drehten sich die Überlegungen wie ein Kreisel. Vielleicht war Marie gar nicht so einfältig, denn es war schon ein seltsamer Zufall, der sie ausgerechnet zum richtigen Zeitpunkt in jenen Raum führte, in dem Diane gerade die Botschaft von Papst Paul IV. las. Genau betrachtet, war kaum anzunehmen, daß Marie ein anderes als ein politisch motiviertes Interesse an Nicholas besaß. Eine junge Dame, meinte Isabelle, der die meisten Edelmänner bei Hofe zu Füßen lagen, brauchte nicht um den farblosen Sekretär der Favoritin zu buhlen. Sie dachte nicht daran, daß harmlose Langeweile und der Mangel an anderer männlicher Gesellschaft Marie in Nicholas’ Nähe getrieben haben könnte.
»Es ist gut, daß Ihr gekommen seid, Madame de Valmy«, behauptete Diane, und in ihrer Stimme schwang der entschiedene Tonfall einer Frau mit, die es gewohnt war, zu befehlen. »Da es Mademoiselle de Roger wieder etwas besser zu gehen scheint und keine dramatischen Folgen ihrer Verletzung zu befürchten sind, solltet Ihr sie auf ihr Zimmer geleiten, wo sie sich hinlegen kann. Ich möchte meine Unterhaltung mit Monsieur Fouquet ungestört fortsetzen.«
Auf dieses Stichwort hin erhob sich der Sekretär. »In der Tat, Mademoiselle de Roger sollte ein wenig ruhen. Dann ist sie am Abend wieder vollständig genesen.«
Aus den Augenwinkeln wagte Isabelle einen Blick auf den Schreibtisch. Sie erkannte ohne Schwierigkeiten das Dokument mit dem Wappen des Heiligen Vaters, allerdings stand sie zu weit entfernt, um die Handschrift zu entziffern. Wenn sie nur für einen Moment neben Diane hätte treten können!
»Madame de Valmy«, sagte Diane, »Ihr habt Monsieur Fouquet noch nicht verraten, welches Anliegen Euch hierhertrieb?«
»Oh ...«, Isabelle spürte ihre Wangen glühen. Eine Spionin, dachte sie verärgert, die bei der kleinsten Lüge errötet, ist so sinnvoll wie ein roter Mantel für einen Jäger. Mit wachsender Kühnheit wich sie Dianes Frage aus: »Ich bitte um Entschuldigung für die Störung, Madame, ich dachte wirklich, Monsieur Fouquet alleine anzutreffen. Selbstverständlich möchte ich Euch nicht länger aufhalten. Mein Wunsch hat Zeit, bis Ihr Eure Konversation beendet habt.«
Um keine weitere Bemerkung zuzulassen, trat sie auf Marie zu und reichte dieser ihre Hand. »Kommt, ich helfe Euch. Wenn ich Euch stütze, wird Euch das Gehen leichter fallen.«
Es war Marie anzusehen, daß sie die Bibliothek ebenso ungern verließ wie Isabelle, doch auch sie folgte widerspruchslos den Anweisungen ihrer Herrin. Begleitet von einem kleinen Schmerzensseufzer, erhob sie sich von ihrem Platz, nahm Isabelles Angebot an und folgte dieser mit vorsichtigen Trippelschritten zur Tür. »Entschuldigt bitte die Störung«, sagte sie kleinlaut zu Diane und, an Nicholas gerichtet: »Habt herzlichen Dank für Eure Hilfe. Es geht mir schon deutlich besser. Seid Ihr in Wahrheit gar ein Medikus, Monsieur Fouquet?«
»Monsieur scheint mir zu ungeahnten Diensten fähig«, erwiderte Diane, »aber nun sollte er die Zeit aufbringen, seiner eigentlichen Befähigung als Schriftführer nachzugehen.« Mit einem amüsierten Schmunzeln wandte sie sich an den wegen dieses Kompliments leicht verlegenen Gelehrten: »Daß an einem Nachmittag gleich zwei meiner Ehrendamen Eurer Aufmerksamkeit bedürfen, ist bemerkenswert. Ich sollte Euch wohl besser im Auge behalten.«
Wahrscheinlich erschien dem Angesprochenen diese Vorstellung ebenso absurd. Er lächelte, was seinem Gesicht einen warmen, sympathischen Ausdruck verlieh. Seine leuchtenden Augen folgten den beiden jungen Frauen, die nach draußen humpelten, und im Moment, da sich Isabelle umwandte, die Tür hinter sich zu schließen, begegneten sich zufällig ihre Blicke. Verwundert sah sie ihn an, als erkenne sie erst jetzt einen Mann mit durchaus menschlichem Begehren hinter der Fassade des Gelehrten. Doch diese Leidenschaft galt offensichtlich nicht Marie de Roger.
»Findet Ihr nicht auch, daß Madame ein wenig eitel geworden ist?« raunte Marie ihrer Gefährtin zu, als sie auf dem Weg zu ihren Gemächern waren. »Was hätte es ausgemacht, wenn ich mich noch ein wenig länger in der Bibliothek ausgeruht hätte?«
»Ihr hättet sie gestört«, gab Isabelle trocken zurück.
»Wahrscheinlich läßt sie das Schreiben des Pontifex nicht unberührt«, plauderte Marie weiter, als habe sie Isabelles Bemerkung gar nicht gehört. »In der Tat ist es beeindruckend, eine persönliche Notiz des Stellvertreters auf Erden zu erhalten. Wie mächtig sie ist! Ich dachte allerdings, Madame würde sich mit dem gewachsenen Einfluß nicht verändern. Sie ist doch schon so groß.«
Isabelle seufzte. Sie fühlte sich in eine Position gedrängt, in der sie Diane verteidigen mußte. Seltsamerweise fiel es ihr ausgesprochen leicht, die Partei der Favoritin zu ergreifen: »Madame ist über jeden Zweifel an ihrer Selbsteinschätzung erhaben. Mir scheint vielmehr, Ihr habt es zu weit getrieben. Ihr habt Madame die Nerven geraubt.«
»Wie könnt Ihr es wagen, so mit mir zu sprechen?« protestierte Marie. Vor Aufregung vergaß sie, daß sie vorgab, sich einen Knöchel verstaucht zu haben. Mit dem glühenden Zorn eines verzogenen kleinen Mädchens machte sie sich von Isabelle los und stampfte wütend mit dem falschen Fuß auf. »Ich lasse mir von Euch nicht mangelndes Benehmen vorwerfen. Das ist ganz ungeheuerlich.«
»Ich sehe, daß Ihr meiner Hilfe nicht mehr bedürft«, konstatierte Isabelle. Der Beweis für die erfundene Verletzung überraschte sie nicht sehr. »Ihr findet allein in Euer Zimmer. Ruht Euch aus, und kühlt Eure Gedanken ab! Solltet Ihr durch das seltene Lächeln von Monsieur Fouquet in derartige Wallungen geraten, laßt Euch sagen, daß er ganz sicher kein Verehrer für Euch ist. Dieser Herr paßt nicht zu Euch.«
Verblüfft fragte sich Isabelle, welcher Teufel sie zu dieser Bemerkung trieb. Es konnte ihr vollkommen gleichgültig sein, mit welchem Kavalier Marie tändelte. In den Augen der anderen las sie, daß sich Marie eben fragte, ob Isabelle selbst ein amouröses Interesse an Dianes Sekretär habe. Besser dieser alberne Gedanke, sagte sich Isabelle im Geiste, als die Wahrheit.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wandte sie sich ab und ging schnellen Schrittes in die entgegengesetzte Richtung. Ihr Kopf war angefüllt mit tausend Fragen; vor allem mit der Überlegung, daß ihre Beobachtung nicht zu den beteiligten Personen paßte. Isabelle war zwar von ihrem Gönner vor den vielen kleinen wie großen Intrigen bei Hofe gewarnt worden, vor Spielen, deren Regeln sie nicht verstand, weil man ihrer Familie den Zugang zur feinen Gesellschaft verwehrte; doch konnte sie sich nicht vorstellen, daß ein vergleichsweise harmloser Grund hinter Maries Verhalten steckte. Diane de Poitiers war eine Meisterin im Überleben bei Hofe, vielleicht war sie auch auf diesem Gebiet eine Lehrmeisterin für Marie de Roger. Konnte es möglich sein, daß sich die Schülerin nun selbständig machte und ihr eigenes Netz spann? Wenn ihr ihre Sache und ihr Leben lieb waren, würde sich Isabelle in Zukunft jedenfalls vorsehen müssen.
Kapitel 3
Bauernhäuser und Jagdpavillons durchschnitten die endlos erscheinende Waldlandschaft südlich von Paris. Es herrschte reichlich Verkehr, der die Gegenden bevölkerte, und viele Reisende aus dem In- und Ausland machten sich nach Orléans und ins Loire-Tal auf, wo sich seit François I. die schönsten Wohnsitze der französischen Könige, Königinnen und Mätressen befanden. Wenn der gesamte Hofstaat von einem Schloß zum nächsten wechselte, waren häufig mehrere tausend Menschen unterwegs. Zwangsläufig zog die Hofgesellschaft Händler, Handwerker und Tagelöhner an, die sich nach und nach in den Ortschaften in der Nähe der jeweiligen Residenz ansiedelten und es mit wechselhaftem Glück sogar zu Wohlstand brachten.
Südlich von Orléans, in einem Dorf mitten in der landschaftlich bezaubernden Sologne, geriet Gabriel de Montgommery in einem solchen Marktflecken unvermutet in einen Aufruhr. Eine Horde einfach gekleideter Leute strömte wie aus dem Nichts herbei, blind gegen den fremden Ritter, der Mühe hatte, sein Pferd abseits des Tumults zu halten und niemanden zu verletzen. Es waren vielleicht fünfzig Menschen, die sich auf einer Art Beutezug zu befinden schienen. Sie erinnerten Gabriel auf bedrückende Weise an die spanischen Söldner, die von ihrem König vor rund einem Jahr zu den grauenvollen Plünderungen in der Normandie aufgefordert worden waren, weil Philipp von Spanien auf diese Weise ihren Sold sparen konnte. Heute wurde der Mob von einem katholischen Geistlichen unteren Standes angestachelt.
Der Vikar – oder was auch immer der Kirchenmann war – konnte sich im Gebrüll der Menge zwar kaum Gehör verschaffen, aber es war offensichtlich, daß er Hetztiraden von sich gab. Der Lärm war ohrenbetäubend, Schreie hallten durch die Straße, gefolgt von Hohngelächter und Gebrüll. Die Menschen wogten hin und her, wie Seeleute auf einem schlingernden Schiff. Gabriel beobachtete, wie sich die Meute auf ihre Opfer stürzte, die sie aus einem respektablen Bürgerhaus gezerrt hatte und auf der Straße voller Haß und mit Gewalt anging.
Obwohl er sich im Hintergrund hielt, wehten Sprachfetzen zu ihm herüber: »Lutheraner ... Ketzer ... die Pest!« Begriffe, die Häretiker kennzeichneten. Offensichtlich hatte der Priester die ärmsten Gläubigen seiner Gemeinde aufgewiegelt, stadtbekannte Protestanten zu überfallen. Vielleicht waren die Reformierten bei einem geheimen Gottesdienst überrascht worden.
Gabriel zog sich der Magen zusammen. Als Ritter an hart ausgetragene Wettbewerbe gewöhnt und als Soldat sich durchaus der Brutalität eines Kampfes bewußt, war ihm, diese hemmungslose Gewalt an wehrlosen Menschen unerträglich.
Er war kein Protestant. Wie es sein Eid vorschrieb, hing er der katholischen Religion an und besuchte regelmäßig die Messe. Seine humanistische Erziehung jedoch förderte seine Sympathien für die Reformation. Mit ansehen zu müssen, wie sich schlecht oder gar nicht ausgebildete katholische Priester in ihren Pfründen bereicherten, den Ärmsten vom Ablaß und dem Teufel predigten und sich gleichzeitig der Völlerei schuldig machten, war ihm ein Ärgernis. Die Tatsache, daß sich die protestantische Religion ausschließlich an das Wort des Evangeliums hielt und nicht an den phantasievollen Auslegungen des Papstes orientierte, erschien Gabriel darüber hinaus ausgesprochen logisch. Auch war ihm klar, daß die Zahl der Heiligen, die angebetet und denen geopfert werden sollte, allmählich überhandnahm. Lediglich die Mißachtung der Muttergottes war ihm ein Dorn im Auge; daß die Glaubensbekenntnisse der Hugenotten häufig mit der Zerstörung von Marienstatuen einhergingen, störte ihn, denn irgendwie hing sein Herz an der Mütterlichkeit dieser Figuren, sie erinnerten ihn an seine wunderschöne Frau, die im Kindbett gestorben war.
Wie ein Rudel hungriger Wölfe stürzte sich der Pöbel auf die unbewaffneten Protestanten. Die aufgebrachten Leute waren sicher nicht in der Lage, ihr Tun aus eigener Anschauung zu rechtfertigen. Diese Menschen folgten dem angeblichen Willen des Herrn, ohne je eine Zeile in der Bibel gelesen zu haben. Im Grunde waren sie nichts anderes als Handlager, die die Drecksarbeit für die Papisten erledigten, da sie wußten, daß sie niemals von einem irdischen Richter zur Rechenschaft gezogen würden.
Zufällig senkten sich die Augen des Hauptmanns auf eine am Boden kauernde junge Frau. Von ihrer Aufmachung her – oder dem, was davon übriggeblieben war – schien sie eine Person von Stand zu sein. Genau war das jedoch nicht mehr zu erkennen, denn bösartigste Weiber hatten sich auf sie gestürzt, um grob das blonde Haar der Dame zu zerzausen und an ihren Kleidern zu zerren, die nur noch in Fetzen von ihrem Körper hingen. Wie ein Skelett ragten die Verstrebungen ihres Reifrocks aus dem sie einst umhüllenden grauen Tuch. Arme und Schultern der Geschändeten waren zerkratzt, Striemen zogen sich über die helle Haut, und sie blutete aus zahlreichen Wunden. Eine alte Vettel riß gerade die zarte goldene Kette vom Hals der Dame und machte sich unverzüglich mit ihrem wertvollen Gut aus dem Staub, weniger aus Angst vor einer Anzeige wegen Diebstahls als vielmehr aus Furcht vor der Habgier ihrer Kumpane.
Tränen liefen in wilden Sturzbächen über die Wangen der jungen Protestantin. Sie hatte keine Stimme mehr, um nach Hilfe zu rufen. Es hätte sie ohnehin niemand gehört. Sie war ebenso verloren wie die anderen aus ihrem Kreis, die vom Pöbel im Namen Gottes mißhandelt wurden. Den Frauen wurde der Kot der Rinder und Schweine ins Gesicht geschmiert, die durch diese Gasse zum Markt getrieben worden waren; die Männer wurden mit Schnapphähnen gefesselt, zusammengeschlagen und beraubt, bevor man sie in ein Verlies sperrte oder gleich tötete.
Angewidert senkte Gabriel den Kopf. Die Scham, die sich angesichts seiner Hilflosigkeit über ihn legte, war verstörend. Zweifellos haderte er mit seinem Glauben an Nächstenliebe und Moral. Er wünschte, nicht Zeuge dieses Ausmaßes von brutaler, sinnloser Gewalt sein zu müssen. Übergriffe auf Protestanten waren jedoch seit dem Kriegsende überall in Frankreich an der Tagesordnung. Er fragte sich nicht zum ersten Mal: Wann würden sich die Anhänger der reformierten Kirche gegen die Mißhandlungen der Katholiken zur Wehr setzen? Unvermittelt fiel ihm ein Satz aus dem Buch Mose ein: Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten.
In einem fast verzweifelten Ausbruchsversuch drängte Gabriel sein Pferd plötzlich rücksichtslos durch die Menge. Als Kurier des Königs brauchte er nicht aufzupassen – weder auf Papisten noch auf Hugenotten. Jeder in der Schlägerbande hatte einen Huftritt verdient, und den Opfern tat er mit einem raschen Ende vielleicht sogar einen Gefallen. Vor sich selbst konnte er seine ungewohnte Brutalität damit rechtfertigen, daß er noch heute abend in Chenonceau eine Botschaft überbringen sollte. Aus ganzem Herzen hoffte er, die Erinnerung an dieses Dorf so schnell wie möglich aus dem Gedächtnis zu löschen.
Kapitel 4
Der Nebel lag wie ein hauchdünnes Seidentuch über dem von Mondlicht und vereinzelten Fackeln erleuchteten Garten von Chenonceau. Es schien, als schwebe das Schloß über dem Wasser – ein Gebäude ohne Bodenhaftung; ein Trugbild, das ein geschickter, von der venezianischen Bauweise geprägter Architekt schuf, als er den Neubau auf zwei Pfeilern errichtete. Dadurch wirkte Chenonceau, als balanciere das Fundament auf dem Fluß Cher. Die derzeitige Eigentümerin hatte diesen Eindruck durch eine Brücke noch vervollkommnen lassen, die den ursprünglich mittelalterlichen Marquis-Turm mit der anderen Seite des Flusses verband und somit die Illusion des Schwebens verstärkte. Der Bau war erst kürzlich fertig geworden, und der Comte de Montgommery fand ihn auf den ersten Blick überaus gelungen. Harmonisch schmiegte sich die Brücke an das Haupthaus mit seinen perfekt geformten Türmen, Schornsteinen, Erkerfenstern und Balustraden. Chenonceau war die Perle unter allen Schlössern des Loire-Tals, und es war wohl kein Wunder, daß sich Diane de Poitiers ausgerechnet dieses Anwesen als Refugium ausgesucht und ihren Besitz gegen die Forderungen der Königin wie auch des vormaligen Besitzers leidenschaftlich verteidigt hatte: Nach jahrelangen Intrigen und Prozessen besaß nicht einmal mehr die Krone einen Anspruch auf Chenonceau, es war das alleinige, private Eigentum der mächtigsten Frau Frankreichs.
Es war später Abend, und Gabriel fürchtete, Diane nicht mehr anzutreffen, als er die von Pappeln gesäumte Auffahrt in leichtem Trab entlangritt und dann sein Pferd vor den Toren des Schlosses zügelte. Der Vorfall in dem Dorf in der Sologne hatte ihn aufgehalten, sonst wäre er wahrscheinlich schon gleich nach Einbruch der Dämmerung an seinem Ziel angelangt. Um diese späte Stunde schien das Anwesen in tiefen Schlaf gefallen zu sein, was ihn nicht weiter verwunderte: Gabriel war bekannt, daß Diane üblicherweise ein sehr frühes Abendessen servieren ließ und sich zu einer Stunde zur Ruhe begab, zu der andere Damen der Hofgesellschaft gerade erst ihre Vorspeise einzunehmen pflegten. Deshalb richtete er sich auf eine Nacht bei seinem Pferd im Stall ein; da niemand von seiner Ankunft wußte, würde auch kein Gästebett hergerichtet worden sein.
»Halt! Wer da?« Wie aus dem Nichts tauchte eine bewaffnete Wache vor ihm auf. Eine Lanze senkte sich vor den Kopf des Rosses.
»Comte de Montgommery im Auftrag des Königs.« Gabriel lehnte sich in seinem Sattel nach vorne und zeigte dem Mann aus Dianes Leibgarde Henris Schreiben. Das Siegel war mehr als ein Passierschein.
Jedermann bei Hofe kannte die verschlungenen Buchstaben als das Cachet des Königs: Das gekrönte H für Henri, das von einem Halbmond umgeben wurde; offiziell wies dieses Zeichen auf den Anfangsbuchstaben im Namen der Königin hin, nämlich C, doch Henri hatte sein Wappen so ausgewählt, daß sich die Enden des C am Schenkel des H trafen und damit ein D – für Diane – darstellten; außerdem war der Mond das Zeichen von Diane. »Ich bringe eine Eilpost für Madame de Poitiers.«
»Ihr kommt spät, Chevalier«, meinte der Wachmann respektlos, »aber vielleicht werdet Ihr noch empfangen.« Er pfiff leise durch die Zähne, und plötzlich erschien ein Reitknecht im Lichtschein. »Kümmere dich um das Roß von Monsieur le Comte, reib es gut ab und gib ihm vom besten Hafer! Es kommt aus dem Stall des Königs.«
Der Kommandant der Schottischen Garde sprang aus dem Sattel und überließ sein Pferd Dianes Burschen. Da er sich seit Stunden keine Pause gegönnt hatte, schmerzten seine Glieder, er fühlte sich bei seinem Eintreten in das Schloß wie ein Seemann auf Landgang. Nach wenigen Schritten dehnten sich seine Muskeln jedoch wieder, und es gelang ihm ein paar Minuten später, sein Knie mit vortrefflicher Eleganz vor Diane zu beugen. Ein Hausdiener hatte ihm das Tor geöffnet und ihn – nachdem er sich vorgestellt, sein Anliegen vorgetragen hatte – unverzüglich zu seiner Herrin gebracht. Diese befand sich zwar bereits in ihren privaten Gemächern, war aber noch nicht bettfertig.
Während er sich verbeugte, versuchte Gabriel das Schlafzimmer der Favoritin so eingehend wie möglich zu betrachten. Der Raum war mit rotem Damast und Brokat ausgestattet und wirkte durch diese Farbwahl warm und einladend. Der Baldachin über dem königlich breiten Bett war dafür gemacht, ein Liebesnest zu beschützen. Es bedurfte wenig Phantasie, sich vorzustellen, wie Henri hier befriedigt in den Armen seiner Geliebten schlief.
Diese empfing den Boten ihres Liebhabers in einem mit Hermelin verbrämten, nur lose geschlossenen weißen Hausmantel, der sich bei jeder Bewegung ein wenig mehr öffnete. Darunter trug sie selbstbewußt ein durchscheinend weißes Gewand, welches wiederum den Blick auf ihre Korsage freigab. Diane legte ihr Bustier niemals ab, selbst in der Nacht und in den Armen des Königs trug sie es, da ihre natürlichen Formen auf diese Weise in die vorteilhafteste Lage gehoben wurden.
»Erhebt Euch, Capitaine«, sagte sie lächelnd. »Wenn Ihr eine Nachricht des Königs bringt, solltet Ihr keine Zeit mit einem Kniefall verschwenden. Ich bin begierig zu erfahren, welche Neuigkeiten Ihr aus Paris bringt.«
Der Hauptmann reichte ihr das Schreiben. »Es ist ein großes Glück, Madame, daß ich Euch zu dieser späten Stunde noch aufsuchen darf. Leider wurde ich unterwegs aufgehalten, so daß ich nicht früher einzutreffen in der Lage war.«
»Was hat Euch behindert?« fragte sie teilnahmslos, während ihre Augen auf den Brief gerichtet waren. Mit flinken Fingern erbrach sie das Siegel. Das Papier knisterte leise in ihren Fingern, als sie es auseinanderfaltete. Plötzlich hoben sich ihre Lider, sie blickte Gabriel forschend an: »Nun?«
»Unruhen, Madame. In einem Dorf nahe der Stadt Orléans geriet ich in einen Aufstand. Katholische Bürger setzten sich gegen Anhänger der Reformation zur Wehr.« Die Worte waren ihm über die Lippen gekommen, bevor er ernsthaft darüber nachdachte. Erst als er die Lüge ausgesprochen hatte, fiel sie ihm auf. Er hatte ganz selbstverständlich eine Version der Ereignisse gewählt, wie sie jeder ordentliche Katholik seinem König oder dessen Mätresse vortragen würde. Daß die Wahrheit anders ausgesehen hatte, spielte in diesen Räumlichkeiten keine Rolle.
»Ihr müßt müde sein, Comte de Montgommery. Zieht Euch für einen Imbiß in die Bibliothek zurück! Ich werde veranlassen, daß Euch etwas zu essen gebracht und in der Zwischenzeit ein Gästezimmer hergerichtet wird. Eine Antwort auf das Schreiben Seiner Majestät werdet Ihr morgen früh erhalten. Bis dahin könnt Ihr es Euch bequem machen.«
Unwillkürlich zog ein zufriedenes Grinsen über sein Gesicht. Es gab wohl kaum einen angenehmeren Ausklang für einen anstrengenden Tag als diesen. Einer der größten Vorteile, die der Haushalt in Chenonceau bot, war die Gemütlichkeit. Das Schloß war nicht als königliche Residenz gebaut worden und auch nicht als eleganter Jagdpavillon eingerichtet, sondern ausschließlich zur Nutzung als privater Wohnsitz konzipiert. Auf diese Weise war es tatsächlich möglich, sich zu entspannen, was anderswo deutlich schwerer fiel. Und die Aussicht auf eine von Dianes Koch sicher vorzüglich zubereitete Mahlzeit ließ ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen.
Er verneigte sich vor der Hausherrin. »Ich danke Euch für Eure Gastfreundschaft. Es wird mir überdies ein Vergnügen sein, auf Eure Befehle zu warten, Madame.«
»Dann habt eine gute Nacht, Chevalier.«
»Das wünsche ich Euch auch, Madame.«
Beim Hinausgehen streifte Gabriels Blick ein Gemälde, das auf der Querwand neben dem wundervollen Himmelbett hing. Es war ein neueres Porträt Diane de Poitiers’ als Göttin der Jagd, bewaffnet mit Pfeil und Bogen und in Begleitung eines Windhundes; sie war nackt. Seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr und ihrer Hochzeit mit dem Großseneschall der Normandie waren immer wieder Bilder von ihr entstanden, die sie häufig in ihrer Hoftracht, meistens aber als leibhaftige Diana zeigten. In dieser Mystifikation ihrer Person sah man sie stets mit einem perfekten, alterslosen Körper. Vor zehn Jahren war sie zuletzt in dieser Rolle gemalt worden, und wahrscheinlich nicht einmal der König würde es wagen, die festen Brüste auf dem Gemälde mit den Originalen zu vergleichen, die unter dem Hausmantel in praller Schönheit aus ihrem Bustier herausdrängten.
Leichtfüßig und mit blendender Laune folgte Gabriel dem Diener, der vor Dianes Schlafgemach gewartet hatte, in die Bibliothek. Dort glimmte noch die Asche im Kamin, aus der mit Hilfe eines Holzstücks und des Schürhakens bald ein freundliches Feuer aufloderte. Er ließ sich in den hochlehnigen Sessel davor sinken und streckte seine langen Beine aus, während er auf den versprochenen Imbiß und eine Weinkaraffe wartete. Er hätte sich die Zeit mit einem der zahllosen Bücher vertreiben können, doch stand ihm der Sinn nicht nach Literatur. Seine Augen waren müde und sein Geist nicht mehr bereit, sich auf eine Lektüre einzulassen. Er versuchte ein wenig zu schlummern, doch da traf ihn die Erinnerung in dieser friedlichen, angenehmen Umgebung wie ein Keulenschlag.
Unglückseligerweise hatte sich das Bild der verzweifelten jungen Frau in dem Dorf in der Sologne gnadenlos in seinem Kopf festgesetzt. Ob sie die brutale Attacke überlebt hatte? Wenn der bösartige Mob sie nicht getötet hatte, war sie wahrscheinlich verhaftet und in einen Kerker geschafft worden, wo sie zur Stunde gefoltert wurde und ihrem Prozeß entgegensah. Da durch einen königlichen Erlaß Berufungsverfahren im Fall der Häresie verboten waren, würde sie wahrscheinlich ohne die geringste Chance auf Einwendung oder Begnadigung die Todesstrafe erdulden müssen. Seltsamerweise, dachte Gabriel, waren es aber gerade die Protestanten auf dem Schafott, die die Papisten das Fürchten lehrten. Sie predigten das Evangelium noch in der Stunde ihres Todes. Deshalb waren die Scharfrichter dazu übergegangen, den Delinquenten die Zungen herauszuschneiden.
Um sich von seinen grausamen Befürchtungen abzulenken, zwang er sich zur Erinnerung an Mademoiselle de Roger. Er war schließlich auch nach Chenonceau gekommen, um die erhoffte amouröse Verwicklung voranzutreiben. Die Ehrendamen schienen bei seiner Ankunft schon schlafen gegangen zu sein, so daß er seine Ambitionen auf morgen verschieben mußte.
Doch Gabriel hatte nicht mehr die Absicht, untätig in der Bibliothek herumzusitzen und sich seinen düsteren Bildern des Tages auszuliefern. Selbst das inzwischen servierte Tablett mit seiner Mahlzeit und der Wein konnten ihn nicht froher stimmen.
Von Unruhe getrieben, blickte er sich nach Schreibutensilien um. Auf dem Sekretär fand er, wonach er gesucht hatte. Mit wenigen Federstrichen warf er eine Nachricht für Mademoiselle de Roger auf ein Blatt Papier. Er bemühte sich, einen romantischen Tonfall zu treffen, der seinem Freund Pierre de Beaujeu, einem Dichter von Liebessonetten, zur Ehre gereicht hätte. Eigentlich rechnete er nicht damit, seine Leidenschaft noch in dieser Nacht stillen zu können, doch mit dem Schreiben vertrieb er sich die Zeit mit einer Tätigkeit, die sowohl seinen Geist als auch seinen Körper in Anspruch nahm. Schließlich öffnete er die Tür zur Bibliothek und weckte den Diener, der sich im Gang neben einer Säule zusammengerollt hatte.
»Dieses Schreiben ist für Mademoiselle de Roger bestimmt und von äußerster Dringlichkeit«, erklärte er mit einer Stimme, die seine Herkunft, seine Stellung und seine Autorität gleichermaßen ausdrückte. »Es soll unverzüglich an die Empfängerin überbracht werden. Aber nur an sie persönlich. Wenn sie schon schläft, sieh zu, daß sie es so schnell wie möglich morgen früh erhält, und gib mir Nachricht!«
Die Vorfreude auf ein Stelldichein – auch wenn dieses erst am nächsten Tag stattfinden sollte – war Balsam für Gabriels verwundete Seele. Endlich konnte er zur Ruhe kommen. Er rechnete zwar nicht damit, daß Marie zu dieser späten Stunde auf die zweideutige Einladung eines Kavaliers reagieren würde, aber seine erotischen Phantasien halfen, seine Schwermut zu lindern. Zum ersten Mal seit den Erlebnissen in dem Sologne-Dorf gelang es ihm, den Gedanken an die verzweifelte junge Frau abzuschütteln. Als er sich wieder im Sessel vor dem Kamin niederließ und die Augen schloß, sah er nicht ihr Gesicht vor sich, sondern das liebliche Antlitz der jungen Ehrendame, auf deren Wiedersehen er sehnsüchtig wartete.