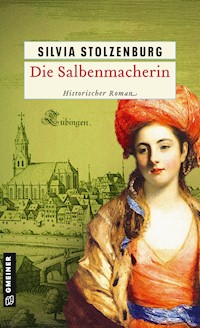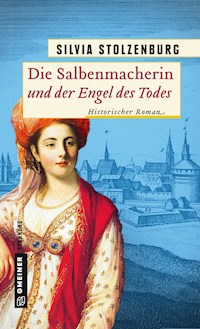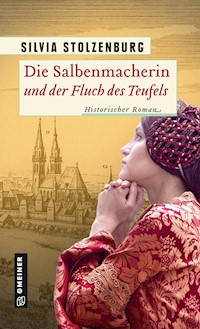6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Edition Aglaia
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Anno Domini 1447: Der junge Vlad Draculea, Sohn des Fürsten der Walachei, befindet sich in türkischer Gefangenschaft. Als Geisel am Sultanshof in Edirne geht er durch die Hölle. Ohnmächtig muss er dabei zusehen, wie der sinnesfreudige osmanische Prinz Mehmet seinem jüngeren Bruder Radu nachstellt. Um Radu zu rächen und seine Freiheit zurückzugewinnen, ersinnt Vlad einen teuflischen Plan … Während Vlad Draculea im Herzen des Osmanischen Reiches um Vergeltung kämpft, muss sich die vierzehnjährige Zehra von Katzenstein in Ulm vor Gericht verantworten. Sie wird der Hexerei und des Mordes an ihrem Vater beschuldigt. Verzweifelt versucht sie, ihre Unschuld zu beweisen. Der fesselnde Auftakt des Zweiteilers um Vlad Draculea, Bram Stokers Vorbild für Graf Dracula. Historische Wirklichkeit statt Vampir-Mythos - aufwühlend und zutiefst ergreifend! Ausgezeichnet mit dem Goldenen HOMER 2014 für die beste historische Biografie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Ähnliche
Silvia Stolzenburg
Der Teufelsfürst
Roman
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, oder Video, auch einzelner Text-und Bildteile.
Alle Akteure dieses Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind von der Autorin nicht beabsichtigt.
Copyright © 2013 by Edition Aglaia, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH
1. Auflage Juli 2013
Lektorat: Dr. Christine Laudahn
E-Book: Mirjam Hecht
Karten Vorsatz/Nachsatz: Joachim Ullmer
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München
ISBN 978-3-95669-002-0
www.bookspot.de
Vorbemerkung der Autorin
Dies ist ein Roman über die historische Figur des Woiwoden Vlad Draculea, durch Bram Stoker weltbekannt als Graf Dracula. Es ist keine Geschichte über Vampire oder andere blutsaugende Kreaturen, welche die Nächte unsicher machen. Es ist die Geschichte einer Person aus Fleisch und Blut, die Geschichte eines Überlebenskampfes, eines Kampfes um Macht, Liebe und Anerkennung.
Namensverzeichnis
(historisch belegte Personen in Kursivschrift)
Vlad Draculea: Sohn des Woiwoden der Walachei
Radu: Sein Bruder
Karl von Katzenstein: Ulmer Kaufmann
Zehra von Katzenstein: Seine Tochter
Utz von Katzenstein: Sein Sohn
Nikolaus Nidhard: Zehras Verlobter
Hans Multscher: Bildhauer und Freund von Utz
Jakob Löw: Prokurator in Ulm
Markus Beinlein: Bader in Ulm
Johann von Katzenstein: Ritter
Helwig von Katzenstein: Seine Mutter
Sophia von Katzenstein: Seine Tochter
Sultan Murad: Sultan des Osmanischen Reiches
Prinz Mehmet: Sein Sohn
Halil Pascha: Großwesir
Johann Hunyadi: Reichsverweser von Ungarn
Herzog Michel: Sintifürst
Kaliya: Sinti-Mädchen
Reyka: Sinti-Kräuterfrau
Graf Ulrich von Helfenstein: Ritter
Georg Kastriota: Albanischer Freiheitskämpfer
Vorwort
Im Jahre des Herrn, Anno Domini 1447
Die spätmittelalterliche Welt befindet sich im Umbruch.
Der – für manchen beängstigende – Wandel scheint vor keinem Lebensbereich haltzumachen. Das Rittertum wird durch neue Waffentechniken und Söldner immer weiter zurückgedrängt. Auch die Städte verfolgen immer aggressiver ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen. Um dem Niedergang entgegenzuwirken, schließen sich viele Niederadelige zu Adels-oder Rittergesellschaften zusammen und das Fehdewesen gelangt zu einer vorher nie da gewesenen Blüte. Überall ziehen sogenannte Raubritter plündernd, raubend und brandschatzend durch die Lande, um den verhassten Städtern und manchmal auch den ungeliebten Nachbarn so viel Schaden wie möglich zuzufügen. Diese Zustände spitzen sich im Süden des Reiches so weit zu, dass immer wieder Beschwerden zum Hofgericht nach Rottweil geschickt werden, vor dem die meisten der Landfriedensbrecher allerdings gar nicht erst erscheinen – wenn sie überhaupt vorgeladen werden. Als wäre dies nicht genug, beginnen bald auch die Landesfürsten, sich in den eskalierenden Zwist zwischen den Städten und dem Adel einzumischen. Der zweite Süddeutsche Städtekrieg wirft bereits seine drohenden Schatten voraus. Während die Zustände im Heiligen Römischen Reich alles andere als geordnet sind, sorgen weitere Entwicklungen dafür, dass sich die Furcht der Stadt-und Landbevölkerung mehrt. Denn seit einigen Jahren tauchen immer öfter dunkelhäutige Fahrende vor den Städten auf, die behaupten, von den Osmanen aus ihrer Heimat in Klein-Ägypten vertrieben worden zu sein. Wo genau dieses sagenumwobene Land liegen soll, weiß niemand so richtig. Aber da die als Zigeuner oder Tataren bezeichneten Reisenden vorgeben, sich auf einer siebenjährigen Bußfahrt zu befinden und Geleitbriefe von Papst und König vorweisen, bleiben das Misstrauen und der Hass der Einheimischen zunächst unterschwellig. Irgendwo müssen sich die brodelnden Emotionen und Ängste jedoch entladen – und das geschieht im aufflammenden Hexenwahn. Seit dem Jahr 1430 verfolgen Staat und Kirche systematisch und flächendeckend Hexen, Zauberinnen und all diejenigen, die im Verdacht stehen, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben. Die Scheiterhaufen beginnen zu brennen.
Während all diese Ereignisse den Westen erschüttern, bricht im Osten Europas der Vorabend der Eroberung Konstantinopels an. Lediglich durch das winzige Fürstentum der Walachei von seinem größten Feind – dem Königreich Ungarn – getrennt, durchbricht der türkische Sultan immer wieder die Befestigungen an der Donau und stößt zusehends weiter auf feindliches Territorium vor. Zwar ist die Walachei ein Vasallenstaat, aber auf den dortigen Woiwoden ist kein Verlass – obwohl sich zwei seiner Söhne, der elfjährige Radu und der sechzehnjährige Vlad Draculea, in osmanischer Geiselhaft befinden. Derweil der Vater der beiden Prinzen nicht nur gegen allzu überzogene Forderungen des Sultans, sondern auch gegen Intrigen seines ungarischen Nachbarn, Johann Hunyadi, zu kämpfen hat, geht der junge Vlad Draculea am Sultanshof in Edirne durch die Hölle. Er wird von gnadenlosen Waffenmeistern in der türkischen Kunst der Kriegsführung ausgebildet und wegen seines störrischen Verhaltens immer wieder gezüchtigt. Noch dazu muss er ohnmächtig dabei zusehen, wie der sinnesfreudige osmanische Prinz Mehmet seinem jüngeren Bruder nachstellt. Jeder Tag, den er als Geisel des Sultans verbringt, schürt seinen Hass weiter. Nacht um Nacht fleht er zu Gott, dass dieser ihm endlich einen Ausweg aus einer Lage zeigt, die hoffnungsloser kaum sein könnte.
Und mit jedem Tag, der ohne einen Fingerzeig des Schicksals vergeht, wird der junge Mann verbitterter und schwört furchtbare Rache – sollte es ihm jemals gelingen, die Freiheit wiederzuerlangen. Zusehends ergreift die Dunkelheit Besitz von seiner Seele und droht ihn schon bald zu einem Geschöpf zu machen, vor dem er sich selbst fürchtet.
Kapitel 1
Edirne, Sultanspalast, Februar 1447
»Vlad, hilf mir!« Die vor Angst schrille Stimme des elfjährigen Radu durchschnitt die Luft wie ein Messer. »Oh, mein Gott, Vlad!« Der Ruf erstickte in einem verzweifelten Schluchzen, dem das Klirren von Metall und ein wüster Fluch folgten. Mit einem dumpfen Scheppern glitt Vlad Draculea die goldene Drachenspange aus der Hand, mit der er gespielt hatte, während er vorgab, dem ermüdenden Geleier des Enderum Sakirdi – des Eunuchenlehrers – zu lauschen. Genau wie alle anderen Augenpaare im Raum zuckte auch das des Eunuchen in seine Richtung, als er aufsprang und sich nach dem nächsten Ausgang umsah. Näher als die Tür, aber weitaus schmaler und hoch über dem Boden gelegen, lockte eine Reihe Arkadenfenster, durch welche die schwache Februarsonne hereinfiel. »Vlad!« Das Entsetzen seines kleinen Bruders ließ Vlad alles Zaudern vergessen. Achtlos fegte er Wachstafel und Griffel auf den Boden. »Was erlaubst du dir?«, fauchte der Koranlehrer ihn an. »Dafür wirst du bestraft!« Doch Vlad machte sich nicht einmal die Mühe, die Schultern zu zucken, da die Bestrafung durch den entmannten Enderum Sakirdi vor dem verblassen würde, was ihm sein Handeln ohne Zweifel einbringen würde. »Bleib hier, du kleiner Teufel!«, drang eine weitere, wesentlich tiefere Stimme von draußen an sein Ohr.
Vlad biss die Zähne aufeinander, ehe er auf eines der Fenster zueilte. Ohne zu zögern, flankte er über den niedrigen Sims und spannte die Muskeln, um den Aufprall auf dem festgetrampelten Gras aufzufangen. Dennoch schoss ihm ein stechender Schmerz in die Glieder, und er sackte mit einem unterdrückten Stöhnen in die Knie. »Dafür werde ich dich auspeitschen lassen«, zischte es unweit von ihm. »Komm sofort da runter!« »Nein!« Trotz der mehr als ernsten Lage verzog Vlad den Mund zu einem grimmigen Lächeln. Sein Bruder machte offenbar der sprichwörtlichen Sturheit seines Volkes alle Ehre. Ein Wutschrei und das Geräusch eines Schlages ließen ihn zusammenfahren und an der Wand der Iç Oğlan – der Schule der Pagen – entlanghasten. Bereits nach wenigen ausgreifenden Schritten erreichte er einen Durchgang, hinter dem sich in einem kleinen Gärtchen eine unglaubliche Szene abspielte.
Auf einem knorrigen Feigenbaum thronte der schmächtige Radu, dessen dunkles Haar ihm wirr in die Stirn hing.
Seine Kopfbedeckung, eine weiße Kappe, lag am Fuß des Baumes, auf dessen Stamm Prinz Mehmet mit einem Krummschwert einhieb. Das rundliche Gesicht des königlichen Sprosses war wutverzerrt und in seinen Augen glomm der gefährliche Funke des Jähzorns. Er blutete aus einer Wunde am Unterarm, die – so nahm Vlad an – Radu ihm beigebracht hatte. »Wenn du nicht freiwillig kommst«, keuchte Mehmet, »dann werde ich dich eben holen.« Er schwang erneut das Schwert und winzige Holzsplitter flogen in alle Richtungen.
»Vlad!«, heulte Radu, als er den Bruder erblickte, der heftig atmend von einem zum anderen sah. »Er wollte mir …« Seine Stimme erstarb in einem Wimmern, als sich der Baum unter ihm mit einem gefährlichen Knarren bewegte. Auch wenn er wusste, dass es Wahnsinn war, schluckte Vlad die eigene Furcht und stürzte sich auf den Prinzen, um diesem die Waffe zu entwinden. Da er den Gleichaltrigen um einen halben Kopf überragte, gelang ihm das auch mühelos. Aber als er ausholte, um Mehmet einen Faustschlag zu versetzen, wurde er von hinten zu Fall gebracht. Ohne dass er es gemerkt hatte, waren ihm vier Janitscharen in den Rücken gelangt, in den sich wenig später ein erbarmungsloses Knie bohrte. Ehe er sich versah, zerrten ihn zwei der königlichen Leibwächter zurück auf die Beine, fesselten ihn und packten ihn derb am Kragen. Mehmet, dessen Interesse nun ihm galt, wischte sich angeekelt die Hand ab, an der Vlad ihn berührt hatte, und spuckte vor dem jungen Walachen aus. »Das hättest du nicht tun sollen«, knurrte er gefährlich ruhig. »Niemand darf den Sultan ohne Erlaubnis berühren!« Vlad schnaubte verächtlich, als er spürte, wie sich die Janitscharen hinter ihm versteiften. »Ihr seid nicht mehr Sultan«, versetzte er abfällig. »Habt Ihr etwa schon vergessen, dass Euer Vater Euch wieder abgesetzt hat?« Eine schwarze Wolke des Hasses zog in Mehmets Augen auf, und einen Augenblick lang dachte Vlad, er würde ihm auf der Stelle den Kopf abschlagen. Doch das wäre ein viel zu schneller Tod gewesen. Einige qualvolle Momente lang schwieg der Prinz, dann schürzte er geringschätzig die Lippen und schluckte die Demütigung, welche die Erinnerung an sein Versagen ihm zweifelsohne bereiten musste. Er fuhr sich mit der Zungenspitze über die Oberlippe und gab zwei Janitscharen zu verstehen, Radu aus dem Baum zu holen. Da in Anbetracht der Lage jeglicher Widerstand zwecklos war, ließ sich der Knabe von den Soldaten wie eine reife Frucht pflücken und vor Mehmet zu Boden werfen.
Dieser blickte auf ihn hinab, als sei er nicht mehr als ein lästiges Insekt, bevor er sich wieder Vlad zuwandte und diesen kalt musterte. »Mag sein, dass mein Vater wieder Sultan ist«, sagte er gepresst. »Aber das wird nicht ewig dauern. Früher oder später werde ich das Osmanische Reich sein. Und dann bist du immer noch nichts weiter als eine unbedeutende Geisel aus einem unbedeutenden kleinen Fürstentum!« Er bedeutete der Wache, Vlad abzuführen. »Und wenn du nicht bald lernst, wo dein Platz ist«, schickte er dem Gefangenen hinterher, »dann wirst du schon bald eine tote Geisel sein.«
Mit diesen Worten bückte er sich, zog den weinenden Radu in die Höhe und stieß ihn – flankiert von zwei weiteren Janitscharen – vor sich her. Als der Knabe seinem Bruder einen letzten flehenden Blick zuwarf, zog sich Vlads Herz zusammen und er wollte sich aufbäumen, um seinen Bewachern zu entfliehen. Diese rammten ihm allerdings beim ersten Zucken die Fäuste in den Bauch, sodass er würgend zusammensackte und sich über seine Stiefel erbrach. Der Schmerz verschleierte ihm die Sicht. Während seine Bewacher ihn auf eine Mauer zuzerrten, nahm er wie durch dichten Nebel wahr, dass Mehmet Radu besitzergreifend am Arm fasste. Die Erkenntnis, dass er seinen Schwur, sein Versprechen, den Jüngeren zu beschützen, gebrochen hatte, traf ihn mit der Wucht eines Keulenschlages. Er stieß einen Laut aus, den die beiden Soldaten fälschlicherweise für ein Zeichen der Furcht hielten, weshalb sie ihn mit Hohnworten und weiteren Hieben vorwärtstrieben. »Mach dir doch nicht schon vorher die Hosen voll«, spottete der Größere der beiden. »Vielleicht hat der Falakaci Başi heute einen gnädigen Tag.« Das Lachen seines Kameraden verriet, wie unwahrscheinlich diese Annahme war. Und Vlad – der bereits mehr als einmal die Bekanntschaft dieses Bestrafungsoffiziers gemacht hatte – spürte, wie sich unbeschreibliche Furcht in ihm ausbreitete. In dem fruchtlosen Versuch, das Unvermeidbare hinauszuzögern, ließ er seine Glieder erschlaffen und biss die Zähne aufeinander, als die Janitscharen ihn grob weiterschleiften.
Viel zu schnell gelangten sie zu dem eisenbeschlagenen Tor eines Wachturms, in dessen Innerem sich winzige Zellen befanden. Der helle Stein des Gebäudes täuschte über seinen düsteren Zweck hinweg, doch als Vlad mit einem Fußtritt auf den strohbedeckten Boden befördert wurde, stieg ihm der Gestank der Todesangst in die Nase. Zitternd kämpfte er sich auf die Knie, während seine Bewacher dem Kerkermeister Anweisungen gaben. »Er hat Prinz Mehmet beleidigt.« Die Worte klangen unheilvoll und schienen das Vergehen schlimmer zu machen, als es ohnehin schon war. »Bestraft ihn aufs Härteste, aber tötet ihn nicht«, warnte einer der Janitscharen.
Vlad hatte Mühe, sich nicht erneut zu übergeben. Was würde es diesmal sein? Die Peitsche, deren geflochtene Riemen bereits ein nicht mehr auszulöschendes Muster aus Narben auf seinen Rücken gemalt hatte? Oder die Falaka, der furchtbare Stock, der jede Fußsohle innerhalb weniger Augenblicke in einen blutigen Brei verwandelte? Oder das Unaussprechliche?
Die Schande, die furchtbare Befleckung, vor der er Radu erfolglos hatte beschützen wollen? Er fuhr mit einem Keuchen zusammen, als die schwere Tür ins Schloss fiel und das Tageslicht aussperrte. »Bring ihn ganz nach unten«, wies der Kerkermeister einen ausgemergelten Burschen an. »Und vergiss nicht, ihn anzuketten.« Der Angesprochene nickte wortlos, half Vlad erstaunlich vorsichtig auf die Beine und schob ihn auf eine schmale Treppe zu, die direkt in den Schlund der Hölle zu führen schien. Zögernd griff er nach einer Fackel, ehe er sich mit dem Gefangenen in den Abgrund hinabtastete.
Unten angekommen, wies er Vlad wortlos an, sich nach rechts zu wenden. Wenig später erreichten sie eine niedrige, vergitterte Pforte. Dahinter wartete eine Zelle, in der ein Kind kaum aufrecht stehen konnte – geschweige denn ein ausgewachsener Mann. »Dort hinüber«, flüsterte der Bursche, dem anzusehen war, dass ihm nicht wohl war bei der Aufgabe. War das Mitleid in seinen Augen? Vlad senkte hastig den Kopf, um die plötzliche Scham zu verbergen, die ihn siedend heiß übergoss.
Wusste der Junge, was ihn erwartete? Wusste es bereits der ganze Sultanshof, dass er, Prinz Vlad Draculea, Sohn des Woiwoden der Walachei, Mitglied des Drachenordens – des größten christlichen Ritterordens aller Zeiten – nichts weiter war als ein Lustknabe für die schmutzigsten, niedrigsten Bediensteten des Sultans? Er presste die Lider aufeinander, um zu verhindern, dass Tränen der Ohnmacht in ihm aufstiegen. Schlaff und willenlos ließ er sich von dem Gehilfen des Kerkermeisters die Fesseln lösen und die rostigen Ketten anlegen, die so kurz waren, dass er sich nicht einmal auf dem Boden ausstrecken konnte. Sobald der Bursche seine Aufgabe erledigt hatte, wandte er sich zum Gehen und verriegelte die Tür hinter sich.
Allein mit seiner Furcht und der undurchdringlichen Finsternis ignorierte Vlad den Schmerz in seinen Schultergelenken und ließ sich – mit dem Rücken an der feuchten Wand – in die Hocke gleiten. Bebend vor Kälte und in dem Bewusstsein, dass ihm die vermutlich furchtbarste Bestrafung seines Lebens bevorstand, schluckte er mühsam und begann zu beten. Stunden schienen im stillen Zwiegespräch mit Gott vergangen zu sein, als ihn ein Geräusch aus den Tiefen des Kerkers aufschreckte.
Mit hämmerndem Herzen rappelte er sich auf und wollte nach der Drachenspange tasten, die er für gewöhnlich auf der Brust trug. Doch selbst wenn die Ketten die Bewegung nicht verhindert hätten, hätte seine Hand ins Leere gegriffen. Denn er hatte das Kleinod in der Madrasa zurückgelassen. Als ihm klar wurde, dass der goldene Drache wahrscheinlich von dem erzürnten Eunuchen eingesteckt worden war, traf ihn der Verlust mit einer Heftigkeit, die in keinerlei Verhältnis zum Wert des Schmuckstückes stand. Während sich schwere Schritte seinem Gefängnis näherten, stieg eine solch überwältigende Trauer in ihm auf, dass ihm die Kehle eng wurde und sein Herz sich krampfhaft zusammenzog. Nicht einmal die Tatsache, dass sich die Schritte vor der Tür wieder entfernten, konnte die Leere vertreiben, die sich in ihm ausbreitete. Schonungslos hämmerte sein Verstand ihm ein, dass das Verlieren des Drachen das Schlimmste war, was ihm in seiner Lage passieren konnte. »Warum hast du mich verlassen, Herr?«, fragte er in die Stille. »Habe ich nicht allen Versuchungen der Ungläubigen widerstanden? Habe ich nicht alles getan, um Deinen Namen zu heiligen?« Er kauerte sich erneut an der Wand zusammen und starrte blicklos in die undurchdringliche Finsternis. Diese schien ihn zu belauern wie ein zum Sprung bereites Tier und ihn mit Tausenden von toten Augen anzuglotzen. Ein weiteres Geräusch aus der Dunkelheit ließ ihn aufhorchen. Es dauerte einige Zeit, bis er begriff, dass es seine eigenen Zähne waren, die immer heftiger aufeinanderschlugen. Von totaler Dunkelheit umgeben und in Erwartung unendlicher Qualen schloss er schließlich die Augen und versuchte, die entsetzliche Angst im Zaum zu halten. »Ich bin der Fürst der Finsternis«, flüsterte er irgendwann, als ihm bereits die Glieder abstarben. »Der Fürst der Finsternis.« Er kämpfte gegen die heißen Tränen an, die immer unaufhaltsamer in ihm aufstiegen. War es nicht das gewesen, was seine Mutter ihm immer erzählt hatte, wenn er sich als Knabe vor der Dunkelheit gefürchtet hatte? Gotteslästerlich, das wusste er inzwischen. Aber so unglaublich tröstend. »Stell dir einfach vor, du wärest der Fürst, dem alle Geschöpfe der Nacht gehorchen müssen«, hatte sie gesagt und ihm mit ihrer warmen, weichen Hand die Wange gestreichelt. »Dann brauchst du dich nicht zu fürchten.« Er biss sich auf die Lippe, als ein Schluchzen ihm die Luft zu nehmen drohte. In der Hoffnung, der Schmerz würde die Schwäche vertreiben, grub er die Zähne so heftig in das Fleisch, dass er schon bald Blut schmeckte. Er musste sich zusammenreißen! Wenn er aufgab, wer würde dann auf seinen Bruder achten? Wer würde stark sein für Radu, dessen Seele vielleicht noch zu retten war?
Kapitel 2
Ulm, ein Stadthaus, Februar 1447
Es war ein lang gezogenes, hohes Wimmern – eher wie das Jaulen eines Hundes – das Zehra von Katzenstein aus dem Schlaf riss. Verwirrt blinzelnd streifte sie die letzten Bilder des Traumes ab, dessen wohlige Wärme sie immer noch erfüllte, und zog die Decke höher, als könne der dünne Stoff sie vor etwaiger Gefahr schützen. Klagend und schmerzvoll zugleich schien der Laut von überall gleichzeitig zu kommen, schien einerseits durch die halb geöffneten Läden hereinzudringen, andererseits in den Tiefen des Hauses zu entstehen. Heftig atmend lauschte die Vierzehnjährige in die Düsternis ihrer Kammer, doch schon wenig später war das Geräusch ihres rasenden Herzens das Einzige, das die plötzlich einsetzende Stille übertönte. Hatte sie sich den Laut nur eingebildet?, fragte sie sich und schob sich unsicher zurück in die warme Kuhle, die ihr Körper in der Matratze hinterlassen hatte. Hatte sie den Schrei geträumt? Das Rascheln der Daunen wirkte unangemessen laut. Deshalb versuchte sie, sich so wenig wie möglich zu bewegen. Aber das konnte nicht sein! Hatte sie nicht noch vor wenigen Augenblicken glücklich und aufgeregt mit ihrem Verlobten, Nikolaus Nidhard, vor dem Altar des Ulmer Münsters gestanden, um Gottes Segen zu empfangen?
Wie passte ein solch grässliches Geräusch dazu? Sie schloss die Augen und zwang sich, die störende Kälte zu ignorieren, die mit einem Mal von ihren Händen und Füßen aus über ihren ganzen Körper kroch. Eine scheinbare Ewigkeit herrschte vollkommene Ruhe. Doch dann schwoll der ohrenzerreißende Ton erneut an. Das Gemurmel gedämpfter Stimmen ließ Zehras Herz erkalten. Flackernder Kerzenschein tanzte an dem Spalt unter ihrer Tür vorbei und das Knarren der Treppen verriet, dass jemand ins Untergeschoss eilte.
»Hol den Priester!«, hörte sie einen Mann tuscheln. »Beeil dich!« Etwas Bitteres, vollkommen Beängstigendes stieg in Zehras Kehle auf. Etwas, das sie noch niemals zuvor in ihrem Leben gespürt hatte. Und trotz der Kälte, die ihr Blut in Eis zu verwandeln drohte, fühlte sie, wie sich ein Schweißfilm über ihr Gesicht legte. »Er ist tot!«, kreischte eine sich überschlagende Stimme, kaum war das Wimmern wieder abgeklungen.
»Tot!« Und ehe sie begriff, was sie tat, warf die junge Frau die Decke von sich, sprang aus dem Bett und hastete barfuß, nur mit ihrem Untergewand bekleidet, zur Tür. Mit zitternden Fingern schob sie den Riegel zurück und starrte entgeistert in den Flur hinaus, auf dem sich ein halbes Dutzend Mägde um den Verwalter ihres Vaters drängten. Dieser hob unsicher die Hand, kaum erblickte er die Tochter des Hauses. Das Flüstern der Mägde verstummte. »Zehra«, sagte er tonlos und senkte den Blick – fast als beschäme ihn die unziemliche Blöße der jungen Frau. »Was ist passiert?«, brachte Zehra schließlich heiser hervor. »Martin! Was ist passiert?!«, wiederholte sie schrill, als der Verwalter lediglich ergeben den Kopf schüttelte. »Martin!« Ihre Stimme erstickte. Doch bevor der hochgewachsene Mann antworten konnte, stolperte eine blonde Frau mit wirrem Haar aus der Kammer ihres Vaters, deren Tür seltsamerweise sperrangelweit offen stand. Ihre Augen zuckten von einem zum anderen wie die eines gehetzten Tieres, bis sie schließlich leer und ausdruckslos an Zehra haften blieben. »Er atmet nicht mehr«, stieß sie hervor und schlug sich kraftlos gegen die volle Brust. Dann verzog sich ihr Gesicht zu einer Maske des Schmerzes. Endlich begriff Zehra, wo der grauenvolle Klagelaut seinen Ursprung hatte. Wie an der Stelle festgenagelt, beobachtete sie Martin, der die Frau an der Schulter packte und sanft schüttelte. Aber erst, als diese in blinder Wut mit den Fäusten auf den Verwalter einschlug und schließlich schluchzend an seiner Brust zusammenbrach, gewann sie die Gewalt über ihre Glieder zurück.
Auf wackeligen Beinen bahnte sie sich einen Weg durch die Mägde, während sich ihr Herzschlag mehr und mehr beschleunigte. Als sie die Schwelle zum Schlafraum ihres Vaters übertrat, verstärkte sich das Dröhnen in ihrer Brust. Einen Augenblick lang fürchtete sie, ihr Herz würde zerspringen. Doch kaum erblickte sie die Gestalt, die leblos in dem ausladenden Himmelbett lag, wich das Rasen ihres Pulses einem heftigen Schwindelgefühl. Ihre Sinne drohten zu schwinden. Halt suchend tastete sie nach dem Schrank neben der Tür, dessen Schnitzereien im Kerzenschein unnatürlich lebendig wirkten.
Ganz anders als der zusammengekrümmte Hausherr, dessen Augen starr geradeaus blickten. Sein Mund war leicht geöffnet, die Zunge eingeklemmt zwischen den Zahnreihen. Die ehemals wasserblauen Augen waren trübe und weit geöffnet – als habe er im Augenblick seines Todes versucht, etwas ganz genau zu erkennen. Obgleich Zehra die Abwesenheit des Lebens mit schrecklicher Deutlichkeit spüren konnte, taumelte sie auf das Bett zu, stolperte das Treppchen des Gestells hinauf und legte eine bebende Hand auf die Stirn ihres Vaters.
Diese – eiskalt und wächsern – fühlte sich falsch und unecht an. Am ganzen Körper zitternd, führte die junge Frau die Rechte weiter zu seinen Augen und versuchte, diese zu schließen. Als ihr das nicht gelingen wollte, fuhr ihr ein Schrecken ins Mark, dessen Heftigkeit ihr die letzte Kraft zu rauben drohte. Immer und immer wieder versuchte sie, die Lider nach unten zu zwingen, aber genauso oft widerstanden diese ihren fruchtlosen Versuchen. »Heilige Mutter Gottes, hilf mir«, flehte sie und ließ sich widerstandslos von Martin zur Seite schieben, der schließlich bewerkstelligte, was ihr nicht gelungen war.
Nachdem er auch den Mund des Toten geschlossen hatte, befahl er einer der Mägde: »Öffne das Fenster, damit seine Seele in den Himmel entweichen kann.« Kaum hatte das Mädchen den Befehl ausgeführt, drang die Kälte der Februarnacht in den Raum, dessen Kachelofen nur noch wenig Wärme verbreitete. Fröstelnd schlang Zehra die Arme um sich, während sie fassungslos dabei zusah, wie Martin einige weitere Kerzen entzündete und Anweisungen gab. »Dein Bruder schickt nach dem Priester«, setzte der Verwalter die junge Frau in Kenntnis. Irgendjemand hatte ein wollenes Obergewand aus ihrer Kammer geholt, das Martin ihr entgegenstreckte. »Zieh das an. Es nützt niemandem, wenn du krank wirst.« Die Nüchternheit in seiner Stimme brach den Bann, unter dem Zehra stand. Fast war sie dankbar dafür, ihm gehorchen zu können.
Irgendwie schien seine Ruhe sich auf sie zu übertragen und die Situation trotz allen Grauens zu etwas zu machen, das sie würde meistern können. Wie, wusste sie noch nicht. Aber irgendwie würde diese furchtbare Nacht vorübergehen, und dann würde das Leben weitergehen wie vorher. Der Gedanke befremdete sie selber, doch war er der einzige Strohhalm, an den sie sich im Moment klammern konnte. Ihr Vater war tot!
Sie schlug die Hände vor den Mund. Tot! Wie war das möglich? Er, der immer stark und unverletzbar gewirkt hatte! Als Tränen in ihre Augen schossen, trat sie von dem Bett zurück und floh in die angrenzende Hauskapelle, auf deren Altar ein vergoldetes Kruzifix prangte.
Weinend sank sie auf die Kniebank nieder und presste die Handflächen im Gebet aneinander. »Barmherziger Vater«, hauchte sie, »nimm seine Seele gnädig auf. Lass ihn ein in dein Himmelreich, denn er war frei von Sünde.« Ihre Stimme verstummte, als ihr ein beängstigender Gedanke kam. War er das?
War ihr Vater wirklich ohne Sünde gewesen, als seine Seele die sterbliche Hülle seines Körpers geflohen hatte? Hatte er in letzter Zeit die Beichte abgelegt? Die Vorstellung, was andernfalls geschehen konnte, ließ sie erzittern. Deshalb hoffte sie inständig, der Priester möge bereits eingetroffen sein. Sie umklammerte ein kleines Silberkreuz an ihrem Hals und führte es an die Lippen. Gewiss war es möglich, einen Ablass von ihm zu kaufen, der sicherstellte, dass ihr Vater keinen einzigen Tag im Fegefeuer zubringen musste! Sie hob den Blick zu dem kleinen Altarbild und versank erneut im Gebet. Lange Zeit versuchte sie, das Gefühl der Enge in ihrer Brust, den immer stärker anschwellenden Schmerz zu verdrängen. Doch irgendwann gewann dieser die Überhand, und sie ließ ihrer Trauer freien Lauf. Es hatte keinen Zweck, sich vorzumachen, dass das Leben jemals wieder so sein würde wie vorher! Wie konnte es das? Während ihr Körper von haltlosem Schluchzen geschüttelt wurde, sackte sie in sich zusammen, bis sie schließlich wie ein Kind auf dem Boden kauerte. Derweil längst vergessen gewähnte Bilder vor ihrem inneren Auge auftauchten, marterte sie sich mit der Frage, warum sie nicht bei ihm hatte sein können. Warum Gott ihr versagt hatte, ihm beizustehen, ihren Geist mit dem seinen zu verbinden – wie sie es so oft im wortlosen Gespräch getan hatten – und ihn auf diesem schwersten aller Wege zu begleiten. »Warum, Herr?«, flüsterte sie und schluckte den bitteren Geschmack in ihrem Mund.
Irgendwann, es schienen Stunden vergangen zu sein, drang das Schlagen einer Tür im Untergeschoss wie aus weiter Ferne an ihr Ohr. Am ganzen Leib taub, richtete sie sich mühsam auf und fuhr sich mit dem Ärmel über die Augen. Stimmen und das Trampeln schwerer Winterschuhe verkündeten die Ankunft mehrerer Männer. »Hier hinein, Pater«, hörte Zehra ihren Bruder Utz sagen. »Ich fürchte, Ihr kommt zu spät«, beschied Martin mit einem Seufzen. Zehra zwang sich, aufzustehen und sich erneut dem furchtbaren Anblick zu stellen.
Nachdem sie einige Male tief Luft geholt hatte, strich sie sich eine Strähne aus der Stirn und trat zögernd über die Schwelle der Hauskapelle. Im Nebenraum beugte sich der Pater gerade über ihren Vater und legte ihm etwas auf Augen und Mund.
Zehra lief ein Schauer über den Rücken. Mit seinem schwarzen Gewand sah der Gottesmann aus wie eine riesige, bedrohliche Saatkrähe. »Legt den Boden mit Stroh aus und breitet das Büßertuch aus«, wies der Pater seine beiden Begleiter an. Sobald diese seine Anweisungen ausgeführt hatten, bestreute er das Tuch mit Asche und bedeutete den Männern, den Leichnam darauf zu betten. Dann griff er nach einem kleinen Fläschchen, entkorkte es und bespritzte den Verstorbenen mit der darin enthaltenen Flüssigkeit. Er erhob die Stimme.
» Credo in Deum Patrem omnipotentem, ich glaube an Gott, den allmächtigen Vater.« Die Anwesenden stimmten in das Gebet mit ein. » Creatorem caeli et terrae et in Iesum Christum, filiumeius unicum Dominum nostrum qui conceptus est de Spiritu sanctonatus ex Maria Virgine. Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, der empfangen wurde vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria.« Einer seiner Begleiter fuchtelte mit einem Weihrauchfässchen über dem Toten herum. Um ein Haar hätte Zehra husten müssen. Während sie sich von dem beruhigend vertrauten Glaubensbekenntnis einlullen ließ, spürte sie jedoch unvermittelt, wie sich etwas im Raum veränderte.
Hatten bisher Trauer und Schock über das unerwartete Ableben des Hausherrn beinahe greifbar in der Luft gelegen, schlug ihr mit einem Mal eine Wand des Misstrauens und der Feindseligkeit entgegen.
So stark war der plötzliche Wandel, dass sie sich erschrocken an die Brust griff und trotz allen Grams den Kopf hob, um sich in der Kammer umzusehen. Als ihr Blick auf die blonde Magd fiel, die seit einigen Monaten das Bett ihres Vaters teilte, schlug diese die verweinten Augen nieder. Aber sie war nicht schnell genug, und Zehra sah nackte Angst darin aufblitzen. Verwirrt runzelte sie die Brauen. Die junge Frau neben der Blonden flüsterte ihrer Nachbarin etwas zu, bemerkte dann jedoch, dass mit dieser etwas nicht stimmte. Hastig zog sie den Mund von deren Ohr zurück. Als sie erkannte, was die junge Magd so sehr erschreckt hatte, verzog sie die Lippen zu einer schmalen Linie. Abfällig betrachtete sie Zehra, die diese offene Feindschaft zutiefst erschütterte. Es war nicht die Mischung aus Häme und geheuchelter Anteilname, welche das Mädchen trafen. Vielmehr waren es die unverhohlene Abscheu und die Tatsache, dass die Magd es nicht einmal für nötig hielt, diese vor ihr zu verbergen. Zwar war Zehra seit ihrer Kindheit an das Misstrauen ihrer Mitmenschen gewöhnt, da sie die dunkle Hautfarbe und das rabenschwarze Haar ihrer Großmutter geerbt hatte – der Frau, die ihr Großvater vor langer Zeit aus dem Harem des mächtigen osmanischen Sultans gestohlen hatte. Aber unter ihrem eigenen Dach war sie bisher von solcherlei offenkundiger Abneigung verschont geblieben. Sie schluckte trocken und bemühte sich um eine ausdruckslose Miene. Der brennende Klumpen der Trauer in ihrer Brust verdichtete sich wieder. Deshalb wandte sie schnell den Kopf von den beiden jungen Frauen ab. Was immer sie sich zugeraunt hatten, war im Moment unwichtig. Gleich morgen würde sie Martin bitten, die Magd zu entlassen. Doch bis dahin durfte sie sich durch nichts von der bevorstehenden Totenwache ablenken lassen. Sie musste sich von ihrem Vater verabschieden – ganz egal, wie sehr es schmerzte.
Kapitel 3
Ulm, ein Stadthaus, Februar 1447
Stunden später ging die Sonne auf. Im Laufe der Nacht – während Zehra neben ihrem Bruder Utz gekniet und gebetet hatte – waren die Kirchenmänner verschwunden und zwei Bedienstete hatten den Verstorbenen gewaschen und in ein Leichentuch eingenäht. Jetzt lag der reglose Leichnam auf einer Bahre, an deren Kopfende ein riesiges Kruzifix ihn vor Dämonen und bösen Mächten schützte. Als der erste Sonnenstrahl auf das blendend weiße Tuch fiel, dachte Zehra einen Augenblick lang, ihr Vater hätte sich bewegt. Grenzenlose Erleichterung durchflutete sie wie eine Welle. Während ihr Puls sich beschleunigte, fuhr ihr freudige Erregung in die Glieder.
Er hatte nur ein Spiel mit ihnen getrieben! Es war alles nur ein dummes Spiel! So wie früher, als sie und ihr Bruder klein gewesen waren und er sich im Heu der Ställe versteckt hatte, um sich erst zu zeigen, wenn sie die Suche aufgeben wollten.
Sicherlich würde er jeden Moment das Tuch zerreißen, aufstehen und sie alle wegen ihrer Gutgläubigkeit auslachen.
Doch der Sonnenstrahl wanderte weiter, ohne dass sich auch nur das geringste Stäubchen regte. Die Endgültigkeit des Todes war nicht zu leugnen, daran würde nichts, aber auch gar nichts etwas ändern! Zehra holte zitternd Luft und schloss ergeben die Augen, die schon längst tränenlos waren. Es war, als habe ihr Körper beschlossen, dass sie genug geweint hatte und dass all ihre Trauer nichts nützte. »Vater unser, der du bist im Himmel«, hub sie erneut an, da das Gebet ihr Halt zu geben schien. Am liebsten hätte sie es unzählige Male wiederholt – so lange, bis der furchtbare Schmerz abklang und sie die Kraft zurückgewann, ihr Leben weiterzuleben. Sie starrte auf die bunten Tonfliesen, auf denen sie kniete, und ließ das verschlungene Muster vor den Augen verschwimmen. Was sollte jetzt nur werden? Wie sollte sie ohne ihren Vater den Weg gehen, den dieser für sie bestimmt hatte? Das hagere Gesicht ihres Verlobten tauchte vor ihrem Geist auf, und es wirkte, als läge Tadel in seinen grauen Augen. »Es ist der Wille Gottes«, würde er sagen. »Sei gehorsam und füge dich in dein Los.«
Sie hob fröstelnd die Schultern und presste die Handflächen noch fester aneinander.
»Es wird alles gut«, flüsterte ihr Bruder neben ihr. Sie spürte seine Hand auf ihrem Rücken. »Vater hätte nicht gewollt, dass du dich so grämst.« Sie blinzelte, um das Brennen in ihren Augen zu verscheuchen und schenkte Utz ein gequältes Lächeln. »Er würde wollen, dass du ihn so, wie er war, in deinem Herzen einschließt«, setzte er hinzu und strich ihr sanft über den Kopf. »Komm«, forderte er sie auf und deutete auf das Fenster, dessen bunte Scheiben im Sonnenaufgang glühten. »Wir müssen dafür sorgen, dass er in der Kirche aufgebahrt wird.« Zehra ließ sich von ihm aufhelfen und von der Bahre fortführen. »Mach dich zurecht«, sagte er. »Ich kümmere mich um alles Nötige.« Mit diesen Worten schob er sie auf den Flur hinaus, auf dem immer noch die Mägde und Knechte zusammenstanden. Als das Gesinde die Geschwister erblickte, zuckten die Köpfe in die Höhe. Erneut vermeinte Zehra, Furcht in dem einen oder anderen Augenpaar zu lesen.
Einige der Mägde starrten sie entsetzt an, schlugen jedoch sofort den Blick nieder, als Utz in scharfem Ton fragte: »Habt ihr nichts zu tun? Geht und holt den Pater.« Martin, der Verwalter, tauchte aus dem Kontor ihres Vaters auf, wo er kurz zuvor verschwunden war. »Ich hatte euch doch gesagt, ihr habt hier nichts mehr zu suchen«, herrschte er die Bediensteten an.
»Macht, dass ihr an eure Arbeit kommt!« Kopfschüttelnd sah er den Männern und Frauen nach, die wie geprügelte Hunde ins Untergeschoss davonschlichen. »Das könnte denen so passen«, brummte er. »Eine Ausrede zum Faulenzen!« Zehra kroch eine Gänsehaut über den Rücken, als sich eine der Mägde umwandte und sie mit einem angsterfüllten Blick bedachte. Was um alles in der Welt ging hier vor sich? Sie erinnerte sich an ihren Vorsatz. »Martin«, bat sie, »bitte sorge dafür, dass Ita noch heute das Haus verlässt.« Als der Verwalter verwundert die Brauen hob, log sie: »Ich habe sie neulich etwas einstecken sehen.« Martin, der selbst die kleinsten Vergehen im Haus aufs Strengste ahndete, wollte aufbrausen, aber Zehra winkte ab. »Wirf sie einfach hinaus.« Dann nickte sie dem Verwalter und ihrem Bruder zu und betrat ihre Schlafkammer. Warum hatte sie Martin nicht die Wahrheit gesagt?, fragte sie sich, schob den Gedanken aber sofort wieder beiseite. Es gab Wichtigeres als die Unverschämtheit einer Magd!
Mit müden Bewegungen öffnete sie den Deckel einer Eichenholztruhe, zog eine Fucke – ein eng geschnittenes Oberkleid – hervor und griff nach einem Kamm. Sie würde tun, was Utz ihr geraten hatte, und sich für die Trauerfeier bereit machen.
Während sie die groben Zinken durch ihr stets störrisches Haar zog, lauschte sie den Stimmen der Männer vor ihrer Tür – ohne sich jedoch auf die Worte zu konzentrieren. Denn ihre Gedanken waren bereits wieder abgeschweift.
****
»Es wird nicht leicht sein, all die Papiere deines Vaters zu ordnen«, stellte Martin an Utz gewandt fest. »Er hat in letzter Zeit offenbar einige große Geschäfte abgeschlossen, von denen er selbst mir noch nichts gesagt hat.« Utz bemühte sich um eine ausdruckslose Miene. Ob Martin wusste, dass er sein Auftreten schon seit Langem als Beleidigung empfand? In der langen, durchwachten Nacht hatte er beschlossen, ihm so schnell wie möglich klarzumachen, dass er, Utz von Katzenstein, jetzt der Herr im Haus war? Immerhin war Utz mit seinen fünfzehn Jahren bereits seit einigen Monaten mündig.
Und es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen, sich um die Geschäfte zu kümmern, seit sein Vater beschlossen hatte, sich für den Stadtrat zur Wahl zu stellen. Nicht die des Verwalters! Er schnitt eine Grimasse, die Martin für einen Ausdruck seiner Trauer hielt. »Es tut mir leid, dass ich dich jetzt damit belästigen muss«, entschuldigte sich der Ältere. »Aber, so schwer dich der Verlust ohne Zweifel trifft, das Leben muss weitergehen. In wenigen Wochen beginnt der große Frühlingsmarkt.« »Du hast recht«, erwiderte Utz und bemühte sich, die Scham zu unterdrücken, die unvermittelt in ihm aufstieg. Wenn Martin wüsste, wie falsch er mit der Annahme lag, dass der Tod seines Vaters ihn genauso hart traf wie Zehra. Er schlug die Augen nieder, um das, was er dachte, vor dem hochgewachsenen Mann zu verbergen. Schweigend folgte er dem Verwalter ins Kontor seines Vaters. Dort stapelten sich neben unzähligen Papierrollen kleine Schubladen, Siegelwachsstangen und diverse in Leder gebundene Bücher.
Auf einem ausladenden Tisch standen ein Lesepult, ein Kruzifix und eine Feinwaage. Neben einem Häufchen – vermutlich gefälschter Münzen – lagen ein Probierstein und die Brille seines Vaters, die auf einem guten Dutzend Briefe ruhte. Da Karl von Katzenstein einer der erfolgreichsten Fern-und Pferdehändler der Stadt gewesen war, hatte er eine große Zahl, zum Teil unanständig reicher, Kunden. Diesen würde es egal sein, wer sie belieferte – solange sie nicht auf ihre Waren warten mussten.
»Die hier sind erst vor zwei Tagen hereingekommen«, sagte Martin und öffnete eine der Schubladen. »Sie sind noch nicht katalogisiert.« Utz beugte sich über den kleinen Kasten und kniff die Augen zusammen. »Granate, Smaragde, Topase, Bernstein und Korallen«, murmelte er. Wahrscheinlich zur Herstellung kostbarer Rosenkränze, dachte er und vergrub die Hand in den teuren Steinen. »Und diese Münzen sollten schon längst bei eurem Bancherius sein.« Martin zog einige weitere Schubladen auf und deutete auf deren Inhalt. Neben Golddukaten aus Venedig, englischen Nobeln, französischen Kronen und flämischen Pfunden enthielten die Kästen Kölner Pfennige, rheinische Gulden und westfälische Groschen.
Utz kniff die Augen zusammen und überschlug den Wert der Münzen. »Übermorgen müssen die Schiffer, Läufer und Fuhrleute bezahlt werden«, fügte der Verwalter hinzu. »Soll ich das übernehmen?« Auch wenn Utz in Anbetracht der plötzlichen Verantwortung Schwindel überkam, schüttelte er den Kopf.
»Nein«, entgegnete er, »das ist jetzt meine Aufgabe.« Er ignorierte Martins säuerliche Miene geflissentlich und beugte sich über eine Aufstellung von Aufträgen. »Je zweihundert Kartenspiele für Italien, Frankreich und Spanien«, las er. »Haben wir noch genügend davon oder müssen wir zukaufen?« Martin zuckte die Achseln. »Da müsste ich nachsehen.« Utz richtete sich wieder auf und bedachte den Verwalter mit einem entschlossenen Blick. »Dann tu das bitte. Ich komme hier schon alleine zurecht.« Martins Mund öffnete sich zum Protest, aber etwas im Gesicht seines jungen Gegenübers schien ihn eines Besseren zu belehren. Wortlos verließ er die Schreibstube. Sobald sich die Tür hinter ihm schloss, atmete Utz mehrere Male tief durch und ließ sich langsam und bedächtig in den Sessel seines Vaters sinken. Den Sessel, in dem niemals jemand anders hatte sitzen dürfen als das Oberhaupt des Hauses höchstpersönlich. Er ließ den Blick über das kleine Regal an der Wand wandern und überflog die Titel der Folianten, die er schon als Zehnjähriger auswendig gekannt hatte. Dann stieß er einen tiefen Seufzer aus und begann damit, die Edelsteine sorgfältig in ein kleines, rotes Heftchen einzutragen.
Als er diese Aufgabe hinter sich gebracht hatte, stützte er die Ellenbogen auf den Tisch und legte grübelnd das Kinn in die Hände. Was sollte er als Nächstes tun? Die Briefe lesen, Mieten und Pachtzins überprüfen oder das Warenlager inspizieren? Etwas ratlos schob er die Brille vor sich hin und her und starrte eine lange Zeit Löcher in die Luft. Anders als seine Schwester, die ihren Vater abgöttisch geliebt hatte, empfand Utz eher Wut als Trauer. Wenn sein Vater ihm doch nur mehr Verantwortung übertragen hätte! Warum hatte es immer Martin sein müssen, der sich um alles kümmerte, wenn der Kaufherr auf Reisen war, um erlesene Waren auf den internationalen Messen in Genua, Venedig oder Barcelona zu erstehen? »Du musst noch viel lernen«, hatte der verstorbene Karl von Katzenstein immer gesagt. »In ein oder zwei Jahren bist du so weit.« Utz schnaubte. Leider hatte er keine ein oder zwei Jahre mehr, um zu lernen! Aber mit dem Tod hatte sein Vater offensichtlich nicht gerechnet. Er kniff die Augen zusammen, da ihn die Helligkeit plötzlich schmerzte. Der gesamte Raum verschwamm vor ihm. Als sich eine Träne aus seinen Wimpern löste, wischte er sie trotzig mit dem Handrücken weg und presste die Kiefer aufeinander. Mädchen weinten, Männer trugen ihr Schicksal mit Fassung! Er fuhr mit dem Zeigefinger die Umrisse eines steigenden Hengstes nach, der in eines der Tintenfässer eingraviert war. Ein Streit, den er vor Kurzem mit seinem Vater ausgefochten hatte, kam ihm unvermittelt in den Sinn. »Du solltest nicht so viel Zeit bei den Pferden vertrödeln«, hatte Karl von Katzenstein seinen Sohn gescholten, der diese Leidenschaft von seinem Großvater geerbt hatte. »Es wäre gescheiter, du würdest dir ein Beispiel an Nikolaus nehmen und deinen Kopf etwas öfter in die Bücher stecken! Die Pferdezucht ist viel zu riskant, um zu viel Zeit darauf zu verschwenden. Die anderen Geschäfte bringen den Profit.« Er hatte mahnend den Finger gehoben. »Und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum du unbedingt bei dem Gesellenstechen mitmachen musst! Ein Turnier bringt nichts als unnötige Kosten. Nikolaus käme nie auf solch eine unsinnige Idee!« Utz rümpfte die Nase, als er an Nikolaus Nidhard, den Verlobten seiner Schwester, dachte. Ob Zehra wusste, was für ein Langweiler er war? Er zog die Nase hoch und lehnte sich in dem Sessel zurück. Wahrscheinlich nicht, denn sonst hätte sie sich wohl gegen den Handel gewehrt und ihren Vater gebeten, sie einem anderen zur Frau zu geben. Und wie hätte Karl von Katzenstein seiner Tochter jemals etwas abschlagen sollen? Utz spürte, wie ihm Hitze in die Wangen stieg. Ärgerlich über sich selbst, schüttelte er den Kopf. Es stimmte, Zehra war der Liebling ihres Vaters gewesen. Aber dafür traf sie dessen Tod jetzt auch umso heftiger.
Sein Blick fiel auf die Einladung zu dem besagten Gesellenstechen, die unter einem Stapel Briefe hervorlugte. Wenn im Sommer das alljährliche Turnier vor der Stadt abgehalten wurde, würde er mit den anderen Patriziersöhnen seine Geschicklichkeit mit der Lanze unter Beweis stellen. Jetzt würde ihn niemand mehr davon abhalten. Erneut überkam ihn Scham. Bevor die widerstreitenden Gefühle in seinem Inneren für noch mehr Aufruhr sorgen konnten, kam er hastig auf die Beine. Anstatt untätig herumzusitzen und seinen Gedanken nachzuhängen, sollte er lieber im Lager die Warenbestände überprüfen. Ein letztes Mal atmete er den im Raum hängenden Geruch seines Vaters ein, ehe er dem Schreibtisch den Rücken wandte. Er hatte gerade die Tür des Kontors geöffnet, als er aufgebrachte Stimmen aus dem Untergeschoss vernahm.
»Ihr könnt ihn nicht in die Kirche bringen«, dröhnte ein sonorer Bass. Die höhere Stimme des Paters, der inzwischen im Haus angekommen war, protestierte: »Wollt Ihr sein Seelenheil aufs Spiel setzen? Lasst mich durch, Mann.« Es folgte etwas, das wie ein Handgemenge klang, dann herrschte einige Augenblicke lang lastende Stille. Mit gerunzelten Brauen straffte Utz die Schultern, setzte eine hausherrliche Miene auf und eilte nach unten. Am Fuß der Treppe angekommen, erstarrte er, als er den Gassenvogt, eine Handvoll Gassenknechte und einen etwa fünfunddreißig Jahre alten Mann in schwarzer Tracht erblickte. Die Wachen hatten sich zwischen der Bahre und dem Pater aufgebaut und hielten diesen mit steinernen Gesichtern davon ab, dem Fremden den Zeigefinger in die Brust zu bohren. »Was geht hier vor?«, fragte Utz mit fordernder Stimme. »Wer seid Ihr?« Aus dem Augenwinkel sah er, dass Nikolaus Nidhard, Zehras Verlobter, ebenfalls im Hintergrund lauerte. Das hatte man davon, wenn man eine eigene Glocke auf dem Dach hatte, dachte er bitter. So wusste jeder im Umkreis von einer Meile, wem das Totengeläut galt. »Ich bin Heinrich Steinhövel«, stellte sich der Schwarzgekleidete vor und neigte den Kopf, als Utz offenbar nichts mit seinem Namen anzufangen wusste. »Der Stadtarzt«, setzte er trocken hinzu und gab den Gassenknechten zu verstehen, die Bahre aufzunehmen. »Auf Befehl des Bürgermeisters werde ich eine Leichenschau an Eurem Vater vornehmen«, erklärte er. »Ich nehme an, es ist Euer Vater.« Utz nickte wie betäubt und öffnete den Mund. Doch außer einem Krächzen kam nichts über seine Lippen. »Der Tod eines solch reichen Herrn muss untersucht werden. Um ein Verbrechen auszuschließen«, ergänzte der Arzt mit einem dünnen Lächeln. Utz kroch ein Schauer über den Rücken. War das normal? Musste einer Leichenschau nicht ein handfester Verdacht oder gar eine Anzeige vorausgehen? Als die Gassenknechte sich mit dem Verstorbenen zum Gehen wandten, rang er um Haltung. Was wurde in einer solchen Lage von einem einflussreichen Mitglied der Kaufmannszunft erwartet – und das war er ja wohl jetzt?
Musste er Einspruch einlegen? Oder musste er sich dem Befehl des Bürgermeisters ohne Widerrede fügen? Ehe er eine Entscheidung treffen konnte, knirschte bereits der Schnee unter den Stiefeln der Bahrenträger, welche die Halle verlassen hatten. »Aber«, stammelte er, doch der Stadtarzt schnitt ihm mit einer Handbewegung das Wort ab. »Wenn Euer Vater eines natürlichen Todes gestorben ist, habt Ihr nichts zu befürchten.« Er stülpte sich einen Filzhut auf den Kopf, um sich vor der eisigen Februarkälte zu schützen. »Ich werde mich beeilen, damit Ihr ihn so schnell wie möglich beisetzen könnt.«
Kapitel 4
Ulm, Februar 1447
Obgleich die Sonne aus einem strahlend blauen Himmel lachte, war der Morgen bitterkalt. Die dreizehnjährige Sophia von Katzenstein war froh, die pelzverbrämte Heuke – den dunkelgrünen Mantel – angelegt zu haben, da dieser auch ihren Kopf bedeckte. Ihr rotes Haar, lediglich von einem dünnen Schleier zusammengehalten, stahl sich zwar bereits unter der Kapuze hervor, aber das störte sie nicht besonders. Dankbar dafür, der Versuchung widerstanden zu haben, die modisch spitzen Schnabelschuhe anzuziehen, stapfte sie in ihrem stabileren Schuhwerk durch gefrorenen Matsch und Schnee. Ihre beiden Begleiter – zwei Reisige ihres Vaters – sorgten nicht nur für ihren Schutz. Sie halfen ihr auch über Unrat und Abwasserrinnen hinweg. Eine der Mägde schlich schüchtern hinter der kleinen Gruppe her, um die Einkäufe zu tragen, die ihre Herrin auf dem Markt tätigen wollte. Nachdem sie das Stadthaus ihres Vaters, des Ritters Johann von Katzenstein, verlassen hatten, steuerten sie auf den – trotz der frühen Stunde – belebten Münsterplatz zu. Und obwohl Sophia das gewaltige Bauwerk bereits bei ihrer Ankunft bestaunt hatte, zog das nahezu fertiggestellte Gewölbe des Chors ihren Blick magisch an. Auch über der Turmhalle und den Seitenschiffen wuchsen hölzerne Stützkonstruktionen in die Höhe. Das Schlagen der Zimmermannshämmer vermischte sich mit dem Klirren der Schlageisen und dem Geschrei der Mörtelträger.
Einen Augenblick lang war das Mädchen versucht, stehen zu bleiben und dem geschäftigen Gewimmel zuzusehen, aber der größere ihrer beiden Begleiter fragte schroff: »Wohin wollt Ihr zuerst?« Sophia zuckte bei dem rauen Ton zusammen und errötete vor Ärger. Warum nur hielt es keiner der Männer ihres Vaters für nötig, ihr den gebührenden Respekt entgegenzubringen? Ihre grünen Augen funkelten, als sie sich zu dem Hünen umwandte und spitz versetzte: »Meine Großmutter braucht zehn Ellen Tuch und einige Kräuter und Gewürze. Außerdem hat sie mir aufgetragen, Trauben, Feigen, Fleisch und Butter mitzubringen.«
Bei der Erwähnung ihrer Großmutter änderte sich die Haltung des Mannes. Sein Gesicht schien an Farbe zu verlieren. »Dann sollten wir zuerst die Lebensmittel besorgen«, stellte er nüchtern fest und wies mit dem Kopf in Richtung Süden. Dort, am Fuße des farbenprächtig bemalten Rathauses, tummelten sich bereits zahllose Kaufwillige. Eine rote Fahne flatterte über dem Treiben im Wind. Diese verkündete weithin sichtbar, dass heute der letzte vollständige Markt vor Beginn der Fastenzeit stattfand. Während sie die halbe Meile zurücklegten, fragte Sophia sich, ob die raubeinigen Dienstmänner ihres Vaters sich genauso vor ihrer Großmutter fürchteten wie sie selbst. Zwar war Helwig von Katzenstein mit ihren fünfundsechzig Jahren eine gebeugte Greisin, aber die dunklen Künste, die sie beherrschte, flößten nicht nur Sophia Angst ein. Auch ihr Vater schien großen Respekt vor seiner Mutter zu haben, da er sein polterndes Temperament in ihrer Gegenwart im Zaum hielt. Zwar kam es hie und da zum Streit zwischen dem aufbrausenden Ritter und der alten Frau, doch es schien stets Helwig zu sein, die bei diesen Auseinandersetzungen den Sieg davontrug. Die Ankunft auf dem Marktplatz vertrieb alle Gedanken an Helwig, denn mit einem Mal fand sich Sophia inmitten eines dichten Menschenknäuels wieder.
Direkt vor ihr zwängte sich ein junger Mann mit einem Traggestell voller Brezeln an den schimpfenden Marktbesuchern vorbei, und zu ihrer Linken trieb ein schmutziges Mädchen ein halbes Dutzend Schweine zwischen den Beinen der Besucher hindurch. Das Brüllen des Viehs übertönte beinahe das Geschrei der Fleischer, Bäcker und Fischer, welche allesamt ihre Waren anpriesen. Während einige der Buden lediglich aus dicken, mit Stoff bespannten Stangen bestanden, waren andere stabil zusammengezimmert und mit bunten Bildern geschmückt. Essig, Speckkuchen, Salz, Schaffüße und Holz wurden genauso lautstark angeboten wie Käse, Honig, Leder, Wachs und Wolle. Am Stand eines Fleischhändlers drückten zwei Marktaufseher Fleischstempel in die Ware, und etwas weiter entfernt wurden die Gewichte eines Getreidehändlers überprüft. Als Sophia endlich einen Fischverkäufer entdeckte, nahm sie erleichtert zur Kenntnis, dass seine Fässer das Brandzeichen der Stadt trugen – der Fisch also vom heutigen Morgen war.
Während sie das Gewimmel genoss und nach und nach die Dinge erstand, die man ihr aufgetragen hatte, fragte sie sich, wann sie wohl wieder nach Katzenstein aufbrechen würden.
Seit drei Wochen wohnten sie jetzt bereits in dem Stadthaus – länger als je zuvor. Normalerweise drängte ihre Großmutter bereits nach wenigen Tagen wieder zur Rückkehr aufs Land, da sie den Gestank der Stadt nicht ausstehen konnte. Aber dieses Mal schien sie etwas in Ulm zu halten. Sophia seufzte und widerstand der Versuchung, etwas Färberröte oder Schminkfarbe aus Brombeersaft für sich zu erstehen. Sicherlich würde ihre Großmutter Rechenschaft für jeden einzelnen Pfennig von ihr verlangen. Während sie die gelangweilten Mienen ihrer Begleiter ignorierte, schlenderte sie durch die Gassen zwischen den Buden und hoffte, dass Helwigs Geduld anhalten würde. Warum konnten sie nicht immer in der Stadt wohnen? Wie viel abwechslungsreicher und leichter das Leben in Ulm war! Nicht so langweilig und öde wie auf Burg Katzenstein. Ein Hoffnungsschimmer malte ein Lächeln auf ihr Gesicht. Vielleicht hatte ihr Vater Helwig endlich dazu überredet, dass es besser war, dem kalten, zugigen Gemäuer den Rücken zu kehren. Vielleicht war der Erwerb einer neuen Rüstung nur ein fadenscheiniger Grund gewesen, um ihre Großmutter in die Stadt zu locken und ihr vor Augen zu führen, um wie viel bequemer es hier war. Ihr Blick wurde von einem jungen Burschen in schreiend bunter Kleidung angezogen und sie spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen stieg. Und außerdem sahen die Männer in der Stadt viel besser aus als die grobschlächtigen Kerle auf Katzenstein. Das Feuer in ihren Wangen verstärkte sich, als der Jüngling ihr einen allzu offenen Blick zuwarf. Hastig senkte sie den Kopf.
Allerdings gewann ihre Neugier nach einigen Augenblicken wieder die Oberhand. Verstohlen sah sie sich nach ihm um. Ohne Erfolg. Denn wie all die anderen Marktbesucher vor ihr, war auch er von dem Strom der Besucher weitergespült worden. Eine schrille Stimme zu ihrer Rechten ließ sie den Kopf wenden. Am Stand eines Pelzhändlers schimpfte eine fette Dame auf den Verkäufer ein, der entschuldigend die Achseln zuckte. »Die Preise sind gestiegen. Ich kann Euch diesen Zobel nicht für weniger überlassen.« »Das ist Raub!«, keifte die Dame weiter und schob die gezupften Brauen zusammen. »Ich werde Euch der Marktaufsicht melden!« Der Mann hob resigniert die Hände und gab mit öliger Freundlichkeit zurück. »Warum seht Ihr Euch nicht bei den anderen Pelzhändlern um. Wenn Ihr irgendwo einen besseren Preis bekommt, dann gehe ich mit.« Er schob die Hände unter eines der Felle – vermutlich, um sie zu wärmen. »Aber ich bezweifle es.« Seine Kundin schnaubte verächtlich und griff nach ihrer Schleppe, um erzürnt davonzurauschen. Auch wenn es schneidend kalt war an diesem Tag, hatte die korpulente Dame davon abgesehen, ein Übergewand anzulegen. Stattdessen stolzierte sie in einer gefütterten, blutroten Fucke über den Platz. Bauschige, saphirblaue Seidenärmel reichten bis zum Boden. Um ihren fleischigen Hals hingen drei schwere Perlenketten. Die wulstigen Finger waren mit Ringen überladen, und ein mit Silberplättchen bestickter Gürtel umfing das, was ihre Taille hätte sein sollen. Neidisch verfolgte Sophia den Abzug der reichen Patrizierin, deren Bedienstete bereits Ballen aus Seide, Kamelhaartuch und Samt schleppten. Sie unterdrückte ein Seufzen. Wenn sie sich doch nur auch all die Kostbarkeiten leisten könnte! Aber solange sie nicht einen reichen Ehemann für sich gewann, lag die Erfüllung solcher Träume in weiter Ferne.
Nachdem sie auch den letzten Posten auf ihrer Liste besorgt hatte, ließ sie sich von den beiden Reisigen einen Weg zurück zum Münsterplatz bahnen, wo sie sich nach links wandten. Sie wollten gerade in die Hirschstraße einbiegen, als Sophia eine Menschentraube vor einem prächtigen Bürgerhaus auffiel. Die bunt verglasten Scheiben zeugten ebenso vom Reichtum des Besitzers wie die vielen Fuhrwerke davor. Doch es war das Schild über dem Eingang, das Sophias Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch wenn sich die tief stehende Sonne darin fing, konnte sie deutlich einen buckelnden Kater auf einem Felsen ausmachen, unter dem der Name »Katzenstein«
geschrieben stand. »Katzenstein?«, murmelte sie und änderte die Richtung, ohne auf das entnervte Ausatmen ihrer männlichen Begleiter zu achten. Sollten etwa Verwandte von ihr in der Stadt wohnen, von denen sie nichts wusste? Sie beschleunigte die Schritte, hielt jedoch in einigem Abstand von der Ansammlung an und verfolgte das Geschehen. Scheinbar war in diesem Haus jemand gestorben, da ein schwarzes Tuch an der Tür angebracht war. Diese stand weit offen, und nach einigen Augenblicken erschienen ein Schwarzgekleideter und einige Stadtwachen, von denen zwei eine Bahre trugen. Hinter den Gassenknechten tauchten ein älterer und ein jüngerer Mann im Rahmen auf, die den Trägern fassungslos hinterherstarrten. Der Jüngere der beiden schien nicht viel älter zu sein als Sophia, und als er sich mit der Hand durch den unbedeckten, dunklen Schopf fuhr, fühlte sie sich seltsam zu ihm hingezogen. Ob er ein entfernter Vetter war? Ohne dass sie es wollte, tasteten ihre Augen seine Erscheinung weiter ab. Breite Schultern sorgten dafür, dass der Stoff seines eher konservativen Tabbards sich über der Brust spannte. Und das eigensinnig vorgereckte Kinn verriet ihr, dass er wahrscheinlich ein beträchtliches Maß an Sturheit besaß. Seine Hände schienen zu zittern, als er sich mit den Handflächen das Gesicht rieb – wie, um es zu wärmen. Als er sich an seinen Begleiter wandte und zurück ins Haus trat, empfand Sophia einen leisen Anflug des Bedauerns, da sie ihn nur zu gerne kennengelernt hätte. Sobald sie das Haus ihres Vaters erreichte, würde sie ihn fragen, wer der junge Mann war. Und wie es kam, dass sie nichts von seiner Existenz wusste, wo er doch offensichtlich den gleichen Namen trug wie sie.
Kapitel 5
Edirne, Sultanspalast, Februar 1447
»Ich sagte, du sollst das fressen!« Ein brutaler Tritt in die Rippen sorgte dafür, dass Vlad Draculea gegen die Wand krachte, wo er regungslos liegen blieb. Jeder einzelne Knochen in seinem Leib schmerzte. Über seinen Rücken zogen sich dick geschwollene, eiternde Wunden. Scheinbar stundenlang hatte der Falakaci Başi ihn von einem jungen, kräftigen Helfer geißeln lassen, um ihn dann zwei Tage und Nächte ohne Wasser am Pfahl darben zu lassen. Mehr als einmal hatte er sich während dieser Zeit gewünscht, dass der Tod ihn endlich von seinen Qualen erlöste, aber Gott war taub für sein Flehen. »Friss, oder ich mache dich zum Eunuchen!«, zischte der Scherge, der ihn losgebunden und zurück in seine Zelle geschleift hatte. Er packte den jungen Walachen im Genick und presste sein Gesicht in einen Haufen Kot am Boden. Obgleich ihm bittere Galle in die Kehle schoss, gelang es Vlad, sich nicht zu übergeben. Er spannte die Nackenmuskeln an, um seinem Peiniger Widerstand zu leisten. Die Lippen fest aufeinandergepresst, versteifte er sich und bäumte sich mit einem heiseren Laut auf, um Abstand zwischen sich und den stinkenden Haufen zu bringen. Zwar war dieser schon mehrere Tage alt und halb vertrocknet, aber um nichts in der Welt wollte Vlad damit in Berührung kommen. »Du hast wohl immer noch nicht dazugelernt?«, knurrte der Wachsoldat und zog einen gekrümmten Dolch aus der Scheide an seinem Gürtel. Die Klinge war stumpf von altem Blut. Als der Kerl kurz darauf mit der Hand in Vlads Haar fuhr, um ihm den Kopf nach hinten zu reißen, schloss der walachische Prinz die Augen und betete um ein schnelles Ende. Anstatt seine Kehle zu durchtrennen, wanderte die Waffe jedoch an seiner nackten Brust entlang nach unten, wo sie eine blutige Spur hinterließ.
Dann griff der Mann in den Bund des Shalvars – der dünnen Pluderhose – und entblößte Vlads Männlichkeit. Er schnalzte mit der Zunge und griff beinahe zärtlich danach. Ehe er allerdings die Hand mit dem Dolch heben konnte, nahm Vlad seine letzte Kraft zusammen und rammte ihm den Ellenbogen ins Gesicht. Augenblicklich schoss Blut aus der Nase des Getroffenen, der mit einem wüsten Fluch von seinem Opfer abließ und nach hinten taumelte.
»Ich werde dir das Herz aus dem Leib reißen!«, tobte der Soldat, nachdem er sich mit dem Ärmel das Blut aus dem Gesicht gewischt hatte. Er wollte sich mit erhobener Waffe auf Vlad stürzen, doch eine herrische Stimme hielt ihn von seiner Rache ab. »Wenn du ihn ohne Befehl tötest, wird Prinz Mehmet dir das Herz aus dem Leib reißen«, sagte der Falakaci Başi, der unbemerkt – in Begleitung von drei Janitscharen – in dem Gefängnis aufgetaucht war. »Du solltest lieber deine Arbeit tun und hier ausmisten lassen.« Der Bestrafungsoffizier hob angeekelt die Hand an die Nase und schürzte die Lippen. Sein makellos weißer Turban sorgte dafür, dass er gebückt gehen musste, wenn er ihn nicht beschmutzen wollte. Auch der Rest seines Gewandes war, wie immer, blütenrein. Das strenge Gesicht mit dem grauen Bart war ausdruckslos, als er Vlad mit kalten Augen musterte. »Deine Willenskraft ist bemerkenswert«, sagte er ohne Hohn. »Du könntest eine große Zukunft vor dir haben, wenn du dich endlich in dein Schicksal fügen würdest.« Er schüttelte verständnislos den Kopf, da Vlad ihn trotzig anstarrte. »Der Prinz will dich sehen«, verkündete er und machte auf dem Absatz kehrt, nachdem er den Janitscharen ein Zeichen gegeben hatte. »Bringt ihn ins Freie«, hörte Vlad ihn sagen. Seine niedergetrampelte Hoffnung reckte für den Bruchteil eines Augenblickes das Haupt. Sollte Mehmet die Bestrafung bereits genügen? Hatte sein Vater, der Sultan, ihn daran erinnert, dass Vlad eine wertvolle Geisel war? Oder hatte gar Radu für ihn gebeten? Der Gedanke an seinen kleinen Bruder ließ ihn frösteln. Er versuchte, das brennende Gefühl der Schuld zu verdrängen, welches den Funken der Hoffnung genauso schnell auslöschte, wie er aufgeflammt war.
Starke Hände hoben ihn auf die Beine und beförderten ihn in den engen Gang hinaus. Halb stolpernd, halb getragen gelangte er schließlich im Erdgeschoss des Turmes an, wo ihm kühle Luft entgegenschlug. Das Gefühl der Kälte verstärkte sich, und er spürte, wie er von innen heraus anfing zu zittern.
Ohne lange zu fackeln, versetzten ihm die Janitscharen einen Stoß, sodass er durch die Tür hinaus ins Freie taumelte. Dort, auf dem Rücken eines mitternachtschwarzen Araberhengstes, thronte Prinz Mehmet. Neben ihm, regungslos und herausgeputzt wie eine Haremskonkubine saß Radu im Sattel einer Stute, die ungeduldig mit den Hufen scharrte. Beim Anblick seines Bruders wollte Vlad zuerst Erleichterung durchfluten.
Aber als er dem Knaben in die Augen blickte, erschrak er so heftig, dass seine Beine ihm den Dienst versagten. Mit einem dumpfen Laut fiel er auf die Knie und senkte den Kopf, um seine Tränen vor Mehmet zu verbergen.
»Ich sehe, du hast endlich Respekt gelernt«, spottete dieser und ließ sich geschmeidig aus dem Sattel gleiten. Goldene Ketten klimperten, als er auf Vlad zutrat und sich vor ihm aufbaute. Durch den Tränenschleier vor seinen Augen nahm Vlad lediglich die perlenbestickten Schuhe des Prinzen wahr, mit denen dieser einen kleinen Kreis in den Schmutz malte. Nach einigen quälenden Augenblicken ließ er schließlich einen glänzenden Gegenstand in die Mitte des Kreises fallen und beugte sich zu Vlad hinab. »Sieh nur, was der Enderum Sakirdi auf dem Boden des Unterrichtsraumes gefunden hat«, flötete er zuckersüß. Nach mehrmaligem Blinzeln erkannte Vlad die verlorene Drachenbrosche. Trotz der aussichtslosen Lage und dem Bewusstsein, am Unglück seines Bruders schuld zu sein, gab ihm das Schmuckstück eine Spur Zuversicht zurück. Hatte er nicht gedacht, alles sei verloren? Auch der Drache, der seine Zugehörigkeit zum Drachenorden symbolisierte? Seine Halsstarrigkeit kehrte zurück und eine Stimme in seinem Inneren schalt ihn einen Narren. Woher wollte er wissen, ob Mehmet sich tatsächlich an Radu vergangen hatte? Vielleicht war das alles nur Teil eines der grausamen Spielchen, welche der Prinz so zu lieben schien. »Nur zu, nimm sie dir«, ermunterte Mehmet ihn mit geheuchelter Freundlichkeit. Kaum streckte Vlad allerdings die Finger nach der Brosche aus, nagelte er das Handgelenk des Walachen mit dem Schuh am Boden fest.
»Dieser Tand ist dir wohl wichtig?«, höhnte er und bohrte die Hacke in die empfindliche Handwurzel. Entgegen aller Selbstbeherrschung kam ein Stöhnen über Vlads Lippen. »Antworte!«, herrschte Mehmet ihn an und nickte dem Bestrafungsoffizier zu. Dieser machte eine Peitsche von seinem Gürtel los und drosch mehrmals auf Vlads geschundenen Rücken ein.
»Ja«, stieß dieser nach einem halben Dutzend Hieben hervor.
»Ja, Herr!« Auf eine Handbewegung des Prinzen hin hörten die Schläge auf. »Dann sollte man dafür sorgen, dass du sie nie wieder verlieren kannst.«