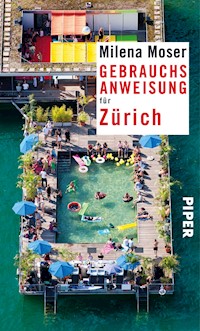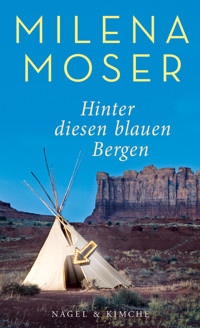13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Sofia von ihren Vätern in die Privatklinik Los Pajaritos an der Nordwestküste der Vereinigten Staaten gebracht wird, denkt sie nicht daran, Gewicht zu verlieren, schließlich hat sie nicht ohne Grund so viel zugenommen. Sofia will um jeden Preis verhindern, ihre Bodenhaftung zu verlieren, und ihr Übergewicht gibt ihr Halt.
Doch sie hat nicht mit den anderen Klinikbewohner:innen gerechnet. Nicht mit ihrer Zimmernachbarin Emerald, die sich entschieden hat, Sofia als neue Freundin zu gewinnen, und nicht mit Zach, der ihr zu Beginn so fremd scheint, am Ende aber derjenige ist, der sie am grundlegendsten durchschaut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Milena Moser, 1963 in Zürich geboren, ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Schweiz. 2015 emigrierte sie nach Santa Fe, New Mexico und lebt seit 2019 in San Francisco.
Neben Das schöne Leben der Toten erschienen bei Kein & Aber Land der Söhne und zuletzt Mehr als ein Leben.
Milena Mosers Figur Sofia ist nicht nur die Protagonistin von Der Traum vom Fliegen, sondern begegnet uns als Nebenfigur auch schon in den letzten beiden Romanen.
ÜBER DAS BUCH
Als Sofia von ihren Vätern wegen ihres Übergewichts in die Privatklinik Los Pajaritos an der Westküste der Vereinigten Staaten gebracht wird, denkt sie nicht daran, dünner zu werden, schließlich hat sie nicht ohne Grund so viel zugenommen. Sofia will um jeden Preis verhindern, ihre Bodenhaftung zu verlieren, und ihr Übergewicht gibt ihr Halt.
Doch sie hat nicht mit den neuen Bekanntschaften in der Klinik gerechnet. Ihre anhängliche Zimmergenossin Emerald, der dominante Zach, bei dem sich alles nur um ihn selbst dreht, die ständig unzufriedene Carmel und nicht zuletzt der mysteriöse, zarte Blue mischen Sofias zurückgezogenes Leben ordentlich auf. Und schließlich muss sie erkennen, dass uns manchmal gerade die Menschen am besten verstehen, die uns zunächst fremd erscheinen.
Ein Roman über das Gefühl, ausgeschlossen und nicht »normal« zu sein, über vermeintliche Schwächen, die eigentlich unsere potenziellen Stärken sind und über die Kraft der Freundschaft.
»Ich will mein eigenes Buch. Ich habemehr zu sagen als ihr alle zusammen.«
SOFIA
DER TRAUM VOM FLIEGEN
Sofia war im Sitzen eingeschlafen, auf dem breiten Bett in ihrem Zimmer, das mit Zierkissen, Nackenrollen und Stofftieren übersät war, mit Büchern, Zeitschriften, ihrem Laptop, ihrem Smartphone. Während der Pandemie war ihr Studium erst unterbrochen und dann zum Fernstudium umfunktioniert worden. Doch davon wollte sie sich nicht aufhalten lassen. Seit sie ein Kind war, wusste Sofia, was sie wollte. Fliegen. Sie wollte fliegen.
Sie wollte ins All. Schon während der Mittelschule hatte sie zielstrebig darauf hingearbeitet, zusätzliche Kurse in Physik und Mathematik belegt, frühzeitig abgeschlossen und sich daraufhin sofort beim renommierten Massachusetts Institute of Technology in Boston für einen Studienplatz in Raumfahrttechnik beworben. Sie war nicht nur aufgenommen worden, man hatte ihr sogar ein Stipendium angeboten.
Sie war eine der Besten ihres Jahrgangs. Gewesen. Denn in letzter Zeit schlief sie immer wieder ein, mitten in einer Recherche oder sogar einer Videovorlesung. Während des Lockdowns hatte sie das Zeitgefühl verloren und sich daran gewöhnt, nicht länger als zwei, drei Stunden am Stück zu schlafen, dafür immer wieder. Egal, ob es Tag war oder Nacht. Das konnte sie ohnehin nicht mehr klar voneinander unterscheiden. Als der Campus wieder geöffnet wurde, entschied sie sich, das Fernstudium vorläufig weiterzuführen. Die Vorstellung, so weit von zu Hause weg zu sein, ihr Zimmer mit anderen zu teilen, die sie nicht kannte, dieselbe Vorstellung, die sie jahrelang mit Vorfreude erfüllt hatte, überforderte sie jetzt. Sie traute sich nicht mehr zu, ihr Zimmer zu verlassen, ihr Haus, ihre Straße, ihre Stadt.
Als sie aufwachte, war es dunkel. Neumond, erinnerte sie sich. Ihr Papa Santiago hatte beim Abendessen darüber gesprochen. Er glaubte an den Einfluss der Sterne auf sein Befinden und las so viele Horoskope, dass er immer irgendwo etwas Tröstliches fand.
Sofia setzte sich auf. Der Nachthimmel vor ihrem Fenster übte eine seltsame Anziehungskraft auf sie aus. Sie ging zum Fenster und schob es auf. Ihr Haus am oberen Ende der Nevada Street grenzte an den Bernal Heights Park. Sofias Zimmer ging auf den Park hinaus, dahinter sah sie die Lichter der Bay Bridge glitzern. An besonderen Feiertagen formierten sich die Lichter zu Mustern, zu Herzen oder Sternen, manchmal auch zu Buchstaben.
Und dann kauerte sie plötzlich auf dem Fensterbrett. Ohne darüber nachzudenken, war sie auf ihren Schreibtisch geklettert und durch die Fensteröffnung geschlüpft. Nun stand sie auf dem Dachvorsprung und breitete die Arme aus. Sie überlegte nichts.
Als Kind hatte sie geglaubt, sie würde das Fliegen ganz automatisch lernen, wie sie das Gehen gelernt hatte. Sofia war sehr behütet aufgewachsen. »Wir haben zu lange auf dich gewartet«, sagten ihre Papas immer. »Wir mussten zu lange darum kämpfen, eine Familie sein zu dürfen.« Bis zu ihrem Schuleintritt war das ganze Haus mit Treppengittern und Türsicherungen versehen, und noch vor wenigen Jahren hatte ein Metallgitter vor ihrem Fenster sie vor dem Herausfallen bewahrt. Trotzdem hatte sie alles versucht, unermüdlich war sie von jedem Mäuerchen, von jeder Treppenstufe gesprungen, mit wild rudernden, ausgebreiteten Armen. Unzählige Male war sie gegen das Schutznetz geknallt, das ihr Trampolin im Garten umgab. Etwas in ihr meinte zu wissen, wie es sich anfühlte, Flügel zu haben und diese zu bewegen. Sie war sich ganz sicher, dass die Fähigkeit zu fliegen irgendwo in ihr angelegt war.
Und dann hatte sie es einfach getan. Ohne darüber nachzudenken. Ihre Schulterblätter zogen sich zusammen. Sie breitete die Arme aus, bewegte sie erst vorsichtig, prüfend, dann immer bestimmter auf und ab, auf und ab. Sie blickte über den Park auf die Bucht hinunter, auf die Lichter des Frachthafens und der Brücke. Und sprang.
Einen furchterregenden Moment lang sackte sie ab. Ihr Zimmer lag im zweiten Stock, aber da ihr Haus in einen steilen Hügel hineingebaut war, waren es eher drei oder vier Stockwerke bis zur Straße hinunter. Vermutlich würde sie den Aufprall überleben, aber nicht ohne gebrochene Knochen. Eiskalte Angst erfüllte sie, der Augenblick dehnte sich, dann trugen sie ihre Arme. Oder eher, die Luft unter ihr trug sie. Wie eine Hand unter ihrem Bauch. Wie damals, als Papa Giò ihr das Schwimmen beigebracht hatte. Instinktiv ließ Sofia sich nach vorn kippen, bis sie liegend über ihrer Straße schwebte. Sie stieg höher und höher, sie flog über den kahlen Hügel des Parks und in den dunklen Nachthimmel. Zu den Sternen, dachte sie.
Ein nie gekanntes Glücksgefühl breitete sich in ihr aus, bewegte ihre Arme, trieb sie hinauf. Sie juchzte laut.
Bis heute hatte sie dieses Gefühl nicht vergessen. Trotz allem, was es nach sich gezogen hatte. Trotz allem, was seither passiert war.
Plötzlich ging es nicht mehr höher. Sie schwebte etwa sieben, acht Meter über dem Boden, musste vereinzelten Baumspitzen ausweichen und dem einen oder anderen Fernleitungsmast. Sie konnte in die Häuser hineinsehen und auf die Passanten herunter. Das wollte sie gar nicht. Sie wollte in den Himmel hinauf, ins All, sie wollte die Sterne sehen. Doch es waren die Menschen, die ihren Blick anzogen, die ihren Kurs bestimmten, und plötzlich fühlte Sofia sich unwohl. Sie konnte das Fliegen nicht so bewusst steuern wie das Gehen. Sie schien an einem unsichtbaren Strick zu hängen wie die Schauspielerin im Kindertheater, die den Peter Pan gespielt hatte. Sofia war zutiefst beleidigt gewesen, als sie die billige Täuschung erkannte. Einen Moment lang hatte sie geglaubt, einen Menschen fliegen zu sehen. Sie hatte geglaubt, dass es möglich war. Doch schon mit sechs oder sieben Jahren hatte ihr technisches Verständnis den Mechanismus hoch über der Bühne erkannt, der die Schauspielerin in der immer gleichen Spur hin und her führte, hinauf und hinunter.
So fühlte es sich jetzt an, als werde sie von unsichtbaren Stricken geführt, an fixen Schienen entlang. Wie ein Straßenbahnwagen. Würde sie den Heimweg wieder finden? Sofia hatte sich bisher kaum allein durch die Stadt bewegt, als Kind durfte sie nicht mal zum Eckladen am Ende der Straße gehen, geschweige denn öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Mit sechzehn hatte sie den Führerschein gemacht, aber auch den nutzte sie nur, um Papa Giò herumzuchauffieren, der das Fahren hasste. Dafür kannte er jede Abkürzung, jede Einbahnstraße und jedes Parkverbot. Unentwegt gab er Sofia Anweisungen, korrigierte und ermahnte sie, bis sie das Fahren genauso hasste wie er. Angestrengt schaute Sofia hinunter, versuchte, die Straßenschilder zu entziffern, sich zurechtzufinden. Sie bewegte sich vom Hügel weg Richtung Bucht, überflog den flachen Bayshore Boulevard mit seinen Autobahneinfahrten und Überführungen, Warenhäusern und Werkstätten. Und da war der eingezäunte Parkplatz, wo sie im Dezember immer ihren Weihnachtsbaum kauften. Jetzt lag er verlassen da. Es gab nichts zu sehen, und trotzdem zog es sie dorthin. Die unsichtbaren Stricke führten sie über den leeren Parkplatz hinweg.
Plötzlich hörte sie Stimmen. Schreie. Hilferufe. Mit einem Ruck zog es sie nach links, wo sich ein paar Obdachlose zwischen dem Zaun und den Abfallcontainern zum Schlafen eingerichtet hatten. Drei junge Männer traten auf die Liegenden ein, die in ihren Schlafsäcken gefangen waren.
»Nein!«, schrie Sofia. »Nein! Nein! Hört auf …« Ihre Stimme wurde vom Wind verschluckt. Sie strampelte und ruderte, doch sie konnte nicht landen, nicht tiefer fliegen. Hilflos hing sie in der Luft und schaute zu, zappelte über ihnen wie eine Marionette. Schreiend und schluchzend. Einer der Jugendlichen schaute kurz zu ihr auf, doch die Nacht war dunkel und der Himmel schwarz.
Sie wusste nicht, wie sie nach Hause gekommen war. Sie wusste nur, dass sie auf ihrem Bett aufwachte, zwischen ihren Büchern und Zeitschriften und elektronischen Geräten, umgeben von ihren Zierkissen und Stofftieren, und dass sie immer noch dieselbe Kleidung wie am Vortag trug. Sie musste während der Arbeit eingeschlafen sein, dachte sie, zwischen Formeln und Zahlen, wie so oft. Beruhigt ging sie ins Bad, zog ihren Pyjama an, putzte sich die Zähne. Es war ein Traum. Sie hatte immer schon stark und realistisch geträumt. Als Kind hatte sie sogar eine imaginäre Freundin gehabt. Ein ausgeprägtes Vorstellungsvermögen war gemäß ihrer Familientherapeutin Doktor Lilly ein Zeichen von Intelligenz und Kreativität.
Sie ging wieder ins Bett und schlief noch mal ein. Als sie endlich aufstand, hatte sie die Episode als Albtraum abgetan und schon beinahe vergessen.
EIN JAHR SPÄTER
Es war, als würden sie in die Ferien fahren. Ein verlängertes Wochenende an der Küste oder im Weinland, in einem dieser Wellnesshotels, die ihr Papa Santiago so liebte. Die Landschaft, die vor dem Fenster vorbeizog, war lieblich. Sanfte Hügel, trockenes Gras, letzte Nebelfetzen, die sich in den Bäumen verfingen. Sofia lehnte den Kopf an die Scheibe.
Papa Giò drehte sich zu ihr um. »Schau dir die braunen Flecken auf den Hügeln an, und wie sie verteilt sind«, dozierte er. »Hier kann man sehr schön verfolgen, wie der von unserer korrupten Regierung unterstützte, wenn nicht gar verordnete Wasserraub durch die Landwirtschaftsindustrie die Auswirkungen der verheerenden Dürrekatastrophe der letzten Jahre verstärkt und …«
Papa Santiago seufzte und drehte die Musik lauter. Der Frühling. Vivaldi hatten sie früher immer sonntags bei ihrem ausgedehnten Frühstück gehört. Sofia tanzte um die Küchentheke, während Santiago mit theatralischem Flair und dem Einsatz sämtlicher verfügbarer Töpfe Huevos Rancheros oder Chilaquiles zubereitete und Giò sie beide gerührt über den Rand einer Zeitungsseite beobachtete.
Sofia erinnerte sich, wie sich der würzige Duft nach gerösteten Tortillas und Salsa Roja in der offenen Wohnküche verbreitete, während sie tanzte und tanzte, ihre Arme dazu bewegte wie Flügel. Wie sie Blumen und Schmetterlinge vor sich sah, Bäume, deren Äste sich im Wind wiegten, Vögel, die in der Luft schwebten. Wie sie sich damals schon eingebildet hatte, sie könne fliegen.
Das war sie gewesen: ein tanzendes Kind. Ein Mädchen, das Musik in Bilder verwandelte und Bilder in Bewegungen. Ein Mädchen, das fliegen wollte.
Sofia träumte nicht mehr vom Fliegen. Sie war kein Kind mehr. Die Mahlzeiten hatten sich zu einer Kampfzone entwickelt. Und die Papas beobachteten sie mit zunehmender Besorgnis. Sie setzte ihre Kopfhörer auf, um die Sonntagsmusik auszublenden, die besorgten Stimmen, die Erinnerungen. Sie schloss die Augen und öffnete sie erst wieder, als Santiago vor dem Fishetarian Market in Bodega Bay anhielt. Hier hatten sie auf ihren Ausflügen immer Halt gemacht. So oft waren sie die endlose, kurvige alte Küstenstraße schon hochgefahren, hatten das Wochenende in Jenner oder Bodega Bay verbracht oder in Mendocino. Eine Zeit lang hatten sie sogar ein Ferienhaus in Sea Ranch gemietet, aber am Ende hatten sie es doch zu wenig genutzt, um die Ausgaben zu rechtfertigen. Ihr heutiges Ziel lag nicht weit davon entfernt, etwas außerhalb von Gualala auf einer steilen Klippe über dem Meer.
»Kommt, wir machen eine Pause«, sagte Santiago. »Es ist schließlich fast Mittag. Was meinst du, Sofikind, noch einmal so richtig schön gebackene Austern essen? Mit Fritten und Tartarsauce und allem Drum und Dran?«
Papa Giò seufzte und schüttelte den Kopf. »Du tust ja grad so, als käme sie ins Gefängnis«, sagte er steif.
»So hab ich’s doch nicht gemeint! Ich wollte nur … Nichts kann man recht machen!«
»Es geht ja hier auch nicht um dich, mein Lieber.«
Früher hatten die Papas nie gestritten. Und auch jetzt taten sie es nur ihretwegen. Schon deshalb hatte Sofia in den Plan eingewilligt. Wenn sie nicht mehr da wäre, wenn sie sie nicht ständig anschauen müssten, würden sich die Papas schnell wieder entspannen, dachte Sofia. Sie würden sich keine Sorgen mehr machen, würden keinen Grund mehr haben, zu streiten.
»Ich hab keinen Hunger«, sagte sie deshalb. »Ich würd ehrlich gesagt lieber durchfahren.«
»Tut mir leid, Liebes«, murmelte Santiago, während er den Wagen wendete. »Ich hab nicht … ich wollte nicht …«
»Kein Problem.« Plötzlich wollte sie es nur noch hinter sich bringen. Sie setzte die Kopfhörer wieder auf, die das gereizte Tuscheln ihrer Papas dämpften, die gegenseitigen Schuldzuweisungen: »Wie oft muss ich dir erklären …«, »Ich habs ja nur gut gemeint …«
Sie seufzte laut, und das Getuschel verstummte. Dann musste sie eingeschlafen sein, trotz der kurvigen Fahrt, während der ihr als Kind immer schlecht geworden war.
Sie wachte auf, als sie Kies unter den Rädern knirschen hörte. Mühsam richtete sie sich auf und wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht. Sie fühlte sich verschwitzt und unwohl. Als sie die Tür öffnete, strömte kalte, salzige Meeresluft ins Auto. Nebelfetzen hingen in den Spitzen der knorrigen Zwergpinien und der Zwiebeltürme, die an eine russische Kirche erinnerten. Das quadratische, zweistöckige Gebäude war aus verwittertem grauem Holz gebaut und mit Buntglasfenstern und Mosaikkacheln verziert. Russische Einwanderer hatten den Baustil in dieser Gegend geprägt, Papa Giò hatte ihnen das auf der Fahrt ausführlich erklärt und auf Ferienhäuser hingewiesen, die wie Datschas aussahen. Doch Sofia erinnerte sich nicht an die Einzelheiten. Früher hatte sie ein nahezu perfektes Gedächtnis gehabt, was sie einmal gelesen oder gehört hatte, war für immer in dem ordentlich sortierten Archiv in ihrem Kopf gespeichert.
Auch das hatte sie verloren. Auch das hatte das letzte Jahr ihr genommen.
Santiago öffnete die Fahrertür, stieg aus, streckte die Arme über den Kopf und dehnte seinen Rücken. »Sieht doch sehr ansprechend aus«, rief er, der ewige Cheerleader. »Wie ein Wellnessresort, nicht?«
Sofia fühlte sich eher an ein Gruselschloss aus einem Horrorfilm erinnert. Bestimmt würde die schwere, mit geschnitzten Holzbalken verzierte Eingangstür schauerlich knarren. Und sie würde nie wieder hier herauskommen.
Und wenn schon.
»Kostet ja auch genug«, murmelte Giò und biss sich sofort auf die Lippen. Schuldbewusst drehte er sich zu seiner Tochter um. »Was meinst du, Hühnchen, hältst du es hier aus?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich denke schon«, sagte sie. Was sollte sie denn sonst sagen?
Los Pajaritos war kein Wellnesshotel, sondern eine Privatklinik, die sich auf Sucht- und Stresserkrankungen spezialisiert hatte. Sie war in den Fünfzigerjahren gegründet worden, um tablettensüchtige Filmstars fern von Hollywood zu entwöhnen. Jetzt diente sie mehrheitlich den höheren Angestellten der Tech-Industrie, die der verzerrten Realität und dem ständigen Druck ihrer Arbeitswelt nicht standhalten konnten. Die Fantasiepreise, die diese bezahlten, ermöglichten auch Krankenkassenpatientinnen wie Sofia einen zeitlich beschränkten Aufenthalt. Der Selbstbehalt war allerdings, wie Giò bemerkt hatte, immer noch beachtlich. Die Klinik vertrat einen innovativen Ansatz und konnte damit eine hohe Erfolgsrate halten. Wohlweislich nahm sie nur Süchtige auf, die den klinischen Entzug bereits hinter sich hatten, keine Rückfälligen, keine Opioidabhängigen, und auch das Körpergewicht musste in einem ungefährlichen Bereich liegen. Diese letzte Bedingung erfüllte Sofia immer noch.
Sie löste die Verlängerung ihres Sicherheitsgurts und öffnete die Tür. Dann legte sie sich seitlich auf die Rückbank, sodass sie ihre Beine aus dem Auto schwingen konnte. Es war nicht praktisch, so dick zu sein. Und auch nicht angenehm. Aber es ging nun mal nicht anders. Santiago war um den Wagen herumgekommen, um ihr zu helfen. Sie streckte die Arme nach ihm aus, wie sie es als Kind getan hatte, und er zog sie hoch.
Giò nahm ihre Reisetasche, Santiago hängte sich bei ihr ein. Sie hörte ihn schniefen und hasste sich einmal mehr dafür, dass sie ihren Papas solchen Kummer bereitete. Der Weg stieg leicht an. Die Kieselsteine drückten durch die dünnen Sohlen ihrer Turnschuhe. Sofia atmete schwer.
Doktor Lilly hatte die Klinik empfohlen. Die rothaarige Familientherapeutin begleitete Sofia, solange sie sich erinnern konnte. Doch hier war sie an ihre Grenze gestoßen.
»Eine Essstörung ist eine nicht zu unterschätzende psychische Erkrankung«, hatte sie erklärt. »Sie ist chronisch und verläuft oft tödlich. Tut mir leid, wenn das brutal klingt, aber ich kann es nicht genug betonen.«
Sofia hatte keine Essstörung. Ihre Gewichtszunahme war eine bewusste Entscheidung gewesen. Sofia hatte sie, wie alles in ihrem Leben, gründlich überdacht. Und sie hatte auch keineswegs vor, in der Klinik abzunehmen. Ihr Gewicht erfüllte eine wichtige Funktion. Doch das konnte sie niemandem erklären. Man würde ihr nicht glauben. Man würde sie für verrückt erklären. Dann doch lieber süchtig, dachte sie.
Die Flügel der eisenbeschlagenen Türe schwangen von alleine und lautlos auf, bevor sie sie erreicht hatten. Ein stämmiger älterer Mann trat heraus. Er trug verwaschene Jeans und ein hellblaues T-Shirt mit dem Logo der Klinik, zwei stilisierten Vögeln im Flug. Wohin die wohl flogen, fragte sich Sofia.
In die Nüchternheit. In die Normalität. In die Freiheit.
Über Abgründe hinweg, so wie sie.
Der Mann hatte ein pockennarbiges Gesicht und muskulöse Unterarme mit verblichenen Tätowierungen. Seine langen grau melierten Haare waren zu einem dünnen Zopf geflochten, darüber trug er ein rotes Bandana als Stirnband. Ein klassischer Filmbösewicht. Die Papas blieben verunsichert stehen. Sofia war dankbar für die Pause, sie atmete schwer. Der kurze Anstieg hatte sie bereits überfordert.
»Sofia Gomez Bernasconi?« Der Mann streckte die Hand aus, Sofia schüttelte sie.
»Willkommen in Los Pajaritos. Ich bin Ken.«
»Ken?«, schnaufte Sofia.
Der Mann lachte. Seine Zähne waren überraschend weiß und strahlend.
»Tja, meine Eltern wollten einen echten Gringo aus mir machen. Aber ich seh wohl nicht aus wie ein Ken …«
»Bis auf die Zähne«, rutschte es Sofia heraus.
»Ja, die sind erstklassig, was! Teuerste Variante.« Er grinste breit, um sein Gebiss zu zeigen. »Das Erste, was ich mir geleistet habe. Da kannst du noch so lange clean sein, die ruinierten Zähne stellen dich sofort als Meth Head bloß. Aber jetzt seh ich doch voll respektabel aus.«
Die Papas nickten und machten höflich zustimmende Geräusche.
»Na, dann wollen wir mal.« Ken nahm Santiago die Reisetasche aus der Hand und drehte sich um. Als die Papas ihm folgten, blieb er stehen. »Ihr wisst, dass Besuch erst nach vier Wochen wieder erlaubt ist, ja?« Seine heisere Stimme klang sanft. Er sprach in diesem nachsichtigen Ton, den Doktor Lilly manchmal auch anschlug.
»Aber wir dürfen schon schnell mit reinkommen?«
»Tut mir leid, das sind die Bestimmungen. Die ersten vier Wochen keinen Kontakt.«
»Vier Wochen!«
Giò legte seine Hand auf Santiagos Schulter. »Das wussten wir, mi amor.« Es war selten, dass Giò seine Gefühle so offen zeigte. Dass er Santiago vor einem Fremden amor nannte, verriet Sofia, wie aufgewühlt er war.
»Können wir denn nicht wenigstens …?«
Ken schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, keine Anrufe, Nachrichten, E-Mails, etc. Ihr könnt aber gern noch mal mit Frau Doktor Rose sprechen, bevor ihr geht.«
Er nahm sein Handy vom Gürtel. Sein Blick war freundlich. Sofia fragte sich, was er sah: ein reiches, behütetes Mädchen aus San Francisco, das sich bis zum Platzen vollgefressen hatte? Sie wünschte, sie könnte es ihm erklären. »Ich habe meine Gründe«, wollte sie sagen. »Ich habe einen Plan.«
Santiago weinte jetzt haltlos, Giò legte die Arme um ihn und zog ihn an sich. Sofia hasste sich.
»Danke, Ken«, sagte Giò über Santiagos Schulter hinweg. »Wir wussten ja eigentlich, wie es abläuft. Es ist nur … Sofia …«
»… ist euer kleines Mädchen«, sagte Ken sanft. »Das versteh ich doch.«
Sofia ließ sich von ihren Papas umarmen. Ihre Arme reichten nicht mehr um ihren Körper herum. Sie wandte sich ab und folgte Ken durch die Flügeltüren, die sich lautlos hinter ihnen schlossen.
Das Innere der Klinik wirkte erstaunlich schäbig. Verstaubte Deckenlampen flackerten in den düsteren Gängen, die dunklen Holzwände waren mit schlecht gerahmten, verblichenen Schwarz-Weiß-Fotografien geschmückt, auf dem Flurboden lag ein trauriger grauer Läufer, mehr schlecht als recht auf die Holzdielen genagelt. Sofia versuchte, mit Ken Schritt zu halten. Doch der Flur war zu schmal für sie beide. Immer wieder blickte Ken über die Schulter zu ihr zurück.
»Du wirst dich hier schnell zurechtfinden«, sagte er. »Das Gebäude ist um einen Innenhof angelegt, den wir immer noch die Raucherlounge nennen, obwohl das Rauchen auf dem ganzen Klinikgelände natürlich schon längst verboten ist. Hier.« Er öffnete eine altmodische Glastüre mit eingelegten Blumenornamenten. In dem kargen Innenhof hatte sich der Nebel gestaut. Wieder dachte Sofia an einen Horrorfilm. An Bösewichte, die in den grauen Schatten lauerten. Unter einem Vordach standen Bänke in regelmäßigen Abständen, drei auf jeder Seite. Das hingegen gefiel ihr. Die Pajarito-Klinik hatte nur zwölf Therapieplätze. Und im Hof standen zwölf Bänke. Sofia würde eine ganz für sich allein beanspruchen können. Sie musste sich von den anderen absondern. Sie musste sich in Acht nehmen, wenn sie ihr Geheimnis wahren wollte.
»Den Innenhof kannst du von allen vier Seiten betreten. Hier rechts vom Flur gehen die Behandlungsräume ab. Einzeltherapie, Gruppentherapie, Kunst und Körper. Die erste Tür direkt neben dem Haupteingang, das ist das Sprechzimmer von Doktor Rose. Da hast du gleich dein Einführungsgespräch.«
Sofia nickte. Sie versuchte, sich zu orientieren. Auch damit hatte sie früher nie ein Problem gehabt. Die Papas hatten sich auf Reisen eher auf Sofias Orientierungssinn als auf ihr GPS verlassen. Jetzt musste sie immer wieder über die Schulter zurückschauen, um sich zurechtzufinden.
Ken schien ihre Verwirrung nicht zu bemerken. Vielleicht ging es ja allen Neuzugängen so. »Aber erst zeig ich dir dein Zimmer«, fuhr er fort. »Wie gesagt, wir haben zwölf Gäste, auf zehn Zimmer verteilt. Die sind alle oben.« Er deutete auf eine düstere, dunkle Holztreppe. »Die meisten Gäste haben Einzelzimmer, aber die jüngeren werden manchmal zusammengelegt. Aus therapeutischen Gründen, nicht etwa, weil du Kassenpatientin bist!«
So viel zu ihrem Plan, sich abzusondern, dachte Sofia.
Das Zimmer war so schäbig wie der Flur. Zwei schmale, mit gestreiften Wolldecken abgedeckte Betten standen im rechten Winkel zueinander, auf der anderen Seite ein einziger breiter Holzschrank und ein fast leeres Regal, in dem einige zerfledderte Taschenbücher neben einem verstaubten Kaktus aus Keramik standen. Auf dem Fußboden ein Flickenteppich, darauf eine grell orangefarbene Yogamatte. Ein halbrunder Erker mit leicht angelaufenen Fensterscheiben würde den Blick auf den Ozean freigeben, sobald der Nebel sich verzog. Ken legte Sofias Tasche auf das Bett, das näher bei der Türe stand. Auf dem anderen saß eine junge Frau, die so dünn war wie Sofia dick. Sie trug eine Wollmütze über langem blondem Haar und eine voluminöse Wolljacke. Die Arme hatte sie um sich geschlungen, die Hände in die Ärmel geschoben. Eine Zwangsjacke, dachte Sofia.
»Aber nicht im Ernst, Ken!« Sie ließ ihren Blick über Sofia schweifen und verdrehte die Augen. »Was soll denn das werden, Dick und Doof?«
Zu Sofia sagte sie: »Ich bin Emerald, und ich meins nicht böse. Ich finds nur ein bisschen billig, dass sie ausgerechnet uns beide zusammensperren. Was soll das? Glauben sie etwa, dass sich die Hälfte deines Gewichts wie von selbst auf mich überträgt, oder was?«
Sofia musste lachen. »Davon stand nichts auf der Website!«
»Emerald, das hier ist ein Doppelzimmer, das weißt du ganz genau.«
Emerald schnaubte und machte eine Bewegung mit der Hand, als wolle sie eine Fliege verscheuchen. »Spar dir den Atem, Ken. Wir kommen hier schon klar.« Ken hob beide Hände und schüttelte in gespielter Resignation den Kopf.
»Sofia, dein Vorgespräch bei Doktor Rose beginnt in zehn Minuten. Und du, Emerald, hast gleich Gruppe, komm bitte nicht wieder zu spät.«
»Aye, aye, Sir!« Emerald salutierte. Kaum hatte Ken das Zimmer verlassen, stand sie auf und hob Sofias Tasche hoch, stemmte sie ein paarmal über ihren Kopf und senkte sie wieder. Sofia schaute sich um. Der kurze Treppenaufstieg hatte sie erschöpft. Doch wenn sie sich jetzt aufs Bett legte, käme sie vielleicht gar nicht mehr hoch. Sie ging zu dem schmalen Büchergestell an der Wand und studierte die Titel. Vampire und Drachen. Ratgeber und Zitate. Wahllos zog sie einen Band heraus und setzte sich damit auf die Fensterbank im Erker. Das Polster war hart und unbequem, die Bank schmal.
Vor dem Fenster hatte sich der Nebel verzogen. Sonnenstrahlen brachen sich in den angelaufenen Scheiben. Vielleicht war das Glas auch nur schmutzig.
Emerald ließ endlich die Tasche auf den Boden fallen und setzte sich im Schneidersitz auf die Yogamatte. Mit den Handflächen strich sie ein paarmal über die Innenseite ihrer Schenkel. »Sag nichts: Deine Eltern genieren sich vor ihren Freunden, so wie du aussiehst, und haben dich hierher abgeschoben?«
Das war so absurd, dass Sofia lachen musste.
»Nicht wirklich. Sie machen sich halt Sorgen. Grundlos, wenn du mich fragst.«
»Ja, ja, ich weiß: Du bist unschuldig. Sind wir doch alle. Das ist genau wie im Gefängnis: Wir gehören alle nicht hierher.«
»Du auch nicht?«
»Also, so dünn, wie alle behaupten, bin ich gar nicht. Schau doch.« Sie stand auf und schob ihren Pullover hoch bis über ihre nackten Brüste, und Sofia schaute. Sie war auch mal dünn gewesen, hatte sich lange nicht »entwickelt«, wie Doktor Lilly es diskret beschrieb. Doch Emerald war nicht dünn, sie war durchsichtig. Sofia meinte, durch ihre Haut hindurch die weißen Knochen sehen zu können. Wie alt sie wohl war? Über achtzehn, sonst wäre sie nicht hier in dieser Klinik.
»Aber wenn ich ehrlich bin, halte ich es hier besser aus als anderswo.« Emerald ließ ihre Kleidungsschichten wieder über ihren Körper fallen. »Doktor Rose ist ganz in Ordnung. Für eine Psychiaterin. Und wenigstens zwingen sie einen hier nicht zum Essen. In Colorado, wo ich letztes Jahr war, wurdest du alle fünf Minuten gewogen. Hier gibts nicht mal Waagen. Und falls du einen Spiegel suchst, den gibts auch nur im Gruppentherapieraum. Oh Mist. Die Gruppe. Ich darf nicht wieder zu spät kommen.«
Sofia wusste genau, wie sie aussah. Emerald offenbar nicht. Einem Impuls folgend, den sie sich nicht erklären konnte, stellte sich Sofia hinter Emerald und breitete ihre Arme aus. So standen sie beide vor einem imaginären Spiegel, der dünne Körper vom dicken verschluckt.
Sofia hatte sich auf die Begegnung vorbereitet. Sie hatte alles über Doktor Rose gelesen, was sie finden konnte: Als eine der letzten Polio-Patientinnen hatte sie eine einsame Kindheit verbracht, zwischen Krankenhaus und Isolation. Obwohl sie ihr linkes Bein kaum gebrauchen konnte, trat sie als junges Mädchen einer experimentellen Tanztruppe bei. Sie tanzte mit Stock, fiel manchmal auf der Bühne hin, doch ihre Auftritte erregten international Aufmerksamkeit. Trotz ihres Erfolgs verließ sie ein paar Jahre später die Bühne, um ihren Schulabschluss nachzuholen. Sie studierte Medizin, machte den Facharzt in Psychiatrie und musste dann zuschauen, wie ihr Fachgebiet politischen Sparmaßnahmen zum Opfer fiel und fast ganz aus dem öffentlichen Gesundheitswesen verschwand. Vor zwanzig Jahren hatte sie die heruntergekommene Klinik Los Pajaritos übernommen und nach ihrem Gutdünken umgekrempelt. Ihre eigenen Erfahrungen mit Krankheit und Isolation und chronischen Schmerzen hatten sie geprägt und ihre Methode beeinflusst. »Psychische Krankheiten sind Symptome, nicht Diagnosen«, erklärte sie. Sie redete von einer »Spaltung«, und davon, dass »Teile des Selbst die Flucht ergriffen hätten«. Dafür gäbe es meist gute Gründe. Sie setzte nie bei der Diagnose an, sondern versuchte, diese einzelnen Teile wieder zusammenzuführen, das Körpergefühl und damit die Lebensfreude wieder zu wecken. Patientinnen wie Emerald und Sofia wurden weder zum Essen gezwungen noch auf Diät gesetzt. Stattdessen wurde ihnen Bewegung an der frischen Luft verschrieben, Massagen, kalte Meerbäder und Gartenarbeit. Aber auch Kunsthandwerk, Gespräche, Gruppentherapie, kreativer Tanz. Gesundes Essen, kein Alkohol, kein Kaffee.
Doktor Rose war Mitte sechzig, sah aber älter aus. Sie war mager, ihr Gesicht markant und faltig, vollkommen ungeschminkt. Lange graue Haare streng aus dem Gesicht gekämmt, klarer Blick. Sie trug einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwere Silberkette mit einem Türkisanhänger. Ihr Stock lehnte gut sichtbar an ihrem Pult. Er war aus schwarzem Holz mit einem silbernen Löwenkopf als Knauf.
Sie musterte Sofia freundlich, sagte aber nichts. Das kannte Sofia schon von Doktor Lilly. Das konnte sie auch. Wohlweislich hatte sie nicht das Sofa, sondern den Sessel an der Seite gewählt. Der war nicht zu tief und mit breiten Holzlehnen versehen. Sie würde ohne größere Peinlichkeit wieder aufstehen können. Die Ärztin brach das Schweigen als Erste: »Warum bist du hier, Sofia?«
»Meine Papas machen sich Sorgen um mich.«
»Und du, machst du dir auch Sorgen um dich?«
Sofia zuckte mit den Schultern. Was sollte sie sagen? Alles außer der Wahrheit.
»Na ja, ich hab mein Studium geschmissen«, sagte sie. Geschmissen war nicht das richtige Wort. Fallen gelassen traf es eher. Es war ihr entglitten. »Dabei hatte ich sogar ein Begabtenstipendium am MIT, das wird nur zwei Mal im Jahr vergeben.« Darauf war sie so stolz gewesen, jetzt lastete es auf ihr, vertiefte ihre Scham. Sie hatte ja nicht nur ihren eigenen Lebenstraum aufgegeben, sie hatte etwas verloren, wofür andere alles gegeben hätten. Andere, Würdigere.
»Hm«, machte die Psychiaterin. Doktor Lilly hatte dasselbe »Hm« in ihrem Repertoire. Und ein »M-hm« und ein »Ah«. Sofia fragte sich, ob diese unterstützenden Laute Teil der Ausbildung waren. Und ob angehende Psychiaterinnen darin geprüft wurden. Sie stellte sich ein Sprachlabor voller Medizinstudentinnen vor, die einfühlsam in die Mikrofone hmmten. Und schon hatte sie Doktor Roses nächste Frage überhört.
»Kannst du mir sagen, wie es dazu gekommen ist?«, wiederholte die Ärztin.
Sofia zuckte mit den Schultern. Wieder war sie an diese unsichtbare Grenze gestoßen, die Grenze der Wahrheit. Das Fliegen war ihr verleidet. Auf die schlimmstmögliche Weise. Und mit dem Fliegen hatte sich ihr Lebenstraum erledigt. Sie hatte kein Ziel mehr, keine Richtung, keinen Plan. Was war von ihr übrig geblieben? Wer war sie ohne dieses Lebensziel, ohne diese Besessenheit? Sofia konnte sich nicht mehr an sich selbst erinnern. Und so war sie in die Defensive gegangen. Sie hatte sich verschanzt.
Doktor Rose wartete eine Weile, doch als Sofia nicht antwortete, verlegte sie ihren Fokus auf das Offensichtliche: »Deine Hausärztin bestätigt, dass du im letzten Jahr fast dreißig Kilo zugenommen hast. Das ist bei deiner Größe ganz schön viel.«
»Ich weiß.«
»Es braucht eine gewisse Disziplin, um in so kurzer Zeit so viel Gewicht zuzulegen. Du musst viel Zeit mit Essen verbringen, mit der Zubereitung oder der Beschaffung der zusätzlichen Mahlzeiten. Zeit, die du vorher anders genutzt hast.«
Sofia nickte. Das sah die Ärztin richtig. Sie war mit wissenschaftlichem Eifer und Ernst an die Aufgabe herangegangen. Und erst, nachdem sie alles andere probiert hatte, die Fußfesseln, die Sandsäcke und schließlich die schwere Decke, unter der sie gerne schlief. Das zusätzliche Gewicht verlieh ihr tatsächlich ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, aber auch das hatte nicht gereicht. Sie brauchte mehr. Es war ihr nichts anderes übrig geblieben, als ihren Körper von innen zu beschweren.
Auch das hatte sie gewissenhaft recherchiert, Interviews mit Schauspielern gelesen, die für Filmrollen an Gewicht zugenommen hatten, die Mahlzeiten professioneller Sumoringerinnen und Footballspieler gegoogelt. Sie hatte sich einen Menuplan zusammengestellt und gewissenhaft eingehalten. Es war nicht einfach gewesen. Anfangs musste sie sich zwingen, so viel zu essen, auch Dinge, die sie gar nicht mochte, Fast Food, Eiscreme, Butter, Sahne. Doch mit der Zeit gewöhnte sich ihr Körper daran, verlangte nach mehr. Je dicker sie wurde, desto weniger Lust hatte sie, sich zu bewegen, je weniger sie sich bewegte, desto schneller nahm sie zu. Sofias Plan funktionierte. Sie führte genau Buch über ihr Gewicht und über die nächtlichen Flüge. Diese waren mit der Zeit immer kürzer und beschwerlicher geworden, und bei dreißig Kilo mehr hatten sie aufgehört. Seit fast drei Monaten war nichts mehr passiert, was nichts heißen musste. Sie hatte kein Muster erkennen können, wusste nie, wann es passieren würde, in welchen Abständen, und auch nicht, wodurch es ausgelöst wurde. Das war ein weiteres Argument für den Ortswechsel gewesen: Die Klinik lag einsam an der Küste oberhalb von Gualala, weit weg von den Ferienhäusern und Hanfplantagen der Nordküste, von anderen Menschen, von jeder denkbaren Gefahr.
Doktor Rose schaute sie immer noch erwartungsvoll an. Ihr Blick war freundlich und irgendwie gefasst. Als könnte sie nichts mehr erschüttern. Als hätte sie schon alles gehört. Sofia wünschte, sie könnte ihr die Wahrheit sagen.
»Vielleicht hat es ja auch etwas mit meiner Mutter zu tun«, sagte sie stattdessen. Das war nicht die Wahrheit, aber auch nicht gelogen. Und wenn etwas bei Psychiaterinnen zog, war es die Mutterkarte.
»Was ist mit deiner Mutter?«
»Sie ist vor Kurzem gestorben.«
Doktor Rose schloss die Augen und öffnete sie wieder. »Und – standet ihr euch nahe?«
Die Ärztin war nicht dumm. Sie wusste, dass Sofia mit ihren Vätern aufgewachsen war. Doch ihre Familiengeschichte war ein Boden, auf dem sie sich sicher bewegte. Sie hatte nicht umsonst ein Leben lang in therapeutischer Begleitung verbracht.
»Celia«, sagte sie. »Ich nannte sie Celia, nicht Mama oder Mom oder so. Und ich hab sie nur ein paarmal im Jahr gesehen. Ich hatte immer das Gefühl, sie käme mehr wegen Papa Santiago, und nicht wegen mir. Sie waren schon befreundet, bevor sie schwanger wurde. Für mich interessierte sie sich nicht besonders.« Automatisch hielt sie inne, damit die Ärztin nachfragen konnte: »Und was hat das mit dir gemacht?«
»Es war okay. Ich bekam von meinen Papas so viel Aufmerksamkeit, dass ich es irgendwie cool fand, mal nicht im Mittelpunkt zu stehen …«
Doktor Roses Stift fuhr über das Papier. Sie benutzte einen Bleistift, als traue sie Sofias Ausführungen nicht genug, um sie in Tinte festzuhalten.
»Celia kannte die Papas schon länger, also vor allem Santiago. Sie war Kundin in seinem Friseursalon in Los Angeles.«
Celia war damals ein mittelmäßig erfolgreiches Model, ein Partygirl, mit vierundzwanzig schon ein bisschen alt für den Job. Sie lenkte sich mit komplizierten Affären ab und wurde immer wieder ungewollt schwanger. Sie wusste, wie sehr sich Santiago und Giò eine Familie wünschten, und bot sich ihnen als Leihmutter an.
»Meine Papas nennen es meine Entstehungsgeschichte, sie haben es mir hundertmal erklärt. In unserer Familie gibt es definitiv keine Geheimnisse.«
»Geheimnisse sind ja nicht nur schlecht«, wandte Doktor Rose ein.
Sofia lächelte. »Stimmt, so genau wollte ich das als Kind gar nicht wissen, vor allem nicht die Sache mit der Bratenspritze.«
»Der Bratenspritze?« Die Ärztin runzelte die Stirn. Dann lachte sie überraschend laut auf und schlug sich beide Hände vors Gesicht. »Oh Gott, Sofia! Kein Wunder, brauchtest du Therapie!«
Durfte eine Psychiaterin so etwas sagen? Doktor Rose hatte ein raues, lautes Lachen, das so gar nicht zu ihrem asketischen Äußeren passte.
Sofia nickte ein paarmal. »In der Bratenspritze waren beide … ähm, also von beiden …«
»Schon gut, schon gut!« Doktor Rose wedelte abwehrend mit den Händen. »Ich versteh schon. Keine Einzelheiten, bitte. Himmel noch mal!«
Sofia beugte sich vor, als verrate sie ein Geheimnis. Aber das klang nur so, weil über solche Dinge normalerweise nicht gesprochen wurde. Sofia hingegen hatte es schon so oft gehört, dass es an Bedeutung verloren hatte.
»Meine Papas wollten nicht wissen, wer von ihnen mein biologischer Vater war. Santiago und Celia sind beide Chicanos, Giò italienischstämmiger Weißer. Und ich … na, Sie sehen ja selbst.«
Die Ärztin musterte sie ungeniert. Das war Sofia nicht gewohnt. Niemand setzte sich freiwillig mit Themen wie Hautfarbe und Rasse auseinander. Es war etwas, worüber man nicht sprach. Ein Minenfeld. Doch das schien Doktor Rose nicht zu kümmern. Sie runzelte die Stirn und nickte langsam.
»Deine Haut ist dunkler, als man erwarten würde. Und deine Augenform …«
»Die Papas konnten meiner Mutter ja schlecht Vorschriften machen …« Sofia grinste schief, als sie das sagte. Als sei sie eine Frau von Welt, die sich in solchen Dingen auskannte. Als sei ihr das kein bisschen peinlich.
»Heute kann ja jeder einen Gentest machen. Warst du nie versucht? Hattest du nie das Bedürfnis, mehr über deine Herkunft zu erfahren?«
»Meine Herkunft? Oder meinen genetischen Bausatz?«
»Touché.« Die Ärztin nickte, der Bleistift wischte. Sofia wusste, dass es irgendwo einen dunkelhäutigen Mann mit schräggestellten Mandelaugen und einer zartgliedrigen Statur gab, einen Mann, der ihr biologischer Vater war.
Aber sie hatte bereits zwei Väter. Sie brauchte keinen dritten.
»Dann hab ich’s aber doch gemacht. Den Gentest, meine ich.«
Die Ärztin wartete. Sofia wartete. Nicht, weil sie Zeit schinden wollte. Sie fand es immer noch schwierig, darüber zu reden.
»Celia hatte ein unheilbares Nierenleiden. Sie brauchte eine Spenderniere, aber wegen ihrer Drogenvergangenheit kam sie nicht auf die offizielle Warteliste für eine Transplantation.«
»Moment, Moment!«, unterbrach Doktor Rose. »Wenn sie mindestens sechs Monate clean war, sollte ihre Vergangenheit keine Rolle spielen.«
Sofia antwortete nicht. Die Ärztin verstand.
»Ach, nein! Was für eine verdammte Scheiße aber auch!«
Durften Psychiaterinnen so fluchen?
Sofia nickte. »Ja. Ihre einzige Chance war eine Direktspende. Drum hab ich mich testen lassen, gegen den Willen meiner Papas, aber die hätte ich schon rumgekriegt. Sie haben mir noch nie etwas verweigert, was ich wirklich wollte.«
Sofia schwieg einen Moment. »Ich hätte es getan. Ich bin ein Nerd, ich glaube an Statistiken und Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Ich weiß, dass man mit einer einzelnen Niere bestens leben kann. Es wäre nicht mal ein Opfer gewesen. Keine heldenhafte Tat. Ein Routineeingriff mit sehr guten Heilungschancen. Aber es ging nicht. Ich war nicht kompatibel, konnte sie nicht retten.«
Und so war Celia gestorben und hatte Sofia mit einer perfekten Erklärung zurückgelassen. Einer Erklärung für alles.
Als Sofia aus Doktor Roses Zimmer kam, wartete Emerald schon auf sie. Sie kauerte zusammengesunken auf dem Boden im Flur, reglos wie ein Bündel alter Kleider. Als sie Sofia sah, stand sie in einer einzigen geschmeidigen Bewegung auf. Ohne sich mit den Händen abzustützen. Das hatte Sofia auch mal gekonnt.
»Hey. Wie wars? Du warst ja ganz schön lange da drin! Mit mir redet Doktor Rose nie so lange.« Emerald schaute auf die geschlossene Tür und schob die Unterlippe vor. »Egal, ich soll dich rumführen, dir alles zeigen und so.«
»Hast du nicht Gruppe?«
»Schon vorbei. Dauert zum Glück nur 45 Minuten.« Sie ging Sofia voraus den Flur entlang und stieß die Glastür zum Innenhof auf.
»Das ist die sogenannte Raucherlounge.« Im Gegensatz zu vorher, als Sofia mit Ken hier vorbeigekommen war, war der Innenhof jetzt voll. Manche standen zu zweit oder zu dritt zusammen, andere saßen auf den Bänken, hielten bauchige Thermosbecher in den Händen.
»Hey!«, rief Emerald. »Das ist Sofia. Meine neue Mitbewohnerin.« Sie zeigte mit dem Finger auf sie, als sei nicht klar, wen sie meinte. Einige schauten zu ihnen hinüber und winkten, andere ignorierten sie.
»Mach dir nichts draus. Die lernst du alle noch früh genug kennen. An der Gruppe kommt niemand vorbei.« Emerald verzog das Gesicht, als sie »Gruppe« sagte. Sofia teilte ihren Widerwillen. Unwillkürlich seufzte sie beim Gedanken daran, wie oft sie ihre Teilgeschichte noch erzählen, wie oft Celia noch sterben musste. Es war so anstrengend, nicht die Wahrheit zu sagen.
»Filmstars haben wir im Moment keine hier. Aber Jan da drüben war mal ein Supermodel, vor zwanzig Jahren oder so.« Emerald zeigte auf zwei dünne, langhaarige Frauen, die dicht nebeneinanderstanden. Wie Pferde, die sich gegenseitig wärmten. Sofia nahm an, dass Jan die größere von beiden war.
»Meine Mutter ist auch … war auch ein Model.«
»Wie, echt jetzt?«
»Ja, aber kein Super-, nur ein normales Model. In den Nullerjahren. Bevor sie mich bekommen hat.« Schon wieder redete sie über ihre Mutter. Sie bereitete den Boden vor. Den Boden für ihre Lügen.
Draußen war es kalt und neblig. Emerald trat in den Flur zurück und zog die Glastür hinter sich zu. Sie schlang die Arme um sich.
»Ich dachte, du hast zwei Väter.«
»Und? Jeder Mensch hat eine Mutter.«
»Haha, okay. Besserwisserin!«
Emerald führte Sofia den Flur entlang und am Haupteingang vorbei.
»Die Tür ist nicht verschlossen, du kannst theoretisch jederzeit raus, aber weit kommst du hier nicht. Außerdem packen sie dir das Wochenprogramm so voll, dass du kaum Zeit zum Nachdenken hast.« Das war vermutlich auch die Absicht, dachte Sofia. Trotzdem öffnete sie versuchshalber die schwere Holztüre und stieß sie ein Stück weit auf. Die kiesbedeckte Einfahrt verlief sich schon wieder im Nebel.
»Eine hat mal Skyes Handy geklaut, Skye ist die Körpertherapeutin, sie ist eigentlich ganz nett, aber total verschusselt, immer vergisst sie was oder kommt zu spät. Stand die Frau also draußen auf dem Parkplatz mit Skyes Handy und versuchte, ein Uber hierher zu bestellen.« Emerald kicherte. »Kannst dir ja vorstellen, wie das ausgegangen ist!«
Das konnte Sofia nicht, aber sie nickte. Sie spürte nicht die geringste Versuchung, wieder abzuhauen. Alles war besser, als die Sorge der Papas auszuhalten, die wie ein Nest voller verstörter Wespen über ihr hing, mit ihrem ständigen Summen, das immer lauter wurde. Und ihre Blicke, die Sofia verfolgten, unruhig über sie hinwegglitten, aber nie länger auf ihr ruhten. Weil sich die Augen der Papas sonst gleich mit Tränen füllten.
»Der Witz ist, dass du jederzeit von hier wegkannst. Hat dir Doktor Rose ja erklärt: Der Aufenthalt ist freiwillig, die Warteliste lang, blablabla. Komm, ich zeig dir den Speisesaal.« Emerald schlurfte weiter den Flur entlang und öffnete dann eine Flügeltür an der kurzen Seite des rechtwinkligen Gebäudes. »Tada!« Speisesaal war ein großes Wort für das gemütliche Esszimmer mit den drei runden Tischen. Die Einrichtung war auch hier altmodisch und etwas schäbig. »Hast du deinen Wochenplan schon bekommen?« Sofia schüttelte den Kopf. »Ken wird ihn dir vorbeibringen. Wir werden nicht zur gleichen Zeit essen, wir bekommen nicht dieselben Mahlzeiten. Offiziell gibt es keine Vorschriften, keine Diätpläne, aber wir Dünnen kriegen eine andere Auswahl am Buffet. Alles mit extra Kalorien, da kannst du Gift drauf nehmen, auch wenn sie behaupten, es sei total gesund. Die Normalen und die Dicken kriegen diese Extrakalorien nicht. Nur die Nährstoffe. Grünkohl à gogo! Freu dich schon mal!«
Sofia hatte ihre ganze Energie und ihren wissenschaftlichen Verstand einsetzen müssen, um in so kurzer Zeit so viel zuzunehmen. Würde sie nun alles wieder verlieren, was sie erreicht hatte? Sie dachte an die gebackenen Austern in Bodega Bay, an die Fritten mit Tartarsauce und wünschte, sie hätte sie nicht ausgeschlagen.
Wenn Sofia ihr Gewicht halten wollte, musste sie so weiteressen, wie sie es sich in den letzten Monaten angewöhnt hatte. Vielleicht konnte sie Emerald dazu überreden, ihr die Überreste von ihrem Spezialbuffet abzuzweigen?
Sofia seufzte.
»Ja, ich weiß, der Speisesaal – der triggert mich auch.« Emerald hatte Sofias Seufzen gehört, wenn auch falsch ausgelegt.
»Du brauchst keine Angst zu haben. Es ist gar nicht so schlimm hier.« Emerald legte ihren knochigen Arm um Sofia, so weit sie um sie herumreichen konnte. Sofia ließ es geschehen. Die Berührung war kaum zu spüren.
»Okay. Danke.«
Nicht so schlimm war gut genug.
In der Nacht würde sich zeigen, wie sicher sie hier wirklich war. Sofia lag auf der Seite, zur Wand gedreht. Weg vom Fenster. Weg von Emerald, die leise röchelnd schnarchte. Sofia hielt die Augen geschlossen und zählte ihre Atemzüge. Vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden den Atem anhalten, acht Sekunden ausatmen. Doktor Lilly hatte ihr diese Methode beigebracht. Angeblich ensprach sie dem natürlichen Atemrhythmus von Schlafenden und führte deshalb zu sofortiger, tiefer Entspannung. Davon merkte Sofia allerdings nichts.
Dabei war sie so müde. Seit fast einem Jahr hatte sie nicht mehr richtig geschlafen. Seit es begonnen hatte. Sie hatte Angst, einzuschlafen. Angst vor dem, was passieren konnte, wenn sie schlief. Sie hatte alles versucht: Türen und Fenster verriegelt, ihr Bett umgestellt, in einem anderen Zimmer geschlafen, im Wohnzimmer, auf der Couch. Sie war sogar für einen Monat zu ihrem Cousin Nestor gezogen, unter dem Vorwand, ihm und seiner Frau Carolina mit dem Baby zu helfen. Die Papas waren ganz gerührt gewesen. Doch es hatte nichts geholfen. Selbst nachdem sie die halbe Nacht mit der untröstlichen, brüllenden Tayanna auf dem Arm durch die kleine Wohnung gewandert war, selbst dann war sie nicht sicher gewesen. Wieder zu Hause hatte sie mit den unterschiedlichsten Methoden experimentiert, um sich im Bett zu verankern. Es hatte alles nichts genützt. Erst das Gewicht hatte geholfen.
Vier, sieben, acht.
Vier, sieben, acht.
»Kannst du nicht schlafen?«
Sofia öffnete die Augen. Das Zimmer lag in vollkommener Dunkelheit. Auch von draußen drang kein Licht hinein. Keine Straßenlampen, dachte Sofia, keine Autoscheinwerfer, keine blinkenden Reklameschilder. Nicht einmal Sterne.
Im nächsten Moment spürte sie etwas an ihrer Seite. Emerald. Sie kroch in Sofias Bett und schmiegte sich an sie. Selbst zum Schlafen trug sie mehrere Kleidungsschichten übereinander, trotzdem war sie kaum zu spüren.
»Was ist das Schlimmste, was du je getan hast?«
»Wie meinst du das?«
»Wie ich’s sage.«
Sofia zögerte. Sie wusste, was das Schlimmste war: Nichts. Dass sie nichts getan hatte. Wieder und wieder nichts. Doch darüber konnte sie nicht sprechen. Wieder war sie ihrer Mutter dankbar, dass sie sie mit einer glaubwürdigen Erklärung zurückgelassen hatte. Sofia holte tief Luft, um die Geschichte von Celias Leiden und Sterben an Emerald auszuprobieren, doch diese wartete ihre Antwort gar nicht ab.
»Erinnerst du dich an den Cancergirl-Skandal?«, fragte sie.
Sofia schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie dann, falls Emerald die Bewegung im Dunkeln nicht sehen konnte.
»Echt? So lang ist das noch gar nicht her. Cancergirl war mein Insta-Account. Ich hatte über zehntausend Follower, das war damals noch echt viel.« Sie klang wie eine alte Frau, dachte Sofia. Als erzählte sie von längst vergangenen Zeiten.
»Ich bin nicht auf Insta oder sonst wo«, murmelte Sofia. Sie spürte, wie der schmale Körper neben ihr hochschoss. Wie ein Fisch aus dem Wasser.
»Wie, du bist nicht … du meinst, gar nicht?« Emerald schnappte nach Luft. Sofia antwortete nicht. Die Plattform, auf der sie damals als Zwölfjährige gemobbt worden war, gab es längst nicht mehr. Ursprünglich war sie vor allem von Zehn- bis Zwölfjährigen genutzt worden, die dort ihre Wohnzimmerauftritte posteten. Hässliche Kommentare hatte es von Anfang an gegeben, die Altersgruppe war offenbar besonders anfällig für gezieltes Mobbing. Oder besonders davon versucht. Wenige Wochen, nachdem Sofia dort von ihren Mitschülerinnen bloßgestellt worden war, hatte sich ein zehnjähriges Mädchen umgebracht. Die Plattform war geschlossen worden, die Meute war weitergezogen. Doch Sofia hatte ihre Lektion gelernt. Aber so genau wollte sie das Emerald nicht erklären.
»Und was war Cancergirl genau?«, fragte sie stattdessen. »Was war der Skandal?« Emerald ließ sich gern ablenken. Ihr Bedürfnis, über sich selbst zu reden, war scheinbar unerschöpflich. »Na ja, Cancergirl war ich, aber nicht wirklich. Ich hab so getan, als hätte ich Krebs. Hab mir die Haare abrasiert, die Augenbrauen, alles. Da hat das auch angefangen mit dem Abnehmen, ich wollte ja glaubwürdig wirken. Obwohl, es gibt ja auch Medikamente, die dick machen. Aber das wusste ich damals nicht. Ich wusste gar nicht viel über Krebs, als ich damit anfing. Mit der Zeit wurde ich aber zur Expertin. Echt, ich könnte auf der Onkologie arbeiten, ohne Probleme.« Sie schwieg einen Moment. Hing der Vorstellung nach. Dann seufzte sie. »Aber das wär ja wieder gelogen …«
Mühsam richtete Sofia sich auf. Sie runzelte die Stirn und starrte ins Dunkle, bis sie die Umrisse der Möbelstücke erkennen konnte, den Lehnstuhl, das Bücherregal und den Kleiderschrank. Sie versuchte, zu verstehen, was Emerald ihr erzählte.
»Du könntest was? Auf der Onkologie, was? Hattest du Krebs?«
»Hörst du mir gar nicht zu? Nein, ich hab nur so getan.«
»So getan, als …«
»Als hätte ich Krebs. Sag ich doch. Nur auf Insta, aber trotzdem.«
Sofia verstand immer noch nicht. »Aber … warum?«
»Warum? Gute Frage. Keine Ahnung. Ich glaub, ich hab mich einfach gelangweilt. Oder ich war einsam. Ich hatte einen Film gesehen, in dem krebskranke Teenager aus dem Krankenhaus abhauten, Abenteuer erlebten und sich ineinander verliebten, und irgendwie kam mir das besser vor. Besser als mein Leben.«
»Dein Leben, wie war denn dein Leben?«
»Langweilig. Einsam. Bedeutungslos.« Emerald seufzte. »Sorry, ich hab wirklich keine bessere Erklärung. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, es gibt mich gar nicht. Niemand sieht mich, niemanden kümmert es, ob ich da bin oder nicht. Ich wollte was Besonderes sein, eine Bedeutung haben, bewundert werden.«
»Hm.«
»Ja, ich weiß schon. Luxusproblem, white privilege und all der Scheiß. Blablabla. Hab ich alles schon hundertmal gehört.«
Sofia wusste nicht, was sie sagen sollte. Im letzten Jahr war so viel passiert. Sie hatte keine Gewissheiten mehr. Wie konnte sie also über jemand anderen urteilen? Außerdem musste sie die nächsten drei Monate mit Emerald zusammenleben.
»Glaub mir, ich bin auch privilegiert aufgewachsen«, sagte sie deshalb.
»Du? Echt? Ich dachte …«
Das Mädchen machte es ihr wirklich nicht leicht. Sofia stieß ihr den Ellbogen in die Seite, ein bisschen gröber als nötig.
»Du dachtest, weil ich nicht weiß bin, muss ich automatisch arm sein?«
»Nein, das ist es nicht.« Unterdessen hatten sich Sofias Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Sie erkannte Emeralds verlegene Grimasse, bevor sie sich abwandte.
»Wegen deinem Gewicht«, flüsterte sie.
Sofia musste lachen. »Ah, klar! Nur die Armen sind fett! Stimmt, das hab ich ganz vergessen. Die landen aber nicht unbedingt hier in der Vögelchenklinik …«
»Auch wahr.« Emerald lehnte sich wieder zurück.
»Ich versteh immer noch nicht, wie man Krebs faked«, sagte Sofia. Ihr wissenschaftliches Interesse war erwacht, fast gegen ihren Willen. »Und dass das niemand gemerkt hat? Du sagst, du hast dir eine Glatze rasiert, ist das nicht aufgefallen?«
»Dumbi, ich trug natürlich eine Perücke! Was denkst du denn.«
»Okay, aber das sieht man doch. Haben deine Eltern das nicht gemerkt?« Die Papas registrierten die kleinste Veränderung an Sofias Verhalten, an ihrem Aussehen, und an ihrem Haar sowieso. Das war schließlich Santiagos Beruf. Sofias dünne, widerspenstige Locken waren eine ständige Herausforderung für ihn. Doch auch Giò, der weltfremde Nerd, der sich tagelang in seinem Filmarchiv vergrub und auch sonst meist in Gedanken versunken war, nahm Veränderungen in Sofias Stimmungen und ihrem Verhalten wahr. Sofia seufzte. Sie vergaß immer wieder, dass nicht alle Eltern so waren wie ihre Papas.
»Meine Eltern«, schnaubte Emerald. »Die doch zuletzt. Die waren damals immer unterwegs, die bekamen das gar nicht mit. In der Schule schnallten sie es auch nicht, monatelang nicht. Ich war halt so ein Ferner-liefen-Mädchen, nicht beliebt, aber ich wurde auch nicht aktiv gemobbt. Niemand beachtete mich. Zu Hause streifte ich die Perücke ab und nahm meine Filme auf. Eine Ecke meines Zimmers war als Studio eingerichtet, mit Stativ und Ringlicht und allen Requisiten. Ich hatte einen Infusionsständer und einen Monitor, im Internet kannst du ja alles kriegen. Mal hab ich eine Chemostation nachgestellt, mal ein Krankenzimmer. Auf einem Handyfilm siehst du ja immer nur einen Ausschnitt. Mit der Zeit traute ich mich immer mehr, ich hab sogar manchmal direkt im Krankenhaus gefilmt. Wenn du da mit Glatze und Pyjama rumläufst, stellt dich niemand infrage.«
»Ganz schön professionell«, murmelte Sofia, gegen ihren Willen beeindruckt.
»Ja, das war mein Projekt, dafür hab ich alles gegeben. Ich nannte mich Indy, abgekürzt für Independent. Das war wie – erst war es, als würde ich eine Rolle spielen. Ich war ja in der Theatergruppe in der Schule. Dann wurde es mehr. Indy wurde ein Teil von mir, der bessere Teil irgendwie. Indy war alles, was ich nicht war, vor allem war sie nicht reich. Sie musste sich von klein auf allein durchschlagen, sie wuchs in einer Pflegefamilie auf, wo sie vernachlässigt und schlecht behandelt wurde. Aber sie war so tapfer! Sie ließ sich nicht unterkriegen. Sie war das Gegenteil der verwöhnten Emerald. Viele Mädchen in meinem Jahrgang folgten Indy auf Insta, aber sie kapierten nicht, dass ich es war, die sie so bewunderten und bemitleideten. Dasselbe Mädchen, das sie in der Schule ignorierten.«
»Und damit bist du durchgekommen?« Sofia war in der Mittelschule auch ein Ferner-liefen-Mädchen gewesen. Allerdings hatte sie das bewusst gewählt. Nur nicht auffallen, nur keine Aufmerksamkeit erregen. Es hatte funktioniert. Niemand hatte gemerkt, dass sie immer mehr Fortgeschrittenenkurse belegte und schließlich ein Jahr früher als geplant abschloss.
»Fast ein Jahr lang lief alles easy. In der Schule war ich immer noch die Außenseiterin, aber das machte mir nichts mehr aus, denn in meiner Instawelt war ich ein Star, ich bekam so viel Aufmerksamkeit und Zuneigung. Manchmal vergaß ich selbst, dass es nicht die Realität war. Echt, manchmal, wenn ich etwas über meine Chemo postete, wurde mir körperlich übel, und ich musste mich erbrechen. Irgendwann kam es mir nicht mehr vor wie eine Lüge. Indy war real, Indy war ich, vielleicht mehr ich als Emerald, verstehst du?«
Sofia verstand nicht, aber sie nickte. Es schien Emerald wichtig zu sein. »Und dann?«
»Ja, dann hatte ich so viele Follower, dass die Medien auf mich aufmerksam wurden, und eine Tusse von einem Lokalsender machte sich die Mühe, zu recherchieren, meine Handyfilme zu analysieren, ziemlich schnell flog alles auf. Und du hast nie was davon gehört? Im Ernst?«
Sofia schüttelte den Kopf.
»Es war der Megaskandal. Endlich war ich weltberühmt – na ja, nicht ganz. Alle kannten mich, außer dir. Aber alle hassten mich. Politiker, Late-Night-Komiker, Krebsorganisationen, meine Follower und alle in der Schule sowieso. Ich verkörperte die Selbstbezogenheit meiner Generation.«
Sofia zog die Brauen hoch, was Emerald nicht sehen konnte. »Na, na«, sagte sie deshalb. »So schlimm kanns nicht gewesen sein. An mir ist das komplett vorbeigegangen.«
»Da bist du wohl die Einzige.« Es schien Emerald zu ärgern, dass Sofia nichts davon wusste. »Meine Eltern schämten sich zu Tode. Sie schickten mich in ein Internat in der Schweiz, wo mich niemand kannte. Dort machte ich den Schulabschluss. Doch als ich zurückkam, war ich … Es gab mich nicht mehr. Emerald ohne Indy, das ging irgendwie nicht. Ich kam nicht mehr zurecht, ich kriegte es mit der Uni nicht auf die Reihe, und auch sonst. Das Dünnsein ist das Einzige, was ich noch habe. Das Einzige, worin ich wirklich gut bin …«
Eine Weile schwiegen sie, und Sofia fragte sich, ob sie so einschlafen könnten. Im selben Bett. Vielleicht würde Emeralds Körper neben ihrem als Schutzschild dienen, so zart und gewichtlos er auch war? Vielleicht war das genug?
»Hast du auch schon mal gelogen?«, fragte Emerald nach einer Weile. »Ich meine, so richtig, im großen Stil?«
»Lügen sind anstrengend«, wich Sofia aus. Sie blinzelte im Dunkeln.
»Anstrengend?« Emerald schnaubte. »Du bist echt komisch. Selbst für eine Patientin in einer Privatklinik bist du seltsam. Aber ich mag dich.«
»Ich mag dich auch«, sagte Sofia, und das war nicht gelogen.
Eine Woche war sie erst hier, und schon saßen ihre schwarzen Leggings lockerer, musste sie die Verschlusshaken ihres Sport-BH