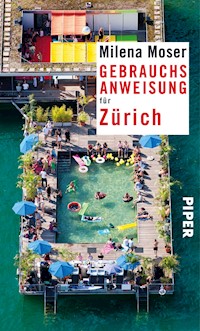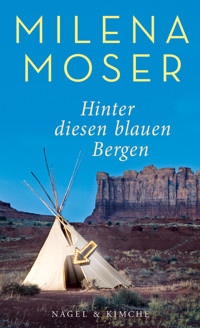15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In der mexikanischen Kultur ist der Tod immer präsent, nie tabuisiert, ganz im Unterschied zur europäischen Kultur. Man freut sich auf den Tag der Toten, wenn die Verstorbenen zu Gast sind, um ein rauschendes Familienfest mit Torten und Tequila, Geschenken und Gelagen zu feiern. Milena Moser hat eine sehr persönliche Geschichte über den Día de los Muertos geschrieben: Ihr Partner Victor-Mario Zaballa ist selbst schwer krank. Doch er sieht seinem Ende ohne Furcht entgegen, denn er weiß: Den Toten geht es blendend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin und den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN UND DEN AUTOR
Milena Moser, 1963 in Zürich geboren, ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Schweiz. 2015 emigrierte sie nach Santa Fe, New Mexico. Zuletzt erschienen die beiden Bestseller über ihr Leben in den USADas Glück sieht immer anders aus (2015) und Hinter diesen blauen Bergen (2017) sowie der Roman Land der Söhne (2018).
Victor-Mario Zaballa, 1954 in Mexico City geboren und in Cuernavaca aufgewachsen, ist Künstler. 1982 gewann er den ersten Preis für traditionelle Altäre in Cuernavaca. Seit über zwanzig Jahren baut er jedes Jahr für den Día de los Muertos öffentliche Altäre, u.a. in der Davies Symphony Hall und der Galerie Somarts in San Francisco, wo er auch lebt.
ÜBER DAS BUCH
In der mexikanischen Kultur ist der Tod immer präsent, nie tabuisiert, ganz im Unterschied zur europäischen Kultur. Man freut sich auf den Tag der Toten, wenn die Verstorbenen zu Gast sind, um ein rauschendes Familienfest mit Torten und Tequila, Geschenken und Gelagen zu feiern. Milena Moser hat eine sehr persönliche Geschichte über den Día de los Muertos geschrieben: Ihr Partner Victor-Mario Zaballa ist selbst schwer krank. Doch er sieht seinem Ende ohne Furcht entgegen, denn er weiß: Den Toten geht es blendend.
Für Maria, ohne die wir gar nicht erst auf die Idee gekommen wären, dieses Buch zu schreiben.Y para Lulu
Vorwort
»Könnt ihr das nicht mal aufschreiben?«
Folgenschwere Worte.
Es war kurz vor Weihnachten. Mein Sohn Lino und seine Freundin Maria besuchten uns in San Francisco. Sie brachten uns eine traditionelle mexikanische Scherenschnitt-Girlande mit, die sie in einer Zürcher Boutique gefunden hatten. Filigrane Skelette, Hand in Hand, tanzten einen bunten Reigen unter der Zimmerdecke.
»Der Tag der Toten ist auch bei uns ein Thema«, sagte Maria. »Wir haben Freunde, die ihre Wohnung im November mit Totenköpfen und Scherenschnitten schmücken. Aber niemand weiß genau, wie man den Tag richtig begeht.« Und dann kam sie, die unschuldige Frage: »Könnt ihr das nicht mal aufschreiben?«
So ist dieses Buch entstanden; so hat es sich zu einer persönlichen Auseinandersetzung nicht nur mit dem Día de los Muertos, dem Tag der Toten, sondern mit dem Tod an sich entwickelt.
Ich wusste nichts über mexikanische Kultur, als ich mich in Victor verliebte, einen mexikanischen Indianer vom Stamm der Nahua, einen Conchero und Imaginero, ausgebildet, um traditionelle Zeremonien durchzuführen, einen Künstler, dessen Arbeit bis in jede Zelle von seiner Kultur geprägt ist. Ich hatte mich nie wirklich für seine Geschichte interessiert.
Obwohl ich meinte, den Brauch des Totentages zu kennen: Als ich vor zwanzig Jahren mit meiner Familie in San Francisco lebte, übernahmen wir mit Begeisterung alle möglichen, uns damals noch fremden Feiertage. Zu Thanksgiving tischten wir einen Truthahn auf, obwohl der eigentlich niemandem so richtig schmeckte. Wir verkleideten uns zu Halloween und forderten ganz unschweizerisch Süßigkeiten von Fremden. Am Día de los Muertos trafen wir uns bei einer befreundeten Familie im damals noch mehrheitlich von Einwanderern aus Südamerika bewohnten Mission District. Pflichtbewusst, aber mit einem etwas mulmigen Gefühl malten wir unseren Kindern bleiche Totenkopfgesichter auf und schlossen uns nach Einbruch der Dunkelheit dem lärmenden Umzug an, der gleich vor ihren Küchenfenstern entlangging. Dieser Brauch war uns Schweizer Einwanderern ebenso fremd wie das drei Tage vorher stattfindende Halloween – vielleicht noch ein bisschen fremder. Skelette und Totenköpfe leuchteten in der Dunkelheit. Unheimliche Trommelmusik. Die Kinder verstanden den Feiertag ebenso wenig wie wir. Warum gab es keine Kostüme? Warum die Totenköpfe? Und viel wichtiger: Warum keine Süßigkeiten? Von Jahr zu Jahr verlagerte sich die Feier immer mehr ins Wohnzimmer unserer Freunde, immer weniger von uns schlossen sich dem Umzug an, bis wir am Ende auch das Schminken sein ließen.
»Der Día de los Muertos ist kein Karneval«, sagt Victor. »Und kein Disneyfilm.«
Tatsächlich hat Disney vor ein paar Jahren versucht, ein Patent auf den Día de los Muertos anzumelden. Nicht nur den Begriff, sondern gleich den ganzen Feiertag zu kaufen. Die Vorstellung, dass der Medienkonzern an allem, was mit diesem Brauch zu tun hat, mitverdienen könnte, lässt einen schwindlig werden. Eine albtraumhafte Vision wie aus einem Disneyfilm: »Der Tag, an dem Weihnachten verkauft wurde!« Eine wahnwitzige Idee, mit der sich der Konzern allerdings nicht durchsetzen konnte. Kurz darauf produzierte Disneys Tochterfirma Pixar den oscargekrönten Trickfilm Coco. Der Konzern hat aber wenigstens oberflächlich aus den heftigen Protesten gelernt und seinen lautesten Kritiker, den Cartoonisten Lalo Alcaraz, als kulturellen Berater engagiert. Oder wurden die Kritiker so gekauft? Die Meinungen gehen auseinander. Doch allein der Versuch beweist, dass der Día de los Muertos seine geografischen und kulturellen Grenzen gesprengt hat und im Mainstream angekommen ist. Wenn sich James Bond in Spectre durch einen gespenstisch anmutenden Umzug von tanzenden Skeletten ballert, ist das jedem klar. Und prompt tauchen traditionelle mexikanische Dekorationen überall auf: Totenköpfe auf Notizbüchern, Handyhüllen – und besonders ironisch: Schminktaschen. Scherenschnitte in Zürcher Boutiquen, tanzende Skelette in nordeuropäischen Fenstern. Was ist es nun, das uns an diesem alten Brauch so fasziniert?
Vielleicht gerade dieser respektlose, vertraute, lockere Umgang mit dem Tod, der ihm so viel von seinem Schrecken nimmt. Der Tod ist das Einzige, was in unserem Leben gewiss ist – okay, der Tod und die Steuerrechnung. Und doch tun wir so, als könnten wir ihn ignorieren. Wir blenden ihn aus, wir erwähnen ihn nicht. Wir umschreiben ihn hilflos, mit gedämpfter Stimme. Wir bilden uns ein, wir könnten ihn austricksen, mit extremen Diäten und obskuren Zusatzstoffen in Schach halten. Je älter wir werden, desto einleuchtender scheint uns die Idee, ihm einfach davonzulaufen. Wir versuchen ihn auf endlosen Marathonstrecken und exotischen Berggipfeln abzuschütteln, ihn mit jugendlicher Kleidung, mit faltenfreier, aufgespritzter Haut zu täuschen. Als ob der Tod nur die Alten holen würde!
Und wenn das alles nicht hilft, wenn er uns unweigerlich einholt, der Tod, wenn er hinter der nächsten Kurve auf uns wartet – dann sind wir hilflos. Ob er nach uns greift oder uns unsere Liebsten entreißt: Wir haben ihm nichts entgegenzusetzen. Keine Tradition, die uns auffängt, kein Ritual, das uns hält. Wir sind allein. Verzweifelt versuchen wir die religiösen Strukturen, die den meisten von uns fremd geworden sind, zu ersetzen. Wir beschäftigen Sterbebegleiter und Trauerbegleiter, die uns durch ein unüberschaubares Angebot von alternativen Ritualen führen. Die Beisetzung auf dem Friedhof wird durch ein Waldgrab ersetzt, wir streuen die Asche unserer Verstorbenen in fließende Gewässer und von Berggipfeln herunter. Und doch sind wir mit unserer Angst vor dem Sterben, mit unserer Trauer um die Verstorbenen oft gnadenlos allein. Weil selbst unsere engsten Freunde keine Werkzeuge zur Hand haben, um mit unserer Trauer umzugehen, ja sie nur auszuhalten. Sie haben es nicht geübt. Wir haben es nicht geübt.
Was hat uns die mexikanische Kultur voraus? Mit ihren Totenköpfen und Skeletten überall, die einen schon auf der Türmatte und vom Fenster begrüßen, die auf schicke Lederjacken gemalt und auf Geldbeutel gestickt am Alltag teilnehmen und zu süßen Brötchen gebacken verzehrt werden?
Es ist eigentlich ganz einfach: Die mexikanische Kultur hat den Tod akzeptiert. Sie bekämpft ihn nicht, sie integriert ihn. Der Tod ist untrennbar mit dem Leben verbunden. Er ist immer dabei. Er wird gefeiert, er wird geneckt, er wird herausgefordert, er wird geehrt. Man kann ihm nicht entkommen, man versucht es auch gar nicht. Stattdessen lernt man, mit ihm zu leben. Vom ersten Tag an.
Das Entscheidende ist die Vorstellung, dass der Tod oder vielmehr das Totsein ein höchst erstrebenswerter Zustand ist. Dass die Toten, wo immer sie sind, die beste Zeit ihres Lebens haben. Und zwar ganz unabhängig davon, wie sie sich im Diesseits benommen haben. Das Paradies ist keine Belohnung für untadeliges Verhalten, sondern eine Tatsache. Ein Fakt des Lebens. Und deshalb trauern wir auch nicht um die Toten, nein, wir trauern um uns, die wir unsere Lieben verloren haben.
Und hier schafft der Día de los Muertos Abhilfe: Wenigstens diesen einen Tag im Jahr können wir mit unseren Muertitos, unseren lieben Toten verbringen. Wir müssen sie allerdings nach allen Regeln der Kunst bezirzen, damit sie ihre paradiesische Existenz vorübergehend verlassen. Andererseits ist dieser Aufwand auch in ihrem Sinne, denn wenn die Toten vergessen werden, zerfällt ihr ganzes tolles Jenseitsleben zu grauer Asche. Beziehungen enden nicht mit dem Tod, sie enden mit dem Vergessen.
Der Día de los Muertos ist der wichtigste Feiertag, der Höhepunkt des Jahres. Nicht nur in Mexiko, sondern auch in Victors Leben. Und unterdessen ist er auch mein liebstes Fest. Wir laden die Toten ein, wir stellen sie unseren Freunden vor, wir teilen eine Mahlzeit mit ihnen. Wir verbringen einen Abend nicht nur mit unseren Muertitos, sondern auch mit denen unserer Freunde und Nachbarn. Wir laden den Tod zu uns nach Hause ein.
Das nimmt ihm seinen Schrecken. Das macht das Leben leichter. Davon handelt dieses Buch. Es ist keine kulturhistorische Abhandlung, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist ein Gespräch zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Menschen. Es erzählt im weitesten Sinn meine eigene Annäherung an diesen fremden und doch so einleuchtenden, beinahe intuitiv vertrauten Brauch. So, wie Victor ihn mir näher gebracht hat. Durch seine Erfahrungen, seine Geschichten, seine Tradition. Es ist ein sehr persönliches Buch geworden.
Und nun – was ist der Día de los Muertos also?
Ein Fest für die Lebenden.
1. DER MARKT
DAS BESTE IST GERADE GUT GENUG
Über die Toten nichts Schlechtes – dieser Grundsatz gilt in der mexikanischen Kultur nicht. Im Gegenteil. Dafür heißt es: Den Toten nichts Altes. Alles, was man den Toten darbietet, muss neu gekauft sein. Bis hin zu den Töpfen, in denen ihr Essen gekocht wird. Das ist natürlich längst nicht für jede Familie durchführbar. Aber alle tun ihr Bestes. Bereits Ende September breiten sich überall in Mexiko spezielle Totenmärkte aus, auf denen man alles kaufen kann, was man für den Día de los Muertos braucht.
»Die Vorfreude auf den Tag der Toten beginnt Ende September mit den Märkten«, sagt Victor. »Da werden ganze Straßenzüge gesperrt, es ist ein Volksfest. Musik wird gespielt, und wie es riecht! Du findest immer einen Vorwand, um dich auf dem Heimweg von der Schule davonzustehlen und die Stände zu bewundern, und es findet sich immer jemand, der dir etwas zusteckt.«
»Die Vorfreude auf den Tag der Toten.« In dieser Formulierung steckt alles, was die mexikanische Totenkultur ausmacht, was sie von allem unterscheidet, was ich kenne.
Ich kenne den Totensonntag, Allerheiligen, nur als Einschränkung: Die geschlossenen Kinos und Bars in meiner Jugend, später die Lesungen, die in katholischen Kantonen nicht durchgeführt werden konnten. Zwangsbesuche an Gräbern, die ich das ganze Jahr nicht gesehen hatte, das Frösteln auf dem Friedhof im grauen Novembernebel, die obligate Chrysantheme im Topf.
Jede Kultur hat ihre Rituale, ihre Bräuche, ihre Zeremonien. Aber ich kenne keine andere, die einen vergleichbar unbeschwerten, fröhlichen Umgang mit dem Tod pflegt. Ich kenne niemanden, der so etwas sagen würde: Die Vorfreude auf den Tag der Toten!
Niemanden, außer einen Mexikaner.
»Für die alten Mexikaner war der Gegensatz Tod und Leben nicht so unbedingt wie für uns«, schreibt Octavio Paz in Das Labyrinth der Einsamkeit.
»Der Tod war ein verlängertes Leben und umgekehrt […] Das Leben hatte keine wichtigere Aufgabe, als in den Tod, seinen Gegensatz und seine Ergänzung, einzumünden. Der Tod seinerseits war kein Ende an sich: Der Mensch nährte mit ihm das gefräßige, unstillbare Leben.«
Das gefräßige, unstillbare Leben: Das gefällt mir. Das gefällt mir auch an Victor. Ich habe es erst auf sein persönliches, privates Bewusstsein der ständigen Anwesenheit des Todes geschoben. Er lebt schließlich seit bald zwanzig Jahren mit ihm. Aber offensichtlich geht dieses Bewusstsein über ihn hinaus, ist in seiner Kultur verankert.
Und was kann man nun auf einem Totenmarkt kaufen? Alles, was die Toten begehren: Blumen, Kerzen, bauchige Töpfe, in denen die Tamales, die gefüllten Maisrouladen, gedämpft werden. Bestickte Stoffe. Reich dekorierte Totenköpfe aus Zuckerteig. Die sind allerdings für die Lebenden gedacht und mit deren Namen versehen.
»Eine meiner deutschen Freundinnen war einmal schwer beleidigt, als ich ihr so einen schenkte«, lacht Victor. »›Willst du mich etwa loswerden?‹ Aber so ist es nicht gemeint – es ist nur eine Erinnerung daran, dass du auch einmal sterben wirst. Dass der Tod zum Leben gehört.«
Diese Zuckerschädel sind besonders bei Kindern beliebt. Zu sehen, wie kleine Kinder genüsslich an einem Totenkopf herumkauen, der ihren Namen trägt, kann schon etwas befremdlich wirken. Wenn man nicht mit dieser Tradition aufgewachsen ist. Aber es erklärt auch den ungezwungenen, vertrauten Umgang mit dem Tod. Wer sich die Ankündigung des eigenen Todes im Mund zergehen lässt, wird ihn nicht fürchten.
»Wenn du als Kind keinen solchen Zuckertotenkopf mit deinem Namen bekommst, ist das, als ob dich der Weihnachtsmann vergessen hat. Einmal«, erinnert sich Victor, »hat meine Mutter Atole gekocht, das traditionelle Warmgetränk aus Maismehl. Doch sie konnte den Piloncillo, den braunen Zuckerhut, nicht finden, der eingerührt wird, und so warf sie einfach meine Calavera, meinen Totenkopf, in den Kessel! Ich konnte zusehen, wie er sich auflöste. Was habe ich geweint!«
Die schönsten dieser reich verzierten Totenköpfe werden aber nicht gegessen, sondern in Seidenpapier gewickelt aufbewahrt und Jahr für Jahr wieder auf dem Altar angerichtet. So mischen sich die Lebenden unter die Toten, die Toten erinnern sich daran, dass sie gelebt haben, und die Lebenden rufen sich ins Bewusstsein, dass sie sterben werden.
Dieselbe Funktion erfüllen die kleinen Schaukästen, in denen Skelette allen möglichen Tätigkeiten nachgehen. Auch die sind als Geschenke für die Lebenden gedacht. Bis ins letzte Detail liebevoll nachgebaute Szenen stellen das Leben des Beschenkten dar: Nur sind es eben Skelette, die in Schulzimmern eine Klasse von Winzlingsskeletten unterrichten. Die verletzte Knochenmänner in Ambulanzen laden, Krane und Bagger bedienen, filigrane Fischskelette aus den blau bemalten Papiermaschee-Wellen ziehen oder auf dem Markt in detailgetreu bedrucktes Zeitungspapier wickeln. Man sieht Gebeine unter reparaturbedürftigen Autos hervorschauen, Skelette als Hochzeitspaar tanzend und an Infusionen und Maschinen angeschlossen im Krankenhausbett liegen.
Wem schenkt man denn so etwas?
»Oh, jemandem, der schwer krank ist.«
Ist das nicht ein bisschen taktlos? Jemanden, der bereits im Krankenhaus liegt, daran zu erinnern, dass er bald sterben könnte?
Das ist der Unterschied zwischen der mexikanischen und der europäischen Kultur. Der Tod ist immer da, ist Teil des Lebens, des Alltags, wird nicht verschämt versteckt. Man spricht über den Tod nicht im Flüsterton – und man wechselt nicht die Straßenseite, wenn man einem Hinterbliebenen begegnet. Im Gegenteil. Am Día de los Muertos besucht man die Familien, die in diesem Jahr einen Angehörigen verloren haben, und bringt ihnen Geschenke mit – den Toten, nicht den Angehörigen. Auch diese Ofrendas kann man auf dem Totenmarkt kaufen: Früchte, Totenbrötchen, Kerzen, reich bestickte Stoffe, Blumenornamente, Spielzeuge. Alles, was an die Toten erinnert, alles, was für sie im Leben von Bedeutung war. Eine Pfeife, ein Plüschaffe, eine neue Bluse, saftige, rosafarbene Kaktusfrüchte. Man geht davon aus, dass sich Geschmack und Bedürfnis im Tod nicht grundsätzlich verändern. So wurden die Toten früher gern mit ihren Wertsachen begraben, oder es wurde ihnen noch im Sarg, auf dem Weg zum Friedhof, Wasser eingeflößt. Nur ein paar Tropfen, aber trotzdem. Sicher ist sicher. Man bringt also den Toten dieselben Geschenke, die ihnen im Leben Freude gemacht hätten. In Michoacán werden diese Ofrendas auf hölzerne Pferdchen gebunden und so transportiert und verschenkt. Die Trauerfamilie wiederum bewirtet die Gäste mit traditionellen Gerichten, Posole, einer Maissuppe, Tamales und Atole. Die Gäste legen ihre Gaben auf den Altar, und dann wird geredet. Die ganze Nacht lang. Es wird über die Toten geredet, als seien sie noch da.
Das ist vielleicht der tröstlichste Aspekt des Día de los Muertos: Der Tod schaut in jedem Haus einmal vorbei. Dieses Bewusstsein wird so selbstverständlich geteilt wie die Trauer. Niemand bleibt damit allein.
DAS VORDRINGEN DES NICHTS
Die Sterblichkeit verdanken wir einem Unfall. Die Spannungen zwischen den Geschlechtern, die angenehmen wie die anstrengenden, auch. Alles nur, weil Quetzalcoatl hingefallen ist!
Jedenfalls gemäß dem toltekischen Schöpfungsmythos, wie Victor ihn mir erzählt hat. Die Hochzeit der Tolteken war längst vorbei, als die Azteken aus dem Norden kamen und sich ihre Kultur, ihre Religion und ihre Götter einverleibten. Das waren deren viele und sie hatten poetische Namen: Coatlicue, »die mit dem Schlangenrock«, die Mutter der Erde, der Sonne, des Mondes und der Sterne. Huitzilopochtli, der »südliche Kolibri«, Gott des Mondes und des Krieges. Mixcoatl, die »Wolkenschlange«, Gott der Jagd und des Polarsterns, Ometeotl, »Zwei-Gott«, Gott und Göttin der Dualität. Tlaloc, »der die Dinge sprießen lässt«, der Gott des Regens. Es gab Fruchtbarkeits- und Medizingötter, jedes Gestirn und jede Ackerfrucht hatte ihre eigene Gottheit, aber auch die Trunksucht, die Wolllust, Erdbeben und Dürre waren in diesem Pantheon vertreten.
Nur: Diese Götter waren einsam. Sie sehnten sich nach Menschen, die ihnen dienen, die sie verehren würden. Also schickten sie Quetzalcoatl, den gefiederten Schlangengott, in die Unterwelt. In der aztekischen Vorstellung war die Erde eine Scheibe, die im Meer schwamm. Sie hatte die Form eines Krokodils oder eines Frosches, je nach Interpretation oder Übersetzung. Den vier Himmelsrichtungen waren spezifische Götter, Pflanzen, Tiere und Farben zugeordnet. Über der Erde stiegen die dreizehn Stufen des Himmels auf, unter ihr ging es neun Ebenen tief in die Unterwelt.
»Was wollt ihr denn mit Menschen?«, fragten die Herrscher der Unterwelt. »Habt ihr es nicht schon oft genug versucht?«
In der Tat waren vier frühere Versuche gescheitert oder vielmehr von den enttäuschten Göttern abgebrochen worden. Diese vier Menschenalter werden die vier »Sonnen« genannt, weil bei jedem Versuch ein anderer Gott die Rolle der Sonne einnahm. Der erste, der es versuchte, war Quetzalcoatls Bruder, der unheilvolle Tezcatlipoca. Quetzalcoatl schubste ihn kurzerhand vom Himmel, was Tezcatlipoca so wütend machte, dass er sich in einen Jaguar verwandelte und alle Menschen auffraß. Und natürlich beendete er postwendend den zweiten Versuch Quetzalcoatls mit einem gewaltigen Windsturm und verwandelte die wenigen überlebenden Menschen in Affen. Die dritte Sonne wurde von Tlaloc, dem Gott des Regens, geführt. Doch auch seine Menschen überlebten nicht, sie waren zu faul, um sich selbst am Leben zu erhalten. Stattdessen verlangten sie von den Göttern ständigen Nachschub an Nahrung und Schutz. »Ihr habt uns gemacht, nun sorgt auch für uns!« Die Götter schüttelten frustriert die Köpfe und fegten sie mit einem Feuersturm dahin. Die Überlebenden dieser Generation wurden in Vögel verwandelt. Die nächste Sonne wurde von der Göttin des Wassers übernommen, aber ihre Menschengeneration war zu sehr mit den eigenen Kämpfen und Streitigkeiten beschäftigt, um die Götter zu ehren, die sie deshalb folgerichtig in einer Sintflut ertränkte oder in Fische verwandelte. Diese Toten landeten in der Ebene der Unterwelt, die Tlaloc regiert und wo seither alle Ertrunkenen hinkommen.
Die Azteken glaubten, dass das Schicksal eines Menschen, und somit auch der Zeitpunkt und die Art seines Todes, von Geburt an vorbestimmt sind. Wie jemand gestorben ist und nicht wie er gelebt hat, entschied über sein Dasein im Jenseits. Anders als im Christentum konnte man sich den Zugang zum Paradies nicht durch gutes Verhalten im Leben verdienen. Nur für Künstler wurde eine Ausnahme gemacht. Diese wurden mit einem Kanu direkt ins Paradies gepaddelt, statt den mühseligen, von Mutproben und Prüfungen gezeichneten Weg zu Fuß zurückzulegen. Dasselbe Privileg genossen auch Mütter, die im Kindbett gestorben, und Krieger, die in der Schlacht gefallen waren. Und die Menschenopfer. Aber zu denen später.
Kleine Kinder haben ihr eigenes Paradies, in dem die Milch von den Bäumen tropft. Die Ertrunkenen, wie gesagt, teilen sich das nasse Paradies von Regengott Tlaloc mit den Opfern von Lepra und Blitzschlag. Alle anderen kommen in die neunte Ebene der Unterwelt, die Mictlan heißt. Die Reise dorthin dauert vier Jahre und stellt die wandernde Seele vor neun Prüfungen. Wenn diese bestanden sind, empfängt sie ein gelber Hund am Ufer eines Flusses und trägt sie hinüber ins Reich der Toten.
Dort, in Mictlan, lagerten damals, als Quetzalcoatl seine Reise antrat, auch die Knochen der letzten vier gescheiterten Versuche von Menschengenerationen. Die Herrscher der Unterwelt wollten sie jedoch nicht herausrücken. Erst stellten sie Quetzalcoatl auf die Probe: Viermal sollte er das Totenreich umrunden und dabei ein Muschelhorn blasen. Aber das Muschelhorn hatte gar kein Loch. Quetzalcoatl rief Würmer zu Hilfe, die Löcher in die harte Schale bohrten. Wespen und Hornissen, die im Inneren der Muschel so laut summten, dass man es bis ins Reich der Toten hören konnte. Doch die Herrscher der Unterwelt ließen sich immer noch nicht erweichen. Schließlich trickste Quetzalcoatl sie aus: »Lasst sie mich wenigstens sehen, diese alten Knochen!«, bettelte er.