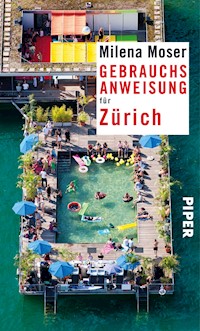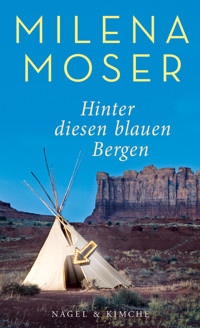17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sofia, 12 Jahre alt, reist mit ihrem Vater Giò im Zug nach New Mexico. Großvater Luigi ist gestorben, und Giò will sich der Vergangenheit stellen. In den 40ern kam Luigi als kleiner Junge aus dem Tessin in die USA und wird von der Mutter, die in Hollywood ihr Glück versucht, in ein Freiluftinternat abgeschoben. Viele Jahre später geht er selbst nach Hollywood, um Produzent zu werden. Seinen Sohn Giò lässt er bei dessen Mutter zurück, die als Hippie-Aussteigerin die freie Liebe probt. Und auch sie lässt Giò in der Kommune zurück, um sich woanders selbst zu verwirklichen. Der neue Moser-Roman ist ein kluges und fesselndes Familiendrama um tief verwurzelte Schuld, Abhängigkeit und Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
Milena Moser
LAND DER SÖHNE
Roman
Nagel & Kimche
Für Ka-Pie, die es mir erklärt hat.
Danke.
SOFIA
Bunte Drachen stiegen auf, kreuzten einander, ihre Schnüre verknäulten sich, dann erstarrten sie mitten im Flug. Zunehmend frustriert wischte Sofia über den Bildschirm. Dann schaute sie hoch und ihrem Vater in die Augen. Seit der Zug den Bahnhof von Los Angeles verlassen hatte, schien er sie ständig zu beobachten.
«Schau mich nicht so an.» Wieder und wieder tippte sie mit dem Finger auf den Bildschirm, doch die Drachen blieben starr. «Die Internetverbindung ist beschissen hier.»
«Rede nicht so, junges Fräulein.» Papa Giò war der strengere Vater, der altmodischere. Aber er war nicht wie sonst. Er wirkte, obwohl er sie anschaute, abwesend. Sofia sah aus dem Fenster, um seinem Blick auszuweichen. Draußen zog eine Landschaft vorbei mit Palmen, dahinter das Meer. In den Frühlingsferien waren sie nach Hawaii geflogen. Sie hatten in einem Hotel direkt am Strand gewohnt, und Sofia hatte surfen gelernt. Aber das hier waren keine Ferien. Das war … sie wusste nicht, was es war. Diese Zugfahrt. Nur sie und Papa Giò.
«Ist doch wahr», murmelte sie. Papa Santi fehlte ihr. Es war das erste Mal, dass sie nicht zu dritt verreisten. Santi organisierte sonst immer alles, kümmerte sich, sorgte dafür, dass es Sofia an nichts fehlte. Sie wollte ihm eine Nachricht schicken, aber auch das funktionierte nicht.
Papa Santi hatte außerdem gesagt, er brauche Zeit für sich.
Zeit für sich. Sofia wusste, was das hieß: Ihre Eltern würden sich scheiden lassen. Die meisten in ihrer Klasse hatten das schon hinter sich, manche zweimal.
Und alle meinten, es sei gar nicht so schlimm. Zwei Wohnungen, zweimal Weihnachten, zweimal Geburtstag, zweimal alles. Außerdem Stiefväter, Stiefmütter, neue Geschwister. Mehr Geschenke von allen Seiten. «Mehr Liebe», sagten die Lehrerinnen salbungsvoll, wenn sie in der Schule den «erweiterten Familienkreis» machten. «Mehr Familienmitglieder bedeutet: mehr Liebe.»
Vielleicht. Aber Sofia wollte keine Scheidung. Ihr fiel nur kein anderer Grund ein, eine Reise anzutreten, kaum hatte das Schuljahr begonnen. Im Zug! Sofia legte das iPad weg. «Ich kann gar nichts machen», quengelte sie. «Nichts funktioniert! Keine Filme, keine Nachrichten, keine Spiele.»
«Hast du keine Bücher heruntergeladen?»
«Nur die für die Schule. Alle doof!»
Wenn Abupaula hier wäre, würde sie Sofia am Ohr ziehen und sie «verwöhnte Prinzessin» nennen. Doch Abupaula war nicht da. Niemand war da.
Sie hatten ein Zugabteil für sich allein. Zwei lange Sofas, die man in Betten verwandeln konnte. Ein kleiner Tisch, ein winziges Bad mit Dusche. Zum Duschen musste man sich auf den Klodeckel setzen und an einem Duschschlauch ziehen, der von der Decke hing. Und dann war alles nass. Sofia zweifelte, ob Papa Giò in das Bad passen würde. Er war zwar dünn, aber beinahe zwei Meter groß. Santi war kleiner und weniger dünn. Immer war er auf Diät, Giò wollte zunehmen, und beide wollten, dass Sofia «ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper entwickelte». Früher waren sie immer stundenlang in der Küche gestanden und hatten darüber diskutiert, ob Kokosöl dick mache. Damals schien das noch ihr größtes Problem. Sofia blinzelte die Erinnerung weg.
«Ich habe Hunger», maulte sie weiter. «Wie lange geht das denn noch? Der Flug hätte zwei Stunden gedauert.»
Eine Nacht und einen halben Tag würden sie in diesem Zug sitzen, auf dem Weg nach New Mexico. Wo Papa Giò «mit seiner Vergangenheit abschließen» wollte. Er hatte dort ein Stück Land geerbt. Aber war das ein Grund, Sofia aus dem Unterricht zu nehmen und auf die Reise mitzuschleppen?
«Sofia, benimm dich bitte nicht wie ein kleines Kind!»
Das klang schon besser. Sofia setzte noch einen drauf: «Ist doch wahr. Scheißzug!» Das war ein Test. Doch Papa Giò ließ es ihr einfach durchgehen. Zuhause musste Sofia für jedes verbotene Wort eine Münze in ein Einmachglas werfen. Es war schon wieder fast voll. Bald würden sie es in den Supermarkt zum Geldzählautomaten bringen. Oben war ein Trichter für die Münzen, das klimperte wie in einem Spielsalon. Unten kam ein Zettel heraus mit einem Betrag, den man an der Kasse ausbezahlt bekam. Das waren dann gut hundert, hundertzwanzig Dollar. Damit unternahmen sie etwas Besonderes, Wale beobachten oder einen Rundflug über die Stadt in einem Helikopter. Sie nannten es die «verdammte Touristenkasse», weil sie sich dank Sofias Fluchen wie Touristen in ihrer eigenen Stadt fühlen konnten. Manchmal nahm Papa Giò das Glas vom Küchenbuffet und wog es in der Hand: «Unglaublich, was ein einziges kleines Mädchen zusammenfluchen kann.» Manchmal sagte er auch: «Wenn du so weiterfluchst, kann ich bald aufhören zu arbeiten!»
Dann musste sie lachen: «Bei dir zählt ja schon ‹Hölle› als Schimpfwort!»
«‹Hölle›? Das macht fünfundzwanzig Cents, mein Fräulein.»
«Papaaa!»
«Welche Bücher musst du denn lesen?», fragte er jetzt.
Aber so schnell gab Sofia nicht auf. «Das Tagebuch der Anne Frank, Die Bücherdiebin. So Scheiß halt über den scheiß Zweiten Weltkrieg!» Nicht besonders originell. Aber sie hatte nun mal keine Übung.
«Sofia!» Na endlich. «Ich verbiete dir, so zu reden! Du entschuldigst dich auf der Stelle!»
«’tschuldigung», murmelte sie. Gott sei Dank, dachte sie. «Du hast doch diese Bücher nicht gelesen?» Es war eine rhetorische Frage. Natürlich hatte er sie gelesen – Papa Giò hatte alles gelesen. Nachts, wenn er nicht schlafen konnte, lud er sich Vorlesungen aus dem Internet über die Parallelen zwischen dem Reich Karls des Großen und der heutigen amerikanischen Politik oder über die Entwicklung religiös bedingter Kriegführung im Mittelalter. Das Verrückte war: Er erinnerte sich an alles, was er je gelesen oder gehört hatte. Man konnte ihn irgendetwas fragen: über Insekten oder Musikinstrumente oder wie der Präsident von Litauen hieß. Papa Giò wusste die Antwort. Santi sagte immer, er solle in einer dieser Quizsendungen mitmachen und Millionen gewinnen. Papa Santi war besessen von dieser Idee. Das kam daher, dass er einmal sehr nahe dran gewesen war, kurz vor Sofias Geburt. Santi war damals Haarkünstler in Los Angeles. Also Frisör, aber in Hollywood. Eine seiner ersten Kundinnen war eine arbeitslose Schauspielerin namens Jenny Macmillan. Wenn sie vorsprechen musste und gerade kein Geld hatte, föhnte er ihre Haare gratis in Form. «Wenn du mal reich und berühmt bist, gibst du es mir zurück», sagte er. Das sagte er nicht nur zu ihr. Aber Jenny war die Einzige, die kurz darauf tatsächlich reich und berühmt wurde. Und sie hielt ihr Wort. Sie ließ sich von niemand anderem die Haare schneiden, und plötzlich wollten alle Stars und alle Ehefrauen der Stars von Santi frisiert werden. Als er Jennys Haare für einen Film kurz und strähnig schnitt, wurde er selber berühmt. Wenn man «Jenny Macmillan» im Internet suchte, erschien «der Macmillan» als Haarschnitt ganz oben. Und dazu Santis Name. Damals wurde ihm eine eigene Realityshow angeboten in seinem Salon, mit seinen reichen und berühmten Kundinnen, mit all ihren Dramen, ihren Geheimnissen und ihren Intrigen. Doch dann wurde Celia schwanger, und Santi fand, ein Kind brauche eine richtige Familie. Und deshalb zogen die Papas, kaum war Sofia auf der Welt, nach San Francisco.
Jenny Macmillan hatte dickes, glattes, schwarzes Haar, wie Santi. «Dankbares Haar», nannte Santi das. «Indianerhaar», sagte Abupaula. Sofia hatte ihr widerspenstiges Kraushaar von Papa Giò. Oder von jemand Unbekanntem.
Ihre Mutter Celia war eine der vielen arbeitslosen Schauspielerinnen, die bei Santi immer wieder mal einen Gratis-Haarschnitt erbettelten. Ihr gegenüber war er besonders großzügig, vielleicht weil sie seiner Schwester Carla ähnlich sah. Die beiden Frauen hatten auch ähnliche Probleme: große Träume, die falschen Männer, Drogen und Schulden. Eines Tages erzählte sie Santi, dass sie sich bei einer Fruchtbarkeitsklinik als Leihmutter angemeldet habe. «Ich werde ja schon schwanger, wenn mich ein Mann schräg anschaut. Vielleicht ist das mein wahres Talent … Außerdem zahlen die gut. Besser als ein doofer Werbespot.» In diesem Moment, sagte Santi, in diesem Moment habe er es einfach gewusst. Vorher nie einen Gedanken an Kinder – plötzlich sah er sich als Familienvater. Er bat Celia, noch nichts zu unterschreiben, und stellte Giò noch am selben Abend vor die Wahl: «Entweder wir gründen eine Familie, oder wir trennen uns.»
An dieser Stelle der Geschichte schüttelte Giò immer den Kopf, und Santi bekam Tränen in den Augen. «Sofi, es war, als hätte es dich in diesem Moment schon gegeben!» Dann kam die Bratensaftspritze, in der die Samen ihrer Papas vermischt wurden. An dieser Stelle hörte Sofia immer weg. Trotzdem erntete Celia weiterhin schräge Blicke von Männern, und als Sofia zur Welt kam, war ihre Hautfarbe mehrere Schattierungen dunkler als erwartet. Außerdem hatte sie recht ausgeprägte Mandelaugen.
Deshalb, und weil sie zwei Väter hatte, dachten in der Schule alle, Sofia sei eine Stipendiatin. Denn obwohl die Sequoia Elementary and Middle School großen Wert auf kulturelle Durchmischung legte, konnten sich die wenigsten Nichtweißen das Schulgeld leisten. Kandidaten aus «anderen Kulturkreisen» wurden geradezu aggressiv umworben, vor allem, seit bekannt geworden war, dass die dunkelhäutigen Kinder auf den Bildern der Schulwerbung bezahlte Fotomodelle waren. Sofia allerdings war eine ganz normale, vollzahlende Schülerin. Santi spendete für den Wohltätigkeitsbasar immer die teuersten Preise: Es sollten alle sehen, dass sie reich waren. So reich wie die Techies, die Internetbarone, die diese Stadt regierten.
Ob Papa Santi Los Angeles fehlte, sein eigener Salon, ob es ihm fehlte, berühmt zu sein? Vor Sofias Geburt hatte er den Salon mit seinem Namen verkauft. Der stand jetzt auf Shampooflaschen und Haarspraydosen, an deren Verkauf er mitverdiente. Hin und wieder wurde er noch gebeten, die Frisuren der Stars an irgendwelchen Veranstaltungen zu kommentieren. Seine Familie war die bestfrisierte der Welt. Vielleicht war das nicht genug, dachte Sofia. Vielleicht waren sie, Sofia und Giò, nicht genug.
«Das Tagebuch der Anne Frank ist Pflichtlektüre», dozierte Papa Giò jetzt. «Das gehört zur Allgemeinbildung. Das Buch steht zuhause in der Bibliothek, du solltest es nicht auf dem Tablet lesen. Das ist eine Frage des Respekts. Die Bücherdiebin ist weniger bedeutsam, aber auch nicht uninteressant. Die Mutter des Autors Markus Zusak war Deutsche, wusstest du das? Sie hat ihm ihre Erlebnisse während der Nazizeit erzählt, und das hat ihn zu diesem Roman inspiriert. Der übrigens in der australischen Erstausgabe nicht als Jugendbuch vermarktet wurde.»
«Woher weißt du das alles?» Vor Erleichterung musste Sofia lachen. Das war ihr Papa Giò. Er runzelte die Stirn, als verstünde er die Frage nicht. Giò führte das umfassendste Filmarchiv der gesamten Vereinigten Staaten. Als er Santi kennenlernte, lebte er in einer riesigen Lagerhalle in Venice Beach, umgeben von sechzigtausend Filmdosen. Wenn für einen Film historische Bilder gebraucht wurden, wandte man sich an ihn. Die Archivaufnahmen aus Silicon Valley in Job zum Beispiel. Oder die Familienfeiern im Vorspann der Fernsehserie Transparent. Diese Bilder fand man sonst nirgends mehr. Nur weil Giò seit seiner Jugend von ihnen besessen war, gab es sie noch.
«Er hat aus seiner Macke eine Karriere gemacht», sagte Santi immer. Mittlerweile war das Archiv digitalisiert. Zwölf ausgebildete Archivare und vier unbezahlte Praktikanten verwalteten die Bilder. Das Lagerhaus in Venice Beach war in ein Filmmuseum umgestaltet worden. Giò mischte sich nur noch selten ins Tagesgeschehen ein. Auch er hatte alles aufgegeben, um nach San Francisco zu ziehen und eine Familie zu gründen. Das fiel Sofia jetzt zum ersten Mal auf: Beide Väter hatten ihre Karrieren, ihre Freunde, ihr ganzes Leben aufgegeben. Ihretwegen.
«Je mehr man um das Privileg, ein Kind zu haben, kämpfen muss, desto mehr ist man bereit, dafür aufzugeben.» Betonten sie das so oft, weil sie sich selber überzeugen wollten? Bereuten sie ihre Entscheidung? Diese Gedanken waren neu und ließen sie schwindeln.
Sofia öffnete ihre Notizen. Sie legte eine Liste an. Zwei Kolonnen, Santi und Giò. Kinder wurden bei Scheidungen gefragt, bei wem sie wohnen wollten. Manchmal entschied der Richter. Das wäre Sofia lieber, aber damit durfte sie nicht rechnen. Sie musste auf alles vorbereitet sein. Also notierte sie gewissenhaft: was Giò besser konnte, was Santi besser machte. Santis Liste war länger, einfach weil er mehr Zeit mit ihr verbrachte. Dafür standen bei Giò wichtigere Dinge wie «erklären» und «erziehen». Papa Giò hatte ihr beigebracht, Listen zu schreiben. Listen machten das Leben einfacher, sagte er. Niemand wurde gern erzogen, aber es musste nun mal sein. Sofia war froh, dass sie wusste, wie man sich benahm, wie man mit Messer und Gabel aß und dass man nicht mit vollem Mund redete, sich bedankte und zuhörte. Ihre Freundin Eloise hatte niemanden, der es ihr beibrachte. Sie durfte «Hölle» sagen, sooft sie wollte. Eloise sagte noch Schlimmeres, ohne je einen Cent in ein Einmachglas werfen zu müssen.
Santi und Giò brauchten einander, beschloss Sofia. Und sie brauchte beide. Sie löschte die Liste wieder, als könnte sie so die Möglichkeit einer Scheidung auslöschen.
Eloise sagte immer, ihre Eltern hätten das Kinderbuch falsch verstanden, nach dem sie benannt war. Es ging um ein kleines Mädchen, das in einem Luxushotel wohnte. In Wirklichkeit waren es nur ihre Eltern, die den größten Teil des Jahres auf Reisen verbrachten, auf Inseln und Jachten, in Luxushotels und Spa-Resorts. Eloise war meist allein in ihrem sehr großen Haus in Sea Cliff, hoch über dem Baker Beach. Allein mit ihren Nannies und Mannies und der Köchin und dem Chauffeur und wechselnden Nachhilfelehrern. Als sie noch kleiner waren, kam Eloise oft zu Sofia nach Hause, zum Playdate und zum Sleepover. Sie war so oft bei ihren Sonntagsessen dabei, dass sie auf der Mitgliederliste von Abupaulas Kirche als Enkelin stand, direkt unter Sofia. Als wären sie Schwestern.
Jetzt feierte Eloise in ihrem elternfreien Haus Partys, zu denen Sofia nicht eingeladen wurde, weil sie noch ein Kind war. Das hatte sie letzte Woche im Schulklo mitgehört. Dort erfuhr man früher oder später alles, was man wissen musste. Man hörte die Türen schlagen, das Wasser rauschen, man hörte, wie sich jemand den Finger in den Hals steckte oder ein Handy piepte. Die waren in der Schule verboten, deshalb hatten die meisten Schüler zwei Geräte, eins, das sie morgens im Sekretariat abgaben, ein zweites in den Falten der Schuluniform versteckt.
«Warum hast du denn Sofi nicht eingeladen?», fragte Daisy-Rose letzten Freitag. «Ich hätte mich beinahe verraten vorhin!»
«Was soll ich denn tun? Du weißt, ich liebe Sofi, aber sie ist noch ein solches Kind!»
«Du hast recht. Wahrscheinlich würde sie sich auch gar nicht wohl fühlen …»
«O Gott, ihr Gesicht, als du gestern den Flachmann aus dem Rucksack geholt hast!»
Alle lachten. Doch dann ging es weiter über Jungs. Wer eingeladen war, wer kommen würde, wen sie süß fanden und wen sie küssen wollten. Ob sie an den Strand gehen und Gras rauchen oder zuhause bleiben und die Bar der Eltern leer trinken würden. Wer zuerst kotzen würde, wer am meisten vertragen konnte. Sofia wollte die Tür aufreißen und schreien: «Wir sind zwölf, verdammt noch mal! Was wollt ihr denn mit vierzehn erleben, eine Entziehungskur?» Aber sie blieb still sitzen, die Beine angezogen, die Arme um die Knie geschlungen.
Vielleicht hatte sie geweint, das wusste sie jetzt nicht mehr. Sie wusste nur noch, dass sie es gar nicht so schlimm fand, als sie am Montag nicht zur Schule fuhren, sondern zum Flughafen. Sie flogen nach Los Angeles, saßen ein paar Stunden lang in einer Anwaltskanzlei herum, Sofia in einem Wartezimmer, das eingerichtet war wie eine Cocktaillounge. Sie trank italienische Limonaden aus kleinen, bauchigen Flaschen und blätterte in Hochglanzmagazinen. Als Giò endlich wieder aus dem Büro kam, war ihr schon halb schlecht. Er zeigte ihr eine schmale Mappe und einen altmodischen Schlüsselbund, bevor er beides in seinen kleinen Koffer steckte.
Und dann fuhren sie zum Bahnhof und stiegen in diesen Zug.
«Alles in Ordnung bei euch?»
Die Tür zum Abteil wurde aufgeschoben, und Samuel schaute herein. Er hatte sich beim Einsteigen als ihr «persönlicher Zugbegleiter» vorgestellt. Er war so dick, dass er sich seitlich in ihr Abteil quetschen musste, eine Vierteldrehung nach rechts, eine nach links. Das Hemd hing ihm über die Hose, seine blaue Uniformweste klaffte über dem Bauch.
«Das Abendessen wird heute in zwei Schichten serviert», sagte er. «Ich habe in beiden noch Platz, sieben Uhr fünfzehn und acht Uhr. Ihr fahrt ja nur bis Lamy, nicht? Dann habt ihr morgen noch Frühstück und Mittagessen mit uns.»
«Sieben Uhr fünfzehn», sagte Sofia rasch. So bald wie möglich, einfach um etwas zu tun zu haben.
«Ist notiert.» Samuel riss ein Ticket von einer Rolle und reichte es ihr. «Kann ich sonst noch etwas für dich tun, junger Mann?»
Einen Moment lang war es still. Dann sagte sie: «Ich bin ein Mädchen.»
«Oh, ich bitte vielmals um Entschuldigung! Was bin ich nur für ein Hinterwäldler, da könnt ihr mal sehen! Meine Frau sagt immer: ‹Samuel, du lebst hinter dem Mond›, sagt sie immer.» Er lachte freundlich.
Papa Giòs Gesicht war starr. Sofia konnte die Worte förmlich sehen, die in ihm aufstiegen und wieder versanken, bevor er sie aussprechen konnte. Plötzlich tat er ihr leid, gleichzeitig war sie wütend auf ihn. Wie sollte Papa Giò ohne Santi zurechtkommen? Wie sollte sie ohne Santi mit Papa Giò zurechtkommen? Sie sprang für ihn ein. «Keine Ursache», sagte sie. «Ich pflege diesen androgynen Stil ganz bewusst, da will ich mich auch nicht beschweren, wenn ich für einen Jungen gehalten werde.»
«Was du nicht sagst.» Samuel zwinkerte Papa Giò zu. «Redet die Kleine immer so? Das reinste Wörterbuch.» Dann wand er sich wieder aus ihrem Abteil. Die Tür ließ er offen stehen. Sofia schob ihr Handy in die Brusttasche ihrer Tweedweste und stand auf. «Sollen wir uns mal den Panoramawagen ansehen?« Sie wartete Papa Giòs Antwort nicht ab, sondern trat in den Flur hinaus. Sie war es gewohnt, dass ihren Launen und Wünschen entsprochen wurde. Der Zug schwankte, sie torkelte und fiel beinahe in die offenen Abteiltüren hinein. Die Passagiere unterhielten sich über den Flur miteinander, reichten Chipstüten und Kleenexpackungen hin und her.
«Hoppla, Junge», sagte jemand. Und dann spürte Sofia eine Hand an ihrem Oberarm. Es war ihr Papa. Einen Moment lang fühlte sie sich sicher. Es ist alles wieder wie früher, dachte sie. Oder es kann sich immerhin noch so anfühlen.
Am Ende des Wagens befand sich eine schmale Konsole. Neben einem Plastikkorb mit Chips, Nüsschen und Gummibärchen und einem Eiswasserspender stand eine altmodische Kaffeemaschine mit zwei Krügen. Normaler Kaffee und koffeinfreier. Sofia schaute Papa Giò fragend an.
«Warum nicht? Was Santiago nicht weiß …» Er nannte Santi immer Santiago, manchmal sogar Santiago Jesus Gutierrez. Er füllte einen Pappbecher mit der dünnen braunen Flüssigkeit und rührte Trockenmilch hinein. Sofia grinste. Santi hätte es nie zugelassen, dass Giò so etwas trank. Stattdessen hätte er Samuel bestochen, ihnen am nächsten Bahnhof Latte macchiato mit Mandelmilchschaum zu besorgen. Oder Santi wäre gar nicht erst in diesen Zug gestiegen. Jetzt vermissten sie ihn beide so sehr, dass ihnen das Lächeln im Gesicht einfror. Sofia drehte sich als Erste um. Schweigend stapften sie weiter durch den Gang.
In der Glasscheibe des Durchgangs erkannte Sofia ihr Spiegelbild. Ich sehe wirklich aus wie ein Junge, dachte sie. Wie ein Zeitungsjunge, ein paperboy. So nannte man diesen Stil, den sie sich über den Sommer angeeignet hatte. Knickerbocker und Weste, Schiebermütze und Schnürstiefel. Amita hatte sie darauf angesprochen, und Sofia hatte sie nicht korrigiert. Dabei wollte sie nicht wie Shilo Jolie-Pitt aussehen, sondern wie Amelia Earhart, die erste weibliche Pilotin der Welt. Sie wollte kein Junge sein, sie wollte fliegen. Seit Wochen versuchte sie im Internet eine Lederkappe mit eingebauter Sonnenbrille zu ersteigern, wie sie die Pilotin getragen hatte. Im Sommer hatte Sofia einen Roboterkurs besucht. Art that Flies. Der Kursleiter, ein lustiger Künstler mit langen Haaren, hatte sie wie angehende Ingenieure behandelt, nicht wie Kinder. Sie war das einzige Mädchen. Aber am Ende war ihr Projekt das ehrgeizigste gewesen: ein fliegendes Puppenhaus. Es hielt sich fast zwanzig Sekunden lang in der Luft, als sie am Strand ihre Werke steigen ließen. Längst nicht alle Flugobjekte flogen tatsächlich. Bevor das propellergetriebene Puppenhaus abstürzte, hatte der Kursleiter es gefilmt. Damit wurde jetzt der Sommerkurs beworben. Seither war Sofia besessen von Robotern und Fliegern. Sie hatte in ihrem Zimmer eine kleine Werkstatt eingerichtet und Zeichenprogramme auf ihr iPad geladen, die für Ingenieure geschrieben waren. Sie arbeitete mit Lego Mindstorms und experimentierte mit Sprudelwasser in Plastikflaschen.
Am ersten Schultag nach den großen Ferien fragte ihre neue Klassenlehrerin Miss Russo beinahe flüsternd, wie sie angesprochen werden wolle, als Junge oder als Mädchen. Sofia verstand nicht: «Wieso denn als Junge, ich bin Sofia …»
Dieser Sommer war außergewöhnlich heiß gewesen. Sie hatte Santi gebeten, ihr die Haare kurz zu schneiden. Ihre dünnen, krausen Locken waren eine Herausforderung für jeden Frisör, aber Santiago war ja nicht jeder. Er sagte, sie habe eine tolle Knochenstruktur, für die manche Schauspielerin viel Geld bezahlen würde, und schor ihr die Seiten raspelkurz. Oben blieb eine kleine braune Wolke. Sofia fand, sie sehe aus wie eine Außerirdische. Verwegen. Doch manche ihrer Freundinnen machten sich lustig über sie. Sie sehe aus wie eine Minilesbe, eine baby dyke. Und da die Sequoia EMS eine integrative Schule war, wurden ihre Papas schon in der ersten Woche des neuen Schuljahrs zum Gespräch gebeten, um Sofias sexuelle Identität zu besprechen.
Erst da verstand Sofia: Die Lehrerin dachte, sie wolle ein Junge sein. Nur weil sie kurze Haare hatte und begeistert war von Robotern und Helikoptern. Dabei hatte sie ein Puppenhaus gebaut in diesem Sommer. «Ich bin ein Mädchen, das Roboter und Helikopter mag!», sagte sie ganz laut. «Ist das erlaubt? Oder dürfen sich hier nur Jungs für solche Dinge interessieren? Muss ich eine Geschlechtsumwandlung vornehmen, um meine Hobbys zu pflegen?» Der Ausbruch war so überraschend, dass Stille eintrat. Sofia war doch sonst so zurückhaltend. Dann riefen Miss Russo und ihre Papas durcheinander: «Natürlich nicht! Wir wollen dich nur in der Suche nach deiner sexuellen Identität unterstützen!»
Sofia wurde übel. Ihr Mund füllte sich mit Speichel. Selbst wenn sie eine sexuelle Identität hätte, würde sie eher sterben, als diese mit ihrer Klassenlehrerin und ihren Vätern zu diskutieren. Sie wollte im Boden versinken. Nein, in die Luft aufsteigen. Davonfliegen.
Sie stellte sich einen fliegenden Fernsehsessel vor, mit weichen Polstern und einer verstellbaren Rückenlehne, mit Bildschirm und Getränkehalter. Ein Flugzeugsessel ohne Flugzeug. Der Sommerkurs hatte ihren Ehrgeiz geweckt. Sie informierte sich über laufende Projekte und folgte anderen Flugfanatikern auf Instagram. Sie war nicht die Einzige, die fliegen wollte. Aber nichts überzeugte sie so richtig. Jetpacks fand sie unelegant, und sie glaubte auch nicht an die Zukunft mechanischer Flügel. Dafür träumte sie manchmal, sie könne fliegen. Ihre Arme bewegten sich wie Flügel. Sie spürte, welche Muskeln sich in ihrem Rücken, zwischen den Schulterblättern und unter den Armen anspannten. Wenn sie aufwachte, wusste sie genau, wie es funktionieren würde. Aber Sofia wollte nicht selber fliegen, sie wollte geflogen werden. Sie wollte Dinge zum Fliegen bringen, die nicht fürs Fliegen gedacht waren. Wie viele Propeller waren nötig, um ein kleines Sofa mit einer kleinen Sofia darauf in die Luft zu heben? Darüber dachte sie so angestrengt nach, dass sie dem peinlichen Gespräch gar nicht mehr folgen konnte.
Jetzt fragte sie sich, ob sie es nicht doch etwas übertrieb. Ein Kind konnte keine Pilotin sein. Was sollte also diese Verkleidung? Wollte sie insgeheim doch für einen Jungen gehalten werden? Wollte sie nicht so sein wie die anderen Mädchen?
«Sofia ist kein Alphamädchen», hieß es immer. Sie fügte sich in die Gruppe ein, sie vermittelte, wenn es Streit gab, sie drängte sich nicht in den Vordergrund. So war sie seit der ersten Klasse mit den beliebtesten Mädchen, den Bienenköniginnen, mitgeflogen. Doch in diesem langen Sommer, den Sofia hochfahrend «den letzten Sommer ihrer Kindheit» nannte, hatten sich auch ihre Freundinnen verändert. Allerdings in eine komplett andere Richtung. Lipgloss, Wonderbras, Instagram, Glamour Shots. Und nur noch ein Thema: Jungs.
«Wen würdest du …?», hieß das neue Pausenspiel ihrer Freundinnen. «Küssen», meinten sie. «Ficken», sagten sie. «Blasen», sagten sie. Dann lachten sie hysterisch. Sofia konnte sich trotz aller Erklärungen nichts Genaues darunter vorstellen. Oder sie konnte sich nicht vorstellen, dass man so etwas wollte. Ihr leuchtete nicht einmal der Zungenkuss ein. Schon immer hatte sie weggeschaut, wenn im Fernsehen geküsst wurde. Sie ekelte sich schon, wenn jemand an ihrem Eis leckte oder aus ihrem Glas trank. Sie wollte über diese Dinge nicht nachdenken. Sie wollte nichts fühlen müssen, was sie nicht fühlte.
«Niemanden», war also ihre Antwort. Sie würde niemanden. Nicht einmal Zachary, für den alle Mädchen in der Schule schwärmten. Letztes Jahr hatte sie mit ihm einen kompletten zusammenhängenden Comicstrip gezeichnet, immer er eine Zeile, sie eine Zeile, in einem großen, unlinierten Schulheft. Doch dieses Jahr beachtete er sie nicht. Keiner beachtete sie. Schon im vergangenen Schuljahr hatte ihre Beliebtheit gelitten. Ihre intensive Comicphase hatte die anderen Mädchen nicht beeindruckt. Dafür hatte sie sich mit ein paar Jungs in ihrem Jahrgang angefreundet. Aber dieses Jahr hatten sich die Regeln wieder geändert. Gemeinsame Interessen galten nichts mehr. Oder jedenfalls nicht so viel wie die gepolsterten Büstenhalter der anderen Mädchen. Sofia hatte immer noch den Körper eines Kindes, und sie war froh darüber. Die neuen Brüste ihrer Freundinnen waren überall im Weg. Nicht nur im Sport. Wirklich unpraktisch war, dass sie alles verschoben: den Blick der Jungs und auch den mancher Lehrer. Die Hierarchien in der Klasse, die Gespräche, das Verhalten der Jungen. Brüste machten alles komplizierter. Sofia hoffte, sie würde noch lange keine bekommen. Oder wenn, dann nur ganz kleine.
Die wenigen Freundinnen, die Sofia noch hatte, hörten gelangweilt zu, wenn sie ihnen ihr Puppenhaus mit Propellerantrieb erklärte. Oder, noch schlimmer, sie legten den Kopf schräg und setzten diesen gespielt besorgten Blick auf, der normalerweise für die Rollstuhlfahrer reserviert war, von denen es in jeder Klasse genau zwei gab. Am Anfang jeden Schuljahrs mussten sie sich den immer gleichen Lehrfilm anschauen, der ihnen zeigte, wie sie mit ihren «anders begabten» Mitschülern respektvoll umgehen sollten. Jetzt schien es, als bräuchten Sofias Freundinnen einen Lehrfilm, um mit ihr zurechtzukommen. Und das alles nur wegen der Hormone.
Die Herausforderungen, die die Schwerkraft stellte, waren wenigstens eindeutig. Sex hingegen war konfus und kompliziert. Wenn es nach Sofia ginge, könnte man es auch gleich sein lassen.
Mit einem entschlossenen Ruck riss sie die Tür zum nächsten Wagen auf. Hinter sich hörte sie Giò leise fluchen, er hatte den heißen Kaffee verschüttet. Der nächste Wagen war schon der Panoramawagen, hellblaue Schalensessel, rundum aus Plastik, ließen sich in alle Richtungen drehen. Die meisten waren den großen Fenstern zugewandt. Sie sahen aus wie schäbige, überdimensionierte Ostereier. Sofia schlängelte sich um alle Sitze herum, bis sie zwei freie nebeneinander fand. Aufgeregt hüpfte sie auf und ab. «Papa, hier!», rief sie.
Doch noch ein Kind, dachte sie.
Dachte ein Kind darüber nach, ob es ein Kind war?
Hauptsache, Giò lächelte wieder. Vorsichtig stellte er seinen Kaffeebecher auf den kleinen Tisch zwischen ihnen und faltete seinen langen, dünnen Körper in das Osterei. Sie saßen auf der falschen Seite. Sie schauten auf die Hügel, nicht aufs Meer. Die Hügel, von der untergehenden Sonne rot gefärbt, waren üppig bewachsen, es blühten immer noch die Wildblumen. Wie große gelbe, weiße und lila Picknickdecken breiteten sie sich auf dem Gras aus. «Das ist der El-Niño-Effekt», erklärte Papa Giò. «Die vierjährige Dürrezeit ist offiziell beendet, der Notstand im Staat Kalifornien aufgehoben. Aber unser Gouverneur hat schon recht, wenn er sagt, wir sollten weiter sparsam sein. Man weiß nie, wann die nächste Dürre kommt.»
Die Sparmaßnahmen hatten sie in der Schule durchgenommen, Arbeiten geschrieben und Vorträge gehalten: dass man den Wasserhahn während des Zähneputzens zudrehen sollte, die Dusche während des Waschens auch. Abupaula lachte sie aus, als Sofia eines Sonntags ganz stolz ihren Vortrag nacherzählte: «Wusstet ihr, dass man das Duschwasser in einem Kübel auffangen kann, während es sich aufwärmt? Und dann gießt man die Pflanzen damit!»
«Was du nicht sagst. Lernt ihr an eurer Schickimicki-Schule jetzt etwa, arm zu sein? Habt ihr das Schulfach ‹Gesunder Menschenverstand› eingeführt?»
«Ich dachte, das Wasser steigt und wir ertrinken alle?», fragte Sofia jetzt. Nur damit er weiterredete. Papa Giò war endlich wieder in seinem Element. Er erklärte ihr die Klimaerwärmung und die meteorologischen Phänomene, die den Dauerregen El Niño hervorriefen. Ganz im Gegensatz zu La Niña, das war ein vollkommen anderes Phänomen, fast schon entgegengesetzt …
Sofia verstand nur die Hälfte, aber das machte nichts. So war ihr Papa. Er wusste einfach alles. Einen Augenblick fühlte sich Sofia wieder wie früher. Sicher. Geborgen. Ihr Papa konnte ihr die ganze Welt erklären und den Himmel auch. Doch dann verstummte er plötzlich. «Ich kannte mal ein Mädchen, das sich nur La Niña nannte. Das heißt Mädchen auf Spanisch … Damals lebte ich in New Mexico, da war ich ungefähr so alt wie du jetzt.» Er schaute aus dem Fenster, angestrengt, mit gerunzelter Stirn. Als könne er in den lieblichen südkalifornischen Hügeln schon New Mexico erkennen. Als verstecke sich das Mädchen dort draußen irgendwo.
«Und was hat das mit der Klimaerwärmung zu tun?», erinnerte ihn Sofia, schon wieder besorgt. Giò setzte seinen Vortrag fort, doch er schweifte ab, verzettelte sich vom Hundertsten ins Tausendste, und dann war er schon bei Donald Trump und dem Pariser Abkommen. Jetzt ließe sich die Zerstörung nicht mehr aufhalten, sie würden alle …
Sofia hatte wieder dieses Gefühl im Bauch. Über Politik dachte sie genauso ungern nach wie über Sex. Sie stellte sich die steigenden Wassermassen vor, Sturzfluten, die ihr Haus wegschwemmten. Das Wasser war überall, drang in ihre Nase, ihren Mund. Nutzlos trudelten die Propeller ihrer unfertigen Flugmodelle auf den Wellen. Sie konnte nicht fliegen. Sie konnte sich nicht retten, und ihre Familie auch nicht. Sie sah sich nach den Händen ihrer Papas greifen, doch die Wogen rissen sie auseinander, rissen sie weg.
Es hatte alles schon viel früher begonnen, dachte Sofia. Nicht mit dem Tod von Big Lou, nicht mit dem peinlichen Elterngespräch. Sondern mit der Wahl von Donald Trump. Santi hatte geweint, als das Resultat feststand. Das hatte Sofia mehr erschreckt als alles andere. Santi auf dem Sofa, ein Kissen vors Gesicht gepresst, das seine lauten Schluchzer nicht wirklich dämpfte. Giò daneben, die Fernbedienung noch in der Hand, seinen langen Körper ungeschickt vorgebeugt, hilflos Santis Schulter tätschelnd.
«Ist ja gut, ist ja gut.»
«Nichts ist gut! Wir verlieren alles, wofür wir gekämpft haben. Sie werden uns ausweisen, sie werden uns Sofi wegnehmen, sie …»
«Pscht.» Giò sah Sofia im Türrahmen stehen. «Geh schlafen», sagte er. «Wir reden morgen darüber.»
Doch Santi richtete sich auf und streckte theatralisch die Arme nach ihr aus. Sofia kletterte zu ihm aufs Sofa. Seufzend setzte sich Giò dazu. Und so verbrachten sie den Rest der Nacht. Aneinandergeklammert wie Schiffbrüchige. Unruhige Träume. Das Flimmern des Bildschirms, ohne Ton. Damals hatte es begonnen. Lange vor diesem Sommer. Lange vor dem Tod ihres Großvaters.
Ihre Familie, diese einst unverbrüchliche Einheit, hatte Risse bekommen. Es gab keine Sicherheit mehr. Die Papas hatten Angst. Die Papas wussten nicht weiter. Das war vielleicht nicht das Ende ihrer Kindheit, aber das Ende ihrer Gewissheiten.
Offiziell war es wegen Opa Lou. Opa Lou war gestorben, so hatte es angefangen.
«Hast du das gesehen?» Santi hielt Giò sein Tablet unter die Nase und zeigte ihm einen Newsfeed: «Das Ende einer Ära! Big Lou Bernasconi ist tot!»
Sofia schaute über Santis Schulter auf die Nachricht und fragte: «Wer ist Big Lou Bernasconi?»
Es war Giò, der antwortete: «Dein Großvater.»
«Mein Großvater?» Sie hatten ihn doch erst vorgestern gesehen, wie jeden Sonntag. Sie schaute zu Santi.
«Dein anderer Großvater.» Giòs Stimme klang ungeduldig, als hätte Sofia etwas Dummes gesagt. Woher sollte sie denn wissen, dass sie noch einen Großvater hatte? Dann fiel es ihr ein: der Familienstammbaum in der vierten Klasse. «Damit haben sie uns damals schon fertiggemacht», hatte Giò gesagt. «Ich weiß nicht, warum sie immer noch auf dieser sinnlosen Aufgabe bestehen. Es ist doch allgemein bekannt, dass die Kleinfamilie keine Norm ist!»
«Es ist uramerikanisch», widersprach Santi. «Wurzeln schlagen, wo keine sind. Das ist doch schön!»
Die Schule hatte eine lange Erklärung geschrieben, dass es angesichts der sich ändernden Familienstrukturen ein umso wertvolleres Zeugnis der gesellschaftlichen Entwicklung sei, wenn alle Kinder, ob eingewandert, adoptiert oder im Reagenzglas gezeugt, ihren Familienstammbaum herstellten. «Um die wundervolle Vielfalt unserer Schulgemeinschaft zu feiern.» Als Beispiel wurde der Familienbaum von Zachary angeführt. Er hatte wie Sofia zwei Väter, aber im Unterschied zu ihren waren seine beide früher Frauen gewesen, und einer von ihnen war genau genommen seine leibliche Mutter.
«Und genau deshalb leben wir in San Francisco», sagte Santi.
«Eigentlich leben wir hier, weil deine Familie hier lebt.»
«Ach, hör auf!»
Zacharys Baum war mit wilden bunten Blumen, Blättern, Blüten und Ranken verziert. Er wurde in der Zeitung abgedruckt, in der Zacharys anderer Vater eine Familienkolumne schrieb. Sofias Baum hingegen war schief. Sie wusste mehr über die Familie ihrer Mutter Celia, die sie nur einmal getroffen hatte, als über die von Papa Giò. Sie kannte nur Santis Familie, sie sahen sie jede Woche. Selbst Santis Großmutter hatte sie noch gekannt. Sie war immer so auf dem Sofa gesessen, dass niemand sonst mehr darauf Platz hatte. Und sprach nur Spanisch.
Bernasconi war ein italienischer Name, so viel brachte sie aus Giò heraus. Nur weil die Schule es verlangt hatte, gab er ihr die Namen: Luigi Bernasconi, Esther Tara Kornbluth Bernasconi. Ihr Großvater, ihre Großmutter. Mehr wisse er nicht, behauptete er. Seine Seite des Baums blieb kahl. Keine Großeltern, keine Onkel und Tanten, keine Cousins und Cousinen, Großonkel und Großtanten, nichts.
«Ist Kornbluth nicht ein jüdischer Name?», fragte Sofia damals. «Ich dachte, der jüdische Glaube wird von der Mutter weitergegeben – heißt das, du bist jüdisch?» In ihrer Schule nahmen sie alle Weltreligionen durch. Die Sequoia Elementary and Middle School hielt zwar auf kulturelle Durchmischung, in Sofias Klasse waren trotzdem keine Juden, keine Muslime, nur ein paar Hindus und ein paar Buddhisten. Die meisten Familien stuften sich «eher spirituell als religiös» ein, was Papa Santi schwach fand. Er selber bezeichnete sich als Pro-forma-Katholik. «Der Familie zuliebe» gingen sie sonntags zur Messe. Falls sie nicht trödelten und direkt zum Mittagessen bei Santis Mutter eintrafen.
«Meine Mutter hat viele Religionen durchprobiert», sagte Papa Giò damals. «Befolgt hat sie keine. Verbindlichkeit war nicht ihre Stärke.»
«Ist sie gestorben?», fragte Sofia weiter. «Und warum heißt du nicht Bernasconi?»
Papa Giòs Nachname war Ortiz. Deshalb und wegen seiner dunklen Haare, seiner großen braunen Augen hielt Santi ihn erst für einen Chicano. «Als mir klarwurde, dass ich mich in einen Gringo verliebt hatte, war es schon zu spät», sagte er immer. Manchmal nannte er Giò liebevoll Giòrtiz, in einem Wort.
«Ortiz ist der Name meines Adoptivvaters. Er ist Indianer.»
«Native american», korrigierte Sofia automatisch. Auch auf politische Korrektheit wurde in ihrer Schule Wert gelegt.
«Wie dem auch sei. Den müssen wir jedenfalls nicht in den Baum einzeichnen!» Ende der Diskussion. Damals wollte Sofia es gar nicht so genau wissen, sie wollte ihren Baum zeichnen, sie war mitten in ihrer Cartoonphase. Sie zeichnete ihr Tagebuch als Comicstrip und die Blätter ihres Familienstammbaums als Sprechblasen. Aber jetzt wünschte sie, sie hätte nicht lockergelassen.
«Big Lou ist der Luigi Bernasconi von meinem Familienbaum?»
Giò nickte. «Du hast ihn einmal getroffen», sagte er. «Aber da warst du noch zu klein, um dich zu erinnern.»
«Zweimal», korrigierte Santi. «Einmal, du weißt schon, gleich nachdem …»
«Stimmt, zweimal.»
Sofia sah vom einen zum anderen. Mit ihren Sätzen flogen Botschaften hin und her, die sie nicht mitbekommen sollte. Sie pusteten sie über ihren Kopf hinweg wie Seifenblasen. Dann platzten sie in der Luft.
«Babe», sagte Santi und legte einen Arm um Giò. Giò machte sich los. Das hatte er noch nie getan. Oder Sofia hatte es noch nie gesehen. Santi blieb einen Moment so stehen, mit den Händen in der Luft, bevor er sich abwandte.
Papa Giò kam von sich aus nie auf die Idee, jemanden zu berühren. Wenn man versuchte, ihn zu umarmen, machte er sich steif wie ein Brett, dann atmete er so laut aus, dass es wie ein Seufzen klang, und seine Schultern gaben nach. Manchmal tätschelte er einem dann mit beiden Händen den Rücken oder den Kopf. Immer ein bisschen ungeschickt, als ob er das zum ersten Mal machte.
Giò ging in der Küche auf und ab. Santi versuchte, ihn am Arm zu fassen, damit er sich hinsetzte. Sofia versuchte zu hören, was sie sagten. Es war immer dasselbe. Giò solle endlich mit seiner Vergangenheit abschließen, doch der stellte sich stur.
Sofia dachte kurz daran, ihre Familientherapeutin Doktor Lilly anzurufen. Seit Sofia denken konnte, gingen sie einmal in der Woche zu ihr. Sofia holte sich ein Glas Wasser in der Küche. Die blauen mexikanischen Gläser standen ganz oben. Sie schleifte einen Hocker herbei, kletterte umständlich hinauf und öffnete den Schrank. Keiner kam. Sie ächzte ein paarmal, klapperte mit dem Stuhl. Spätestens jetzt müssten beide Papas neben ihr stehen und «Um Himmels willen, pass bloß auf!» rufen. Nichts. Sie stellte sich vor, wie sie auf dem Boden läge, überall Blut und den Kopf verdreht. Endlich würden die Papas alles fallen lassen und zu ihr stürzen: «Geliebtes Mädchen, querida! Wie konnte das passieren?» Das würde ihnen eine Lehre sein.
«Ich fühle mich von euch nicht wahrgenommen», sagte sie laut. Das war einer von Doktor Lillys Lieblingssätzen. Aber auch das interessierte heute niemanden.
Das hatte Sofia noch nie erlebt. Santi sagte immer: «Wir haben zu lange auf dich gewartet, um dich jetzt aus den Augen zu lassen.» Das war ihr früher gar nicht aufgefallen: Da war einfach immer jemand, der sie sah. Wenn sie lachte, wenn sie weinte, wenn sie zeichnete, wenn sie fragte. Da war immer jemand, der sich freute. Sie war der Mittelpunkt. Ihre ganze kleine Welt drehte sich um sie. Sofia bildete sich nichts darauf ein, es war einfach so. Sie kannte nichts anderes.
«Du wirst noch fürs Atmen gelobt», sagte ihre abuela Abupaula immer. Sie sagte auch, Sofia sei das verwöhnteste kleine Mädchen auf diesem Kontinent. Aber an diesem Tag, als sie vom Tod ihres anderen Großvaters erfuhren, schien sie sich vor den Augen ihrer Papas aufzulösen. Sie befand sich zwar noch im selben Raum, aber sie sahen sie nicht mehr. Einen Moment lang hing sie verwirrt im luftleeren Raum, dann fiel sie. Wie sehr sie diesen Halt brauchte, merkte sie erst, als er von einem Moment auf den anderen nicht mehr da war.
So musste sich ihr Puppenhaus gefühlt haben, als der Sauerstoff aus der Mineralwasserflasche verbraucht war und es in der Bucht unterging.
Am Ende hatte Giò selber bei Doktor Lilly angerufen und um einen dringenden Termin gebeten. Doch dann saß er nur mit verschränkten Armen da, während Santiago auf Doktor Lilly einredete. «Sie sind doch bestimmt auch der Meinung, dass wir zu dieser Beerdigung fahren müssen, nicht? Er war immerhin sein Vater! Man hat doch nur einen Vater …»
Doktor Lilly hustete diskret. Aber Santiago war nicht aufzuhalten. «Ich meine … Sie wissen schon, was ich meine! Giò weigert sich wieder mal, sich seinen Gefühlen zu stellen. Ich bin immer noch der Meinung, dass er auf dem Spektrum ist, das sehen Sie doch auch so?»
Manchmal dachte Sofia, Santi habe recht und Giò eine Diagnose. So sagten sie in der Schule immer, wenn die Lehrerin etwas von ihnen verlangte, das sie nicht leisten wollten. Oder konnten. «Miss, ich hab aber doch eine Diagnose!» Manche hatten ADD oder Allergien, oder sie bewegten sich «auf dem Spektrum». Benji hatte das Tourettesyndrom. Sie hatten einen Lehrfilm darüber gesehen. Seither warteten alle gespannt darauf, dass er mitten in der Stunde schlimme Wörter ausspuckte. Aber er zuckte immer nur wild mit der linken Schulter. Das nannte man einen Tick. Und das fanden einige der Mädchen plötzlich sexy. Vor den Ferien hatten sie ihn noch ausgelacht deswegen.
Ganz abwegig war die Vermutung nicht, dass auch Papa Giò auf dem Spektrum war. Andere Menschen machten ihn nervös, selbst wenn er sie schon lange kannte. An den Sonntagen bei Abupaula verzog er sich immer in ein leeres Zimmer oder in die hinterste Ecke des Gartens. Einmal war er so lange im Bad, dass alle dachten, eins der Kinder habe sich dort eingeschlossen. Sie wollten schon die Tür einschlagen oder den Schlüsseldienst anrufen, als Papa Giò mit der dicken Sonntagszeitung unter dem Arm herauskam. Als er die Versammlung vor der Tür sah, erschrak er so sichtbar, dass niemand, nicht einmal Sofias frecher Cousin Nestor, einen Witz machte. Giò hielt sich die Zeitung wie einen Schild vor die Brust. Dann rannte er förmlich aus dem Haus und wartete im Auto.
«Darüber haben wir bereits gesprochen, Santiago», sagte Doktor Lilly streng. «Ich kann Ihre Diagnose nicht bestätigen, und ich finde diese Kategorien nicht hilfreich. Giò, warum sagen Sie mir nicht, wie Sie sich bei all dem fühlen?»
«Wie ich mich dabei fühle? Wie soll ich mich denn Ihrer Meinung nach fühlen? Vielleicht fragen Sie Santiago, der weiß am besten, wie ich mich fühle.»
Einen Moment lang war es still. Sofia schaute gar nicht auf. Sie spielte mit dem Puppenhaus, wie immer bei Doktor Lilly. Sie liebte dieses Puppenhaus, es war größer und realistischer als ihr eigenes, das sie in der Bay versenkt hatte. Dieses hatte drei Stockwerke, fünf Schlafzimmer, vier Badezimmer und drei verschiedene Wohnzimmer, und war mit Miniaturmöbeln eingerichtet. Die winzigen Bücher konnte man aus dem Regal nehmen und umräumen. Es gab Ständerlampen, die richtig leuchteten, und ordentlich über die Sofalehnen gefaltete Wolldecken. Sofia wünschte sich, sie könnte diese dreistöckige viktorianische Villa in die Luft aufsteigen lassen. Samt ihren politisch korrekten Bewohnern in allen denkbaren Hautfarben. Natürlich wusste sie, dass dieses Puppenhaus ein «klassisches diagnostisches Mittel» war. Das hatte Giò ihr schon vor ihrem ersten Termin erklärt. Er erklärte ihr immer alles genau und wenn möglich im Voraus. Er ging davon aus, dass Sofia genau wie er gern wusste, was auf sie zukam. Sofia wusste also, dass Doktor Lilly notierte, wie sie die Puppen arrangierte. Sie hütete sich, die erwachsene Frau irgendwo einzusetzen, damit niemand auf die Idee kommen könnte, sie wünsche sich eine Mutter, eine konventionelle Familie. Sie legte auch die diversen Kinderpuppen gleich beiseite, sie wollte keine Geschwister haben, wirklich nicht. Sofia achtete darauf, immer nur zwei Männerpuppen und ein kleines Mädchen einzusetzen. Diese arrangierte sie immer gleich zu Anfang in einer harmonischen Szene in einem der Wohnzimmer oder in der Küche, bevor sie sich an ihre technischen Überlegungen machte. Vier Heißluftballons, dachte sie. Das könnte funktionieren.
«Ist doch egal, wie du dich fühlst!», rief Santi. «Er war dein Vater, und jetzt ist er tot, und du musst zur Beerdigung. Das finden Sie doch auch, Doktor Lilly, nicht? Und außerdem hat ein Anwalt angerufen, wegen der Testamentseröffnung.»
«Natürlich willst du zur Beerdigung: weil sie auf allen Fernsehsendern übertragen werden wird.»
«Das ist nicht fair.»
Sofia schob die kleinen Betten im großen Schlafzimmer zusammen und versteckte die Mädchenpuppe darunter. Das Puppenhaus war so ganz anders als das Haus, in dem sie aufwuchs, ganz oben am Fuß des kahlen Hügels von Bernal Heights, der aussah wie der haarlose Schädel eines Griesgrams. Ihr Haus war grün und modern und voller Licht. Es hatte Sonnenkollektoren auf dem Dach und pflanzenüberwucherte Mauern. Aber kaum Wände und Türen. In ihrem Haus konnte man sich nirgendwo verstecken. Sofia steckte eine winzig kleine Katze zu dem Mädchen unter das Bett. Früher hatte sie sich nie Tiere gewünscht. Früher hatte sie sich nie alleine gefühlt.
«Was würden Sie zu Ihrem Vater sagen, wenn er hier wäre?», fragte Doktor Lilly jetzt. Giò blickte kurz zum Puppenhaus, zu Sofia hinüber, bevor er antwortete. «Nichts, das Sofia hören sollte.»
Sofia tat, als liege sie wie die kleine Puppe unter dem Bett, mit ihrer Katze im Arm. Als sei sie unsichtbar. Sie wollte hören, was Giò seinem Vater zu sagen hatte. Seit der Nachricht von seinem Tod sammelte sie Informationskrumen wie eine Ameise, hortete sie in einem Winkel ihres Verstandes, dort, wo sie auch Flugmaschinen konstruierte. Wo sie Dinge zusammensetzte, die nicht auf den ersten Blick zusammenpassten.
Aber es war wieder Santiago, der als Erster sprach. «Wir werden nun mal von unseren Familien geprägt, von unserer Kindheit, von der Art, wie wir aufgewachsen sind. Stimmt es nicht, Doktor Lilly? Wir sind die Väter, die wir sind, weil wir die Söhne unserer Väter sind.»
«Bitte, lassen Sie Giò antworten», mahnte Doktor Lilly.
Giò sagte: «Bullshit.» Er sprach das Wort langsam aus wie ein Fremdwort, er fluchte ja nie. Es klang beinahe höflich. «Bullshit! Wenn du wüsstest, was für ein Vater er war, wenn du wirklich glaubst, dass er mich geprägt hast, dann hättest du mich nie heiraten, geschweige denn eine Familie mit mir gründen dürfen!»
«Können Sie das vielleicht noch etwas ausführen?», fragte Doktor Lilly, während Sofia versuchte, den Sinn zu verstehen.
Santiago seufzte ungeduldig. «Na, prima! So ist er immer, er gibt nichts von sich preis. Ich dagegen, ich bin ein offenes Buch! Meine Familie ist ein offenes Buch. Gut oder schlecht, wir wissen alles voneinander, wir haben keine Geheimnisse!»
«Santiago, lassen Sie Giò bitte Zeit, um zu antworten.»
«Warum sollte ich, Santiago weiß ja schon alles, und er weiß alles besser.»
Sofia hörte, wie Doktor Lilly tief atmete. Ein und aus. Dann wandte sie sich an Sofia: «Was spielst du denn da Schönes im Puppenhaus?»
«Verstecken», sagte Sofia.
«Hier seid ihr also!» Sie drehten ihre Sessel zum Gang. Samuel stand vor ihnen, die Hände in die breiten Hüften gestemmt, vorwurfsvoll. «Ihr solltet doch um sieben Uhr fünfzehn im Speisewagen sein!»
«Oh, ist es schon so spät?» Sofia zog ihr Handy aus der Westentasche. Sieben Uhr siebzehn. Die Zeit, die so träge dahingeflossen war wie die Landschaft vor den staubigen Fenstern, hatte einen Sprung gemacht.
«Das kommt davon, dass niemand mehr eine Uhr trägt», schimpfte Samuel. «Alle schauen immer nur auf ihre Telefone und ihre Computer. Kommt mit, wir schauen, was sich machen lässt.» Sie standen auf und folgten dem Zugbegleiter, der sich erstaunlich schnell und geschickt durch den Wagen bewegte. Das Schaukeln des Zuges schien ihm nichts auszumachen. Wie ein Seemann passte er sich der Bewegung an, während Sofia und Giò immer wieder gegen Abteiltüren und andere Passagiere taumelten. Der übernächste war zum Glück schon der Speisewagen. Eine sehr große Frau mit sehr schwarzer Haut versperrte den Eingang. Ihre Augenlider glitzerten grün wie die Haut einer Schlange. Ihre Wimpern waren so lang, dass sie an den Augenbrauen anstießen.
«Sind das die verspäteten Sieben-Fünfzehner?», fragte sie streng.
«Sylvie! Sie sind mir entwischt, bitte verzeih mir. Tu mir den Gefallen und lass sie noch dazusitzen», bettelte Samuel außer Atem.
Sofia schaute von ihm zu Sylvie und zu Papa Giò, der unbeteiligt dastand. Der Ernst der Lage war ihm nicht bewusst, aber Sofia verstand, dass sie kein Abendessen bekommen würden, weil sie zu spät gekommen waren. Sylvie verzog keine Miene, sie schien nicht einmal zu atmen. Vielleicht war sie wirklich ein Reptil. Sofia setzte ihr süßes Kleinkindgesicht auf, doch Sylvies Blick wurde erst weicher, als er auf Papa Giò fiel.
«Na dann … Aber ihr esst, was auf den Tisch kommt!»
«Danke, Sylvie, du hast was gut bei mir!» Samuel wischte sich theatralisch den Schweiß von der Stirn, dann verschwand er. Sofia und Giò folgten Sylvie zu einem Tisch, der bereits belegt war. Sylvie scheuchte sie auf die Bank neben einen einzelnen Mann, der unwillig zur Seite rutschte. Er hatte mehrere Prospekte vor sich ausgebreitet, die er nun umständlich zusammenschob.
«Hi!», sagte die Frau am Fenster freundlich. «Habt ihr es doch noch geschafft. Wir haben uns schon Sorgen gemacht!»
Ihr kennt uns doch gar nicht, dachte Sofia. Sie spürte Papa Giò an ihrer Seite, zusammengesackt, vor sich hin starrend. Wieder wusste sie instinktiv, dass sie für ihn einspringen musste. Sie nahm ihre Mütze ab und lächelte breit: «Fast hätten wir das Abendessen verpasst. Und wir haben nicht mal ein Picknick dabei! Ich bin Sofia, und das ist mein Papa Giò.»
«Oh. Sofia, sagst du?»
«Ja – Überraschung: Ich bin ein Mädchen.» Sofia lachte. Harmlos, freundlich, unschuldig.
Die Frau fasste sich als Erste. «Hauptsache, ihr seid jetzt hier. Hallo, ich bin Chris, und das ist mein Mann, Chris.» Sie lachte.
Sofia sah genauer hin. Die beiden trugen nicht nur denselben Namen, sie sahen auch gleich aus. Verwaschene graue Sweatshirts der University of Colorado. Lesebrillen an Lederbändern, kurzgeschnittene, graue Haare. Die Frau war so ungeschminkt wie ihr Mann. Nur an ihren ausladenden Brüsten konnte man sie auseinanderhalten. Offenbar war die Geschlechtsunsicherheit bei Erwachsenen kein Thema mehr.
«Und ich bin Jack», sagte der einzelne Mann. Er lehnte sich über Sofia hinweg, um Giò die Hand zu geben. «Joe, sagtest du?»
Giò nickte nur. Sylvie brachte die Getränke. Ungefragt stellte sie eine Flasche Bier vor Giò hin. Alle Männer bekamen ein Bier, Sofia und Chris-die-Frau Eistee.
«Ich hoffe, ihr mögt Hamburger», sagte Sylvie mit warnendem Unterton. Sofia lächelte wieder. Zum ersten Mal, seit Santiago sie gestern am Flughafen verabschiedet hatte, war sie froh, dass er nicht hier war. Er hätte garantiert nachgefragt, ob das Fleisch biologisch und hormonfrei sei und welches Öl zum Braten verwendet wurde. Giò stieß Sofia mit dem Ellbogen an, er hatte gerade dasselbe gedacht. Sie dachten beide ununterbrochen an Santi.
«Burger sind perfekt», sagte Giò. Er trank sein Bier in wenigen großen Schlucken und unterdrückte dann einen Rülpser. Chris-die-Frau sah ihn mit leichter Besorgnis an, doch die Männer am Tisch entspannten sich sichtlich. Giò mochte in vieler Hinsicht auffällig wirken, aber er wurde nur selten gleich als Homosexueller erkannt. Natürlich nur, bis jemand fragte, wo denn Sofias Mutter sei. In San Francisco war das kein Problem. Aber sie waren nicht in San Francisco.
Sie versuchten sich vorzustellen, wie Santi sich an diesem Tisch verhalten würde, und sahen einander verständnisinnig an. Vielleicht war alles gar nicht so schlimm, dachte Sofia. Vielleicht war es gar nicht das Ende. Nur eine Zäsur: Jemand war gestorben. Donald Trump war Präsident. Ein Vater musste mit seiner Vergangenheit abschließen, der andere brauchte Zeit für sich. Vielleicht war das normal. Auch Eltern ihrer Freundinnen hatten das durchgemacht. Allerdings führten Midlife-Krisen oft zu Scheidungen. Und so schob Sofia diesen Gedanken wieder beiseite und griff zu dem Plastikbecher mit Ölkreiden, den Sylvie neben ihren Eistee gestellt hatte. Die Kreiden waren kurz, trocken und brüchig. Vorsichtig löste Sofia das Gummiband, das sie zusammenhielt. Sie fand Schwarz und Grün und versuchte, Sylvies Lidschatten nachzumalen. Dann zeichnete sie eine Schlangenfrau mit grünen Augen, eine Superheldin ohne Beine.
Chris und Chris zeigten Fotos von ihren Enkelkindern. Es waren elf, über das ganze Land verteilt, aber alle am Amtrak-Schienennetz.
«Wir reisen immer mit dem Zug», sagte Chris-die-Frau. «So haben wir mehr davon.»
«Sie ist nicht gern mit mir allein zuhause, seit ich pensioniert bin», sagte Chris-der-Mann.
«Ach, du!» Sie boxte ihn in die Seite, liebevoll, und lächelte. «Na ja, ganz falsch liegt er nicht, ich gebe es zu!»
«Ich fliege auch nicht mehr, seit es die TWA nicht mehr gibt», mischte sich Jack ein. «Beste Fluggesellschaft aller Zeiten! Unbestritten! Achtzehn Jahre bin ich geflogen, als Pilot, aber jetzt fahre ich nur noch mit dem Zug!»
Die anderen nickten höflich. «Wie interessant», sagten sie, und: «Ist ja toll!» Dann fragten sie Giò nach seinem Beruf.
«Filmarchivar? Wirklich? Ist das ein Beruf?», fragte Jack ein wenig gehässig. Er hätte lieber noch länger über die TWA gesprochen.
Giò leierte seine Referenzen herunter. Er hatte sie so oft schon genannt, dass er die jüngsten vergaß.
«Der Vorspann für I’m dying up here», warf Sofia ein.
Jack tippte die Informationen in sein Handy und legte es dann seufzend weg. «Kein Internet! Aber pass auf, ich werde dich googeln. Du bleibst besser bei der Wahrheit.»
«Ich liebe diese Show», sagte Chris-die-Frau, eine pensionierte Lehrerin. Chris-der-Mann hatte für die Highway Patrol gearbeitet.
«Na, in Colorado habt ihr wenigstens nicht viel mit Illegalen zu tun», sagte Jack.
«Colorado, wie kommst du denn auf Colorado? Ach, die Sweatshirts. Nein, die haben wir von unserem Jüngsten, der hat da studiert … wir leben in Texas.»
«Texas, hä? Da werdet ihr schön froh sein, wenn die Mauer endlich steht.»
Chris und Chris pressten die Lippen zusammen und schauten angestrengt in ihre Gläser. Es war offensichtlich, dass sie Jacks Meinung nicht teilten, aber keinen Streit anfangen wollten.
Jack schien den Stimmungsumschwung nicht zu bemerken. «Oh, hoppla, Joe, hab ich dich beleidigt?»
«In Amerika geboren, in Amerika aufgewachsen», sagte Giò. «Was nicht heißt, dass …» Sofia hielt den Atem an. Giò würde die Bemerkung über die Mauer nicht durchgehen lassen.
Doch Chris-die-Frau lenkte schnell ab: «Erzähl ihnen von deinem aufregendsten Fall!», sagte sie zu ihrem Mann.
«Okay. Da muss ich nicht lange überlegen: Bei uns in der Gegend lebten zwei Brüder, die in ihrem Keller eine Marihuanaplantage hatten. Offenbar hatten sie ein bisschen viel von ihrem eigenen Produkt inhaliert. Es heißt ja, dass Pot paranoid mache, oder? Also, wir wussten nicht mal von ihrem Business, als sie sich freiwillig stellten. Sie waren so paranoid, dass sie bei jeder Lieferung Blut und Wasser schwitzten. In jedem Passanten, in jedem Autofahrer sahen sie einen Zivilfahnder, der hinter ihnen her war. Schließlich hielten sie es nicht mehr aus und riefen die Polizei an: ‹Wir können nicht mehr! Wir wissen, dass ihr uns auf der Spur seid, warum verhaftet ihr uns nicht einfach?› Da hat die Kollegin gesagt: ‹Tut mir leid, dazu sind unsere Zivilfahnder nicht befugt. Aber fahren Sie doch bitte einfach beim nächsten McDonald’s raus, steigen Sie aus und öffnen Sie den Kofferraum. Ich schicke Ihnen jemanden.› Tja, und dann rief sie uns an, und wir machten den größten Fang unserer Geschichte, ohne das Geringste dafür tun zu müssen!»
Alle lachten ein bisschen lauter als nötig. Dann kam Sylvie schon mit dem Essen. Chris und Chris hatten den großen Salat bestellt. Wehmütig schauten sie auf Jacks Steak, auf die Burger von Sofia und Giò. «Wir müssen auf die Linie achten. Vier Tage im Zug, ohne viel Bewegung, drei Mahlzeiten pro Tag …»
«Ich hab gleich nach der Abfahrt fünfhundert Rumpfbeugen und hundert Liegestützen absolviert», sagte Jack. «Wer den Willen dazu hat, kann auf kleinstem Raum trainieren.»
«Wie ein Häftling in einer Gefängniszelle», nickte Giò. Jack runzelte die Stirn, aber Giòs Stimme klang sanft, als meine er nichts Böses. Er verschlang seinen Burger in zwei Bissen und winkte Sylvie, ihm noch ein Bier zu bringen. Er trank selten Alkohol, selten mehr als ein Bier. Aber Sofia hatte plötzlich genug davon, sich Sorgen um ihn zu machen. Chris-die-Frau würde schon aufpassen, dass alles ordentlich ablief. Sie kannte sich aus in diesem Zug. Sofia zerteilte ihren Burger und arbeitete sich gewissenhaft durch die Bestandteile. Erst das Salatblatt, dann die Tomatenscheibe, die Essiggurke, das Fleisch und schließlich das Brot. Sylvie nahm ihren Teller mit und schaute stirnrunzelnd auf die Zeichnung darunter: «Was ist denn das? Soll das etwa ich sein?»
Sofia erschrak. «Es ist ein Cartoon», sagte sie schnell. «Eine Superheldin.»
«Und, wie heißt die? Snake Woman?»
Chris und Chris hatten gewissenhaft ihre Salatschüsseln leer gegessen und bestellten Dessert. Es gab Käsekuchen mit Himbeersauce oder Schokoladenpudding. Sie nahmen von jedem eins. «Das Menü ist in jedem Zug dasselbe», sagen sie. «Die Hauptspeisen wechseln ein bisschen, zum Beispiel fuhren wir über Ostern im Southern Crescent nach Louisiana, da gab es Chicken Fried Steak mit Okra. Aber der Nachtisch: immer derselbe.»
Jack winkte jetzt auch nach einem zweiten Bier, aber Sylvie sagte knapp: «Tut mir leid, die nächste Schicht steht schon im Gang.» Plötzlich ging es ganz schnell. Die Erwachsenen signierten ihre Essenscoupons, dann scheuchte Sylvie sie auch schon aus dem Speisewagen.
«Kommt jemand mit in den Lounge-Wagen? Joe?» Jack stand etwas verloren an der Tür. Beinahe tat er Sofia leid. Aber nur beinahe.
«Mein Vater muss mir noch bei den Schularbeiten helfen», sagte Sofia. «Sorry!»
«Hey, Mädchen!» Sylvie stand plötzlich hinter ihnen. Sie hielt ein mehrfach gefaltetes Stück Papier in der Hand. Das Tischtuch. «Hier ist deine Zeichnung. Und die Kreiden kannst du auch mitnehmen. Vielleicht machst du sie ja noch fertig?»
Als sie in ihr Abteil zurückkamen, hatte Samuel aus den beiden Sofas Betten gemacht. Sie waren mit Leintüchern und blauen Wolldecken bezogen.
«Ich dachte, wir haben Kajütenbetten?» Sofia war enttäuscht. Sie hatte sich darauf gefreut, im oberen Bett zu schlafen. Giò hatte es ihr sogar versprochen. Aber die Betten standen in einem rechten Winkel zueinander.
«Tut mir leid», sagte Giò.
«Blöder Zug», murmelte Sofia.
«Es ist ja nur für eine Nacht.»
Sie wusste selber nicht, warum es ihr so viel ausmachte. Sie benahm sich kindisch, und sie wusste es. Sie wünschte sich, Mettschen wäre hier, ihre imaginäre Freundin. So hatte Doktor Lilly sie genannt. Leider war auf diese imaginäre Freundin ebenso wenig Verlass wie auf ihre realen. Gerade jetzt, wo sie sie am meisten brauchte, zeigte sie sich nicht mehr.
«Sie haben Angst.» Das war das Erste, was Mettschen zu Sofia gesagt hatte. Sofia war noch sehr klein gewesen. Sie weinte – warum, das wusste sie nicht, sie wusste nur noch, dass sie nicht damit aufhören konnte. Sie bekam keine Luft mehr, japste und heulte und schrie, bis sie glaubte, ihre Augäpfel würden herausspringen.
Papa Santi und Papa Giò hatten sich über sie gebeugt. Ihre Gesichter waren viel zu nah, ihre braunen Augen, Santiagos mit Kajal umrahmt, Giòs hinter Brillengläsern. «Was hast du denn, mein Kleines? Was willst du, was brauchst du, sag uns doch bitte, bitte, was los ist.»
Je mehr sie fragten, desto verzweifelter wurde Sofia. Desto lauter schrie sie.
«Sie bekommt keine Luft!», rief Giò.
«Vielleicht sollten wir sie doch in den Notfall fahren?»
«Nein, nein, neiiin!»
Dann plötzlich diese Stimme aus dem Nichts: «Sie haben Angst.» Sofia drehte erstaunt den Kopf, und da saß sie, neben ihr auf der Couch, ein sehr weißhäutiges Mädchen mit struppigem roten Hahnenkammhaar. Ganz ruhig saß sie da, die Beine gekreuzt. Sie trug lila Turnschuhe aus Stoff mit roten Sternen an der Seite, knallgrüne Shorts und ein gelbes T-Shirt mit einem rosa Stern vorne drauf. Sie hatte so viele Farben an, dass Sofia beinahe schwindlig wurde.
«Keine Schuhe auf der Couch», schluchzte Sofia.
Die Papas wechselten einen besorgten Blick. Sie schienen das fremde Mädchen nicht zu sehen, das auf ihrer Designercouch saß, als gehöre sie zur Familie. Das Mädchen ließ sich von Sofias Weinkrampf nicht im Geringsten beeindrucken. Sie schien auch nicht zu befürchten, dass Sofia an ihren Tränen ersticken könnte. Sie stellte keine Fragen. Dafür wusste sie als Einzige ganz genau, was Sofia jetzt brauchte: eine klare Stimme, die sie aus ihrer Verzweiflung riss.
Keine Fragen, sondern Antworten. Das Mädchen war nicht viel größer als Sofia, aber sie wusste alles, was Sofia nicht wusste. Und was nicht einmal die Papas wussten.
«Sie haben Angst», sagte sie. Als sei es das Normalste der Welt. Und offensichtlich war es das auch. «Sie haben Angst, etwas falsch zu machen. Sie haben Angst, dass du …»
Um das Mädchen zu verstehen, musste Sofia aufhören zu weinen. Sie schluckte noch ein paarmal, wischte ihre Nase am Ärmel ab. Papa Giò reichte ihr sein gefaltetes, sauberes Taschentuch. Dann schaute er zu Papa Santi hinüber, der erleichtert seufzte.
Sofia setzte sich auf. «Wer ist das?», fragte sie und zeigte auf die andere Seite des Sofas. Doch da war niemand. Nur Santiago. Er nahm Sofia in seine Arme. Jetzt, wo sie nicht mehr so untröstlich weinte, fiel ihm das leichter. Er küsste ihr Haar. «Ist ja gut, Prinzessin, ist ja gut.»
Wenn ihre Freundinnen Königshof spielten, war Sofia nie die Prinzessin. Sie war lieber die Zofe. Manchmal spielte sie auch einen Jungen. Den frechen Küchenburschen im Dornröschenschloss. Es reichte ihr, zuhause Prinzessin zu sein. Prinzessin zu sein war anstrengend. Und einsam. Niemand sagte der Prinzessin die Wahrheit.
Eine Prinzessin bekam keine Benimmregeln. Stattdessen erklärte man ihr, dass kleine Tierchen auf der Haut ihrer Hände lebten, die man Bakterien nannte. Und die sich vermehren würden, wenn man sie nicht ab und zu wusch. Dass man nur das Beste für sie wollte, dass es aber selbstverständlich ihre Entscheidung war und dass man ihre Entscheidung respektieren würde.
Einer Prinzessin, die den Broccoli zur Seite schob, damit er den Reis auf ihrem Teller nicht berührte, bot man gedünstete Karotten an oder etwas Regenbogenkohl, der von gestern übrig war. «Den mochtest du doch, Liebes, nicht? Oder soll ich schnell losfahren und diesen indischen Spinat mit Frischkäse holen, den du so gerne isst?»