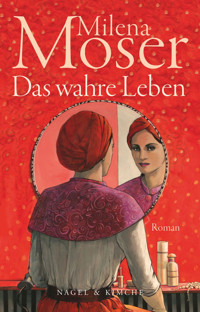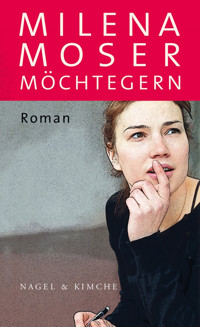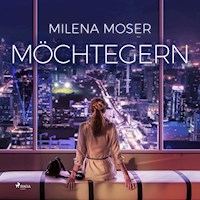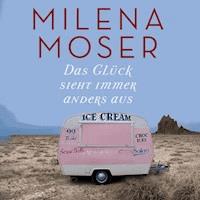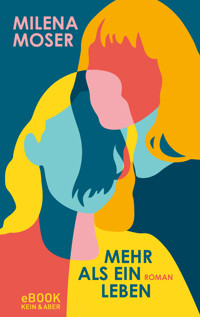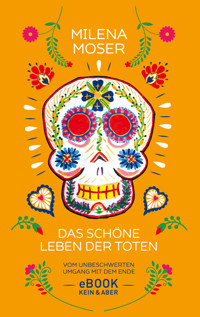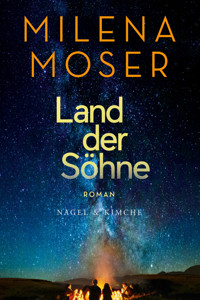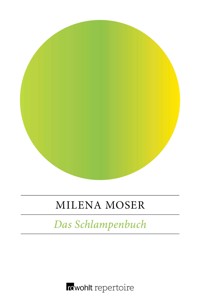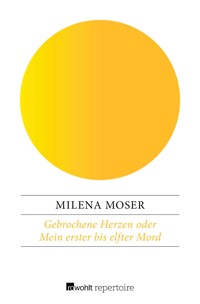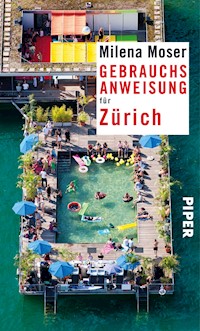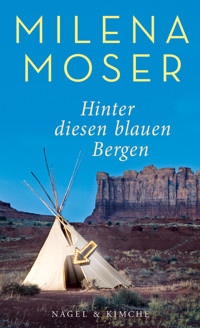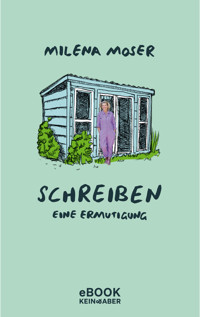
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vor über zwanzig Jahren hat Milena Moser beschlossen, es einfach zu versuchen: Sie wollte andere mit ihrer Leidenschaft fürs Schreiben anstecken. Also bot sie Schreibkurse an. Und lernte dabei selbst sehr viel: Plötzlich war sie gezwungen, das eigene Schreiben zu analysieren, eigene Methoden zu erkennen, sich an Momente und Irrwege zu erinnern, aus denen sie gelernt hat. Erstaunt stellte sie fest, dass sie Methoden entwickelt hatte, die sich auf andere übertragen lassen. Und dass sie durchaus das Feuer fürs Schreiben entfachen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Milena Moser, 1963 in Zürich geboren, ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Schweiz. 2015 emigrierte sie nach Santa Fe, New Mexico und lebt seit 2019 in San Francisco.
Bei Kein & Aber erschienen Das schöne Leben der Toten (2019), Land der Söhne (2020), Mehr als ein Leben (2022) und zuletzt Der Traum vom Fliegen (2023).
ÜBER DAS BUCH
Wenn du schreiben willst, kannst du es auch!
Milena Moser erzählt vom eigenen Weg zur Schriftstellerin, von ihrer Leidenschaft fürs Schreiben und gibt mit spielerischen Übungen Kniffe weiter an alle, die schreiben wollen.
»Im ersten Schreibkurs, den ich vor Jahren anbot, bemerkte ich, dass ich beim Schreiben einer Methode folge, die sich erkennen und vermitteln lässt. Eine Methode, die sich auf andere übertragen lässt, ganz unabhängig davon, was sie schreiben. Dass meine Methode funktioniert, weiß ich, weil ich sie selbst anwende, jeden Tag. Ich kann sie vermitteln, weil ich sie entwickelt habe, ohne es zu bemerken, weil ich aus falschen Anläufen und Irrwegen gelernt habe. Weil ich jede Hürde kenne, selbst schon hundertmal über sie gestolpert bin.«
MILENA MOSER
Wie du dieses Buch für dich nutzen kannst – eine Art Vorwort
Meinen ersten Schreibkurs hielt ich an meinem Küchentisch in San Francisco, im Sommer 2001. Der Grund dafür war ein prosaischer: Ich brauchte Geld.
»Warum bietest du nicht einfach ein bisschen Creative Writing an?«, fragte mein älterer Sohn, 13 Jahre alt. Creative Writing war ein Schulfach. Selbst die ganz Kleinen, die noch gar nicht schreiben konnten, diktierten den Lehrkräften kurze Sätze über ihre Gefühle, über den heutigen Tag, oder etwas, worauf sie sich gerade freuen.
Im deutschen Sprachraum waren Schreibkurse damals noch nicht so verbreitet wie heute. Wenn es sie überhaupt gab. Wir glaubten an den von höheren Kräften auserwählten und mit außergewöhnlichem Talent beseelten Schriftsteller, und ich nutze hier mit Absicht die männliche Form. Frauen waren – sind? – von dieser göttlichen Erhebung weitgehend ausgeschlossen.
Ich bin in einem solchen Elfenbeinturm aufgewachsen: Mein Vater war Schriftsteller, meine Mutter Übersetzerin, später Sachbuchautorin. Während meiner Kindheit hab ich viele Schriftsteller kennengelernt, und auch ihre meist sehr schönen Frauen. Aber keine einzige Schriftstellerin. Die Freunde meines Vaters glaubten nicht nur an das grundsätzliche Auserwähltsein des Schriftstellers, sondern auch an seine aufklärerische Mission. Geschichten zu erzählen, wie ich es als Kind schon wollte, war nicht vorgesehen. Die Vorstellung, dass man das Schreiben lernen, dass man es sich aneignen könne, hätten sie vehement zurückgewiesen.
Kann man schreiben lernen? Kann man es vermitteln? Ich würde es herausfinden. Der endlose Sommer stand vor der Tür, ich ließ fünfzig Postkarten drucken mit einem Foto, wie ich an einem Schreibtisch im Freien sitze und versuche zu schreiben, während hinter mir ein kleines Kind in einer Hängematte liegt und Faxen macht. Der Tisch ist mit Manuskriptseiten und Teetassen übersät, mein Lächeln schief. Mein älterer Sohn half mir, einen Flyer zu gestalten, und korrigierte meinen Text: Statt Swiss Writer solle ich Bestselling Swiss Writer schreiben.
»Wir sind hier schließlich in Amerika, Mama.«
Ich legte den Flyer in der Bibliothek, im Lebensmittelladen und im Café an der Ecke aus. Und irgendwie – wie, ist mir bis heute nicht klar – bildete sich eine wild zusammengewürfelte Gruppe von acht Schreibwilligen, die einen Sommer lang jede Woche zu mir kamen, sich vertrauensvoll an meinen Tisch setzten und mir sogar auf den Spielplatz folgten – ich begann nämlich jede Lektion mit ausgiebigem Schaukeln. Fast konnte ich sehen wie die festgesetzten Vorstellungen, was gute Literatur sei und wie man schreiben müsse, aus ihren Köpfen fielen, wenn sie sich zurücklehnten, die Beine in die Höhe streckten, lachten.
Eine junge Frau reiste dafür jedes Mal aus Los Angeles an, wo sie studierte, immerhin 600 Kilometer weit entfernt. Wohlgemerkt, es gab damals kein Buch von mir in englischer Sprache, und auch meine Webseite war nur deutsch. Warum vertrauten mir diese Menschen?
Was sahen sie in mir?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich ebenso viel von ihnen lernte wie sie von mir. Sie zwangen mich, mein Schreiben zu untersuchen, zu analysieren, mich mit ihm auseinanderzusetzen. Bis dahin hatte ich bewusst nicht über meinen Prozess nachgedacht. Das Schreiben hatte für mich seit meiner Kindheit etwas Magisches. Etwas, das nur bedingt mit mir zu tun hatte. Ich empfand es immer als Geschenk und fürchtete wohl, es zu verlieren, wenn ich es hinterfragte und sezierte.
In diesen sechs Wochen merkte ich zum ersten Mal, dass ich einer Methode folge, die sich erkennen, zusammenfassen und vermitteln lässt. Eine Methode, die sich auf andere übertragen lässt, ganz unabhängig davon, was sie schreiben. Lebenserinnerungen oder Gedichte, Krimi oder Fantasy oder ein Sachbuch. Dass meine Methode funktioniert, weiß ich, weil ich sie selbst anwende, jeden Tag. Ich kann sie vermitteln, weil ich sie entwickelt, weil ich aus falschen Anläufen und Irrwegen gelernt habe. Weil ich jede Hürde kenne, selbst schon oft über sie gestolpert bin.
Der Kurs war ein voller Erfolg. Obwohl einer der Teilnehmer später in mein Haus einbrach und mich ausraubte, als ich nach Kursende wie angekündigt in die Schweiz gereist war. Ich nahm es ihm nicht übel, viel hatte er nicht gefunden, nur meinen Vorrat an ausländischen Münzen, den ich mal für eine Schreibübung auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Der Mann kämpfte mit allen möglichen Dämonen, und da er sein Vorhaben in einer (brillanten) Kurzgeschichte sozusagen angekündigt hatte, wie mir später klar wurde, verbuchte ich auch dieses Erlebnis als Erfolg.
Das Hochgefühl, das ich in dieser Gruppe zum ersten Mal erlebt hatte, dieses unglaubliche Privileg, dabei zu sein, wenn eine jahrelange, quälende Blockade in sich zusammenfällt wie ein Kartenhaus, wenn Geschichten aufs Papier drängen, wenn Bleistifte nicht mehr innehalten können – das ist mit nichts zu vergleichen. Ich wollte es so schnell wie möglich wiederholen und begann wenig später, im Medienausbildungszentrum Luzern zu unterrichten. Die ersten paar Jahre musste ich die Ankündigung wiederholt korrigieren: »Nein, der Kurs heißt ERST schreiben, DANN denken! Nicht umgekehrt!«
Die angehenden Journalistinnen und Journalisten von damals waren eher skeptisch. Sie vertrauten mir nicht so, wie es die Küchentischgruppe getan hatte. Immerhin verlangte ich von ihnen, alles zu vergessen, was sie gelernt hatten. Alle Regeln über Bord zu werfen.
»Das ist Creative Writing«, hörte ich eine Teilnehmerin ihrem verzweifelten Sitznachbarn zuflüstern. »Das machen sie in Amerika so. Lass dich einfach drauf ein!«
Sie stellten mich infrage, forderten mich heraus, halfen mir, meine Methode zu überprüfen und zu verfeinern. Wieder und wieder beobachtete ich diesen Moment der puren Magie des Schreibens, die den Denkprozess überspringt. Diesen Moment miterleben zu dürfen, ist das Beste, was das Leben zu bieten hat. Außer natürlich, diesen Moment selbst zu erleben. Selbst zu schreiben.
Diesen Moment möglich zu machen, wurde meine Mission. Ich gebe zu, ich bin besessen davon. So viele Menschen wollen schreiben. So viele Menschen trauen sich nicht, trauen es sich nicht zu, denken, sie erfüllen die Bedingungen nicht. Dabei ist es das Einfachste der Welt. Der direkteste Weg zum Glück, den ich kenne.
Das Aufbrechen der Mauern dieses imaginären Elfenbeinturms, in dem sich die Schriftsteller vergangener Generationen sicher gefühlt hatten, stößt manchmal durchaus auf Widerstand. Unvergessen der preisgekrönte Autor, der mich in einem voll besetzten Zugabteil lautstark zusammenstauchte: »Du mit deinen Kursen!«, donnerte er. »Wo soll das denn hinführen? Am Ende meinen Hinz und Kunz, sie können schreiben! Da könnte ja jeder kommen!«
Im Moment war ich zu eingeschüchtert, um zu antworten. Aber ja, genau darum geht es mir: Wenn du schreiben willst, kannst du das auch. Darfst du das.
»Aber ich will doch gar kein Buch schreiben«, sagst du. Musst du auch gar nicht.
Das heißt aber nicht, dass du nicht schreiben kannst. Wenn ich mich in meinem Alter noch für einen Ballettkurs anmelde, strebe ich damit keine zweite Karriere als Ballerina an. Es macht mich einfach glücklich. So wie es mich glücklich macht, auf langen Autofahrten sämtliche Blondie-Hits mitzusingen. Oder im kalten Wasser des Pazifiks zu schwimmen oder einen Kräutergarten zu pflanzen. Keine dieser Unternehmungen ist mit beruflichen Ambitionen verbunden, und trotzdem sind sie mir wichtig, sie fordern mich heraus und erfüllen mich.
Ob du Tagebuch schreibst oder einen Roman, ist im Grunde nebensächlich.
Schreiben ist ein einfacher und allen zugänglicher Weg zum Glück. Ich erzähle dir, wie ich zur Schriftstellerin geworden bin. Das heißt nicht, dass du das auch tun musst. Du schreibst deine eigene Geschichte – und dieses Buch begleitet dich dabei.
In den erzählenden Kapiteln erfährst du, wie ich zur Schriftstellerin wurde, mit all den Hindernissen und Widerständen, die mir unterwegs begegneten. Konkrete Übungen, im Inhaltsverzeichnis kursiv angezeigt, führen dich Schritt für Schritt von deinen ersten Versuchen zu einer überarbeiteten Fassung. Das beigelegte Schreibheft lädt dich ein, seine Seiten zu füllen – und zu sprengen. Viel Freude damit!
»Du kannst doch gar nicht schreiben!«
»Was machst du denn da, Milenchen?«
Meine Mutter erzählte die Geschichte so: Ich sei vor dem Sofatisch auf dem Boden gesessen und hätte mit großem Ernst und Eifer Zeichen auf ein Blatt Papier gekritzelt. Wellen, Kreise und Striche.
»Ich schreibe ein Buch«, soll ich geantwortet haben. Ich war drei Jahre alt, konnte weder lesen noch schreiben, wusste aber schon, dass diese beiden Dinge untrennbar miteinander verbunden sind. Heute hätte meine Mutter vermutlich ein Video aufgenommen und auf Social Media verbreitet, damals schüttelte sie nur den Kopf und ließ mich machen. Nach einer Weile soll ich sie gefragt haben, wie man »Preiselbeere« buchstabiere. Das allerdings kann ich mir nicht recht vorstellen. Dass ich schon wusste, was Buchstabieren heißt. Aber so ist es mit Familienlegenden: Oft genug erzählt, werden sie zu Erinnerungen, werden sie zur Wahrheit. Teil meiner Geschichte. Teil meiner Identität. Ich bin jemand, der schreibt. Weil ich jemand bin, der liest.
Zur leisen Verzweiflung meiner Mutter, die mich mit modernen, feministischen Kinderbüchern großziehen wollte, liebte ich die moralinsauren Büchlein von Ida Bohatta, speziell Die braven und die schlimmen Beeren. Die etwas kitschigen Illustrationen zeigten die Beeren als kleine Mädchen in voluminösen Tutus und Beerenhüten. Das gefiel mir sehr. Auch das zum Ärger meiner Mutter, die die Farbe Rosa hasste. Wie oft und auf wie viele Weisen ich meine Mutter enttäuscht habe, ist eine andere Geschichte …
Jedenfalls hatten wir Preiselbeeren im Garten, daher kannte ich sie. Im Büchlein von Ida Bohatta kamen diese aber nicht vor, also lag es nahe, dass ich ihre Geschichte ergänzte. Dass ich keinen einzigen Buchstaben kannte und effektiv nicht schreiben konnte, hielt mich dabei nicht auf. Das war ein Detail.
Meine Mutter sagte nicht: »Du kannst das nicht«, oder: »Du weißt doch gar nicht, wie man schreibt.« Bei allem, was in meiner Kindheit schiefgelaufen ist, das mit dem Schreiben war es nicht. Das mit dem Schreiben hatte ich. Das gehörte mir.
Siebzehn oder achtzehn Jahre später, als ich versuchte, meine ersten Romane in einem Verlag unterzubringen, hörte ich das ständig: »Sie können das nicht. Sie können nicht schreiben. So schreibt man nicht. Das ist keine Literatur, was Sie da machen!«
Mama, wie buchstabiert man Literatur?
Übung: Was ist Literatur?
Okay, lass es raus – damit du es wieder vergessen kannst. Schreib auf, was gute Literatur, gutes Schreiben, ein gutes Buch für dich bedeuten. Zensiere dich nicht, korrigiere nichts. Du musst nicht mal ganze Sätze machen, darfst Stichworte und Listen notieren. Hör einfach nicht auf, bevor du die letzten versteckten Winkel deiner Vorstellung ausgekratzt hast. Denn diese Vorstellung davon, was Literatur ist und darf, stellt sich deinem Schreiben in den Weg.
Spar dir die Gründe und Beispiele dafür, warum du das nicht kannst, nicht gut genug bist, für die nächste Übung auf.
Wenn du fertig bist, leg die Übung weg, aber behalte sie vorläufig. Wir kommen darauf zurück!
Schreiben im Affenhaus
Meine Knie taten mir weh, meine Hüften, mein Rücken. Nicht aber meine Füße – die spürte ich schon gar nicht mehr, sie waren eingeschlafen. Meine Augenlider zuckten.
Wie lange sitzen wir schon hier? Wie lange geht das noch so weiter?
Der Schmerz kroch in meine Schultern, ich hob sie sachte an, schließlich sollte ich still sitzen. Man nennt es Meditation.
Reine Folter, dachte ich. Doch gerade, als ich den Mund öffnen und einen lang gezogenen Schrei ausstoßen wollte, schlug der Kursleiter den Gong, und die längsten 45 Minuten meines Lebens waren zu Ende. Und dann, als hätte er in meinen Kopf hineingeschaut, sprach er vom Monkey Mind, dem Affengeist. Kaum hatte er das Wort ausgesprochen, sah ich das Affenhaus in meinem Kopf ganz plastisch. Unter der harten Decke meines Schädels ein offenes Gehege, Pflanzen mit fleischig grünen Blättern und dicken Seilen, an denen sich Affen durch die Luft schwangen, andere saßen auf dem Fußboden und kratzten sich oder bewarfen sich mit Bananen, wieder andere bewegten sich auf langen Armen erstaunlich schnell durch den Raum – durch meinen Kopf –, und alle kreischten sie durcheinander. Kleine und große Affen, schwarze, braune, orangerote.
Mit dem Affengeist solle man sich nicht identifizieren, warnte der Meditationslehrer. Das sei nur eine lästige Funktion des menschlichen Denkens und habe mit der Realität nichts zu tun.
Und in diesem Moment war mir klar: Das, was ich höre, wenn ich schreibe, sind die Affen.
Das ist doch alles Mist.
Banal.
Irrelevant.
Das hat man schon hundertmal gelesen. Und erst noch besser.
Wem versuchst du etwas vorzumachen?
Mir nicht!
Wie oft hatte ich mich mit diesen Affen identifiziert? Einen angefangenen Text verworfen, eine Geschichte weggelegt, ein halbes Buch? Ich hatte den Affen geglaubt, hatte ihre kreischenden Kommentare für bare Münze genommen, mit einem objektiven Urteil verwechselt. Automatisch war ich davon ausgegangen, dass ich diese Stimmen eines Tages nicht mehr hören würde. Dass ich eines Tages wie eine »richtige Schriftstellerin« am Tisch sitzen und schreiben würde, ohne an mir zu zweifeln. Doch je länger ich mich mit diesen Stimmen befasste, mich mit anderen Schreibenden über sie unterhielt und in Schriftstellerbiografien und Tagebüchern über sie las, desto klarer wurde mir: Wir hören sie alle.
Die schlechte Nachricht: Wir werden diese Affen nicht los. Sie gehören zu uns, zum kreativen Prozess.
Die gute: Man kann sich an sie gewöhnen. Mit ihnen leben.
Wie? Indem man jeden Tag schreibt.
Wer jeden Tag schreibt, merkt, dass die Affen nicht immer dasselbe sagen. Nachdem sie einen wochenlang beschimpft haben, brechen sie plötzlich in Triumphgeheul aus.
Brillant!
Das hat noch niemand gewagt.
Meine Liebe, du hast soeben die Literatur neu erfunden!
Auch das ist – leider – kein objektives Urteil. Auch damit darf man sich nicht identifizieren. Denn es ist nur eine Variante des Affenkreischens. Der Text bleibt der Text, von den Stimmen unberührt.
Übung: Die inneren kritischen Stimmen bändigen
Nimm den Stift in die Hand oder öffne ein neues Dokument auf dem Laptop, um zu beginnen. »Schreiben, okay, aber was?«, denkst du. Du versuchst, einen Einstieg zu finden, einen ersten Satz zu formulieren, und schon geht es los:
Fällt dir nichts ein?
Hast du nichts zu sagen?
Bisher hast du dich von diesen Stimmen einschüchtern lassen. Hast vielleicht den Laptop zugeklappt, den Stift weggelegt. Heute nicht.
Hör genau hin. Nimm das Diktat auf. Schreib alles auf, was die Affen in deinem Kopf so behaupten. Auch wenns unangenehm ist: Schreib, bis alles dokumentiert ist. Jeder einzelne fiese Vorwurf.
Bonus: Flugzeuge fliegen lassen
Wenn du diese beiden ersten Übungen in deinem Computer geschrieben hast, druck sie aus.
Dann falte jedes einzelne Blatt zu einem einfachen Flugobjekt. Such dir ein Dachfenster, eine Aussichtsterrasse, von mir aus einen Baum. Schmeiß diese Papierflieger einen nach dem anderen in die Luft.
Das ist in meinen Kursen normalerweise der Moment, in dem auch die Skeptischsten befreite Juchzer ausstoßen. Tus ihnen nach. Nur keine Hemmungen!
Bonus: Literaturliste gegen die Affenkommentare
Du kannst eigentlich jeden Vorwurf der Affenfamilie mit einem Beispiel aus der Weltliteratur abschmettern. Hier ein paar besonders fiese Affenkommentare und die dazu passende Antwort aus der Bibliothek:
Affenkommentar
Bibliothek
»Das versteht doch kein Mensch!«
James Joyce, Ulysses
»Wann kommst du mal endlich zum Punkt?«
Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
»Mein Gott, wen interessiert schon dein Liebesleben?«
Max Frisch, Montauk
»Was zum Teufel soll denn das nun wieder?«
Georges Perec, Das Leben, Gebrauchsanweisung (mit Puzzle!)
»Wer, bitte, interessiert sich für das Wetter?«
Peter Bichsel, Über das Wetter reden
»Da passiert ja gar nichts!«
Markus Werner, Am Hang
»Da passiert viel zu viel!«
Katharina Faber, Und manchmal sehe ich am Himmel einen endlos weiten Strand
»Adjektive sind des Teufels, hat dir das niemand gesagt?«
Hermann Burger, Schilten
»Mann, diese endlosen Beschreibungen, wen interessiert die Beschaffenheit der Vorhangskordel!«
Thomas Mann, Der Zauberberg
»Blablablablabla! Hörst du auch mal auf zu quasseln?«
Jonathan Franzen, Die Korrekturen
»Was für ein Kitsch!«
Boris Vian, Der Schaum der Tage
»Spinnst du jetzt komplett?«
Raymond Queneau, Hunderttausend Milliarden Gedichte
Und zum Schluss gegen das Hochstaplersyndrom, unter dem wir alle leiden:
Walter Serner, Letzte Lockerung. Ein Handbrevier für Hochstapler und solche, die es werden wollen
Mein Zaubertrank fürs Schreiben
Ich bin Schriftstellerin der zweiten Generation. Tochter eines Schriftstellers und einer Übersetzerin und Sachbuchautorin. Das hat mir einen Vorteil verschafft, der mir lange Zeit gar nicht bewusst war. Und ich meine damit nicht, dass ich von den Beziehungen meines Vaters profitieren konnte, der starb, bevor ich mein erstes Buch veröffentlichte. Ich meine auch nicht die Tatsache, dass unsere Kreativität in der Kindheit fast bis zur Erschöpfung gefördert wurde. Nein, ich meine etwas ganz anderes, viel Wichtigeres, etwas, das ich fast beiläufig gelernt habe, einfach, indem ich dabei war, beobachtete und zuhörte. Etwas, das ich absorbierte, bis es ein Teil von mir war. Etwas, das mir geholfen hat, die langen Jahre der Absagen und Niederlagen durchzustehen. Es ist ein innerer Schutz gegen die Kommentare, Beurteilungen, die Kritik der anderen. Es gibt kein Schreiben ohne sie, aber wir müssen sie ausblenden, wie wir die Affen ausblenden. Das ist nicht einfach. Ich aber bin damit imprägniert, wie Obelix, der als Kind in den Kessel mit dem Zaubertrank gefallen ist.
Die Generation meiner Eltern hatte den Zweiten Weltkrieg noch knapp miterlebt, war zwar zu jung, um sich dafür verantwortlich zu fühlen, aber alt genug, um zu wissen: nie wieder. Jedes Kunstschaffen dieser Zeit hatte einen klar definierten Anspruch: Als Künstler war man verpflichtet, die Welt zu verändern. Und hatte aufgrund der gewichtigen Aufgabe ein Anrecht auf bevorzugte Behandlung. Diese Gewissheit fehlte mir, und ich beneidete die Älteren darum. Sie irritierte mich aber auch, so wie man nur als Kind mit noch unbeeinflusstem Sinn für falsche Töne irritiert sein kann. Hier waren die Künstler, nach eigener Einschätzung die wichtigeren, wertvolleren Menschen, und dort die anderen, die »Bürgerlichen«, das tumbe Volk. So sah aber die Welt nicht aus, die ich als krankhaft schüchternes Kind meist hinter Möbelstücken versteckt beobachtete. Bei Einladungen kauerte ich oft hinter dem Sofa und schaute auf die Hinterköpfe unserer Gäste, bekannte und weniger bekannte Schriftsteller, Bildhauer, Maler, Dichter, Journalisten. Alles Männer. Mit ihren schönen Frauen, den Künstlergattinnen. Manche von diesen hatten die Angewohnheit, sich im Verlauf des Abends auszuziehen. Da musste ich wegschauen. Und neben ihnen saßen unsere Nachbarn, ein Automechaniker, ein Lehrer, ein Hautarzt und mehrere Männer mit nicht näher definierten Berufen, die sie »im Büro« ausübten. Und ihre Frauen: Hausfrauen, Mütter, meine Sonntagsschullehrerin, die ich sehr gerne hatte und die auch zuverlässig ihre Kleider anbehielt. Ich saß hinter dem Sofa und verstand nicht, warum die Künstler solche Angst vor diesen eigentlich doch sehr netten Nachbarn hatten.
»Ich kann mit diesen Leuten nicht reden!«, riefen sie. Doch wenn sie in Ruhe gelassen, also nicht erkannt wurden, waren sie auch nicht zufrieden. Die Künstler rückten gerne zusammen und hielten sich aneinander fest. Sie redeten meist über sich und über ihre Stellung in der Welt. Und in der Szene. Und im Betrieb. Das waren Begriffe, die ich schnell lernte: Szene. Betrieb. Und natürlich: die Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit war das Maß aller Dinge, die letzte Konsequenz. »Ja, aber unsterblich macht ihn das nicht!«, sagte man über das eben erschienene Buch, den erhaltenen Kunstpreis, den neuen Jaguar eines zufällig gerade nicht Anwesenden. Kommerzieller Erfolg stand der Unsterblichkeit im Weg, mangelndes politisches Bewusstsein, fehlende gesellschaftsverändernde Bedeutung. Anbiederung an das Volk, das dumme. Diese Ansprüche konnten je nach Zusammensetzung der Runde ändern.
Mein Vater erhielt nicht die Anerkennung, die er sich wünschte und die er zu verdienen glaubte. Die Bitterkeit, mit der ihn diese Tatsache erfüllte, machte vieles unmöglich. Zum Beispiel sein Schreiben. Er stocherte in der offenen Wunde, indem er sich etwa mit Max Frisch in der Kronenhallen-Bar verabredete und in einem Notizbüchlein notierte, wie oft er und wie oft der andere erkannt und angesprochen wurde. Diskrete Striche mit dem Bleistift: »Siebenundzwanzig zu eins«, sagte er, als er nach Hause kam.
Ich litt mit meinem Vater mit. Das ist der Zaubertrank, in den ich als Kind gefallen bin. Besonders gut hat er nicht geschmeckt, doch sein Schutz hält an. Ich bin fast ganz immun gegen diese Art von Enttäuschung, von Bitterkeit. Die Frage nach der Unsterblichkeit prallt an mir ab wie die Spieße der Römer an Obelix’ dickem Bauch. Das macht mich unbeschwert, macht mich frei. Zum Beispiel zum Schreiben.
Das Schreiben selbst ist die glühende Lava in meinem Inneren. Der Prozess fordert mich heraus, inspiriert mich, treibt mich an. Ist mein Lebensinhalt. Die Rezeption des Geschriebenen ist es nicht. Was in meinem Fall möglicherweise ein Glück ist.
Die Alexander-Regel: Was im Kopf ist, kommt aufs Papier
Der Schüler war 14 oder 15 Jahre alt und musste einen Schnupperlehrtag absolvieren. Weil er Schriftsteller werden wollte, wandte er sich an mich. Ich sagte zu, ohne mir genau zu überlegen, wie ich diesen Tag gestalten würde. Am Ende saßen wir einfach in meiner Schreibwerkstatt, schrieben, redeten, lasen einander vor. Alexander, so hieß der Junge, wurde von seinem Deutschlehrer gefördert und unterstützt. Was durchaus nicht die Regel ist. Eigentlich eher selten. Ich habe oft mit Schreibenden zu tun, deren Schulzeit Jahrzehnte zurückliegt und die noch immer die Stimme eines Lehrers im Kopf haben, der ihnen sagt: »Das kannst du nicht. So macht man das nicht!«
Alexanders Lehrer war nicht so. Nur manchmal wies er auf eine Stelle hin, die er nicht verstand. Die keinen Sinn ergab. »Und dann merke ich jedes Mal, dass ich was im Kopf hatte, das ich aber nicht aufschreiben wollte«, analysierte Alexander mit erstaunlicher Klarsicht.
»Hm.« So hatte ich mir das noch gar nie überlegt. Dabei passiert mir das auch immer wieder. Ich schreibe eine Szene, meine zu wissen, worauf sie hinausläuft. Und plötzlich drängt sich etwas anderes vor. Etwas, das nicht hierhergehört, nicht in den Ablauf passt, nichts mit dem Text zu tun hat. Statt dagegen anzukämpfen, schreibe ich es auf. Ganz einfach, weil es den Schreibfluss weniger unterbricht als der krampfhafte Versuch, dem vorgefassten Plan zu folgen. Manchmal entwickelt sich die ganze Geschichte in eine andere Richtung als vorgesehen. Manchmal verlaufen sich diese Abschweifer auch einfach wieder im Sand und können beim Überarbeiten leicht wieder herausgepflückt werden.