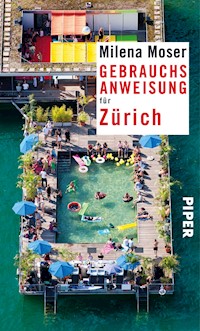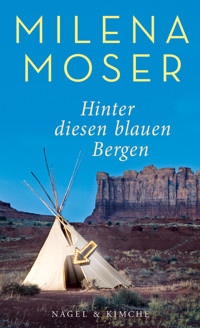14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Helens Kindheit ist keine unbeschwerte. Ihre Mutter verarbeitet die Trennung von Helens Vater Luc vornehmlich mit Alkohol, während sich dieser eher seinem Reporter-Job und seinen wechselnden Freundinnen widmet, als sich seiner Verantwortung zu stellen. So lernt Helen früher, als ihr lieb ist, wie man sich allein für den Kindergarten bereit macht und die Ausbrüche der Mutter vor den schaulustigen Nachbarinnen vertuscht. Glücklicherweise wohnt da auch die Familie Esposito mit Sohn Frank, der Helens Hand hält und sein Lunchpaket mit ihr teilt. Als Luc eines Tages das Sorgerecht beansprucht, steht Helen vor einer grundlegenden Entscheidung. Welchen Lauf wird ihr Leben nehmen? Wird sie erfolgreich sein, verheiratet mit ihrer Sandkastenliebe, aber belastet mit einer Schuld, die das Familienglück trübt? Oder will sie nur weit weg, endlich unabhängig sein, sich ausprobieren und neu erfinden? Man lebt schließlich nur einmal – oder?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Milena Moser, 1963 in Zürich geboren, ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Schweiz. 2015 emigrierte sie nach Santa Fe und lebt heute in San Francisco. Bei Kein & Aber erschienen bisher Das schöne Leben der Toten (2019) und Land der Söhne (2020).
ÜBER DAS BUCH
Helens Kindheit ist keine unbeschwerte. Ihre Mutter verarbeitet die Trennung von Helens Vater Luc vornehmlich mit Alkohol, während sich dieser eher seinem Reporter-Job und seinen wechselnden Freundinnen widmet, als sich seiner Verantwortung zu stellen. So lernt Helen früher als ihr lieb ist, wie man sich allein für den Kindergarten bereitmacht und die Ausbrüche der Mutter vor den schaulustigen Nachbarinnen vertuscht. Glücklicherweise wohnt da auch die Familie Esposito mit Sohn Frank, der Helens Hand hält und sein Lunchpaket mit ihr teilt. Als Luc eines Tages das Sorgerecht beansprucht, steht Helen vor einer grundlegenden Entscheidung. Welchen Lauf wird ihr Leben nehmen? Wird sie erfolgreich sein, verheiratet mit ihrer Sandkastenliebe, aber belastet mit einer Schuld, die das Familienglück trübt? Oder will sie nur weit weg, endlich unabhängig sein, sich ausprobieren und neu erfinden? Man lebt schließlich nur einmal – oder?
HELEN
1975
1.
Es war heute. Heute war der Tag, das wusste Helen gleich. Sie war aufgewacht, weil sie den Wecker gehört hatte, im Zimmer ihrer Mutter auf der anderen Seite des Flurs. Sie hörte ein einziges Klingeln und ein dumpfes Geräusch und dann nichts mehr. Ihre Mutter hatte den Wecker gehört und ausgeschaltet. Aber sie war nicht aufgestanden.
Helen wartete, warten konnte sie gut. Sie wartete darauf, dass ihre Mutter aufwachte. Sie wartete darauf, dass Mama Frühstück machte. Sie wartete auf Papa, der versprochen hatte, sie abzuholen und mit ihr in den Zoo zu fahren, wo es echte Löwen gab und Elefanten. Sie wartete auf die Gutenachtgeschichte im Fernsehen, die einzige Sendung, die sie sehen durfte. Sie wartete, bis die großen Jungen den Spielplatz freigaben. Sie wartete darauf, dass sie einschlief. Sie wartete.
Es machte ihr nichts aus. Helen hatte ein Haus in ihrem Kopf. Das Haus war voller Türen und hinter jeder befand sich ein Zimmer, immer ein anderes und immer eine Überraschung. Manche waren voller Bilderbücher, andere voller Süßigkeiten. In einem schwebten alle Möbel an der Decke, in einem anderen stand ein Pferd auf einem Teppich aus Gras.
Am Anfang hatte sie immer nur das Haus gesehen, in dem sie früher gewohnt hatte, bevor sie mit ihrer Mutter in diese Siedlung gezogen war. Sie sah das rote Samtsofa gleich hinter der Eingangstür, das Wohnzimmer mit dem flauschigen weißen Teppich und dem alten Ledersessel, in dem ihr Vater immer saß und die Zeitung las und rauchte. Der Sessel erinnerte Helen an einen Elefanten, seine graue zerknitterte Haut, die sie im Zoo einmal von ganz nahe gesehen hatte. Helen lag auf dem Bauch auf dem flauschigen Teppich, die Wollflusen bewegten sich wie Grashalme und kitzelten sie. Dann war sie in der Küche und half ihrer Mutter, frische Apfelschnitze auf dem Kuchenteig anzurichten, immer rund und rund im Kreis herum wie ein Schneckenhaus. Sie sah ihr Zimmer. Es hatte schräge Wände, die ihre Mutter mit dünnem Vorhangstoff bespannt hatte. Wenn man das Fenster öffnete, bauschte sich der Stoff im Wind. Manchmal stellte Helen sich vor, sie sei auf einem Schiff. Ihr altes Zimmer war größer gewesen als das hier in der Siedlung, sie hatte nicht all ihre Sachen mitnehmen können. Aber vor allem war ihr Vater nicht mitgekommen.
Ihre Eltern waren getrennt. Getrennt, das war, wenn sauer gewordene Milch im Kaffee flockte und in schmutzigen Wolken auf der Tasse schwamm, statt zu dem perfekten Hellbraun zu verschmelzen, das Mama so liebte. Helen wusste nicht, wie man Kaffee kochte, aber sie konnte die Milch dazugießen und umrühren, sie wusste genau, wie der Kaffee aussehen musste, damit ihre Mutter ihn gerne trank. Milch, die sich vom Kaffee trennte, war etwas Widerwärtiges. Getrennte Eltern auch. Man durfte nicht darüber reden, das Wort nicht mal aussprechen. Sie presste immer die Lippen zusammen, wenn die anderen Mütter danach fragten: »Wo ist denn dein Vater, Helen? Kommt er bald wieder vorbei? Sind deine Eltern getrennt?«
Wenn Mama so etwas hörte, antwortete sie scharf: »Wir sind nicht wirklich geschieden! Nur auf dem Papier.«
Wenn Helen nur wüsste, wo dieses Papier war. Dann könnte sie es einfach mit der Schere zerschneiden und alles wäre wieder gut. Schere, Stein, Papier!
Ihre Eltern hatten immer schon viel gestritten. Oder laut geredet. Das sagte Mama jeweils, um sie zu trösten: »Wir reden nur laut.« Und Vera hatte immer schon »Launen« gehabt. »Deine Mutter und ihre Launen«, sagte Luc immer. Mit einem Seufzen in der Stimme, als rede er über das Wetter, über etwas, das man einfach hinnehmen musste. Man konnte nie wissen, ob sie lachen oder weinen würde, wenn sich ihr Mund verzog. Helen studierte die Mundwinkel ihrer Mutter, wie sie zitterten und zuckten, nach unten zeigten oder manchmal auch nach oben, wie sich ihre Lippen kräuselten oder streckten. Sie kannte jede ihrer Regungen. Und konnte sie doch nie richtig einschätzen. Schon ganz früher, vor der Trennung, im alten Haus, war Veras Stimmung manchmal ganz plötzlich umgeschlagen. Ohne die geringste Vorwarnung. Eben noch hatte sie liebevoll den Tisch gedeckt, ein von Helen bemaltes und mit einem Strauß Gänseblümchen aus dem Garten bestücktes Joghurtglas in die Mitte gestellt. Doch plötzlich sackte sie in sich zusammen, als hätte ihr jemand die Luft abgelassen, wie bei einem Ballon. Dann setzte Vera sich auf den Boden und weinte, während das Essen im Ofen verbrannte und die Küche sich mit Rauch füllte. Manchmal hielt sie mitten im Putzen inne, schaltete den Staubsauger aus und legte stattdessen eine Schallplatte auf. Dann wirbelte sie mit Helen durchs Wohnzimmer, hielt sie an den Händen und schwang sie hoch, hoch, hoch bis unter die Zimmerdecke. Helen konnte nie wissen, was als nächstes passieren würde. Sie hielt deshalb immer ein wenig den Atem an.
Später wurde ihre Mutter immer öfter wütend, sie warf Gläser an die Wand, Teller, Tassen. Einmal hatte sie Papas Anzüge im Kamin verbrannt, das ganze Haus hatte tagelang nach verkohltem Plastik gestunken. Ein andermal hatte sie seine Bücher aus dem Fenster geworfen. Doch dann hatte es zu regnen begonnen. Barfuß war sie hinausgerannt, um die Bücher zu retten, aber es war zu spät, sie waren ruiniert. Als Papa schließlich eines Abends mit zwei Koffern im Flur stand, fiel Mama laut schluchzend auf die Knie und klammerte sich an seine Beine. Er musste ganz komische, steife Schritte machen wie ein Storch. Helen war damals erst vier, aber sie wusste, dass es kein Spiel war. Ihr Vater meinte es ernst. »Papa!«, rief Helen und warf sich neben Mama auf den Boden, klammerte sich an sein anderes Hosenbein. Und da blieb er stehen. Er ging in die Knie und hob Helen vom Boden auf, nahm ihr Gesicht in beide Hände und sagte: »Du nicht, Prinzessin, du nicht!«
Zu Vera sagte er: »Wie tief kannst du noch sinken?« Er schüttelte sie beide ab, stieg mit einem großen Schritt über sie hinweg und zur Tür hinaus. Sie hörten seinen VW Käfer husten und knattern und schließlich davonfahren. Mama heulte auf wie ein Tier, kroch auf allen Vieren zur Tür und hämmerte mit den Fäusten dagegen. Helen wusste nicht mehr, wie es weitergegangen war, irgendwie war es weitergegangen.
Helen lauschte. Beide Zimmertüren standen offen. Sie konnte nachts nicht schlafen ohne das helle Flurlicht, das schräg in ihr Zimmer fiel. Mama machte ihre Tür manchmal nachts zu. Dann schlich sich Helen aus dem Bett und öffnete sie wieder, ganz leise. War ihre Mutter einmal eingeschlafen, konnte man sie kaum aufwecken. Häufig schnaufte sie dabei laut, trotzdem fühlte Helen sich besser, wenn ihre Zimmertür offenstand.
Es war so still, meist konnte sie die Nachbarn durch die dünnen Wände hören, ihren Fernseher, das Radio, ihre Stimmen. Frau Hofstetter auf der anderen Seite schrie immer ihren Mann an. Ihre Mutter sagte, das sei, weil er nicht mehr gut hörte. Er schrie nie zurück.
Helen stand auf. Auf dem Bettrand lagen ihre Kleider ausgebreitet wie die einer Papierpuppe. Neben dem Bett standen die neuen Pantoffeln, die sie mitbringen musste, und die kleine Tasche aus rotem Leder, die sie mit einem Fix-und-Foxi-Aufkleber verziert hatte. Er saß ein wenig schief.
Vor einem Jahr hätte Helen schon den Kindergarten besuchen sollen, zusammen mit ihrer Freundin Susanne, die damals an derselben Straße wohnte. Doch Mama hatte sie zurückbehalten. Helen hatte sich das Wort gemerkt. Mama hatte sie zurückbehalten, bei sich behalten. Weil Papa nicht mehr da war und sie tagsüber nicht allein sein wollte. Aber vielleicht war es auch, weil sie jetzt morgens immer sehr lange schlief. Sie holte immer mehr Weinflaschen aus dem Keller und trank sie ganz allein aus. Früher hatte Papa ihr dabei geholfen. Doch seit Papa weg war, war alles anders. Mama war jetzt immer müde, lachte nicht mehr und tanzte nicht mehr. Sie nannte Helen nicht mehr »mein Mädchen«. Sie kochte nicht mehr, bügelte nicht mehr, fegte den Küchenboden nicht mehr. Helen versuchte verzweifelt, die Handreichungen, die sie so oft beobachtet hatte, aus dem Gedächtnis nachzuahmen. Sie hatte Mama doch immer geholfen, sie war ihr durchs Haus gefolgt wie ein Hündchen, von oben nach unten, von einem Zimmer zum nächsten. Sie wusste genau, was Mama jeden Tag getan hatte: lüften, Betten machen, abstauben, staubsaugen … Aber wenn sie es allein versuchte, konnte sie es nicht.
Und dann sagte Papa, sie könnten das Haus nicht länger halten. Das war Mamas Beruf, das Haus zu halten. Das sagte sie doch immer. Wie sehr sie es liebte, das Haus zu halten, und dass es nichts gäbe, was sie lieber tun würde. Aber offenbar nur, wenn Papa auch in dem Haus war. Helen allein war nicht genug.
Statt einem Haus, das sie nicht halten konnten, hatten sie nun zwei Wohnungen, eine in der Siedlung und eine in der Nähe von Papas Arbeit. Das war kein guter Tausch, fand Helen. Papa hatte beim Umzug geholfen. Er hatte an den Türen geklingelt und sich den Nachbarinnen vorgestellt. Alle mochten ihn. Sie kannten ihn vom Fernsehen und waren ganz aufgeregt, ihn persönlich kennenzulernen. Auch deshalb ging Helen nicht gern in den Hof hinunter zum Spielen oder zu den anderen Kindern nach Hause. Wegen der Mütter. Ständig fragten sie nach ihrem Papa. Wie es ihm ginge und wann er wiederkäme. Vielleicht war das auch der Grund, warum Mama nur noch selten die Wohnung verließ.
Papa kam oft vorbei, aber immer nur kurz und nie dann, wenn er es versprochen hatte. Er hatte die Lampen in der Küche montiert und den Bücherschrank an die Wand geschoben. Er öffnete die Briefe von der Bank und vom Steueramt, er legte die Rechnungen in ordentlichen Stapeln auf den Küchentisch und half Mama, die Einzahlungsscheine auszufüllen. Manchmal ließ er auch Geld auf dem Tisch liegen, zerknitterte Noten, die Mama mit der Handkante glattstrich als wären es Briefe.
»Natürlich liebt er uns noch«, sagte Mama. »Er braucht nur etwas Abstand. Das tut jeder Beziehung gut. Und dein Vater ist nun mal ein Freigeist.«
Jetzt hörte sie eine Tür schlagen, das Getrampel von Füßen im Hausflur, die laute Stimme von Frau Huber. »Dani, deine Turnsachen! Barbie, die Jacke!« Ihre Stimme war schrill. Wie ein Messer, das auf dem Teller abrutschte. Frau Huber hielt sich für etwas Besseres, sagte Mama immer.
Der Kindergarten begann später als die richtige Schule, wusste Helen. Aber wie viel später? Sie würde sich besser auch langsam bereit machen. Auf Sockenfüßen schlich sie zu Mamas Zimmer, doch sie ging nicht hinein. Sie blieb in der Tür stehen, mit sicherem Abstand zum Bett. Ihre Mutter hatte die Decke abgeworfen. Sie trug noch das Kleid vom Vorabend, das Gelbe mit den dicken, weißen Blumen, das Helen so gern mochte. Jetzt war es ganz zerknittert.
»Mama, Mama!«, rief sie vom Türrahmen aus. »Wach auf!« Ihre Mutter seufzte und drehte sich um, aber sie öffnete nicht die Augen. Ihr schönes Kleid hatte vorne einen großen, dunklen Fleck. Schon gefiel es Helen nicht mehr. Sie drehte sich um und ging in ihr eigenes Zimmer zurück. Sie zog sich fertig an, wusch sich die Hände im Bad, fuhr sich mit der Bürste durch die Haare. Eigentlich müsste sie auch die Zähne putzen, aber das war ihr jetzt zu viel. Helen nahm die neue Kindergartentasche vom Stuhl und legte sich den Riemen quer über die Brust. Die Tasche war leer. Sie versuchte sich zu erinnern, was ihre Mutter gestern gesagt hatte. Musste sie etwas mitbringen? Etwas zu essen? Hatte Mama etwas für sie vorbereitet?
Sie öffnete den Kühlschrank. Die Auswahl war nicht groß. Den offenen Milchkarton konnte sie nicht gut einpacken. Sie öffnete alle Klappen und zog an allen Schubladen, bis sie etwas fand, das sie einstecken konnte. Dann schlüpfte sie in ihre Gummistiefel, die einzigen Schuhe, die sie allein anziehen konnte. Im Kindergarten würde sie lernen, ihre Schuhe zu binden. Das hatte Frank ihr erzählt, der es wiederum von den älteren Kindern wusste, die im Hof spielten. Frank war ein Jahr jünger als Helen, aber er wusste mehr als sie. Frank war ihr Freund.
Sie trat in den Flur hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Einen eigenen Schlüssel hatte sie nicht. Aber ihre Mutter war ja zu Hause. Sie würde aufwachen und sich erinnern. Vielleicht sogar rechtzeitig, um sie nach dem Kindergarten abzuholen.
Helens Plan war ganz einfach: Sie würde im Treppenhaus warten, bis Frank sich auf den Weg machte, und ihm folgen.
2.
Frau Esposito trug einen Regenmantel, der falsch zugeknöpft war, darunter schaute ihr Nachthemd hervor. Barfuß schlüpfte sie nur in ein Paar Gummistiefel, die neben der Tür standen. Schwarz mit einem kleinen Absatz. Lippenstift trug sie keinen, und die langen Haare waren zu einem strubbeligen Pferdeschwanz gebunden. Sie sah müde aus. Herr Esposito kam nicht wie die anderen Väter jeden Abend von der Arbeit nach Hause, sondern nur alle zwei Wochen. Dafür blieb er dann gleich ein paar Tage. Er fuhr einen Lastwagen. Alle zwei Wochen tönte Musik aus ihrer Wohnung und im Treppenhaus roch es tagelang nach Essen. Alle zwei Wochen föhnte Frau Esposito ihre langen Haare glatt, bis sie wie ein glänzender Vorhang über ihre Schultern fielen, und trug rosa Lippenstift auf. Alle zwei Wochen lachte sie.
Jetzt verschwand sie nochmal in der Wohnung und kam mit einem Deckenbündel zurück, in dem die kleine Maja schlief, die alle Meieli nannten. Den zweijährigen Marco hatte sie in eine Art Geschirr geschnallt, an dem ein Riemen befestigt war. Wie die Zügel der Ponys im Kinderzoo, dachte Helen. Frank hatte sich die Haare mit Wasser zurückgekämmt, seine Locken klebten am Kopf fest. Helen konnte die Linien sehen, die der Kamm gezogen hatte. Fragend schaute er sie an, hob stumm seine blaue Kindergartentasche hoch und zeigte ihr den Schlumpf-Aufkleber auf der Klappe.
Helen hob zur Antwort ihre rote Tasche hoch. Sobald sie Frank sah, fühlte sie sich besser. Wenn sie mit ihm zusammen war, konnte ihr nichts passieren.
»Kommst du mit uns?«, fragte Frau Esposito und Helen nickte. Sie stellte keine weiteren Fragen. Wo ist deine Mutter, zum Beispiel. Bist du ganz allein? Weiß deine Mutter denn nicht, dass heute der Kindergarten beginnt?
»Halt mal«, sagte sie nur und reichte ihr die Riemen, die an Marcos Geschirr befestigt waren. Dieser scharrte mit den Füßen wie ein richtiges Pferdchen.
Im Erdgeschoss musste Frank mit dem Kinderwagen und der Tür helfen. Frau Huber hatte Unterschriften gesammelt gegen das Abstellen des Kinderwagens im Eingang. Helens Mutter hatte sich geweigert, zu unterschreiben. Sie hatte Frau Huber etwas von Frauensolidarität erzählt und dass sie sich schämen sollte und ihr dann die Tür vor der Nase zugeschlagen. Das hatte sie bei den anderen Müttern nicht gerade beliebter gemacht.
Endlich zogen sie los. Eine Mutter mit vier Kindern. Kein ungewöhnlicher Anblick in der Siedlung. Auch ganz allein würde Helen schon morgen nicht mehr auffallen. Nur am ersten Tag wurden die Kinder von ihren Müttern begleitet.
Die älteren Jungen rannten über die Straße, ohne das grüne Männlein abzuwarten, manchmal blieben sie nicht mal auf dem gelben Streifen. Helen beobachtete solches Verhalten mit Interesse. Man musste sich schon sehr sicher fühlen, um so etwas zu tun. Helen blieb lieber auf dem Gehsteig.
Als sie vor dem Kindergarten ankamen, wartete Fräulein Imbach, die Kindergärtnerin, ungeduldig vor der offenen Tür. Von weitem sah sie jung und lustig aus, mit bunten Ringelstrümpfen unter dem kurzen Rock und langen, schwarzen Haaren, die seitlich zu wippenden Zöpfen gebunden und mit roten Bommeln geschmückt waren. Doch je näher sie kamen, desto älter und missmutiger wirkte sie. Tiefe Linien zogen sich um ihren Mund wie bei einem Clown. Scheu duckte Helen sich hinter den Kinderwagen.
»Da seid ihr ja endlich«, rief Fräulein Imbach. »Du musst wohl Franco sein.«
»Ich heiße Frank.« Sein Vater hieß Franco, das hatte Frank mal erzählt, ganz leise, als sei es ein Geheimnis. Und dass er Italiener sei. Das wusste Helen aber schon.
Fräulein Imbach schaute auf ihre Liste. »Frank, also. Und du bist die Helen?«
Helen nickte schüchtern.
»Dann mal rein mit euch, ihr seid die Letzten.« Durch die offene Tür konnte Helen in den Raum sehen. Kleine Stühle waren im Kreis angeordnet, auf jedem saß ein Kind und hinter jedem Stuhl stand eine Mutter. Frau Esposito würde sich also nicht vor der Tür von ihnen verabschieden, nein, sie würde mit hineinkommen und hinter Franks Stuhl stehen. So dass alle sehen konnten, wer zu wem gehörte und wer niemanden hatte, nämlich sie. Helen.
Doch dann fing Meieli an, zu weinen und Marco stimmte mit ein. Frau Esposito schaute nach rechts und nach links, knöpfte das Verdeck des Kinderwagens auf und machte Anstalten, Meieli hinauszuheben. Fräulein Imbach nahm Helen und Frank an der Hand.
»Sie können gerne gehen, Frau Esposito, wir kommen schon zurecht.« Es klang nicht besonders freundlich. Fräulein Imbach ging schnell, die Kinder mussten laufen, um mitzukommen, Helens Handgelenk schmerzte im harten Griff.
»Hier könnt ihr eure Schuhe wechseln.« Sie zeigte auf die letzten beiden Haken ganz am Ende der Wand. Frank setzte sich hin und nahm seine Pantoffeln aus der blauen Tasche.
Die Pantoffeln! Sie hatte die Pantoffeln vergessen, die Mama extra für den Kindergarten gekauft und zusammen mit ihren Kleidern für heute bereitgelegt hatte. Sie waren schwarz getupft und hatten einen roten Bommel. Und Helen hatte sie unter ihrem Stuhl stehen lassen. Sie biss sich auf die Lippen, um nicht zu weinen.
Jetzt kam es. Es musste ja kommen: »Und wo ist deine Mutter?«
»Sie ist krank.« Ohne zu überlegen sagte sie das. Zum ersten Mal. Mit der Zeit würde sie es fast selbst glauben: Ihre Mama war krank. Schließlich lag sie hinter heruntergelassenen Läden im Bett und stöhnte im Schlaf.
»Krank, so.« Fräulein Imbach schien ihr nicht zu glauben. »Und die Hausschuhe hast du auch nicht?«
Stumm schüttelte Helen den Kopf. Fräulein Imbach nickte ein paar Mal. Ihre Lippen bewegten sich, als wollte sie etwas sagen.
»Nimm meine«, sagte Frank. Er rutschte auf der Bank zu ihr hinüber, streifte seine Pantoffeln ab und schob sie ihr hin. Dankbar schlüpfte sie hinein. Sie waren aus dunkelblauem Kordsamt und ein bisschen zu groß für sie. »Jungshausschuhe«. Franks Socken hatten Löcher, auf einer Seite schaute sein großer Zeh heraus, doch das schien ihn nicht zu kümmern. Er stand auf und nahm Helens Hand. Ohne Fräulein Imbach weiter zu beachten, zog er sie in den Kindergarten hinein, an den Kindern und Müttern vorbei zu den letzten beiden freien Stühlen.
3.
Frau Esposito kam zu spät. So lange Franks Mutter noch nicht hier war, dachte Helen, konnte ihre ja auch noch kommen. Während sie vor dem Kindergartentor warteten, hörten sie Fräulein Imbachs aufgeregte Stimme und dazwischen die der anderen Mütter.
»… etwas unternehmen«, hörten sie. »Nie erlebt.« Und immer wieder »Zwiebel!«.
Helen wollte sich die Ohren zuhalten, aber Frank hielt ihre Hand und ließ sie nicht los. Sobald sie Frau Esposito an der Ampel entdeckten, rannten sie ihr entgegen. Sie fragte nicht, wie der erste Tag gewesen war, sie drückte ihnen je eine Einkaufstasche in die Hand und sagte beiläufig zu Helen: »Du bleibst zum Mittagessen, ja?«
Jetzt musste Frank Helens Hand loslassen, um die Tasche entgegenzunehmen. Helens Hand fühlte sich verlassen an. Sie steckte sie in den Jackenärmel und schüttelte tapfer den Kopf. »Meine Mutter wartet mit dem Essen auf mich«, behauptete sie. Herausfordernd schaute sie Frau Esposito an. Doch diese dachte nicht daran, ihr zu widersprechen und nickte nur. Meieli fing wieder an zu weinen, Marco stimmte mit ein. Helen vermutete allerdings, dass er nur so tat. Seine Augen blieben trocken und er schielte immer wieder zu seiner Mutter hinüber, die sich um Meieli bemühte. »Du saugst mich noch ganz aus«, sagte sie. Das sagte Helens Vater auch manchmal, in demselben erschöpften Ton, allerdings zu ihrer Mutter. Helen wunderte sich.
Dann setzte sich Marco einfach auf den Boden, mitten auf dem Gehsteig, und brüllte mit weit aufgerissenem Mund. Helen konnte sein Halszäpfchen sehen. Eine Frau, die einen Einkaufswagen aus kariertem Stoff hinter sich herzog, sagte ganz laut: »Immer diese Italos, missratene Tschinggenbande!« Jetzt hatte auch Frau Esposito Tränen in den Augen. Helen dachte, dass der Unterschied gar nicht so groß war. Zwischen ihrer Mutter und der von Frank.
Schließlich nahm Frau Esposito Meieli aus dem Wagen und hielt sie in einem Arm, während sie mit der anderen Hand die Leine festhielt, die an Marcos Gürtel befestigt war. Frank legte seine Einkaufstüte in den Wagen und bedeutete Helen, ihre dazuzulegen. Gemeinsam schoben sie den Wagen auf die andere Straßenseite, in die Siedlung hinein, und trugen ihn dann die Treppe in den zweiten Stock hinauf, was gar nicht so einfach war. Immer wieder kippte er, eine der Einkaufstüten fiel herunter und zwei große Kartoffeln kullerten die ganze Treppe hinunter. Helen wollte den Kartoffeln nachjagen, als der ganze Wagen umkippte. Frank fluchte.
Frau Esposito war schon oben, sie hatte die Wohnungstür offen gelassen, sie konnten Meieli schreien hören. Dann verstummte das Schreien abrupt, als ob man auf einen Knopf gedrückt hätte.
»Weißt du, wo die Milch herkommt?«, fragte Frank.
»Aus der Packung«, sagte Helen. Manchmal war Frank wirklich komisch.
»Aus meiner Mutter«, sagte Frank. »Ich schwörs!« Sie sammelten die im Treppenhaus verstreuten Lebensmittel zusammen, legten sie wieder auf die gelbe, gehäkelte Wolldecke, und endlich schob Frank den Wagen in die Wohnung hinein. Er winkte Helen, ihm zu folgen, und hielt einen Finger an die Lippen: Sie musste still sein. Wie zwei Einbrecher schlichen sie den Flur entlang und blieben vor der Küchentür stehen. Marco saß in seinem Hochsitz und kaute an einer Brotrinde. Dicke, feuchte Krümel klebten in seinem Gesicht und auf seinen Händen. Helen ekelte sich ein bisschen. Dann sah sie Frau Esposito. Sie saß auf der Fensterbank, ein Bein anzogen, Meieli im Arm. Sie hatte ihre Bluse aufgeknöpft und den Büstenhalter nach oben geschoben, so dass man ihre Brüste sehen konnte. Sie waren größer als die von Vera und dunkler, die Brustwarzen waren riesig und fast schwarz. Aus einer tropfte eine durchsichtige Flüssigkeit, die andere steckte in Meielis Mund, die mit geschlossenen Augen daran sog und zufrieden schmatzte. Frau Esposito verzog ein wenig das Gesicht. Das musste doch wehtun, dachte Helen. Beim Spielen hatte sie ihrer Mutter mal den Ellbogen in die Brust gerammt, und sie hatte aufgeschrien. Vera trug allerdings auch keinen Büstenhalter, das fand sie überflüssig.
Auch das unterschied sie von den anderen Müttern. Dass ihre Brüste nicht steif und spitz unter der Kleidung vorstanden, sondern weich und rund waren und sich auf und ab bewegten.
Sie musste nach ihrer Mutter sehen, also schlich sie ebenso leise wieder aus der Wohnung, wie sie gekommen war, bevor Frau Esposito sie bemerkt hatte. Frank folgte ihr.
»Was hab ich gesagt?«
»Das wusste ich schon lange«, behauptete Helen. »Jedes Kind weiß das!« Sie hatte es satt, dass Frank so viel mehr wusste als sie, obwohl er ein Jahr jünger war. Deshalb fragte sie auch nicht, warum die Milch aus Frau Espositos Brust nicht weiß war wie die aus der Flasche, sondern durchsichtig. Langsam ging sie die Treppe hinauf. Ihre Füße wurden mit jedem Schritt schwerer, bis sie sie gar nicht mehr anheben konnte. Helen setzte sich auf die Stufe. Frank war ihr gefolgt und setzte sich neben sie. Manchmal ging er ihr wirklich auf die Nerven. Doch wegschicken mochte sie ihn auch nicht. Und als er ihre Hand in seine nahm, fühlte sie sich wieder etwas besser. So saßen sie einfach da, auf der Treppe, ohne zu reden.
Bis plötzlich Helens Vater an ihnen vorbeirannte. Er nahm zwei Stufen auf einmal, rannte so dicht an ihnen vorbei, dass er sie beinahe getreten hätte, und doch sah er sie nicht. Erst drei Stufen weiter oben blieb er stehen und rief: »Da bist du ja, Prinzessin!« Er kam zurück, hob sie hoch und trug sie in den vierten Stock hinauf. Dort setzte er sie ab und begann, an die Tür zu poltern, was Helen unnötig fand. Sie hatten schließlich eine Klingel.
Sie hörten, wie sich die anderen Türen im Stockwerk öffneten, Frau Hofstetter fragte, ob etwas passiert sei, und Frau Huber erkundigte sich scheinheilig, ob Vera etwa krank sei. »Helen ist heute früh ganz allein in den Kindergarten gegangen, ihre Mutter haben wir heute noch gar nicht gesehen!«
»Stimmt gar nicht, ich bin mit Frank gegangen«, korrigierte Helen, öffnete die Tür und schlüpfte hinein. Sie musste sich beeilen, musste ihre Mutter finden, dann könnte sie das Schlimmste vielleicht noch verhindern. Doch plötzlich konnte sie sich kaum mehr bewegen, ihre Arme und Beine waren wie aus Stein. Sie musste ihren Vater vorbeilassen, schloss die Tür und lehnte sich einen Moment dagegen. Aber die Nachbarinnen würden auch so alles hören.
Schon ging es los.
»Was hast du dir dabei gedacht?«
»Ich bin einfach so erschöpft, es ist alles zu viel«, weinte Vera. Immerhin: Sie hatte sich angezogen. Und in der Küche roch es nach geschmolzenem Käse – Käseschnitten, dachte Helen, sie hat Käseschnitten gemacht. Das war ihr Lieblingsessen. Heute Morgen war noch nichts im Kühlschrank gewesen. Ihr Mutter musste also auch eingekauft haben. Sie hatte die Wohnung verlassen! Frau Huber war eine Lügnerin!
Helen gab sich einen Ruck. Sie rannte in die Küche und umarmte ihre Mutter und strahlte ihren Vater so breit an, dass ihr die Lippen wehtaten.
»Papa, Papa!«, rief sie als habe es die letzten fünf Minuten nicht gegeben. »Papa, ich war im Kindergarten und wir haben ein neues Lied gelernt und Frank hat mir seine Hausschuhe gegeben!«
Luc blies die Backen auf und schüttelte den Kopf. Schließlich zog er seinen Regenmantel aus und setzte sich auf einen der freien Stühle. Vera zog das Blech aus dem Ofen, der Käse auf den Brotscheiben war perfekt gebräunt, und man konnte die kreisrunden Erhebungen sehen, wo Ananasscheiben unter dem Käse lagen. Diese waren speziell für sie. Ihre Mutter mochte Ananas nicht und legte saure Gurken auf ihre.
Jetzt stellte sie eine Holzschale mit Salat auf den Tisch und Luc mischte die grünen Blätter sorgfältig mit zwei großen Löffeln. Helen liebte dieses Salatbesteck. Die Griffe waren zu Nashörnern geschnitzt. Nur wegen dieser Griffe ließ sie sich überhaupt überreden, Salat zu essen. Vera schenkte Apfelsaft ein und setzte sich hin. Da stand Luc nochmal auf und holte eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank. Er öffnete den Schrank, in dem die Gläser standen und nahm zwei heraus. Helen hielt den Atem an, doch ihre Mutter schüttelte den Kopf.
»Nicht für mich, danke. Ich mach besser mal eine Pause.«
»Dann helf ich dir, die Versuchung zu eliminieren!«
Sie aßen die Käseschnitten und lachten über die endlos langen Fäden, die sich von den Gabeln zogen. Helen erzählte, wie sie mit Frank den Kinderwagen die Treppe hochgewuchtet hatten, und Vera regte sich einmal mehr über die anderen Mütter auf. »Können sie die Frau nicht in Ruhe lassen? Das machen die nur, weil sie einen Italiener geheiratet hat«, sagte sie. »Reine Schikane!«
Über das Wort dachte Helen noch länger nach. Schikane. Eine schicke Frau, dachte sie, die die anderen plagt. Frau Huber war eine Schikane. Fräulein Imbach. Definitiv eine Schikane. Obwohl, wirklich schick war sie nicht. Mit ihren Ringelstrümpfen und Haarbommeln. Nicht wie ihre Mutter. Wenn ihre Mutter nicht krank war, war sie die schönste Frau, die Helen je gesehen hatte. Und die lustigste.
Luc trank die ganze Flasche leer, »wegen der Versuchung« und legte sich anschließend auf das schmale Sofa im Wohnzimmer, um Mittagsschlaf zu halten. Vera schickte Helen auf ihr Zimmer. Genau wie früher, in ihrem alten Haus, an den Tagen, an denen ihr Vater nicht arbeitete. Nur dass Helen damals noch kleiner gewesen war und selbst Mittagsschlaf hielt. Sie erinnerte sich, wie die Nachmittagssonne durch den orangefarbenen Vorhang in ihr altes Zimmer geschienen hatte. Manchmal dachte sie dann, das Haus stünde in Flammen, und begann zu schreien, bis Mama kam und sie aus dem Gitterbett hob. Dafür war sie jetzt zu groß. Helen setzte sich auf den Fußboden und zog ein Buch nach dem anderen aus ihrem Regal und blätterte es durch. Wenn sie nur schon lesen könnte! Sie versuchte, sich an die Worte zu erinnern, die ihre Mutter gebraucht hatte, als sie ihr die Geschichten vorgelesen hatte und die Worte mit den Buchstaben auf den Seiten zu verbinden. Es gelang ihr nicht, es war zu lange her. Sie musste sich die Geschichten selbst zusammensetzen, nur mit Hilfe der Bilder. Im Wohnzimmer machte ihr Vater sonderbare Töne. Doch dann hörte sie ihre Mutter lachen. Wie früher.
1980
1.
Helen saß auf dem Mäuerchen und ließ die Beine baumeln. Ihre Fersen schlugen gegen den Beton, sie würde das Leder abnutzen. Die Schuhe waren neu. »Collegeschuhe« nannten die anderen Mädchen diese Mokassins. Alle in ihrer Klasse trugen solche, allerdings aus glattem blauem Leder, nicht aus braunem Wildleder wie ihre. Helen hatte nie die richtigen Schuhe, Pullover, Haarschnitte, geschweige denn Jeans. Aber das kümmerte sie wenig. Sie interessierte sich nicht für die anderen Mädchen, deren Freundschaften ihr kompliziert und unberechenbar erschienen. Helen war ganz auf ihre Mutter ausgerichtet. Vera war wie ein Schiff auf hoher See, das geradewegs auf einen Eisberg zusteuern würde, wenn Helen sie auch nur eine Minute aus den Augen ließ. Es war an ihr, zu verhindern, dass ihre Mutter zerschellte. Und weil ihr die Meinung der anderen Mädchen in ihrer Klasse so offensichtlich egal war, ließen sie sie mehrheitlich in Ruhe. Helen wurde nicht ausgelacht wie andere Kinder aus der Siedlung, die abgetragene Cordhosen trugen oder ihre Haare nicht jeden Tag wuschen.
Im Turnunterricht hatte ihre Klassenlehrerin Frau Stein Helens blaue Zehennägel gesehen und ihre Mutter angerufen.
Als Helen an diesem Mittag nach Hause kam, stand Vera bereits im Mantel im Flur bereit. Sonst war sie um diese Zeit oft noch im Bett. Sie hatte die Lippen zusammengepresst und schaute Helen nicht an. Doch auf der Busfahrt in die Innenstadt zog sie erst zischend, dann immer lauter, über Frau Stein her, »ausgerechnet diese eingebildete Ziege!«, und anschließend über Luc. »Was bildet der feine Herr sich ein, uns einfach so sitzen zu lassen und dann nicht mal genügend Geld für neue Schuhe springen zu lassen! Ich sollte dich barfuß zur Schule schicken, sollte ich wirklich, dann würden mal alle sehen, wer hier der Abzocker ist, Abzocker und Betrüger, ha!«
Helen erkannte zwei Frauen aus der Siedlung und drei Mütter aus ihrer Schule, die im selben Bus saßen. Sie versuchte, sich unsichtbar zu machen. Sie duckte sich neben ihre Mutter. Aus der Nähe roch sie Veras vertrauten, etwas säuerlichen Geruch nach abgestandenem Wein und Schweiß und ein bisschen Parfüm. Ihr Gesicht war bleich und glänzte.
Abzocker und Betrüger hieß die Sendung, die Helens Vater moderierte. Darin warnte er die Konsumenten vor unseriösen Angeboten. Er trug eine Brille mit schwarzem Rahmen. Die Gläser waren nicht geschliffen, er setzte sie nur auf, um seriöser auszusehen. Die Sendung wurde nachmittags um vier ausgestrahlt, wenn offenbar alle Mütter vor dem Fernseher saßen. Die Lehrerinnen waren dann noch in der Schule, trotzdem kannten auch sie alle Luc Bertschi, den Beschützer der Konsumentinnen. Wenn er zu einer Theateraufführung oder zum Elternabend kam, summte das ganze Gebäude vor Aufregung. Und irgendwie erfuhr ihre Mutter immer davon. Helen wusste nicht, wie. Wenn sie es wüsste, würde sie es verhindern. Sie fing die Nachrichten der Schule an ihre Mutter ab, informierte sie weder über den Sporttag noch über den Besuchstag im Klassenlager noch über das Schultheater, in dem sie immerhin die zweitwichtigste Rolle gespielt hatte.
Helen versuchte, die Füße stillzuhalten, um die Schuhe, die so viel Aufregung verursacht hatten, nicht gleich wieder zu ruinieren. Mit dem Fingernagel kratzte sie hellgrüne Moosfetzen von der Mauer. Ihr Vater hatte ihr eine Überraschung versprochen. »Du wirst Augen machen, Lieblingstochter«, hatte er gesagt.
Ein Hund, dachte sie. Vielleicht war es ein Hund. Aber in ihrer Wohnung durften sie keine Haustiere halten, außer sie lebten in Käfigen, wie Hamster oder Wellensittiche. Vielleicht hatte er endlich den Wohnwagen gekauft, mit dem sie dann in den Sommerferien die Mittelmeerküste entlangreisen würden. Das hatte er ihr schon so oft versprochen. Mehrere Wochenenden hatten sie damit verbracht, die Verkaufsinserate in der Zeitung nach einem geeigneten Modell zu durchsuchen. Einem gebrauchten, denn neu waren sie zu teuer. Ein- oder zweimal waren sie auch zusammen irgendwohin gefahren, um sich ein Angebot anzuschauen. Aber irgendwie hatte es dann doch nie geklappt, entweder war der Wohnwagen zu teuer, oder die Besitzer hatten ihn schon verkauft.
»Warum gehen wir nicht einfach zelten?«, hatte sie einmal gefragt, aber keine befriedigende Antwort erhalten. Ihr Vater konnte ohnehin nie länger als eine Woche freinehmen. Heimlich war Helen froh darüber, ihre Mutter würde eine längere Abwesenheit nur schwer verkraften.
Als sie das letzte Mal nach einem verlängerten Wochenende mit ihrem Vater nach Hause gekommen war, hatte sie Vera nicht aufwecken können. Wie tot hatte sie neben dem Sofa auf dem Wohnzimmerteppich gelegen, in einer bereits angetrockneten Pfütze von Erbrochenem. Sie wollte schon die Notfallnummer wählen, die in der Mitte der Wählscheibe aufgedruckt war. Dann stellte sie sich vor, wie der Krankenwagen mit Blaulicht und Sirene in die Siedlung hineinfuhr, vor ihrem Eingang hielt, wie die Sanitäter mit einer Bahre die Treppe hinaufstürmten und alle Nachbarinnen in den offenen Wohnungstüren standen und glotzten. So war sie stattdessen zwei Treppen hinuntergerannt und hatte bei Frank Sturm geklingelt. Sein Vater, Franco senior, war gerade zu Hause, er hatte die Tür im Bademantel geöffnet, obwohl es bereits später Nachmittag war. Sie fürchtete sich ein wenig vor ihm, aber damit konnte sie sich jetzt nicht aufhalten.
»Herr Esposito, kommen Sie, meine Mutter …«
Er hatte sie in die Wohnung gezogen, wo Frank mit seinen jüngeren Geschwistern, Marco und Meieli, vor dem Fernseher saß. Dann kam Frau Esposito aus dem Schlafzimmer, sie zog sich einen Wollpulli über ihr Nachthemd und folgte ihrem Mann aus der Wohnung. Ihre Mutter war also nicht die Einzige, die manchmal mitten am Tag noch im Bett lag, dachte Helen. Man musste wohl verheiratet sein, um mit so einem Verhalten durchzukommen. Sie setzte sich zwischen Meieli und Frank, der stumm zur Seite rutschte. Im Fernsehen lief Unsere kleine Farm. Helen hatte die Mädchen in der Schule darüber reden hören, aber sie hatte die Serie selbst nie gesehen. Zu Hause sah sie selten fern. Sie musste sich schließlich auf ihre Mutter konzentrieren. Selbst jetzt war sie in Gedanken bei Vera und konnte der Handlung nicht richtig folgen. Immer wieder schaute sie zur Tür. Wie lange waren Franks Eltern schon weg?
»Was hat er gesagt?«, fragte Meieli immer wieder. »Warum sagt er das?« Bis Marco ihr ein Sofakissen über den Kopf zog.
»Seid doch mal still!«, rief Frank, der so angestrengt auf den Fernseher starrte, als wollte er hineinkriechen und Helen gleich mitnehmen. Er schaute sie nicht an, aber er hielt ihre Hand und drückte sie. Seine Hand war trocken und warm und tröstlich. Helen erinnerte sich wieder, wie er sie am ersten Tag im Kindergarten bei der Hand genommen hatte und wünschte sich, er würde sie nie mehr loslassen. Doch im nächsten Moment schon stürzte er sich schon in eine Kissenschlacht mit seinen Geschwistern. Helen rutschte ganz ans Ende des Sofas und starrte auf den Bildschirm, ohne etwas zu sehen.
Die Sendung war schon lange vorbei, als Herr Esposito endlich wieder herunterkam. Der Fernseher lief immer noch, etwas Langweiliges über Autobahnen. Niemand schaute mehr hin, aber sie schalteten das Gerät auch nicht aus. Der Fernseher lief bei den Espositos oft einfach so im Hintergrund, auch wenn gar niemand mehr zuschaute. Helen fand es beruhigend. In dieser Wohnung war es nie still. In dieser Wohnung musste man nie Angst haben.
»Du bleibst heute Nacht hier bei uns«, sagte Herr Esposito. »Meine Rita kümmert sich um deine Mutter. Keine Sorge, es geht ihr schon viel besser. Das wird schon wieder.« Dann klatschte er in die Hände. »So, wer hilft mir kochen?«
Sie machten Spaghetti mit Tomatensauce, und dann gab es dreifarbiges Eis. Rosa und grün und weiß mit bunten kandierten Früchten. Herr Esposito hielt ein großes Küchenmesser unter fließendes, heißes Wasser, bevor er den Eisblock in gleichmäßige Scheiben schnitt. Helen schlief auf dem Sofa. Am nächsten Morgen begleitete Frank sie nach oben. Ihre Mutter saß mit Frau Esposito am Küchentisch und trank Kaffee. Helen konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so früh schon wach gewesen war. Die Wohnung war sauber und aufgeräumt, es roch nach Putzmittel und Raumspray. In Helens Zimmer war das Bett gemacht und ihre Tasche ausgepackt. Die Bibliotheksbücher waren ordentlich auf ihrem Nachttisch aufgestapelt, ihre schmutzige Wäsche im Korb im Badezimmer, der Koffer unter dem Bett verstaut.
Vera trank ihren Kaffee und umarmte Frau Esposito, und dann war es auch schon Zeit für die Schule. Helen und Frank gingen wie immer zusammen, quer durch die Siedlung und dann die Hauptstraße entlang bis zur Kreuzung. Sie warteten an der roten Ampel, bis das Männchen grün leuchtete und rannten dann über Straße und ins Schulhaus hinein. Über die Geschehnisse des Vortags redeten sie nicht. Nicht an diesem Tag und auch sonst nie. Auch Franks Eltern erwähnten den Zwischenfall nicht wieder.
Jetzt schaute Helen auf die andere Straßenseite hinüber und sah eine Gruppe Jungen aus dem kleinen Laden kommen. Sie rempelten einander an, stolperten, einer ließ sein Eis fallen und jaulte auf, als sei er angeschossen worden. Die anderen lachten wiehernd. Einer lachte so sehr, dass er ebenfalls sein Eis fallen ließ, was noch mehr Geheul und Gezappel hervorrief. Und dann rannten sie wie auf Befehl plötzlich alle los, quer über die Straße, ohne das grüne Licht abzuwarten.
Jungs, dachte Helen. Jungs waren richtig mühsam. Das fiel ihr allerdings erst seit Kurzem auf. Selbst Frank ging ihr jetzt oft auf die Nerven. Allerdings war er nur doof, wenn er mit den anderen Jungen zusammen war. Seit einem halben Jahr war es auch nicht mehr denkbar, dass Mädchen mit Jungen befreundet waren. Deshalb taten Frank und sie in der Schule so, als kannten sie sich kaum. Doch zu Hause, in der Siedlung, war alles wie immer. Sie verbrachten jede freie Minute miteinander und erzählten sich alles. Sie waren beste Freunde, heimliche beste Freunde.
Frank kannte sie zu gut, dachte Helen jetzt. Er kannte ihre Mutter, wenn sie weinte, wenn sie mit Gläsern warf, wenn sie fröhlich war, wenn sie Pfannkuchen durch die Luft wirbelte und mit der Bratpfanne auffing, wenn sie im Flur lag, in einer Pfütze von Erbrochenem, das Nachthemd über die Schenkel hochgerutscht. Vielleicht war es gut, dass sie nächstes Jahr nicht mehr dieselbe Klasse besuchen würden. Frank kam in die 4a zu einer neuen Lehrerin, die noch niemand kannte. Sie sei jung, hieß es, und hübsch. Helen hingegen kam in die 4b, zu Herrn Wegmann, den alle fürchteten. Er galt als streng und altmodisch, man hörte Geschichten über ihn. Die jüngeren Lehrerinnen riefen ihn zu Hilfe, wenn die Jungen nicht gehorchten. Es hieß, er habe mehr als ein Lineal auf einem Schülerkopf zerbrochen. Aber Helen freute sich gerade seinetwegen auf die vierte Klasse.
Herr Wegmann interessierte sich nicht für Mütter. Er hielt nur einen Elternabend im Jahr ab. Es interessierte ihn nicht, wie seine Schüler lebten, mit wem und warum.
2.
Die Trennung ihrer Eltern war jetzt sechs Jahre her. Und Vera glaubte immer noch, es sei nur vorübergehend, die Scheidung existiere »nur auf dem Papier.« Das war ein Problem. Und es war bestimmt zum Teil auch Helens Schuld. Weil sie ihrer Mutter nie etwas von den wechselnden Frauen erzählte, die sie an den Wochenenden in den ebenfalls wechselnden Wohnungen ihres Vaters antraf. Allerdings blieben diese auch nie lange. Kaum hatte Helen sich an eine gewöhnt, war sie auch schon wieder weg. Darauf folgte eine kurze Phase, in der sie ihren Vater wieder öfter sah, in der er auch ab und zu in der Siedlung auftauchte, die Gerüchteküche anheizte und Veras Fantasien nährte. Dann sagte er plötzlich wieder ein Treffen nach dem andern ab, bis sie beim nächsten gemeinsamen Ausflug rein zufällig »einer guten Freundin« über den Weg liefen.
»Was für eine Überraschung!«, rief Luc. »Sollen wir zusammen ein Eis essen gehen?«
Dann bestellte er den Coupe Tête-à-tête mit drei Löffeln, die »gute Freundin« errötete und legte den Kopf schief. Als hätte diese Bestellung eine besondere Bedeutung. Helen wusste nicht, wie viele solche Eisbecher sie schon gegessen hatte.
Luc sagte jedes Mal dasselbe: »Meine Tochter ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Das muss eine Frau einfach akzeptieren.«
Bisher war noch keine aufgestanden und gegangen. Im Gegenteil, sie seufzten, sie nahmen Lucs Hand und bekamen ganz glänzende Augen. Manche versuchten auch, Helen übers Haar zu streichen, aber das sah sie schon kommen und wich ihren Händen aus. Als nächstes folgte dann Lucs Vortrag über das unfaire und veraltete Scheidungsrecht, das Mütter blind bevorzugte. Das hätte Helen hingenommen. Aber warum musste er Vera ins Spiel bringen? Musste er diesen ständig wechselnden Frauen erzählen, wie oft er sie betrunken vorgefunden hatte, wenn er Helen abholte. Und dass sie es nicht mal an Helens erstem Tag im Kindergarten fertiggebracht hatte, rechtzeitig aufzustehen, um sie zu begleiten.
»Da ist ein Riss, der mitten durch mein Herz geht«, seufzte er. »Eine Wunde, die nie verheilt!« Die Frau stand auf, ging um den Tisch herum, setzte sich neben Luc und begann ihn zu küssen. Und Helen fuhr mit der Löffelkante durch die geschmolzenen Eisreste, bis sich alles zu einem unappetitlichen Grau vermischt hatte.
Helen hatte sich auf eine längere Wartezeit eingestellt, doch keine Viertelstunde nach der verabredeten Zeit kündigte sich mit lautem Knattern Lucs blauer Käfer an. An der Ecke verlangsamte er und kam dann direkt vor ihr zum Stehen. Helen sprang vom Mäuerchen und hob ihren kleinen Koffer, den sie immer mitnahm, ihre Schulsachen und die Sporttasche herunter. Sicher war sicher. Jetzt wurde die Beifahrertür aufgestoßen und eine Frau stieg aus. Sie klappte den Sitz zurück, so dass Helen einsteigen konnte.
»Helen, erkennst du mich denn nicht mehr?« Helen schüttelte den Kopf, ohne genauer hinzusehen. Die Frau sah aus wie alle Frauen, die ihrem Vater seit der Trennung zu gefallen schienen: großgewachsen, dünne Beine, lange, glatte, dunkelbraune Haare. So ganz anders als ihre kurvige Mutter mit der schmalen Taille und den runden Hüften, mit ihrer weißen Haut und den wilden, rötlichblonden Locken. Erdbeerblond nannte man diese Farbe. Helen hätte auch gerne solche Locken, aber ihr Haar war glatt und dick wie das ihres Vaters.
»Komm schon, erinnerst du dich nicht? An die Zwiebel?« Jetzt lachte die Frau meckernd. Es war Fräulein Imbach. Ihre Kindergärtnerin. »Das hab ich in meiner ganzen Karriere nicht erlebt. Luc, weißt du noch, wie erschüttert ich damals war? Erschüttert und betroffen!«
Helen zog den Kopf ein und schlüpfte unter ihrem Arm hindurch auf den Beifahrersitz. Seit Jahren hatte sie nicht mehr an diesen Tag gedacht, ihren ersten Tag im Kindergarten. Gerade hatte sie sich etwas entspannt, da war es Zeit für die Frühstückspause gewesen. Die Kinder hatten sich in Zweierreihen aufgestellt, ihre Taschen aus der Garderobe geholt und ihren Proviant ausgepackt. Apfelschnitze, belegte Brote, in kleine Quadrate geschnitten und in Alufolie gewickelt, hier und da ein Beutel mit Nüssen und Trockenfrüchten. Ruthli hatte eine ganze Rolle Kekse dabeigehabt, die Fräulein Imbach sofort konfiszierte. Doch ihr Vortrag über gesunde Zwischenmahlzeiten war von johlendem Gelächter unterbrochen worden, als Helen ihre Zwiebel hervorzog. Es war das Einzige, das sie an diesem Morgen hatte finden können.
Jetzt rüttelte Fräulein Imbach an ihrer Sitzlehne, aber Helen rührte sich nicht. Auch nicht, als ihr Vater dreimal laut »Helen!« rief. »Helen, nun komm schon!« Sie tat, als hörte sie nichts. Schließlich musste Luc aussteigen und den Fahrersitz nach vorne klappen, damit Fräulein Imbach auf die unbequeme Rückbank klettern konnte.
»So haben wir uns kennengelernt«, fuhr sie unverdrossen fort. »Weißt du noch, amore? Ich habe dich angerufen, weil ich Helens Mutter nicht erreichen konnte, ich dachte schon, es sei etwas passiert. Ich wusste ja nicht, was damals bei euch los war. Ich hatte keine Ahnung! Ich heiße übrigens Kati. Jetzt musst du mich ja nicht mehr Fräulein Imbach nennen.« Wieder lachte sie dieses meckernde Lachen.
Amore, dachte Helen. Das sagte Frau Esposito zu ihrem Mann. Aber bei ihr klang es anders.
»Ja, so wars, so haben wir uns kennengelernt.« Jetzt schlang die Kindergärtnerin von hinten ihre Arme um Lucs Hals. »Ich wusste es sofort, wir gehören zusammen, aber du hast ein bisschen länger gebraucht, gell, Schatz?«
Schatz war noch schlimmer als amore, fand Helen. Und dann diese dünnen Arme. Wie Schlangen.
»Was ist denn mit Nicole?«, fragte sie. »Und Ursula, ich mochte Ursula.« Willkürlich zählte sie alle Frauennamen auf, die ihr in den Sinn kamen: »Bettina«, fuhr sie fort. »Esther, Kathrin und … wie hieß sie gleich, Anja?«
»Helen, das reicht jetzt!« Aber ihr Vater klang amüsiert, und immerhin hatte Fräulein Imbach ihre Schlangenarme zurückgezogen und aufgehört zu reden.
3.
Die Überraschung war ein Haus. Ein altes Haus wie aus einem Bilderbuch, mit weiß getünchten Wänden und dicken Holzbalken. »Ein Fachwerkhaus«, erklärte Papa. Es war das schönste Haus, das Helen je gesehen hatte. Schöner als das Haus in ihrem Kopf, selbst schöner als das, in dem sie früher gewohnt hatten. Und es hatte sogar einen großen Garten mit alten Bäumen und Blumenbeeten und einem Mäuerchen darum. Über das Mäuerchen hinweg sah man über sanfte grüne Hügel, aus denen irgendwo ein Kirchenturm ragte. Plötzlich hatte Helen das Gefühl, dieses Haus zu kennen. Hatte sie es in ihrem Kopf gesehen? War es das Haus, das ihre Mutter ihr beschrieb, wenn sie den »Neuanfang« heraufbeschwor? Sie drei in einem alten Haus auf dem Land, mit einem Holzofen und einem großen Garten …
»Hereinspaziert, meine Damen!« Die Haustür hatte eine schwere, eiserne Klinke. Aufgeregt drängte Helen sich hinein, rannte den schmalen, dunklen Flur entlang. In der Küche stand ein grüner Kachelofen. Aufgeregt zog Helen die Schuhe aus und schlitterte in Sockenfüßen über die glatten Holzdielen. Die Decken waren niedrig, die Fenster klein, die Wände dick. Das ganze Haus schien sie zu umarmen. Sie breitete die Hände aus und drehte sich im Kreis.
»Liebes Haus!«, rief sie. »Liebes, liebes Haus!«
Aus den Augenwinkeln sah sie ihren Vater und Kati lächeln. Sie hielten sich eng umschlungen.
»Willst du dein Zimmer sehen?« Kati nahm ihre Hand, als sei sie wieder fünf Jahre alt. Der harte Griff war derselbe, der ungeduldige Ruck an ihrem Arm. Helen dachte wieder an die Zwiebel in ihrer Tasche und an das hämische »Na, dann guten Appetit« der Kindergärtnerin und zog ihre Hand zurück. Luc packte Helen unter den Armen und hob sie auf seine Schultern.
»Autsch!«, schrie sie, als sie sich den Kopf an der niedrigen Decke stieß. »Autsch, Papa, pass doch auf!« Sie nannte ihn selten Papa, er bevorzugte Luc.
Ihr Zimmer war bereits eingerichtet. Bisher hatte sie bei Luc nie ein eigenes Zimmer gehabt, egal, wo er seit der Scheidung gewohnt hatte. Sie hatte immer auf dem Sofa geschlafen, unter einer Decke, die nicht mal eine richtige Bettdecke war. Diesmal war es anders. Dies war ein neues Leben, so viel verstand sie.
»Und, was sagst du? Hab ich zu viel versprochen?«
Sie schaute sich um. Es war, als hätte ihr Vater die Zimmer in ihrem Kopfhaus besucht und dann das schönste davon nachgestellt. Das Bett hatte verschnörkelte Pfosten, an denen bunte Tücher befestigt waren, fast wie ein Himmelbett. Auf dem Holzboden lag ein flauschiger Teppich, und eine ganze Wand war voller Bücher. Unter dem Fenster stand ein kleines Pult, mit ordentlich aufgereihten Buntstiften, so wie sie es mochte. Auf dem Bett saßen zwei Sasha-Puppen, ein Mädchen mit langem, blondem Haar wie sie und ein dunkelhaariger Junge.
Wie Frank. Nur ohne Locken.
Sie musste lachen. »Ich bin doch zu groß, um mit Puppen zu spielen«, sagte sie nachsichtig. »Ich komm ja schon in die vierte Klasse!«
»Oh, entschuldigen Sie bitte, junges Fräulein, mein Fehler!«
Es waren genau die Puppen, die sie sich gewünscht hatte, als sie noch kleiner war.
Zum Abendessen gab es gebratenes Huhn mit Ratatouille, ein französisches Gemüsegericht, das Helen nicht besonders schmeckte, aber der Name gefiel ihr.
»Ratatatatatatouille!«, rief ihr Vater und tat, als würde er mit einem Maschinengewehr um sich schießen. Die Küche war gemütlich und warm, und es roch gut. Der Holzofen knisterte, Kerzen flackerten, Luc öffnete eine Flasche Wein. Helen hielt den Atem an, aber Fräulein Imbach trank ihr Glas nicht mal ganz aus.
Helen bekam einen Hähnchenschenkel und durfte ihn mit der Hand essen. Mit den Zähnen knabberte sie die knusprige Haut ab. Sie hatte Hunger, merkte sie. Zu Hause konnte sie oft nicht richtig essen. Manchmal schlief Vera noch, wenn Helen mittags von der Schule kam, und wenn sie wach war, war sie schlecht gelaunt, hatte Kopfschmerzen oder weinte. Manchmal hatte sie Mittagessen gekocht, manchmal nicht. Manchmal wollte Vera mit Helen reden, sie ausfragen, doch sie hatte ja nur eine Stunde frei. Oft musste Helen mitten im Satz aus der Tür rennen, um wieder rechtzeitig zum Unterricht zu kommen. Am besten waren der Mittwoch und der Freitag, wenn sie nachmittags frei hatte. Dann machte es nichts, wenn sie erst um zwei Uhr zu Mittag aßen. Nach dem Essen trank Vera einen Kaffee und rauchte eine Zigarette. Dann ging es ihr bis zum Abend meist ganz gut. Sie fing nicht an zu trinken, bevor es draußen dunkel wurde. Manchmal ging sie abends aus und blieb dann die ganze Nacht weg.
Vera würde dieses Haus lieben, dachte Helen und schob den Gedanken sofort wieder beiseite. Auch die gleich darauffolgende Frage, wie sie das Ganze ihrer Mutter erklären sollte. Sie wollte immer ganz genau wissen, was Helen mit ihrem Vater unternommen hatte, ob er sie erwähnt hatte, ob andere Frauen da gewesen waren. Helen hatte gelernt, ihre Berichte zu beschönigen. Die Frauen verschwieg sie ganz, das verstand sich von selbst. Dinge, die ihr besonders Spaß gemacht hatten, den Kinobesuch, die Wanderung, den Streichelzoo, die Fahrt mit dem Tretboot auf dem See, das Picknick im Park, erwähnte sie nur beiläufig. Manchmal log sie, der Film sei langweilig gewesen, die Picknickdecke voller Ameisen und auf dem Boot sei ihr schlecht geworden. Aber das hier, das konnte sie nicht kleinreden. Dieses Haus, Fräulein Imbach, die bevorstehende Hochzeit, die Fernsehsendung. Kati hatte den Job im Kindergarten aufgegeben und würde zusammen mit Luc die Kinderstube moderieren. Die Sendung lief jeden Tag, in jedem Haushalt, in dem kleine Kinder lebten. Das ließ sich nicht verheimlichen. Helen musste ihre Mutter darauf vorbereiten, bevor eine der Frauen in der Siedlung etwas sagte.
»Wir brauchen deine Hilfe«, sagte ihr Vater jetzt. Helen schaute auf. Kati lächelte. Sie hatte den Kopf schiefgelegt und sah sie mit großen, glänzenden Augen an, als sei sie ein junger Hund aus dem Tierheim. Nichts hasste Helen mehr als diesen Blick.
Sie versteckte ihre Hände unter dem Tisch, bevor Fräulein Imbach nach ihnen greifen konnte, und zwang sich, zuzuhören. Was hatte sie verpasst? Wovon redete ihr Vater? Vom unfairen Scheidungsrecht, das die Väter benachteiligte? Das kannte sie ja schon.
»Nur ganz, ganz, ganz selten wird ein Kind nach der Scheidung dem Vater zugesprochen«, erklärte Luc. »Nur, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen. Das heißt, zum Beispiel, wenn die Mutter schwer krank ist, oder wenn sie sich aus irgendwelchen Gründen nicht richtig um das Kind kümmern kann. Wenn sie drogensüchtig ist, zum Beispiel. Oder Alkoholikerin.«
Da war das Wort wieder. Wie oft hatte Helen das schon gehört. Ihre Mutter war krank. Das sagte sie selbst auch immer, wenn jemand fragte. »Wo ist deine Mutter, warum ist sie nicht hier?« – »Meine Mutter ist krank.« Das war keine Lüge, hatte sie irgendwann verstanden. Vera war eine Alkoholikerin. Frau Stein hatte es gesagt und Frau Huber, die Mutter von Dani und Barbara. Manche Mädchen in ihrer Klasse hatten es gesagt: »Deine Mutter ist ein Alki.«
»Alkoholismus ist eine Krankheit«, hatte Frau Stein ihr erklärt. Aber die Leute behandelten Vera nicht wie eine Kranke. Sie redeten nicht über sie, wie sie über Retos Mutter redeten, die Brustkrebs hatte. Über sie wurde zwar auch getuschelt, aber anders.
»Und wenn ein Mann dann noch allein lebt und unregelmäßige Arbeitszeiten hat, dann kann er noch so ein hingebungsvoller Vater sein, das Kind bleibt bei der Mutter. Egal, wie unfähig die auch sein mag. Das ist die Situation.« Helen nickte ungeduldig. Das hatte sie schon so oft gehört. Und ihre Mutter war nicht unfähig, sie war … krank.
»Aber jetzt, jetzt wo meine Situation stabil ist«, fuhr Luc fort, »das Haus, die Sendung, du, Kati …« Fräulein Imbach hatte er zuletzt genannt, dachte Helen. Ob ihr das auch aufgefallen war?
»Es ist unsere einzige Chance«, wiederholte Luc, jetzt zu Helen gewandt. »Es liegt alles an dir.«
4.
Sie wusste nicht gleich, wo sie war. Die Sonne schien durch die bunten Tücher, die mit Reißnägeln an den Bettpfosten befestigt waren, dünne, gemusterte Seidenstoffe in leuchtenden Farben, die jetzt über Helens Gesicht tanzten. Es roch nach frischem Brot und nach Kaffee. Sie hörte Stimmen, sie hörte Musik. Jemand lachte. Eine Frau.
Fräulein Imbach, fiel es ihr wieder ein. Kati. Ihr Vater. Das neue Haus.
Der Plan.
Der Plan, der ohne sie nicht durchgeführt werden konnte. Sie hatten ihr alles erklärt, einmal, zweimal, dreimal. Während der Recherchen zu einer Sendung hatte Luc eine Sozialarbeiterin kennengelernt, die beim Jugendamt arbeitete und bereit war, ihm zu helfen. Zusammen hatten sie den Plan entworfen, sie hatte ihm genau erklärt, worauf es ankam. Was die Sozialarbeiterin sehen und hören musste, um ihren Bericht schreiben zu können. Dieser Bericht würde dazu führen, dass Helen bei ihrem Vater wohnen konnte. Wieder und wieder und wieder waren sie den Plan in allen Einzelheiten durchgegangen.
»Verstehst du, Kleines?«
Wieder und wieder und wieder.
Bis sie schließlich die Arme auf der Tischplatte verschränkt und ihren Kopf darauf gebettet hatte. Ihr Kopf war so schwer geworden, dass sie fürchtete, er würde abknicken wie eine Blume von ihrem Stil.
»Lass doch das Kind«, hatte Kati endlich gesagt. Helen erinnerte sich plötzlich, dass sie sich im Kindergarten gern im Puppenparadies versteckte, einer mit Tüchern verhängten Ecke unter dem Hochbett. Der Boden war mit weichen Kissen ausgelegt, die Vorhänge um das Hochbett herum waren so dick, dass die Stimmen aus dem großen Raum nur gedämpft hereindrangen. Es war immer halb dunkel. Den meisten Kindern wurde es dort schnell langweilig, und so hatte Helen das Puppenparadies meist für sich ganz allein. Und manchmal war Fräulein Imbach dann hereingekommen und hatte sich einfach zu ihr gesetzt, ohne etwas zu sagen, hatte eine Hand auf ihren Rücken gelegt oder ihr Haar gestreichelt. In diesen Momenten hatte Helen ihre Kindergärtnerin gemocht. Aber diese Momente waren selten gewesen.
Helen stand auf und ging in die Küche. Unter ihren nackten Füßen fühlte sich der Holzboden warm und schon vertraut an. Gerade zog Kati ein Blech aus dem rauchenden Holzofen.
»Ich habe Brot gebacken«, verkündete sie. Sie trug ein weißes Trägerkleid, das beinahe durchsichtig war. Ihre langen Haare waren ungekämmt, am Hinterkopf hatte sich ein kleines Nest gebildet. Luc kam herein, auch er war barfuß. Der Tisch war bereits gedeckt, mit blauen und gelben Tellern und Schüsseln, die wohl als Tassen dienen sollten. Helen merkte sich alles, jedes Detail für das Haus in ihrem Kopf. Sie glaubte noch nicht ganz, dass sie wirklich hier wohnen würde. Es kam ihr unwirklicher vor als der Dornröschenturm in ihrem Kopfhaus, oder das Zimmer, das wie eine Bibliothek eingerichtet war, in der ihre Lieblingsbücher immer vorrätig waren.
Das Brot war so hart, dass man es kaum schneiden konnte, und schmeckte wie aufgewärmter Karton. Das sagte jedenfalls ihr Vater. Er sagte es lachend, aber sein Blick war hart. So war Luc manchmal. Aus heiterem Himmel sagte er etwas richtig Fieses, aber in einem so fröhlichen Ton, dass man es nicht immer gleich merkte. Helen kannte das. Sie duckte sich und hielt den Atem an. Doch Kati war nicht Vera. Sie begehrte nicht auf, sie warf nicht mit Gegenständen. Sie weinte nur leise und schluchzte: »Ich hab das Rezept doch genau befolgt, und Vollkornschrot ist so gesund.«
Und so schimpfte Luc auch nicht weiter, legte den Arm um sie und zog sie an sich.
»Es liegt am Holzofen«, sagte er. »Da kannst du die Temperatur nun mal nicht bestimmen wie bei einem Elektroofen. Aber du gewöhnst dich schon daran.«
Dann wandte er sich an Helen: »Kati hat das Mehl selbst geschrotet.« Er zeigte auf die Ablage, wo mehrere Gläser voller Körner neben einer wuchtigen, hölzernen Mühle standen. »Sie macht alles selbst: Brot, Pasta, Joghurt, Kleider, Vorhänge – mit unterschiedlichem Erfolg.«
Kati schluchzte noch lauter, was Luc wieder zu verärgern schien. »Kati, nun geh und wasch dir das Gesicht, du erschreckst ja das Kind.«
Das stimmte gar nicht, Helen war nicht erschrocken. Aber sie würde ihrem Vater nicht widersprechen. »Komm mit, Lieblingstochter«, sagte er jetzt zu ihr. »Wir fahren zum Bäcker und holen uns was Essbares zum Frühstück.«
Als sie eintraten, klingelte eine Glocke über der Tür, und es wurde still. Die Gespräche im Café neben der Bäckerei verstummten, alle schauten zu ihnen herüber. Luc tat, als merkte er nichts, trat an die Theke und schaute sich alles ganz genau an.
»Was meinst du, Mädchen, nehmen wir einen Butterzopf?« Helen nickte, ohne aufzuschauen. Sie studierte die Auslage, die süßen Brötchen, mit Rosinen, mit Hagelzucker, mit Schokoladenstreuseln.
»Und einen Kuchen, warum nicht, es ist schließlich Sonntag!« Luc nahm sich Zeit, zeigte auf einen Marmorkuchen und dann auf einen Gugelhupf mit Zuckerguss, bevor er sich für den Apfelkuchen entschied. Die Verkäuferin hatte ganz rote Wangen vor Aufregung.
»Es stimmt also!«, rief sie. »Wir haben schon gehört, dass Sie hierherziehen wollen, aber wir wussten nicht, ob es auch stimmt. Vom Fernsehen! Nein, so etwas! Nein, so was aber auch!« Sie war noch aufgeregter als die Mütter in der Schule. Luc zwinkerte Helen zu. Aus der Nähe sah er müde aus, seine halblangen Haare waren zottelig und seine Augen geschwollen. Helen wusste nicht, was all diese Frauen an ihm fanden. Ihr gefiel Herr Esposito besser, der immer frisch rasiert war, gut roch und sich die Haare mit Gel aus der Stirn kämmte.
Die Bäckerin packte ihre Einkäufe ein und legte noch ein paar Brötchen oben in die Tüte. »Es wird ihnen gefallen bei uns, Sie werden sehen. Wir haben viele Städter hier, die wollen gar nicht mehr zurück.«
»Oh, das bezweifle ich nicht! Das ist übrigens meine Tochter Helen.« Er schob sie sanft vor, Helen lächelte schüchtern.
»Ich sage Ihnen, für Kinder gibt es nichts Besseres«, nickte die Frau. »Die Leute ziehen allein schon wegen unserer neuen Schule hierher.« Nun kam sie hinter der Theke hervor, drückte Luc die Tüte in die Hand und ließ erst wieder los, als die Tür klingelte.
»Frau Müller, Marianne!« Die Bäckerin winkte den Eintretenden zu, einer jungen Frau in einem bodenlangen Kleid und einem dunkelhaarigen Mädchen in Helens Alter.
»Das sind Luc und Helen Bertschi. Sie sind gerade hierhergezogen. Helen kommt nächstes Jahr in deine Klasse«, sagte sie zu dem Kind. »Du kommst doch in die vierte, nicht? Zum Fräulein Schneider?«
Marianne nickte. Sie schaute Helen prüfend an, dann lächelte sie schüchtern. Sie hatte große Schneidezähne und eine metallglänzende Zahnspange. Ihr dunkles Haar war kurz, die Stirnfransen sahen aus, als hätte sie sie selbst geschnitten. Helen dachte an die Puppen in ihrem neuen Zimmer, und dass dieses Mädchen der Jungenpuppe ähnlicher sah als Frank. Jetzt trat die Mutter vor und schüttelte Lucs Hand. »Ich bin Susi, ich bin die Bibliothekarin hier. Und du – dich kenn ich doch! Vom Fernsehen?«