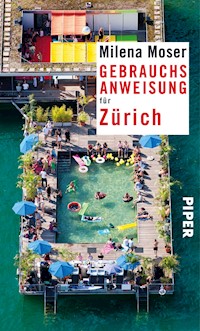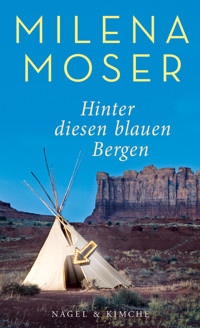9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nagel & Kimche
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen in der Mitte ihres Lebens, beide in der Krise. Nevada ist krank und lernt gerade damit umzugehen. Immer noch unterrichtet sie Yoga und das so erfolgreich, dass ihr eine Klasse mit schwierigen, absturzgefährdeten Mädchen anvertraut wird. Erika dagegen beschließt angesichts ihres Versagens als Mutter und Ehefrau das zu tun, was ihr niemand zutraut: Sie verlässt ihr luxuriöses Zuhause am Zürichberg und zieht in eine heruntergekommene Vorstadtsiedlung. Dort lernt sie Nevada kennen, die unverhofft von der großen Liebe erwischt wird. Mit Witz, Verve und voller Zuneigung lockt Moser ihre Figuren durch existentielle Höhen und Tiefen. Eine intensive Liebesgeschichte rund um Schmerz, Krankheit und Trennung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nagel & Kimche E-Book
Milena Moser
Das wahre Leben
Roman
Nagel & Kimche
© 2013 Nagel & Kimche
im Carl Hanser Verlag München
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann
ISBN 978-3-312-00587-1
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Umschlagmotiv: Spiegelbild, © Gabriele Latzke, Euskirchen
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Die Kriegerinnen
Die Mädchen standen im Krieger. Stämmige Beine, Knie gebeugt, Arme hochgereckt, zitternde Hände, grimmige Mienen.
«Noch einmal», sagte Nevada. «Einatmen: ein-, zwei, drei – und ausatmen: aus-, zwei, drei.»
Mit beiden Händen trieb sie den Rollstuhl zwischen den Yogamatten hindurch, drückte da ein Knie tiefer, zog hier eine Hand höher. Nevada dachte an ihre erste Stunde mit diesen Mädchen zurück. Sie hatte nicht gewagt, sie anzufassen. Drei Wochen später hatte das tägliche Üben sie einander nähergebracht. Der Saal war überhitzt, Schweißgeruch hing in der Luft.
Sie wusste, dass sie heute eine bessere Yogalehrerin war als vor dem Ausbruch ihrer Krankheit. Wenn sie nicht müde war, wenn sich die Schmerzen an den Rand ihres Bewusstseins zurückgezogen hatten. Die Krankheit hatte sie gelehrt, dass es um die Wirkung einer Übung geht, um ihren Inhalt und nicht um die Form. Diese Wirkung konnte auf viele Arten erzielt werden. Statt sich auf den Kopf zu stellen, konnte man sich auch einfach im Rollstuhl nach vorne beugen und den Kopf über die Knie hängen lassen.
Früher hatte sie ihren Anspruch, den Körper zu beherrschen, auf ihre Schüler übertragen. Sie hatte ihnen vorgemacht, dass die Ausführung einer schwierigen Asana eine Leistung war, die sie auszeichnete. Eine Leistung, die belohnt würde. Sie hatte das Unmögliche von ihnen verlangt. Diese innere Stimme, die sie antrieb, solange sie denken konnte, und der sie nie genügte, war verstummt. Die Krankheit hatte sie zum Schweigen gebracht.
Der Stuhl war schmal und wendig. Ihre erste Stunde hatte sie noch auf Krücken gegeben. Damals war sie kaum aufgestanden. Sie war den Mädchen nicht nähergekommen. Der Stuhl war eine echte Hilfe, gestand Nevada sich ein, wenn auch ungern.
Sie rollte zwischen den schwitzenden Kriegerinnen hindurch. «Bildungsferne Umgebung», hatte die Schulpflegerin gesagt. «Kulturell bedingte Verhaltensauffälligkeiten», die Sozialarbeiterin.
«Wir müssen die Jugendlichen erwischen, bevor sie ganz aussteigen», sagte der Schulleiter, der sich diesen Versuch ausgedacht hatte und einer ihrer langjährigen Yogaschüler war. «Solange sie noch in der Schule sind. Bevor sie durch alle Maschen fallen.»
Was heißt bildungsfern?, wollte Nevada fragen. Was heißt verhaltensauffällig? Nevada war am Zürichberg aufgewachsen, sie hatte das Gymnasium besucht, nicht lange zwar, aber immerhin. Trotzdem wusste sie, wie es sich anfühlte, durch die Maschen zu fallen. Durch die Maschen fiel man in einem unbeobachteten Moment. Vielleicht war das ihre eigentliche Aufgabe: diese Mädchen im Blick zu behalten.
Rebecca, siebzehn, magersüchtig, die dünnen Arme bedeckt von Schnittwunden, kurze Striche in ordentlichen Reihen, die älteren schon weiß verblasst, die neueren rot leuchtend. Rebecca hielt die Stellung perfekt, obwohl sie kaum noch Muskeln hatte. Oder Fleisch. Als Einzige schwitzte sie nicht, sie lächelte beifallheischend, als Nevada an ihr vorbeikam. Nevada vermied es, sie zu berühren, sie fürchtete, die spröden Knochen würden unter ihren Händen brechen.
Deniz, Zahnspange, rosa Plastikschmetterlinge in den Haaren, vierzehn Jahre alt, im zweiten oder dritten Monat schwanger. Nevada legte eine Hand auf ihren Schenkel und drückte ihn in den rechten Winkel. Tief im weichen Fleisch zitterte ein Muskel.
«Und noch einmal: ein-, zwei, drei …»
Die Mädchen stöhnten. Arme schwankten in der Luft wie Schilf. Gebeugte Knie streckten sich unwillkürlich wieder, Oberschenkel zitterten. Elma, in der hintersten Reihe, Schultern aus Stahl. Bei der geringsten Berührung würde sie ausschlagen wie ein Pferd. Elma keuchte.
«Durch die Nase atmen», murmelte Nevada. «Langsam. Ein-, zwei, drei, vier – und aus-, zwei, drei, vier …» Sie wollte die Mädchen im Alltag begleiten, sie wollte ihnen zeigen, wie sie während einer Prüfung weiteratmen, wie sie gerade in der Schulbank sitzen können. Wie sie ihr Essen Bissen für Bissen genießen, wie sie einer Drohung ausweichen.
«Fuck», stöhnte es aus der hintersten Reihe. Das war Suleika, das neue Mädchen, rotgesichtig und verschwitzt in ihrem schwarzen, zeltartigen Überwurf. Unmöglich zu sagen, ob ihre Knie gebeugt waren. Nur schon die Arme über den Kopf zu heben war bei ihrem Gewicht eine Herausforderung. Die Arme hatten neben ihrem Gesicht zu wenig Platz. Ihrem schönen Gesicht. Was für ein Klischee. Das Mädchen schaute sie direkt an, abschätzend, na, was sagst du dazu?
Nevada sagte nichts. Sie hatte noch nie ein so dickes Mädchen gesehen. Sie wusste nicht genau, was sie mit ihm anfangen konnte.
Zwischen Elma und Suleika stand klein und zierlich, aber unverrückbar, Stefanie, die Vernünftige, Stefanie, die Vermittlerin. Nevada wünschte sich, sie würde sich entspannen, sie würde ihr die Verantwortung für diese zusammengewürfelte Gruppe überlassen. Stefanies Blick huschte rastlos von einem Mädchen zum anderen.
«Drishti zu den Fingerspitzen», sagte Nevada. «Lenkt euren Blick nach oben!» Widerwillig gehorchte Stefanie und konzentrierte sich wenigstens einen Augenblick lang nur auf sich selbst.
«Virabhadrasana, die Stellung des tapferen Kriegers Virabhadra, der aus dem Schmerz geboren ist, aus dem Kummer des Gottes Vishnu über den Tod seiner Frau, aus seinen vor Trauer ausgerauften Haaren auferstanden …» Nevada wusste nicht genau, was sie da erzählte, der Singsang sollte die Mädchen ablenken, sie noch etwas länger aushalten lassen, noch einen Atemzug oder zwei. Die meisten von ihnen kannten diese Art von Schmerz, der einen die Haare ausraufen, den Kopf gegen die Wand schlagen lässt – den eigenen oder einen anderen. Die Yogastellungen sollten ihnen Werkzeug sein, mit diesem Schmerz umzugehen, mit starken Gefühlen aller Art. So stand es wenigstens in dem Projektbeschrieb, den die Schulleitung entworfen hatte.
Gewaltprävention bei gefährdeten Jugendlichen. Ein ähnliches Programm wurde seit einigen Jahren in einer anderen Siedlung erfolgreich durchgeführt. Doch dieses Programm richtete sich zum ersten Mal ausschließlich an junge Mädchen.
«Mit Gewalt unter Mädchen haben wir wenig Erfahrung», hatte die Schulpflegerin zugegeben. «Es war ein Fehler, Mädchen ausschließlich als Opfer zu sehen. Gewalt unter Mädchen ist versteckter, selten wird eine offen verprügelt oder abgestochen …»
«Abgestochen?»
«Willkommen in der Realität!»
Seit Beginn des Sommerprogramms war ein Mädchen ausgestiegen und ein anderes in der Notaufnahme gelandet. Es war fraglich, ob das Projekt fortgesetzt wurde.
«Shit, Sie! Die Fette fällt um!»
Suleika fiel aus der Stellung, krachte zu Boden, zuckte, mit Schaum vor dem Mund. Nevada starrte. Was hatte sie getan?
«Fuck, Frau, tun Sie was!»
Vier Wochen davor
Om Chandraka Namah
Sie setzte sich im Bett auf. Es war dunkel. Sie wusste nicht,
was sie geweckt hatte. Draußen schien der Mond.
Er schob sich in das schwarze Viereck ihres Fensters,
dick und gelb und voll. Das Licht, das in der Nacht scheint,
dachte sie. Ich grüße den Mond, das Licht,
das im tiefsten Dunkel der Nacht scheint.
Erika
1.
Erika hatte einen Traum. Sie stand auf ihrer Dachterrasse am Zürichberg. Zuerst war alles vertraut. Hier stand ein blauer Tisch, dort ging der Blick über den See, die Berge dahinter. Dann verwandelte sich das Bild. Ein Teppich aus vertrockneter Erde legte sich über den Betonboden. Die Hortensienbüsche ließen ihre weißen Köpfe hängen. Sie schlüpften aus ihren schweren Töpfen und rückten vom Geländer der Terrasse ab. Sie scharten sich um Erika, drängten ihre Wurzeln in den trockenen Erdboden. Erika schaute auf ihre Füße, sie waren schmutzig und nackt. Als sie wieder aufschaute, war um sie herum alles verödet. Vertrocknete Stauden reichten ihr bis zur Brust. Manche wuchsen über sie hinaus. Manche waren verbrannt, manche geknickt. Verzweifelt stand sie inmitten dieser Verwüstung, und sie fühlte sich schuldig. Daran, dass diese Pflanzen gestorben waren, diese Erde verbrannt.
«Hab ich es nicht gesagt?», rief Max ihr zu. Sie wandte den Kopf. Da stand ihr Mann. Er stand außerhalb dieses jämmerlichen Feldes, lehnte sich ans Geländer und rauchte eine Zigarre. Sie wollte ihm zurufen, er solle die Zigarre ausmachen, aber was nützte das jetzt noch? Ihr Garten war schon abgebrannt.
«Ich hab dir immer gesagt, hier wächst nichts!», rief Max wieder, und eine bodenlose Verzweiflung erfüllte sie. Sie begann zu weinen. Sie weinte um die verbrannte Erde, um die verdursteten Pflanzen, sie weinte um ihren Dachgarten. Sie weinte um ihren Glauben, auf diesem Dach etwas anpflanzen, etwas wachsen lassen zu können. Dabei war das gar nicht möglich! Max hatte es immer gesagt! Oh, hätte sie es doch gar nicht erst versucht! Ihre Verzweiflung wurde so groß, dass sie sich krümmte. Da sah sie aus den Augenwinkeln, zwischen den dürren Ästen hindurch, eine Bewegung auf der anderen Seite. Die Terrassentür wurde aufgeschoben, und ein Mann trat zu ihr. Auch er war barfuß. Er lächelte ihr zu, mehr mit den Augen als mit dem Mund, und sie richtete sich auf.
«Ach! Gott sei Dank!», rief sie laut. Die Erleichterung, die sie bei seinem Anblick empfand, flutete jede einzelne Zelle. Jetzt würde alles gut werden. Alles war gut. «Ach, Gott sei Dank! Da bist du ja!»
Denn der hier war eigentlich ihr Mann, das wusste sie im Traum. Der, und nicht der andere, der mit der Zigarre, dessen Namen sie schon vergessen hatte, sein Gesicht, seine Form, es gab nur noch diesen Mann, ihren Mann, der ihr barfuß entgegenkam. In der Hand trug er eine Gießkanne.
Erika lachte noch, als sie aufwachte. Gießkanne, dachte sie, Zigarre, Himmel, ich war wirklich zu lange in Therapie. Freud würde in den Tiefschlaf fallen, wenn er diese Träume hörte. Trotzdem notierte Erika sie gewissenhaft. Sie wusste nicht, wie sie das Gefühl der Erleichterung beschreiben sollte. Sie kannte es nur aus Träumen. Der Mann, der dieses Gefühl in ihr auslöste, sah in jedem Traum anders aus. Aber nie war es Max. Nie ihr Mann.
2.
«Du Liebe, Liebe, Liebe, Liebe», flüsterte die Stimme in ihrem Ohr. Weiche Arme hielten sie, es roch nach Rosenblüten und Gewürzen. Dann wurde ihr etwas in die Hand gedrückt, automatisch schlossen sich ihre Finger darum. Eine Frau in einem weißen Kaftan zog sie am Ellbogen zur Seite. Erika stand auf und folgte den anderen zwischen den Stuhlreihen hindurch, ließ sich Richtung Ausgang drängen. Vor der Tür zu den Toiletten blieb sie stehen. Sie öffnete ihre Finger. Auf ihrer Handfläche lagen eine zerdrückte Rosenblüte und ein Bonbon. Sie ließ die Blüte fallen, wickelte das Bonbon aus und steckte es in den Mund. Dann lehnte sie sich an die Wand. Sie fühlte sich nicht anders als vorher. Was hatte sie erwartet?
Erika suchte mit den Augen die Menge ab, die auf Stühlen oder Sitzkissen saß und wartete. In der Mitte rutschten weitere Menschen auf den Knien zur wartenden Mutter vor, die sie in ihre Arme schließen würde. Erika entdeckte Mona und Susanne, schon ziemlich weit vorn. Zu dritt waren sie nach Winterthur gereist, um sich von Amma umarmen zu lassen. Drei Damen im mittleren Alter. Wobei Susanne die entscheidenden fünfzehn Jahre jünger war. Susanne war eine Zweitfrau – und Erikas Nachbarin. Sie hatte sich ihnen heute früh spontan angeschlossen. Mona und Erika besuchten denselben Yogakurs. Ihr Lehrer hatte sie auf die einmalige Gelegenheit hingewiesen, sich von der spirituellen Führerin aus Indien umarmen zu lassen. «Eine lebensverändernde Erfahrung», hatte er versprochen. Erika und Mona hatten sich mit einem Blick verständigt: Das würden sie sich nicht entgehen lassen! Heimlich hatten wohl beide gehofft, Rashi würde sich ihnen anschließen. Und sie könnten sich von ihm umarmen lassen. Sie hatten den Ausflug sorgfältig geplant, sich dem Anlass entsprechend gekleidet. Erika und Mona waren sogar extra zusammen einkaufen gefahren. Sie hatten sich dünne Sommerpaschminas gekauft und grobe, an Malas erinnernde Halsketten aus Kristallkugeln. Sie waren gerüstet.
Das Leben konnte kommen. Und sich ändern.
Seit Wochen wurde Erika dieses Gefühl nicht los, dass ihr Leben sich ändern würde. Ändern musste. Sie hatte seltsame Träume. In einer Nacht fiel sie aus einem offenen Fenster. Panik erfasste sie, bis sie merkte, dass sie nicht nach unten fiel, sondern waagrecht weiterflog. Sie schwebte aus einem Fenster hinaus und in ein anderes hinein. Dort fand sie sich bäuchlings auf einem Fußboden liegend, den sie sofort als ihren erkannte, obwohl sie ihn nie vorher gesehen hatte. Sie stand auf. Der Teppich war rosa, er lag vor einem reich verzierten Prinzessinnenbett mit verschnörkeltem Metallrahmen, an den Wänden hingen Bilder von hübschen Jungen mit gefühlvollen Augen, die sie auch nicht kannte, aber in die sie, das wusste sie, verliebt war. Erika schaute sich im Zimmer um, sie fand einen Plattenspieler aus Plastik, sie fand Vinylschallplatten in Hüllen, sie nahm eine Single heraus. Adriano Celentano, Yuppi du, sie legte sie auf und begann auf dem Teppich wie auf einer rosafarbenen Blumenwiese zu tanzen, barfuß.
In einem anderen Traum stieß sie im Supermarkt mit ihrem Einkaufswagen an den einer anderen Kundin, und als sie sich entschuldigen wollte, sagte die andere: «Überhaupt kein Problem!» Und sie tauschten die Wagen aus, als ob nichts dabei wäre. Erika schob ihren neuen Wagen zur Kasse, versuchte zu erkennen, was alles darin lag, er war überladen, zuoberst eine Tiefkühlpizza in einer großen quadratischen Schachtel, die immer wieder herabzurutschen drohte. Erika fühlte sich wie ein Kind, das die von der Mutter im Schrank versteckten Weihnachtsgeschenke gefunden hat und nun zu erraten versucht, was darin sein könnte. Als sie zur Kasse kam, wurde die Musik immer lauter. «When the moon hits your eye like a big pizza pie, that’s amore …» Erika tänzelte hinter ihrem Wagen her, und als sie die Pizzaschachtel aufs Band legte, fiel die Kassiererin in den Song ein. «Big pizza pie, that’s amore!» Einen Artikel nach dem anderen fischte Erika aus dem Wagen und legte ihn aufs Band. Lauter Dinge, die sie noch nie gekauft hatte: Fertigmahlzeiten, abgepackte Kuchen mit rosa Zuckerguss, Babynahrung in Glasfläschlein, Kondome, ein pinkfarbener Lippenstift. Mit jedem Gegenstand wurde ihr Glücksgefühl größer, bis es sie schließlich ganz ausfüllte.
Aus diesen Träumen erwachte sie lächelnd. Dann verstummte die Musik in ihrem Kopf, das Glücksgefühl entwich aus ihr wie Luft aus einem Ballon. Sie war kein Mädchen mit einem Prinzessinnenbett, keine sorglose junge Mutter, die Fertigpizza und Kondome kaufte, sie war … wer? Sie war niemand. Sie war nichts.
«Niit!», hörte sie plötzlich die Kinderstimmen ihrer Erinnerung. «Niiteli, komm, wir spielen Fangis!»
Erika war ein schüchternes Kind gewesen. Ein Einzelkind. Allein unter Erwachsenen. Ihre Eltern führten eine Stofffabrik, sie wohnten außerhalb des Dorfes in einem kalten Haus mit zu vielen Zimmern und einem großen Park. Erika hatte viel Platz gehabt. Und keine Gesellschaft. Bis zu ihrem ersten Tag im Kindergarten hatte sie nie mit anderen Kindern gespielt. Sie hatte noch nicht einmal andere Kinder gesehen. Und jetzt waren da zwanzig, dreißig von ihnen, die lärmten und lachten und schubsten. Angst überwältigte Erika. Sie versteckte sich in der Puppenecke, saß ganz still zwischen den Puppen, aber die Kindergärtnerin entdeckte sie und zog sie in den Kreis.
«Hier gibt es keine Extrawurst», sagte sie streng. Erika spürte, dass sie anders war als die anderen Kinder. Sie war kleiner. Anders angezogen. Sie sprach anders. Anders war nicht gut, das gab ihr die harte Hand der Kindergärtnerin klar zu verstehen. Keine Extrawurst! Extrawurst war auch nicht gut.
Später saßen sie im Kreis und nannten der Reihe nach ihre Namen. Alle Kinder begannen mit ihrem Nachnamen. «Brunner, Hansli», sagten sie, «Stucky, Vreneli.» Erika kannte ihren Nachnamen nicht. Und ihren Vornamen hatte sie noch nie ausgesprochen. Sie hatte, laut ihrer Mutter, noch nicht einmal «ich» gesagt. «Nicht ein einziges Mal!» Das betonte ihre Mutter mit einem gewissen Stolz, den Erika sonst nicht hörte. Es war gut, das Wort «ich» nicht aussprechen zu können, begriff sie. Doch jetzt musste sie etwas sagen. Dreißig Kinder schauten sie erwartungsvoll an, einige lachten bereits. Die Kindergärtnerin runzelte die Stirn und drohte wieder mit der Extrawurst. Erika zog den Latz ihrer Schürze über ihr Gesicht und murmelte verzweifelt: «Nichts. Niit.»
Und so kam es, dass die anderen Kinder sie Niiteli riefen. Später wurde Niita daraus. Später wurde eine gute Geschichte daraus. Wenn sie erzählte, wie sie zu ihrem Spitznamen gekommen war. Als Niita hatte sie in besetzten Häusern gelebt, als Model Karriere gemacht. Niita war eine Kultfigur gewesen. Erst Max hatte sie zu Erika gemacht.
«Und?» Erika fuhr zusammen. Susanne stand plötzlich neben ihr. «Spürst du was?»
Erika zuckte mit den Schultern.
«Ich auch nicht», sagte Susanne. «Ich hab mir irgendwie mehr erwartet.» Susanne schob mit dem Finger ihre Brille hoch. Sie sah aus wie ein Mädchen. Ungeschminkt. Unbeeindruckt. Erika hasste Susanne. Gerade jetzt, in diesem Moment, hätte sie sie erwürgen können. Du Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, dachte sie. Ha! Susanne konnte nichts dafür. Sie war nur jung. Sie konnte ihr Leben noch zweimal ändern, wenn sie wollte. Susanne hatte alle Zeit der Welt. Alle Zeit, die Erika fehlte. Die sie verloren hatte. Sie wusste, dass Susanne ihr diese Zeit nicht persönlich gestohlen hatte, aber genau so fühlte es sich an. Sie wandte sich ab. Bevor sie etwas Falsches sagte. Bevor ihr gar die Hand ausrutschte.
«Ich geh kurz aufs Klo, wartest du hier?» Vor der Toilette hatte sich eine Schlange gebildet. Erika tastete nach dem Flachmann in ihrer Handtasche und beschloss, noch zu warten. Sie war keine Alkoholikerin. Sie bestimmte, wann und wie viel sie trank. Sie ließ sich von der Menge weitertreiben, zu den Verkaufsständen in der Eingangshalle. Sie nahm ein Buch in die Hand, drehte es hin und her, schüttelte es. Als keine Antwort herausfiel, legte sie es wieder zurück. Erika wusste nicht, wie sie ihr Leben ändern konnte. Sie hatte keinen Beruf gelernt. Sie war fast fünfzig. In ihren Träumen war sie arm und von allem guten Geschmack verlassen. Sollte sie ihr Geld weggeben? Ihre Designermöbel aus der Jahrhundertmitte? Ihre teuren Kleider? Was würde Max dazu sagen? Max verachtete ihr Geld. Würde Max einen solchen Entschluss würdigen? Würde er sie vielleicht sogar besser mögen? Mit anderen Augen sehen?
Aber Max kam in ihren Träumen gar nicht vor. Erika dachte an den Mann mit der Gießkanne. Sie versuchte, diese tiefe Erleichterung, die sie bei seinem Anblick verspürt hatte, noch einmal zu spüren. Sie war weg. Mit ihrem Traum verflogen. Max weckte etwas ganz anderes in ihr. Unsicherheit. Atemlosigkeit. Seit fünfundzwanzig Jahren versuchte Erika, Max gerecht zu werden. Jetzt war sie müde. Konnte sie Max verlassen? Wer wäre sie ohne Max?
Sie war niemand. Sie war nichts.
Am nächsten Stand kaufte sie einen weichen dunkelgrünen Schal. Auch er roch nach Gewürzen. Die Verkäuferin, eine dicke, dunkelhäutige Frau, die einen hässlichen knallfarbenen Faserpelzpullover trug, wickelte ihn in ein Stück Packpapier ein.
«What’s wrong with you?», sprach sie Erika an.
Erika runzelte die Stirn. Ihre Stirn bewegte sich nicht, aber sie fühlte den Druck zwischen ihren Brauen, wo die gelähmten Muskeln auf Irritation reagierten. Wie konnte man ihr ansehen, wie sich fühlte, wenn sich kein Muskel mehr bewegte?
«Want me to tell you?», fragte die Frau weiter.
«Yes, please!» Da war sie aber gespannt.
Die dicke Frau nickte. «You live in the wrong house!», sagte sie. Als ob nichts dabei wäre. Erika öffnete den Mund. Sie wollte etwas sagen. Die Worte überschlugen sich. Blieben ihr im Hals stecken. Wrong house! Wie in ihrem Traum. Wrong house, wrong Einkaufswagen, wrong life! Das war es.
Etwas landete schwer auf Erikas Brust. Ein Vogel mit eisernen Flügeln. Er krallte sich in ihrem Herzen fest.
«Du bist so verzweifelt», sagte die Frau.
Erika erschrak. «Sieht man mir das an?»
«Nicht jeder kann das sehen. Nicht deine Freundinnen. Nur ich! Ich bin eben etwas Besonderes.» Die dicke Frau lachte.
Erika lachte mit. «Und jetzt? Was heißt das? Soll ich umziehen?» Innerhalb weniger Minuten hatte sie die lästige dicke Frau zu ihrer Führerin erkoren. Sollte sie doch die Entscheidungen treffen! Sollte sie Erikas Leben verändern!
«Nicht nur dein Haus ist verkehrt. Dein ganzes Leben ist verkehrt. Das merkst du doch. Du strengst dich viel zu sehr an. Das ist das falsche Leben. Das richtige Leben sollte nicht so anstrengend sein. Hör auf, dir solche Mühe zu geben! Was bringt es?»
«Ja, was?» Atemlos hörte Erika zu.
«Du bist traurig, weil du nicht fliegen kannst. Du gibst dir solche Mühe, aber es geht einfach nicht. Du flatterst und flatterst und bleibst doch immer auf dem Boden kleben.»
«Der eiserne Vogel», krächzte Erika. «Seine Flügel sind so schwer!»
Wie konnte die dicke Frau das wissen? Konnte sie in ihr Herz sehen?
«Nein, es sind nicht die Flügel – du hast gar keine Flügel. Du bist gar kein Vogel. Darum kannst du auch nicht fliegen!»
«Ich bin kein Vogel? Ich kann gar nicht fliegen?» Erika wollte weinen. Sie wusste nicht, warum sie das so traurig machte.
Die dicke Frau hingegen schien das gar nicht schlimm zu finden. Sie winkte lachend ab. «Das macht nichts», sagte sie. «Du bist ein Pferd. Pferde sind gut. Ich bin selber eins!»
Bevor Erika fragen konnte, was es bedeutete, ein Pferd zu sein, drängte sich ein junger Mann neben sie, streckte der Frau eine bestickte Stofftasche entgegen, er wollte bezahlen. Dann wurde Erika von der Masse weitergetrieben.
«Hier bist du!» Mona hängte sich bei ihr ein. «Ich hab dich überall gesucht. Little Miss Sunshine hat uns einen Tisch reserviert, kommst du?»
Erika verdrehte die Augen. «Müssen wir?»
«Du hast sie doch eingeladen.»
«Nein, sie hat sich mir aufgedrängt.»
Mona konnte Susanne ebenso wenig ausstehen wie Erika, aus demselben Grund. Einen Augenblick lang dachten beide Frauen dasselbe: Komm, wir hauen ab. Lassen sie sitzen. Machen uns einen schönen Nachmittag. Doch da winkte ihnen Susanne von einem der langen Tische zu.
«Ich hab uns ein paar indische Leckereien geholt», strahlte sie. Sie zeigte auf das Metalltablett: «Samosas, frittiertes Gemüse, Pappadam …»
«Champagner?», fragte Erika. Mona kicherte.
«Ich glaube, hier wird kein Alkohol ausgeschenkt», sagte Susanne ernst. «Ich habe uns kalten Chai geholt.»
«Auch gut.» Erika tastete nach ihrer Flasche. Sie unterhielten sich über die bevorstehenden Sommerferien, über ihre Pläne. Max würde ein Weberinnenkollektiv in Südindien besuchen, Erika eine Ayurvedakur machen. Vielleicht veränderte sich ihr Leben ja dort. Wenn nicht in Indien, wo dann?
«Also, mich hat das irgendwie schon berührt.» Mona schob das Tablett außer Reichweite. «Ich weiß nicht, wann ich das zuletzt gehört habe. Du Liebe, Liebe, Liebe …» Sie wandte sich nur an Erika, als säße Susanne nicht neben ihr.
Erika knabberte an dem trockenen Fladenbrot. «Ich weiß nicht. Ich habe nichts gespürt.»
«Ja, du», sagte Mona heftig. «Schon klar. Du hörst das vermutlich ständig! Dein Mann liebt dich, das ist offensichtlich!»
Tat er das wirklich? Warum sagte er es dann nicht? Und warum war es für Außenstehende offensichtlich, aber für sie nicht? Warum fühlte Erika sich nicht geliebt?
Niemand konnte sich die Stille vorstellen, die zwischen ihnen herrschte, wenn sie allein waren. Seit Jahren vermieden sie es, miteinander allein zu sein. Die Stille füllte den Raum wie ein giftiges Gas, verschluckte jeden Gedanken, jedes Wort, jede Berührung. Niemand würde ihr glauben, wenn sie versuchte, diese Stille zu beschreiben. Niemand würde sie verstehen, schon gar nicht ihre Freundinnen, die nicht müde wurden, ihr vorzuhalten, was für ein großes Glück sie hatte mit diesem Mann. «So ein toller Mann! Und so gutaussehend. Und erst noch anständig, einer mit Idealen! Einer, der denkt und diskutiert!»
«Ja, in der Öffentlichkeit.»
Man kannte Erika und Max als eingespieltes Paar, das reibungslos funktionierte. Jeder Seitenblick saß, jede Berührung, jede halblaute Bemerkung. Es war gar nicht unbedingt so, dass diese Intimität, diese Vertrautheit gespielt war, es war mehr so, dass sie sich nur in Gesellschaft an sie erinnerten. Erika dachte, dass sie schuld sei an dieser Entfremdung.
Sie fühlte sich nicht geliebt, weil sie nicht liebenswert war. Das musste es sein. Das sagte Gerda immer. «Du weißt gar nicht, wie gut du es hast», sagte Gerda. Und das sagte Mona jetzt auch: «Du weißt ja nicht, wie gut du es hast. Du hast den letzten anständigen Mann der Schweiz geheiratet!»
Susanne blickte skeptisch. «Ihr wollt das vielleicht nicht hören, aber mein Markus ist auch ein anständiger Mann.»
Mona sah die Jüngere an, als hätte sie vergessen, dass sie mit am Tisch saß. «Einer, der seine Frau für eine Jüngere sitzenlässt, ist nicht anständig, sorry!»
«Aber so war es doch gar nicht! Markus war sehr unglücklich in seiner Ehe», sagte Susanne. «Hätte er denn bleiben sollen? Hätte er das Glück wegschicken sollen, als es an seine Tür klopfte? Wem hätte das etwas geholfen?»
«Lass mich nachdenken – Jolanda vielleicht?» Mona sagte es scharf, obwohl sie Markus’ erste Frau auch nicht gemocht hatte.
«Jolanda hat doch von der Scheidung nur profitiert! Aber, ich weiß, ich sollte nichts sagen, ihr wart ja mit Jolanda befreundet …»
«Nein, das waren wir nicht», sagte Erika. «Aber vielleicht solltest du trotzdem nichts sagen.»
«Es ist schlimm genug, dass du jung bist», sagte Mona. «Und dann hast du einfach null Feingefühl! Es geht hier nicht um dich, merkst du das nicht?»
Erika schaute Mona genauer an und sah, dass ihre Haut gerötet und fleckig war. Ihr Mann John war Schönheitschirurg. Manchmal probierte er neue Maschinen und Methoden an Mona aus. Manchmal ging dabei etwas schief.
«Was ist los, Mona?»
«Marine ist schwanger!»
«Wer ist Marine?» Wer hieß so?, dachte Erika. Was für ein Name.
«Johns Praxishilfe! Und sie behauptet, das Kind sei von ihm! Und sie will ihn wegen sexueller Belästigung verklagen!» Mona schniefte. «Scheiße. Gibt es hier wirklich keinen Alkohol?»
Erika zog ihren Flachmann aus der Tasche und schüttete einen großzügigen Schluck Wodka in Monas Chai, dann in ihren eigenen. Susanne hielt schützend die Hand über ihre Tasse. Typisch, dachte Erika. Dann sah sie die Jüngere noch einmal genau an.
«Jetzt sag aber nicht, du bist auch schwanger!»
Susanne errötete, und Mona brach in Tränen aus.
«Du bist wirklich unglaublich, Susanne!», rief sie. «Siehst du nun, was ich gemeint habe? Du hast einfach kein Feingefühl! Null!»
«Was kann ich denn dafür, dass ich schwanger bin? Ich dachte, ihr freut euch! Ihr seid doch meine Freundinnen!»
«Erika ist deine Nachbarin», sagte Mona grob. «Mehr nicht. Und jetzt nimm dich bitte ein bisschen zurück, ja? Deine Energie verstopft die ganze Atmosphäre hier am Tisch!»
Erika wich Susannes verletztem Blick aus und wandte sich an Mona. «Bist du denn ganz sicher, dass sie lügt? Die Praxishilfe?»
«Natürlich bin ich sicher! Warum fragst du? Du kennst doch John!»
Erika kannte John. Jedes Mal, wenn sie in seine Praxis kam, fasste er ihre Brüste an. Es geschah automatisch, es war ein Reflex. Sie nahm es nicht persönlich. Sie sah auch, wie er mit den jungen, hübschen Praxishilfen schäkerte. Jeder sah das. Jeder wusste das. Konnte Mona wirklich so blind sein?
«Du hättest ihn sehen sollen – er war am Boden zerstört! Verzweifelt! Und gerade jetzt, wo Gregory aus Amerika zurückkommt.» Ihr Sohn hatte ein Austauschjahr gemacht. Erika meinte sich zu erinnern, dass bei seiner Geburt etwas schiefgegangen war, dass Mona keine weiteren Kinder bekommen konnte. Aber sie konnte sich täuschen. Erika fiel es schwer, sich auf das zu konzentrieren, was um sie herum passierte, sich an das zu erinnern, was gesagt worden war. Lieber verlor sie sich in ihren Tagträumen und Gedanken. Da war es ihr schon als Kind am wohlsten gewesen. Sie nahm auch genügend Medikamente, um diese innere Welt vor der Realität zu schützen.
«Schau dir doch die Zeitungen an – heutzutage kannst du dir als Frau alles erlauben, du musst nur einmal ‹Missbrauch› sagen, ‹sexuelle Belästigung›, und schon bist du ein Leben lang versorgt! Eine Schande ist das! Und ein Mann wie John ist natürlich das ideale Opfer – ein Wunder, dass ihm das nicht schon früher passiert ist.»
Allerdings, ein Wunder, dachte Erika. Sie schenkte sich nach. Sie verstand Mona nicht. Glaubte sie wirklich, was John ihr erzählte? Was, wenn das Kind zur Welt kam und Johns unverwechselbare Augen hatte? Wie es diesem Sportler passiert war, wie hieß er gleich, der behauptet hatte, man habe ihm seinen Samen geraubt …? Je länger sie darüber nachdachte, desto wütender wurde sie auf Mona. Mona hatte den perfekten Scheidungsgrund! Sie könnte jetzt gehen, und das Mitgefühl aller wäre ihr sicher. Aber nein, Mona glaubte ihrem Mann, sie stand zu ihm, sie dachte keine Sekunde daran, ihn zu verlassen. Wie konnte sie, Erika, denn überhaupt an so etwas denken, sie, die mit dem letzten anständigen Mann der Schweiz verheiratet war?
«Ich will euch ja nicht unterbrechen», sagte Susanne.
«Warum tust du es dann?», fuhr Mona sie an.
Susanne ignorierte sie. «Erika, du hast hoffentlich nicht vergessen, dass wir heute Abend bei dir zum Essen eingeladen sind? Ich meine nur – es ist bald drei Uhr, und bis wir wieder in Zürich sind …»
Erika zuckte zusammen. Das hatte sie tatsächlich vergessen. Mona schaute verletzt. Max hatte die Gästeliste zusammengestellt. Er lud nur Leute ein, die etwas Sinnvolles taten oder wenigstens etwas Interessantes. An seinem Tisch würde nie ein Schönheitschirurg sitzen. Schweigend schoben sie die Metalltablette zusammen und standen auf. Als Erika auf dem Weg zum Ausgang noch einmal am Stand der hellsichtigen Verkäuferin vorbeischauen wollte, konnte sie ihn nicht mehr finden.
3.
Erika kontrollierte den Esstisch, den ihre Haushälterin gedeckt hatte. Der Blumenschmuck in der Tischmitte war von einem Floristen geliefert worden. Papageienblumen, zu protzig, zu groß. Sie trat auf die Terrasse hinaus und schnitt einige Hortensienköpfe ab. Sie waren grün, mit zarten rosafarbenen Rändern. Erika liebte ihre Hortensien. Sie blühten bis zum ersten Frost. «Tankstellenblumen», nannte Max sie. Aber Gerda hatte sie abgesegnet, Gerda, die Architektin, die die Terrassenhaussiedlung entworfen hatte, in der Erika lebte. Gerda, ihre beste Freundin.
«Du lebst im falschen Haus», hörte sie wieder die Stimme der dicken Inderin. «Es ist kein Haus», wollte sie antworten, wie sie es so oft tat. «Es ist nur eine Wohnung!» Warum war es so wichtig, nicht in einem ganzen Haus zu wohnen? Ihre Wohnung hatte eine eigene Hausnummer, einen eigenen Eingang, acht Zimmer auf drei Stockwerke verteilt. Nur weil zwei weitere, beinahe identische Terrassenhäuser auf demselben Hanggrundstück in bester Lage am Zürichberg standen, wurde ihre Adresse nicht zu der einer Genossenschaftssiedlung.
Wen wollte sie täuschen?
Gerda und ihr Mann Arnold hatten das Land geerbt, auf dem die Häuser standen. Sie gehörten zu Erikas und Max’ ältesten Freunden. In den achtziger Jahren hatten sie Häuser besetzt, in den Neunzigern ihre Kinder in Genossenschaftswohnungen großgezogen. Mit dem Schuleintritt der Kinder wurden plötzlich Kriminalität und Ausländer zu einem Thema. Außerdem verdienten alle plötzlich viel Geld. Und irgendwann gab man zu, dass man ein Grundstück am Zürichberg besaß, mit einer baufälligen Villa drauf, die nicht dem Denkmalschutz unterstellt war. Trotzdem sahen sie sich immer noch als progressiv, als die Akteure einer Veränderung, als die neue Generation. Als die junge Kultur, auch noch im mittleren Alter. (Mittleres Alter, dachte Erika, war ein trügerischer Begriff. Wenn sie nicht hundert Jahre alt werden wollten, hatten sie das mittlere Alter längst überschritten.) Sie wehrten sich gegen die Zuschreibungen von außen, Grundstücksbesitzer, Fabrikdirektor, reiche Erbin. Sie wollten Rebellen bleiben.
Und bequem leben. Das auch.
Zehn Gedecke zählte Erika. Die Nachbarn, Gerda und Arnold, Markus und Susanne, dann Delia Kaufmann, die neue Direktorin des Opernhauses mit ihrer Lebenspartnerin, deren Namen Erika vergessen hatte, und Felix Feilchenfeldt, der Fernsehjournalist, der entweder seine neue Freundin oder seinen erwachsenen Sohn, einen hoffnungsvollen Jungschauspieler mitbringen würde. Erika hoffte auf Letzteres, so dass sie beide Geschlechter gleichmäßig um den Tisch verteilen konnte. Seit wann interessierte sie so etwas? Und wen kümmerte es? Seit dreißig Jahren flirteten Max und sie halbherzig übers Kreuz mit Gerda und Arnold, eine alte Gewohnheit. Den beiden Operndamen würden zwei Herren am Tisch herzlich wenig bedeuten. An diesem Abend ging es vielmehr darum, Bühnenbilder und Garderobe des Opernhauses vermehrt mit Stoffen der Textilfabrik Keiner auszurüsten. Und den Fernsehreporter für einen Dokumentarfilm über Max’ Projekte mit Arbeiterinnenkollektiven in der Dritten Welt zu interessieren. Um das Interesse des Journalisten würde auch Arnold buhlen, dessen letztes Buch zwar bereits vor mehreren Jahren erschienen war, aber, so dachte Arnold, eine perfekte Vorlage für einen Fernsehfilm liefern würde. Was die Lebenspartnerin der Opernhausdirektorin beruflich machte, hatte Erika nicht herausfinden können. Es war aber anzunehmen, dass sie sich in Zürich standesgemäß niederlassen wollte. Am liebsten in einem von Gerdas preisgekrönten Wohnhäusern, in denen frei werdende Einheiten unter der Hand weitervermietet wurden. Gerda selber wollte von niemandem mehr etwas. Sie hatte es nicht nötig, sich an Erikas Esstisch zu profilieren. Dafür würde sie sich früh verabschieden. Und arbeiten.
Erika nahm die Hortensienköpfe und verteilte sie einzeln in flache Schalen, Fingerschalen aus gehämmertem Silber, die sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Das Menü war rustikal, wie es im Moment angesagt war. Hackfleisch mit Hörnli und Apfelmus, Äplermagronen für die Vegetarier. Keine leichte Kost. In ihrem Alter. Sie würden alle schlecht schlafen heute Nacht. Aber immer noch besser, als ein unangesagtes Gericht auf den Tisch zu stellen.
Plötzlich sah Erika einen Reigen solcher Einladungen von früher vor ihrem inneren Auge tanzen. Da war der schwere Holztisch in der WG, in dessen Platte im Lauf der Zeit unzählige Initialen, Liebeserklärungen und Parolen geschnitzt worden waren. Damals hatte kein Teller zum anderen gepasst, und das Essen hatte auch einmal aus Spaghetti ohne Sauce bestanden, mit Streuwürze und Butter abgeschmeckt. Sie erinnerte sich an den Ehrgeiz, den sie damals entwickelt hatten, den billigsten gerade noch trinkbaren Rotwein im Supermarkt zu finden. Royal Kabir aus Algerien, dachte sie, ein Franken achtzig die Literflasche mit Kronkorkenverschluss. Dass sie das noch wusste! Sie tranken ihn aus Zahnputzgläsern.
Heute würde Max sich um den Wein kümmern. Wein war der einzige Luxus, den er sich gönnte. Natürlich sammelte er nicht dieselben teuren Weine wie alle anderen Männer in seinem Alter, sondern achtete auf nachhaltigen Anbau, auf faire Arbeitsbedingungen bei den Winzern. Oft verband er seine Reisen zu den Kollektiven, die seine Stoffe herstellten oder färbten oder bedruckten, mit Besuchen bei innovativen Weinbauern in Südamerika oder Afrika oder sogar in der Karibik.
Erika hoffte, dass er es rechtzeitig nach Hause schaffen würde. Er hatte schon zweimal angerufen, er stand im Stau. Hätte er doch den Zug genommen! Vier Tage pro Woche blieb er im Glarnerland, wo er sich um die Stofffabrik Keiner kümmerte, aus deren etwas unglücklichem Namen er Kult gemacht hatte. Eigentlich war es Erika, die Keiner hieß. Die die Fabrik geerbt hatte. Aber ihre Mutter hatte von langer Hand vorbereitet, dass der begabte junge Designer, den sie angestellt hatte, als ihr Mann krank wurde, eines Tages den Betrieb übernehmen würde. Das war Erika lange nicht klar gewesen. Sie hatte Max, so hatte sie gedacht, zufällig kennengelernt, bei einem ihrer seltenen Besuche zu Hause. Sie hatten den ganzen Abend lang gestritten, über Politik und soziale Verantwortung: Max war zwölf Jahre älter als sie, er hatte die 68er Bewegung mitgemacht und auch die der Achtziger. Erika arbeitete damals als Model, was Max nicht beeindruckte. Sie unterstütze den Konsumwahn der Gesellschaft, warf er ihr vor, sie verdiene ihr Geld mit etwas, wofür sie nichts könne, mit ihrer Schönheit, die, so Max, «ohnehin relativ» war.
«In einem anderen Kulturkreis würdest du als hässlich gelten, zu groß, zu dünn …» Erika erwiderte nicht, dass sie auch für den eigenen Kulturkreis zu groß und zu dünn gewesen war, als sie mit zwölf plötzlich das ganz Dorf überragte. Sie sagte es nicht, weil ihr Agent ihr verboten hatte, dieses «typische Modelklischee, die Geschichte vom hässlichen Entlein» in Interviews zu erzählen. Stattdessen hatte er mit ihr eine Legende entwickelt. Die Legende von Niita, die aus dem Nichts erschienen war.
Nach dem Essen war Max mit ihr nach Zürich zurückgefahren, auf seiner klapprigen Vespa durch die kalte Nacht. Die Fahrt hatte mehrere Stunden gedauert, sie hatten sich nichts dabei gedacht. Sie waren jung. Unverwundbar. Als sie in Erikas WG ankamen, zog Max sofort seine Hose aus, um sie seinen gefrorenen Hintern fühlen zu lassen. Aber mit ihr schlafen wollte er nicht. Das irritierte Erika. Normalerweise war sie es, die das Begehren der anderen zurückwies. Männer umschwärmten sie, starrten sie an, versuchten, sie zu beeindrucken, verfolgten sie, standen nachts unter ihrem Fenster und riefen nach ihr. Nicht Max.
So hatte es begonnen. Mit dieser Unsicherheit. In dieser allerersten Nacht, die schon dem Morgen wich, als Erika ihre Hand über die kalten Hinterbacken nach vorne wandern ließ. Die von Max schroff zurückgeschoben wurde.
«Das geht mir jetzt etwas zu schnell», hatte er gesagt. Das war sonst Erikas Text. Damit hatte es begonnen. Dieses Bemühen, herauszufinden, was Max wollte, was ihm gefiel. Dieses Bemühen, ihm gerecht zu werden.
Max machte kein Hehl daraus, dass Erika nicht sein Typ war. Er mochte kleine, dunkle Frauen mit weiblichen Kurven. Erika war groß und blond und dünn. Max verliebte sich in Frauen, die ein hartes Schicksal tapfer meisterten. Alleinerziehende Mütter, Fabrikarbeiterinnen, Flüchtlinge. Je länger Erika ihm dabei zuschaute, wie er versuchte, andere Frauen zu retten, desto größer wurde ihr Verlangen, selber von ihm gerettet zu werden. Sah er nicht, dass sie ihn brauchte?
Sie umwarb Max, wie sie selber von Männern umworben worden war. Drei Jahre lang kämpfte sie um ihn. Da sie ohnehin immer weniger Aufträge als Model bekam, schrieb sie sich an der Kunstgewerbeschule ein. Sie fuhr häufiger nach Hause ins Glarnerland, wo Max immer wichtigere Aufgaben in der Stofffabrik ihrer Eltern übernahm. Sie unterstützte seine Bemühungen um umweltfreundliche Herstellung und faire Arbeitsbedingungen. Sie engagierte sich im Umweltschutz, half einer Stiftung, die sich um eingewanderte Frauen bemühte, und unterrichtete Deutsch für Fremdsprachige. Max sah, dass sie sich Mühe gab.
Als sie schließlich zum ersten Mal miteinander schliefen, waren sie beide betrunken. Erika fühlte sich angekommen. Am nächsten Morgen schaute er sie ernst an und sagte: «Ich bin nicht der Typ Mann, der mit einer Frau schläft und sie dann sitzenlässt.»
So wurden sie ein Paar. Erika wurde Erika. Manchmal strich er ihr die Haare aus dem Gesicht und sagte: «Ich sehe so viel mehr in dir.» Er sah ihr Potential, ein sinnvolles Leben zu führen. Er glaubte an sie. Auch wenn sie ihn immer wieder enttäuschte. Liebe war kein Thema damals. Es ging um gemeinsame Ziele, den gemeinsamen Weg.
Max zog in ihre WG ein und pendelte ins Glarnerland. Marylou Keiner war eine kluge Frau, sie ließ Max an einer sehr langen Leine, bezahlte ihm Auslandsaufenthalte und lange Ferien, hörte sich seine Ideen an, setzte sie um, gab ihm das Gefühl, er habe etwas zu sagen in der Stofffabrik, er habe einen Wirkungskreis. Dabei war es immer Marylou gewesen, die die Fabrik geführt hatte. Nicht Erikas Vater, nicht Max.
Grüner Salat, dachte Erika. Weiße Sauce. Das Rezept hatte sie auf der Homepage eines urchig-hippen Restaurants gefunden. Die Hauptspeisen hatte ihre Haushälterin vorbereitet. Erika stellte in den Steamer, wärmte auf, überbuk, was ihr Frau Nadolny auf den Zettel geschrieben hatte. Und immer tat Erika so, als habe sie selber gekocht. Sie wusste nicht, ob sie irgendjemanden damit täuschte. Dabei hatte sie früher gern gekocht. Als alles noch nicht so kompliziert war. Heute galten strenge Regeln selbst für eine ungezwungene Einladung unter Freunden. Man orientierte sich an den Gesellschaftsseiten der New York Times on Sunday und kochte nach, was die Hipster letzte Woche in Brooklyn aufgetischt hatten. Der Trend zur währschaften Schweizerküche allerdings war auf lokalem Mist gewachsen und hielt für Erikas Geschmack schon viel zu lange an. Sie wusste nicht, wie viele Varianten von Vogelheu sie sich noch ausdenken konnte. Sie sehnte sich nach der Zeit zurück, als sie mit dem Aufschneiden von reifen Tomaten und Mozzarellabällchen aus dem Supermarkt schon Begeisterung auslösen konnte. Später folgte der Ruccolasalat mit gehobeltem Parmesan und Balsamico-Essig. Vermutlich hatte es damit begonnen. Dass man über den Essig sprach wie über den Wein: Wo er herkam, in welchen Fässern er gereift war, wo man ihn aufgetrieben und was er gekostet hatte.
Wenn Erika es recht überlegte, war es immer schon so gewesen. Auf allen Tischen in Zürich wurde das gleiche Menü serviert, bis endlich ein anderes angesagt war. Und immer saßen Leute um den Tisch, die sich ähnlich sahen, ähnliche Frisuren und Schuhe trugen. Im Grunde genommen waren auch die Spaghetti mit Streuwürze eine Art Trend gewesen. Auch damals trugen alle das Gleiche und waren doch stolz auf ihre Einzigartigkeit. Sie waren damals gar nicht freier gewesen, dachte Erika. Die Zwänge hatten einfach anders ausgesehen. Damals durfte nichts etwas kosten – hatten nicht die Bewohner einer legendären Groß-WG einmal Zürichseeschwäne gejagt, gerupft und gebraten? Wenige Jahre später musste plötzlich alles furchtbar teuer sein. Dieselben Gesichter saßen einander plötzlich an Chromstahl- und Glastischen gegenüber und aßen Kaviar und Sushi. Jede zweite Einladung endete damit, dass man den Gastgeber in die Notaufnahme bringen musste, weil er sich mit dem Austernmesser verletzt hatte. Und heute ging nichts über Authentizität. Wenigstens auf dem Tisch suchte man das Einfache, Echte, das man im Alltag schmerzlich vermisste. Dafür mussten die Älplermagronen herhalten. Auch wenn keiner der Gäste je auf einer Alp gearbeitet hatte.
Außer Max. Natürlich.
4.
Suleika kauerte vor dem Kühlschrank. Ihr Kopf mit dem neuerdings rosarot gefärbten, halblangen Haar steckte so tief im Kühlschrank, dass nur ihr ausladender, schwarz verhüllter Hintern zu sehen war.
«Sully, was tust du denn da? Wir haben doch heute Abend Gäste», sagte Erika.
Suleika richtete sich auf und schlug sich den Kopf an der offenen Kühlschranktür an. Sie hielt eine halbleere Auflaufform in der Hand. «Ups», sagte sie. «Sorry.»
Suleika war dick. Es gab kein anderes Wort dafür. Kräftig gebaut. Schwere Knochen, stämmig, robust, vollschlank, pummelig? Nein. Sie war dick. Sehr dick.
Und es schien ihr nicht das Geringste auszumachen. Sie richtete sich auf und drehte sich um. In ihren zeltartigen schwarzen Kleidern wirkte sie noch umfangreicher. Erika fühlte sich beinahe bedroht. Von ihrer eigenen Tochter.
Sie trat einen Schritt zurück. «Sully, das war doch für heute Abend!»
Suleika schaute auf die Gratinform, die sie wie ein Baby in der Armbeuge hielt. Mit der anderen Hand hatte sie die Alufolie abgedeckt und in die Kartoffel-Nudel-Käse-Sahne-Masse gegriffen. Mit der bloßen Hand. Weiße Sauce tropfte von ihren Fingern. Ihr Kinn glänzte. Erika zwang sich, nicht wegzuschauen.
«Was für ein Jammer», sagten die Leute. «Sie hat so ein schönes Gesicht!» Immer noch konnte man die hohen Wangenknochen erkennen, die auch Erikas Gesicht formten. Geformt hatten, bevor sie es aufspritzen ließ. Wie in dem Kinderspiel, in dem man Papierpuppenkörper reihum mit anderen Gesichtern kombinieren konnte, hätten Suleikas markante Gesichtsknochen besser auf Erikas dünnen Kinderkörper gepasst. Und deren wattiertes Rundgesicht auf Suleikas massig-weichen Leib.
Die Schwangerschaft war ungeplant gewesen, aber nicht unwillkommen. Sie zogen in eine Genossenschaftssiedlung, in der ihre Freunde bereits ihre etwas älteren Kinder aufzogen, und Max nahm seine Arbeit in der Fabrik etwas ernster. Nach Suleikas Geburt fing er an, im Glarnerland zu übernachten, erst ein-, zweimal die Woche, bald spielte es sich ein, dass er vier Tage in der Woche dortblieb. Erika war eine alleinerziehende Mutter gewesen, nur ohne deren Schwierigkeiten. Sie war verheiratet, sie hatte Geld. Niemand bemitleidete sie, niemand bot ihr Hilfe an. Sie arbeitete ja nicht einmal. Damals waren Frauen über dreißig nicht mehr gefragt. Heute war das anders. Heute hätte sie, als Fünfzigjährige, die Chance, wieder als Model zu arbeiten – wenn sie ihr Gesicht nicht zerstört hätte. In ihrem Bemühen, den Alterungsprozess aufzuhalten, hatte sie das Gegenteil erreicht.
Suleika war ein kränkliches Kind gewesen. Klein für ihr Alter. Zwei Jahre lang war sie gar nicht gewachsen, Erika hatte sie von Arzt zu Arzt, von Spezialist zu Naturheiler geschleppt. Suleika hatte immer einen empfindlichen Magen gehabt, schon als Säugling hatte sie die Milch in hohem Bogen wieder ausgespuckt. Ihre Dreimonatskolik hatte drei Jahre gedauert. Drei Jahre lang hatte sie geschrien, ununterbrochen, so schien es Erika. Geschrien und nicht geschlafen. Ihr erstes Wort war nicht «Mama» gewesen, sondern «Bauchweh». Erika hatte irgendwann aufgegeben und Suleika essen lassen, was sie wollte.
«Sie weiß es selber am besten, ihr Körper sagt ihr schon, was er braucht», hatte eine Kinesiologin geurteilt. Suleikas Körper brauchte offenbar nur weiße Nahrung. Doch der Eintritt ins Gymnasium mit knapp zwölf Jahren hatte alles verändert. Suleika kam über Mittag nicht mehr nach Hause, sie aß mit ihren Freundinnen, von denen sie immer viele gehabt hatte, sie ernährte sich von Süßigkeiten, von Fastfood, von Backwaren. Und sie nahm zu. Erst langsam, dann explosionsartig. Erst hatte Erika sich gefreut über den Appetit ihrer Tochter, den sie für gesund hielt – aber was verstand sie davon, sie hielt Diät, seit sie sechzehn war.
Erika war ihre Tochter peinlich. Sie schämte sich für dieses Gefühl, aber es war da. Ihre Tochter machte all ihre Anstrengungen zunichte. Solange Suleika so dick war, konnte Erika tun, was sie wollte. Sie konnte so gut aussehen, so schön wohnen, sich so kultiviert unterhalten, so formvollendet einladen, wie sie wollte. Der Anblick ihrer Tochter machte all das zunichte. Ihre Tochter war der Fleischberg gewordene Beweis für Erikas Versagen.
«Ich bin heute Abend eh nicht da», sagte Suleika nun, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. «Sagen wir einfach, ich hätte meinen Anteil einfach zwei Stunden früher gegessen als die anderen.»
«Deinen Anteil?» Anklagend zeigte Erika auf die halbleere Ofenform.
«Als ob Gerda oder Susanne mehr als einen halben Löffel davon essen würden», sagte Suleika. «Oder du. An euch Röntgenbilder ist Frau Nadolnys Kochkunst eh verschwendet!»
«Suleika, mach jetzt bitte keine politische Grundsatzdiskussion daraus», rief Erika. «Es kommen schließlich auch noch andere Gäste. Gäste, die essen. Männer!»
Verzweiflung stieg in ihr auf. Das Essen war ruiniert. Sie war zu spät mit allem. Sie hatte sich noch nicht umgezogen. Max würde erst später kommen, und Erika wusste nicht, welchen Wein sie zum Aperitif reichen sollte. Das wackelige Kartenhaus ihrer Zuversicht stürzte ein.
«Was soll ich denn bloß tun?», jammerte sie. «Es ist alles ruiniert, ich schaff es nicht, es ist alles ruiniert, es ist alles ruiniert, ich dreh noch durch …» Erika sah sich beim Durchdrehen zu, wie einem außer Kontrolle geratenen Spielzeugkreisel auf dem Küchenboden. Sie wollte das Kreiseln anhalten, unterbrechen, doch sie konnte es nicht. Ihre Stimme wurde immer schriller.
«Wer kommt denn noch?», fragte Suleika schließlich, und Erika riss sich zusammen. Sie atmete einmal tief durch, zweimal. Suleika betrachtete sie mit einem kalten Blick. Konnte es sein, dass ihre eigene Tochter sie verachtete?
«Delia Kaufmann mit ihrer Partnerin, und Felix Feilchenfeldt mit seinem Sohn, wie heißt er gleich?»
«Der Schauspieler?» Einen Moment lang zeigte sich Suleika interessiert. «Delia Kaufmann, das ist die Opernhausdirektorin, nicht? Ist die lesbisch?»
«Natürlich ist sie lesbisch», sagte Erika heftig. «Das weiß doch jeder.» Wie konnte Suleika so weltfremd sein? Wo lebte sie denn? Sie interessierte sich für nichts, was wirklich wichtig war. Erika spürte eine Wut in sich aufsteigen, die nichts mit den weggefressenen Älplermagronen zu tun hatte und nichts mit Suleikas Weigerung, sich über gesellschaftliche Zusammenhänge in ihrer Stadt auf dem Laufenden zu halten. Die Wut lebte direkt neben ihrer Verzweiflung. Sie war uralt. Älter als sie selbst. Und sie würde alles überschwemmen, wenn Erika es nicht verhinderte. Sie würde alles mit sich reißen und zerstören. Während die Verzweiflung alles zusammenhielt.
Erika ging ins Bad und trank einen großen Schluck aus der Plastikflasche, die nicht Linsenflüssigkeit enthielt, wie draufstand, sondern Wodka.
Suleika hatte recht gehabt: Es war genug da. Heute aßen auch Männer nicht einfach ungeniert, worauf sie Lust hatten. Sie achteten genau wie Frauen auf ihre Linie. Sie bekämpften den körperlichen Zerfall mit derselben Verbissenheit. Das Alter machte keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Aber Erika würde sich hüten, das auszusprechen. Ihre letzten Versuche, sich ins Gespräch einzumischen, hatten betretenes Schweigen ausgelöst. Max war etwas später gekommen und hatte als Erstes den Weißwein kritisiert, den sie zum Apero gereicht hatte. Erika hatte zweimal nach dem Namen von Delia Kaufmanns Partnerin fragen müssen und beide Male «Wie interessant, ist das ein italienischer Name?» gesagt. Karin Misoto war Japanerin. Das Tischgespräch war ihr bald entglitten, vielleicht, weil sie einen Schluck zu viel aus ihrer heimlichen Flasche genommen hatte. «Nicht mit Alkohol einnehmen», stand auf der Packungsbeilage aller Medikamente, die sie einnahm. Nicht mit Alkohol? Wie denn sonst?
Sie musste besser aufpassen. Erika hatte gesehen, wie Max einen Blick mit Gerda wechselte, der über ihr übliches Flirten weit hinausging. Wie die Eltern eines ungezogenen Kindes hatten sie sich über den Tisch hinweg angeschaut, resigniert und doch verschwörerisch.
«Früher starben die Frauen im Kindbett», sagte Gerda jetzt. «Da war es ganz normal, dass ein Mann alle paar Jahre eine Jüngere hatte. Warum sollte es heute anders sein? Es ist doch einfach in den Genen drin!»
Erika riss sich zusammen. Sie musste versuchen, den Anschluss zu finden. Hatten sie gerade von Mona gesprochen, von John, von der schwangeren Praxishilfe? Hatte sie die Geschichte ausgeplaudert oder Susanne? Oder ging es immer noch um Susannes Schwangerschaft, die an diesem Abend offiziell verkündet worden war?
Erika atmete schneller. Sie fühlte sich, wie so oft, an ihrem eigenen Esstisch wie bei einer Prüfung.
«Wenn das so ist, warum sind wir dann noch zusammen?» Arnold nahm Gerdas Hand und küsste sie.
Gerda ließ ihn einen Augenblick gewähren, dann zog sie ihre Hand zurück. «Du und ich, wir sind eben etwas Besonderes», sagte sie sachlich, als verkünde sie eine allgemein bekannte Tatsache. «Nein, was ich sagen will: Ich kann dieses Gewinsel nicht mehr hören! Hier in der Schweiz ist keine Frau benachteiligt. Schaut mich an, ich bin eine Frau, ich bin über fünfzig, mein Vater war Kondukteur bei der VBZ. Ich hab die Matura auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt, und heute baue ich das Olympiastadion – na ja, das hoffe ich wenigstens. Was ich kann, kann jede – aber natürlich nur, wenn sie bereit ist, so hart zu arbeiten wie ich! Eine Frau, die hierzulande zu wenig verdient, ist einfach selber schuld. Eine Frau, die verlassen wird, auch. Ich hab die Nase voll von den Weibern, die zu faul sind, um wirklich etwas zu leisten, und die sich dann beklagen, sie seien nicht wichtig! Sie würden nicht ernst genommen! Warum sollte man sie denn ernst nehmen, bitte sehr?»
«Absolut einverstanden», rief Delia Kaufmann. «So etwas gibt es doch auch nur hier, in diesem fetten, verwöhnten Land, in dem der Kleinbürgermief noch regiert. Nirgendwo sonst auf der Welt können Frauen es sich leisten, zu Hause auf ihren fetten Ärschen zu sitzen.»
«Der Anspruch auf lebenslange Versorgung durch die Gebärmutter hat überall sonst auf der Welt längst ausgedient», stimmte ihre Partnerin Karin zu. «In keinem anderen Land kommt man mit ‹Frau von …› oder ‹Mutter von …› durch.»
«Na ja, vielleicht in den amerikanischen Vorstädten … oder wenigstens in den Vorstädten der Fernsehserien!»
«Little boxes», begann der junge Mann zu singen, der Schauspieler, und die anderen fielen ein. «Little boxes on the hillside, little boxes, all the same …»
Erika kannte die Melodie nicht. Gehörte sie zu einer Fernsehserie? Sprachen sie über Fernsehserien? Gerda hatte doch nicht einmal einen Fernseher. Erika verstand oft nicht genau, wovon die anderen sprachen. Sie hatte gelernt, ihre Unwissenheit zu überspielen, ihr Unverständnis zu verbergen.
«Also … little boxes würde ich das hier nicht gerade nennen», sagte sie und deutete mit einem, wie sie hoffte, koketten Lachen den Rest des Raums, des Hauses, der drei Häuser an.
Einen Moment lang war es still. Hatte sie zu laut gesprochen? Hatte sie etwas falsch verstanden?
«Nun nimm doch nicht immer alles gleich so persönlich», zischte Max ihr zu, und da verstand sie erst, dass sie gemeint war. Nicht ihr Haus. Sie. Sie übte keinen Beruf aus. Sie trug nichts zur Gemeinschaft bei. Nicht einmal das Essen, das sie auftischte, hatte sie selber gekocht. Trotzdem war sie ständig überfordert und erschöpft. Das richtige Leben sollte nicht so anstrengend sein, fiel ihr wieder ein.
«Oh, nein, nein, nein! Wir wollten dich nicht beleidigen», sagte jetzt Karin Misoto. «Es steht uns nicht zu, über dein Leben zu urteilen. Meine Mutter war auch Hausfrau, und ich habe sie sehr geliebt. Ich hatte den allergrößten Respekt für sie. Alles, was ich geworden bin, verdanke ich ihr.»
Suleika wählte diesen Augenblick, um an den Tisch zu treten, die Essensreste zu begutachten und eine der halbleeren Schüsseln mitzunehmen. Die Gespräche verstummten, es blieb still am Tisch, auch als Suleika schon wieder außer Hörweite war.
«Und das ist unsere Tochter», murmelte Max.
«O Gott, es tut mir so leid, ich hatte keine Ahnung …», stammelte Karin und machte alles noch schlimmer.
«Danke.» Erika stand auf. Sie wusste nicht, was an diesem Abend anders war als an allen anderen. Aber sie wusste, dass sie keinen Augenblick länger am Tisch sitzen bleiben konnte. Sie spürte einen Klumpen im Hals und sah sich schon würgen, wie ihr schwarzer Kater Peter, den sie als Kind gehabt hatte, einen abscheulichen Klumpen aus Speichel und Haaren hervorwürgen. Gleich hier am Tisch. Stattdessen stand sie auf und ging aus dem Zimmer.
«Bringst du uns noch eine Flasche von dem Salice Salentino?», rief Max hinter ihr her. «Sie sollte schon offen sein.»
Doch Erika ging nicht in die Küche. Sie ging aus dem Wohnzimmer und die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. Sie versuchte, Mona anzurufen, doch Mona nahm nicht ab.
Sie schaltete ihren Laptop ein und klickte sich durch die Wohnungsangebote. Seit Monaten hatte sie eine Suchanfrage auf einem Immobilienportal laufen. Sie klickte sich durch die Bilder der leerstehenden Wohnungen und Häuser und stellte sich vor, wie es wäre, in ihnen zu leben.
Allein.
In den letzten Wochen waren keine neuen Angebote dazugekommen. Es schien Wohnungsmangel zu herrschen. Erika hatte die immer selben Wohnungen im Geist schon mehrmals umdekoriert. Doch heute blinkte eine Nachricht auf ihrem Bildschirm. «DRINGEND!!!», hieß es dort. «AB SOFORT! Nachmieter gesucht!»
Sie klickte das Angebot an. Eine billige, kleine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. Erika erkannte weder den Straßennamen noch die Postleitzahl. War das überhaupt noch in Zürich? Vermutlich eine dieser neuen Siedlungen am Stadtrand, die sie aus dem Zugfenster sah, wenn sie zu ihrer Mutter ins Glarnerland fuhr.
Auf den Fotos war die Umgebung nicht zu sehen. Die Aufnahmen waren hastig gemacht, die Wohnung nicht einmal aufgeräumt worden. Umzugskisten standen herum, ein riesiger Fernsehsessel aus künstlichem Leder.
Kein Geschmack, kein Geld, dachte Erika. Wie in ihrem Traum. War das der Schlüssel? War das ihr richtiges Zuhause, das, in dem sie wirklich wohnen sollte?
Sie füllte ein Antwortformular aus und tippte gerade ihre Handynummer ein, als Max hereinkam.