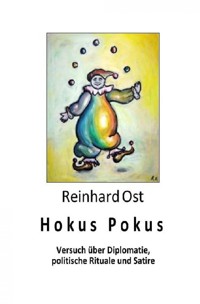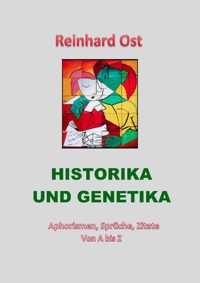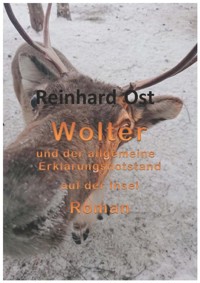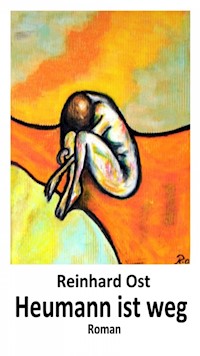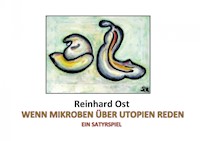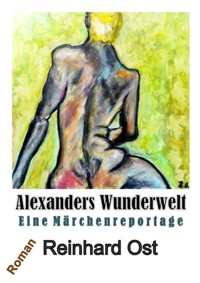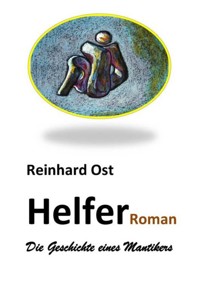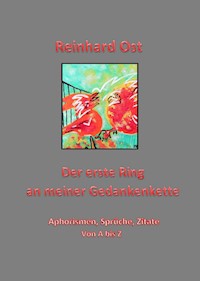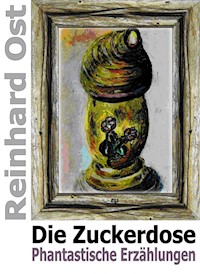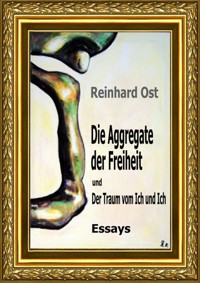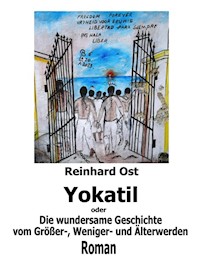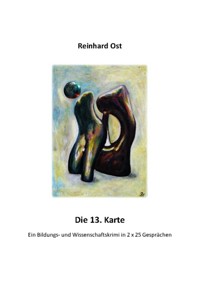
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Die zunächst erfolglosen Ermittlungen in einem spektakulären Mordfall begleiten den Leser in die unbekannte Welt der Wissenschaften. Während der Lektüre können wir die Umrisse einer historisch-philosophischen Anthropologie und auf besondere Art und Weise die kommentierte Geschichte der Freien Universität Berlin entdecken. Das außergewöhnliche Buch spiegelt bedeutende Aspekte der Wissenschafts- und Universitätsgeschichte in unterschiedlichen Fachdiskursen und verschiedenen Sprach- bzw. Literaturgenres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 683
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teilung und Verdopplung
Rebellarium
Kunst und Inspiration
Weltmeisterschaft
Spaziergang
Bildung, Geschichte und Erkenntnis
Projektkult und Entgrenzung
Daten, Dominoeffekte und Sicherheit
Vertrauen und Internationale Vernetzung
Nutzen und Nützlichkeit
Sprache
Heimat von Glauben und Wissen
Schatzkammer der Spione
Verlorene Kindheit
Krieg und Geschlechter
Gefängnisinsel
Schubkästen
Regeln gegen den Selbstbetrug
Würdigung und Wettbewerb
Hören und Verstehen
Verteilung des Geldes
Mensch und Masse
Index Professorum
Gedächtnis
Zukunftswerkstatt
Epilog
Nachruf im Gedenken an Professor Dr. Ing. Aporius
Personenverzeichnis
Über den Autor
Impressum
Prolog
Laut Akte der Mordkommission wurde der Hobby-Angler Walter Aporius am Sonntag, dem 15. April 2013, an einem Baggersee im Norden Berlins von spielenden Kindern tot aufgefunden. Mit dem Gesicht nach unten und einer stark blutenden Kopfwunde lag er im seichten Uferwasser. Die Sofortabteilung der Schutzpolizei hatte den Tatort ordnungsgemäß abgesichert. Die Beamten der Mordkommission wurden ordentlich und zeitnah benachrichtigt.
Die ersten 48 Stunden nach der Tat waren für die Kommissare schnell und leider erfolglos verstrichen gewesen. Nach zwei Tagen ohne Täterzugriff ist es klar, dass es zäh wird für die Beamten. In den meisten Fällen geht es bei Mord und Todschlag um Beziehungstaten, bei denen die Täter innerhalb weniger Tage ermittelt werden können. 90 Prozent aller Berliner Mordfälle werden, dem Vernehmen nach, aufgeklärt. Problematisch sind solche Fälle, bei denen die Ermordeten wie zufällig ausgewählte Opfer erscheinen. Der Aporius-Fall schien einer dieser problematischen Fälle zu sein.
Die Todesursache konnte schon am Tatort eindeutig festgestellt und dann durch die Gerichtsmediziner bestätigt werden. Der Professor für Maschinenbau an der Technischen Universität Berlin, Dr.-Ing. Walter Aporius, war beim Angeln durch einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf, mit Hilfe eines stumpfen Gegenstandes, eines Baseballschlägers oder eines Holzknüppels ohne Rinde, erschlagen, dann ins Wasser geworfen worden und anschließend ertrunken. Der Todeszeitpunkt lag in der beginnenden Abenddämmerung zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr. Eine Tatwaffe wurde nicht gefunden. In der Innentasche des Jacketts fand man die Brieftasche des Toten mit Personalausweis, einer Krankenkassenkarte der DAK, zwei Scheckkarten, einer goldenen Visa-Karte, einer EC-Karte, 155 Euro Bargeld in Scheinen sowie ein Foto seiner Frau. Ein Raubmord war es nicht. Darüber hinaus wurden am Tatort die Angel-Utensilien sichergestellt, bestehend aus Klapphocker, einer „Sänger Anaconda Undercover Travel-Angelrute“, kleinem Köcher, Köderkästchen, mittelgroßem, leeren Plastikeimer sowie einer halbvollen Flasche Mineralwasser und einer angebrochenen Keksrolle, die sich in einer Plastiktüte befand. Der Tathergang konnte einwandfrei nachvollzogen werden. Der Täter hatte sich von hinten an sein Opfer herangeschlichen. Es gab keine Zeichen eines Kampfes, keine Fingerabdrücke und auch keine DNA-Spuren des Täters. Nicht das Geringste konnte bis dato täterbezogen ermittelt werden. Es fehlte im Grunde jeglicher Hinweis, der einen bestimmten Täter, einen Täterkreis oder gar das Motiv für die Tat auch nur erahnen ließe. Die Vegetation am Baggersee, das hohe Schilfgras im seichten Uferwasser und die Büsche direkt davor, boten, so stellte man fest, einen besonderen Blickschutz für den Täter. Der Ort schien als Tatort wie durch den Täter ausgesucht. Der Tatort erzählte gewissermaßen seine Mordgeschichte, die aber nicht sehr tiefsinnig war. Man fotografierte sorgfältig alle Details und machte plastinierte Schuhabdrücke des Täters, die auf der ufernahen Seewiese und dem angrenzenden Sandweg deutlich erkennbar waren. Die Abdrücke gehörten einer Person, die Schuhgröße 45 hatte und circa 85 bis 90 Kilo schwer war. Die Schuhspuren verliefen sich dann im angrenzenden Wäldchen, durch das der Täter gekommen und auch wieder gegangen sein musste - und zwar langsam, gemessenen Schrittes, notierte man.
Der Hobbyangler und Kunstliebhaber Professor Walter Aporius war kinderlos und alleinstehend. Seine Ehefrau war zwei Jahre zuvor an einem Krebsleiden verstorben. Die Befragungen der beiden Kinder, die die Leiche entdeckt hatten, direkt am Tatort, brachten keine zusätzlichen Erkenntnisse. Die beiden Brüder, 10 und 12 Jahre alt, hatten per Handy ihre Eltern verständigt und die Eltern dann die Polizei benachrichtigt. Die Auskünfte von Anwohnern in der nahen Reihenhaussiedlung hinter dem Wäldchen, die man noch spät am Abend einholte, blieben ohne verwertbare Hinweise auf die Tat oder den Täter. Die Befragungen der nahen Verwandten und Bekannten von Aporius sowie die Auskünfte seiner Kolleginnen und Kollegen am Institut für Werkzeugmaschinen der Technischen Universität Berlin sowie auch die Suche nach Zeugen auf der Homepage der Berliner Polizei waren erfolglos geblieben. Man hatte ein Foto des Ermordeten, eine kurze tabellarische Angabe seiner Physiognomie und seiner Kleidung ins Netz gestellt. Jede polizeiliche Dienststelle hätte Hinweise gerne entgegengenommen, aber die gab es nicht. Niemand wusste etwas oder konnte etwas mutmaßen, das zur Aufklärung der schrecklichen Tat hätte beitragen können.
Walter Aporius ist 62 Jahre alt geworden. Er war ein guter und bei den Ingenieurstudenten sowie den wenigen Ingenieurstudentinnen ein außerordentlich beliebter Hochschullehrer. Er sah für sein Alter sehr gut aus, hatte dichtes schwarzes Haar, einen tiefen Haaransatz und war vielleicht sogar ein Frauentyp gewesen. Der Beruf des Hochschullehrers nahm ihn, wie seine Kollegen berichteten, voll in Anspruch. Im Fachgebiet der Füge- und Beschichtungstechnik war Aporius in den letzten zehn Jahren auch als exzellenter Forscher mit einer Reihe von Industrieprojekten, die er leitete, erfolgreich gewesen. Er war, nach Auskunft seiner Kollegen in der Universität, sehr kommunikativ, freundlich, weltoffen und ausgesprochen eloquent. Nichts deutete darauf hin, dass ein Interesse an seinem Tod bestanden haben könnte.
So wurden schließlich die Ermittlungen im Mordfall Aporius nach etwas mehr als einem Jahr erfolglos eingestellt. Der Fall galt als abgeschlossen.
Im Arbeitszimmer von Kommissar Noel geschah dann etwas Unerwartbares. Noel hatte sich während der wöchentlichen Dienstbesprechung, die immer dienstags um 10 Uhr stattfand, ein wenig über seinen neuen Kollegen geärgert, der als Anwärter im höheren Dienst vorgestellt wurde. Der neue Kollege wirkte für Noel so, als wäre er ohne Umwege und praktische Erfahrungen direkt aus der Hochschule in die Mordkommission gelangt, weil der Neue den Versuch unternahm, den Älteren im Dezernat die moderne Welt der Verbrechen erklären zu wollen. Noel musste sich allerdings eingestehen, dass einige Dinge sprachlich ziemlich geschickt formuliert waren, so dass es zwar naseweis, aber auch mutig und intelligent klang. „Gut reden und geschickt formulieren kann der Besserwisser also“, dachte Noel und erinnerte sich an nassforsche Sätze wie: Man müsse bei der Aufklärung von Verbrechen in allen Bereichen der Kriminologie, der Kriminalistik und der Kriminaltechnik noch viel wissenschaftlicher und systematischer vorgehen. Als wenn nicht gerade er, Frank Noel, es war, der alle neuen Kolleginnen und Kollegen stets mit offenen Armen und viel vorauseilender Sympathie empfing, weil er in ihnen immer den Fortschritt, die Frische und das besondere Engagement erkennen konnte. Der neue Kollege Heumann hatte in seinem mutigen Eingangsstatement ein kleines Plädoyer für die moderne Aufklärung gehalten und Dinge formuliert wie, dass die Wissenschaft inzwischen in hohem Maße an der Verbrechensbekämpfung mitwirken würde. Sie wäre aber zugleich auch an vielen Verbrechen, direkt oder indirekt, beteiligt. Es waren diese speziellen Sätze mit den Schlüsselworten „Wissenschaft“, „direkt“ und „indirekt“, die Noel nicht mehr aus dem Kopf gingen.
Wohl aus Langeweile, Erregung und Ablenkungsbedürfnis erinnerte sich Noel an den Mord am Berliner Wissenschaftler Aporius und eher zufällig gab er die Worte Aporius und Wissenschaft auf seinem Arbeitsplatzrechner in die Suchzeile von Google ein. Er konnte sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er man bei der Bearbeitung des Aporius-Falls überhaupt eine Google-Recherche gemacht hatte. Jedenfalls stand nichts davon in den Unterlagen, wie Noel durch ein kurzes Durchblättern seines Aporius-Ordners feststellte. Und siehe da, das Rechercheergebnis bei Google zum Stichwort Aporius zeigte nicht nur die vielen Zeitungsartikel an, die seinerzeit erschienen waren, sondern gleich zu Beginn der Google-Liste entdeckte Noel ein E-Book beim Online-Herausgeber und Buchhändler Spartacus / Mändle. Das E-Book hatte den Titel „Fenster im Turm“ mit dem Untertitel „Die Berliner Gespräche des Herrn Aporius über Kultur, Wissenschaft und Universitäten“. Das Buch erschien in der Verlagsrubrik Wissenschaft/Sachthemen/Philosophie. Der Autor des elektronischen Buches wurde mit A. Nonymus angegeben. Da Noel auch schon das Inhaltsverzeichnis im Netz vorfand, sah er, worum es in insgesamt 25 Buchkapiteln ging: Teilung und Verdopplung, Rebellarium, Kunst und Inspiration, Weltmeisterschaft, Spaziergang, Bildung, Geschichte und Erkenntnis, Projektkult und Entgrenzung, Daten, Dominoeffekte und Sicherheit, Vertrauen und internationale Vernetzung, Nutzen und Nützlichkeit, Sprache, Heimat von Glauben und Wissen, Schatzkammer der Spione, Verlorene Kindheit, Krieg und Geschlechter, Gefängnisinsel, Schubkästen, Regeln gegen den Selbstbetrug, Würdigung und Wettbewerb, Hören und Verstehen, Verteilung des Geldes, Mensch und Masse, Index Professorum, Gedächtnis und Zukunftswerkstatt. „Eine kuriose Mischung ist das Ganze“. Noel grübelte. „Ein Berliner Professor für Ingenieurwesen, der über so etwas Grundsätzliches und Unterschiedliches spricht, das ist schon hochinteressant. Haben wir damals bei unseren Recherchen wirklich vergessen ins Internet zu schauen? Internetrecherche gehört ja eigentlich inzwischen zum Standardprogramm von Ermittlern. Haben wir das Buch übersehen oder haben wir überhaupt an die Publikationen des Wissenschaftlers Aporius gedacht?“ Noel stellte dann aber ohne große Mühe fest, dass das E-Book „Fenster im Turm“ erst kurz nach dem Tod von Walter Aporius herausgekommen war. „Deshalb konnten wir es also seinerzeit gar nicht finden. Aber eigentlich weiß man ja nie so richtig, wie das bei diesem modernen Online-Schnickschnack heutzutage so alles abläuft. Vielleicht haben Spartacus / Mändle das Buch mit Absicht erst nach dem Tod von Walter Aporius herausgebracht. Ermordete Autoren, die vorher auf den Titelseiten der Tageszeitungen erscheinen, bringen wahrscheinlich mehr verkaufte Exemplare zustande als die Lebenden“, kombinierte Noel. „Geschrieben wurde das Buch jedenfalls viel früher. Wenn der Berliner Professor und Hobbyangler Walter Aporius vom Baggersee also der Autor und die Hauptfigur dieses Buches mit Namen „Fenster im Turm“ ist, dann gäbe es vielleicht eine neue Spur. Warum haben seine Ingenieurkollegen aus der TU das Buch überhaupt nicht erwähnt? Ach ja, richtig, weil es zum Zeitpunkt des Todes noch gar nicht veröffentlicht war.“ Noel ließ sich durch solcherart Gedankenspiele anregen, das E-Book in seinen Online-Warenkorb zu legen und kaufte es schließlich. Er war Mitglied bei Spartacus und besaß auch einen Mändle-Reader. Das elektronische Buch kostete 6,80 Euro. „Man könnte ja mal in das Buch hineinschauen“, dachte er sich.
Noels Arbeitstag ging dann mit vielen kleineren Routineaufgaben langsam zu Ende. Es war inzwischen 18.50 Uhr geworden. Noel fuhr in seinem 1er-BMW nach Hause. Auf der Heimfahrt grübelte er immer noch: „Merkwürdige Themen sind das in diesem Buch. Na, wir werden morgen ja schon sehen, ob an den neuen Hinweisen in der Aporius-Sache etwas dran ist.“ Wirre Gedanken schossen ihm noch am späten Abend durch den Kopf. „Hat Walter Aporius eventuell ein Doppelleben geführt oder aus anderen geheimnisvollen Gründen philosophische Bücher geschrieben?“ Noel schlief dann, für seine Verhältnisse sehr früh, kurz vor Mittenacht, ein. Am nächsten Morgen, nach dem er wie immer traumlos geschlafen hatte, ging er sehr viel früher und in seinem persönlichen Empfinden sogar engagierter zum Dienst. Er fühlte sich nicht so kaputt und ausgelaugt, wie sonst so häufig. Wie er fand, hatte er sogar weniger Beschwerden in seinem rechten Knie, in seiner rechten Schulter und im rechten Oberarmbereich. „Wenn man frühmorgens aufwacht und keine Schmerzen hat, dann ist man entweder tot oder hat den Job gewechselt“, war Noels Lebensmotto, beides traf an diesem Morgen natürlich nicht zu.
Seine erste Amtshandlung im Büro bestand darin, das neue Mändle-Buch auf seinem E-Reader, den er von zu Hause mit ins Büro brachte, durchzuscrollen. „Fenster im Turm“ entpuppte als ein wissenschaftsphilosophisches und wissenschaftshistorisches Bildungshandbuch. Schon beim Lesen des Vorworts kramte Noel aus seinem persönlichen Aporius-Aktenordner die Telefonnummer eines Hochschullehrers aus der TU hervor, den sie damals bei ihren Ermittlungen befragt hatten und der ihm in Erinnerung geblieben war. Sogleich versuchte er ihn anzurufen. Als das nicht klappte, schaute er auf der Website des TU-Hochschullehrers nach, um die aktuelle Telefonnummer zu bekommen. Es gelang schließlich, Professor Heberle telefonisch zu erreichen. Noel stellte sich mit „Mordkommission Berlin, Frank Noel“, vor. „Sie wissen schon, die Mordsache Aporius“. Er fragte Heberle sehr direkt, ob er davon wisse, dass Walter Aporius ein philosophisches Bildungsbuch geschrieben habe. Ein solches Buch wäre kürzlich bei Spartacus unter dem Titel „Fenster im Turm“ veröffentlicht worden. Heberle verneinte mit dem Hinweis darauf, dass er sich aber eine solche Veröffentlichung seines ehemaligen Kollegen durchaus vorstellen könne. Aporius wäre ein umfassend gebildeter Mensch gewesen. „Wenn das mit dem philosophischen Buch stimmen würde, wäre es aber schon sehr merkwürdig, dass man in der TU nichts davon mitbekam.“ Heberle fuhr dann fort: „Der Tod von Walter Aporius ist bei uns lange Zeit das wichtigste Gesprächsthema gewesen. Die vielen Zeitungsartikel über den Todesfall, auch in der BILD-Zeitung, haben hier damals alle schier verrückt gemacht. Die BILD-Zeitung berichtete über ‚Zerschmetterte, Überfahrene, Vergiftete, Erhängte, Erschossene und über die Mordhauptstadt Berlin‘ und dass nunmehr auch ein Professor dabei sei. So etwas bringt wohl Auflage. Wenn etwas Dramatisches passiert, dann darf das Volk anscheinend nichts verpassen. Alles wird dann immer in den großen Zusammenhang von Mord und Totschlag im Allgemeinen gestellt. Je aufsehenerregender das Ende, desto prächtiger und dramatischer ist die BILD-Überschrift.“ Noel wusste eigentlich nicht genau, warum der Professor ihm die Sache mit der BILD-Zeitung überhaupt erzählte. Er fragte aber nicht nach und erwähnte auch nicht, dass das ominöse Buch erst nach dem Tod von Walter Aporius herausgekommen war. Es stellte sich im Laufe des Gesprächs dann heraus, dass Heberle selbst, der die Abschiedsrede für seinen Kollegen bei der internen Trauerfeier in der Technischen Universität gehalten hatte und dass er mit Aporius ziemlich eng befreundet gewesen war. Noel fragte noch gleich einige andere Dinge hinterher. Er erfuhr von Heberle, dass Walter Aporius ein sehr guter Institutsdirektor und lange Zeit auch Dekan des Fachbereichs war. Gerade in den schwierigen Zeiten starker Personalkürzungen an der TU Berlin, Mitte der 1990er Jahre, sei das Amt des Dekans ein außerordentlich schwieriger Job gewesen. Noel konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie damals so etwas überhaupt ermittelt hätten. Noel verabschiedete sich am Telefon sehr freundlich und bat Heberle darum, ihr kurzes Telefongespräch doch bitte vertraulich und sehr persönlich zu verstehen. Es handele sich lediglich um einige routinemäßige Nachrecherchen in einem leider erfolglos abgeschlossenen Verfahren.
Noel nahm sich wieder das E-Book vor. „Ziemlich grundsätzliche Themen sind das, in denen auch ein eine Menge Zündstoff steckt“, mutmaßte Noel. „Man sollte in das Buch jedenfalls mal hineinschauen, wenn ein Mordopfer über so etwas Kurioses spricht.“
Noel ging es in diesem Augenblick wie immer, wenn er Neues und Unerwartetes entdeckte. Er musste sofort mit jemandem darüber reden. „Meine Kolleginnen und Kollegen hauen mir das Ding um die Ohren, wenn ich erzähle, dass eine Schnellrecherche bei Google möglicherweise neue Anhaltspunkte im Fall Aporius gebracht hat. Mit wem also kann ich sprechen?“, fragte er sich. Seine Dienststelle war kein Großraumbüro mit Massenbetrieb, wie immer in diesen amerikanischen Geheimdienstfilmen, wo alle beieinander stehen und einfach drauflosquatschen. Sein Vorgesetzter arbeitete auch nicht in einem Bürozimmer mit stets offenen Glastür und Lamellenjalousie, die ihn von seinen Mitarbeitern nicht wirklich trennt. Noel spielte mit solchen Gedanken, als ihm plötzlich wieder sein neuer Kollege Heumann einfiel. Hatte der Neue nicht so locker und jungfräulich gesagt, dass die Wissenschaft inzwischen an vielen Verbrechen beteiligt sei. Das könne er ja nun unter Beweis stellen, dachte Noel. Kaum gedacht, schon stand er vor der Tür des Dienstzimmers, in dem sein neuer Kollege, zusammen mit einer weiteren Kollegin und einem weiteren Kollegen, untergebracht worden war. Er klopfte an und ging ohne Rückmeldung hinein.
Der neue Kollege Heumann war noch mit seinem Schreibtisch und dem Sortieren seiner Arbeitsutensilien beschäftigt. Er war mit Kugelschreiber, Locher, Schmierpapier, Maus, Mousepad und Klebestift zugange, als Noel ihn kurz und schmerzlos bat, fast wie eine dienstliche Aufforderung, ihm in sein Zimmer zu folgen. Heumann folgte. Hauptkommissar Noel hatte ein Einzelbüro. Beide standen noch in der Tür, als Noel in aller Kürze stichwortartig den alten Fall Aporius samt seiner neuen Entdeckung schilderte. Heumann reagierte schnell und positiv, aber letztlich dann doch schon wie sehr viele Beamte üblicherweise. Ohne dass sie überhaupt Platz genommen hatten, sagte der neue Kollege Heumann, er habe so viel zu tun und gleich wieder einen neuen Termin bei Oberkommissar Suße. Noel fand den Spruch, wie immer eigentlich, sehr enttäuschend. Sie schafften es dennoch, sich gemeinsam zum Mittagessen in der Kantine zu verabreden, mit dem Ziel, dann über die Angelegenheit intensiver reden zu wollen.
Noel war noch ein wenig aufgekratzt. Beim Gespräch am Mittagstisch entpuppte sich der junge Kollege Heumann als ausgesprochen freundlicher, kluger und aufgeschlossener Typ. Er fände die Sache mit dem Buch von Professor Aporius und den „Fenstern im Turm“ ganz spannend, sagte er. Und auch die Kapitelüberschriften schienen ihm kriminologisch, wie er es nannte, interessant zu sein. „Wenn Aporius der Protagonist des Buches und der Autor mit dem Namen A. Nonymus ist, dann könnte er am Ende mehr Feinde und Widersacher gehabt haben, als ihm lieb sein konnte.“ Beide gingen nach dem Mittagessen ausgesprochen gut gelaunt wieder in ihre Büros zurück. Sie freuten sich darüber, dass sie sich näher kennengelernt hatten. Einige Kollegen in der Kantine wunderten sich über die beiden: „Kennen die sich vielleicht? Dann könnte Noel den Neuen bei uns reingehievt haben“.
„Wenn man den Fall Aporius wieder aufrollen würde, dann bedeutet das viel zusätzliche Arbeit, zum Beispiel Anträge schreiben, Begründungen ausformulieren, Vorgesetzte überzeugen“. Noel stöhnte vor sich hin, als er sich wieder an seinen Schreibtisch setzte. Hatte er doch auch noch eine ganze Reihe anderer Aufgaben zu erledigen. Er schaute wieder in sein neues E-Book. „Rebellarium, Gefängnisinsel, Schatzkammer der Spione, Verteilung des Geldes: Das sind Stichworte, nach denen selbst der amerikanische Geheimdienst die deutschen E-Mails durchgucken würde“, sinnierte Noel. „Und was machen wir? Wir haben Probleme, einen einfach gestrickten Mordfall, allerdings leider ohne Motiv, ohne Tatverdächtige und Zeugen, wieder aufzurollen.“ Mit wir meinte er sich.
Hauptkommissar Noel entschloss sich dann, bevor er weiter nachdenken oder gar etwas niederschreiben wollte, mit seinem Vorgesetzten, Oberkommissar Suße, zu sprechen. Suße selbst hatte seinerzeit die Ermittlungen im Aporius-Fall geleitet und war vor Ort am Baggersee mit dabei gewesen. Das Gespräch mit Suße war nicht ganz einfach, wies dieser doch, wie zu erwarten, auf all die Fallstricke und Begründungsnotwendigkeiten für eine formelle Wiederaufnahme von Aporius-Recherchen hin. Beide verabredeten dann, das Ganze zunächst informell handhaben zu wollen. Noel erzählte Suße, dass er auch schon mit dem neuen Kollegen Heumann kurz darüber gesprochen habe. Suße freute sich über den persönlichen Kontakt, und man einigte sich darauf, dass Noel und Heumann gemeinsam, wenn es denn ginge, sich in ihrer freien Zeit ein wenig recherchemäßig in der neuen Angelegenheit Aporius umtun könnten. „Freie Zeit gibt es erfahrungsgemäß auch in der Arbeitszeit, wenn man sie sich herausnimmt“, dachte Noel. „Vielleicht würde Heumann ja unter diesem Aspekt mitmachen und auf das Projekt aufspringen.“
Noels anschließendes kurzes Telefonat mit Heumann war vielversprechend. Heumann hatte angebissen und versprach, sich einige Gedanken zu machen. Ob er es freiwillig, also ohne Köder, tat, weiß man nicht genau. Wahrscheinlich war Heumann nur glücklich über die ersten Dienstgespräche auf seiner neuen Arbeitsstelle. Noel mochte informelle Dinge im Dienst eigentlich gar nicht. Deshalb erklärte er die vorgesehenen informellen Zusatzrecherchen zum abgeschlossenen Aporius-Fall einfach zu einer Dienstangelegenheit und machte sich an seine aktuelle Tagesarbeit.
Schon in aller Frühe des nächsten Tages rief der junge Heumann seinen älteren Kollegen Noel mutig an. Heumann telefonierte in seinem Dreierdienstzimmer von Beginn an sehr geschickt. Er drehte sich mit dem Telefonhörer am Ohr linksseitig zum Fenster und stellte seinen Fuß auf dem Heizungskörper ab. Heumann sprach am Telefon sehr leise, fast schüchtern, aber sehr akzentuiert und deutlich. Er sprach jedenfalls so leise, dass seine Zimmerkollegen, Nikolee Gerber und Andreas Schwab, akustisch nur ein Gemurmel wahrnehmen und nichts verstehen konnten. Den Computerbildschirm und die Tastatur drehte er ebenfalls zum Fenster hin. Das Fensterlicht verspiegelte zwar den Bildschirm. Ergonomisch war alles eine Katastrophe, aber er konnte sich wenigstens sicher sein, dass niemand unmittelbar sah, was er auf dem Computer trieb. Er sagte zu Noel, dass er sich inzwischen ebenfalls den Text besorgt und auch eine gute Idee habe. „Wie im Vorwort des E-Books zu lesen ist, fragt der Autor dort seine Leser, ob diese sich auch schon gefragt hätten, was so irritierend daran wäre, wenn Marcel Reich-Ranicki eine Liste von Büchern als Bildungskanon empfiehlt oder wenn Dietrich Schwanitz ‚Alles’ definiert, ‚was man wissen muss’ und Regeln aufstellt‚ nach denen man unter Gebildeten kommuniziert“. „Heumann kennt Marcel Reich-Ranicki und weiß sogar, wer Dietrich Schwanitz ist“, dachte Noel. „Die fiktiven Berliner Gespräche von Herrn Aporius können zwar auch keine Antwort auf diese Fragen geben“, fuhr Heumann fort. „Man kann im Buch aber erfahren, wie man ungewöhnliche Antworten sucht, um sich dem Phänomen der Bildung, der Aufklärung und der Kultur auf eine neue Art zu nähern.“ Noel wusste nun aber genau, dass sein neuer Kollege das direkt aus dem Vorwort des Buches herausgelesen und nicht selbst formuliert hatte. Heumann kam zum Ergebnis: „Also, ich möchte vorschlagen, dass wir das Buch gemeinsam lesen und die ganze Sache als eine Art von Fortbildung verstehen. So etwas könne ja auf keinen Fall schaden.“ Er machte darüber hinaus den Vorschlag, das Buch ganz langsam und systematisch, Kapitel für Kapitel, durchzuarbeiten, um anschließend jeweils gemeinsam darüber nachzudenken, wer denn die möglichen Gegner und Feinde von Aporius gewesen sein könnten. So könne man ein umfassendes, kriminologisch-kriminalistisches Bild der Lage durch die Lektüre eines Bildungsbuches erhalten. Das bedeute in diesem Fall, sich ein Bild von den Gedanken des Professors Walter Aporius zu machen und die möglichen Gegner seiner Gedanken zu identifizieren. Vielleicht gäbe es ja sogar einige Textstellen, die möglicherweise, direkt oder indirekt, auf den Täter hinweisen würden. Noel fand das alles zwar irgendwie abartig, aber letztendlich fand er es sehr gut. Er stimmte zu und gab grünes Licht zu einer gemeinsamen Bildungslektüre. Heumann hatte sich durch seine Vorschläge geschickt in den Fall Aporius eingeklinkt. Es stellte sich dann für beide sehr schnell, schon beim Durchblättern des elektronischen Buches, heraus, dass das Lesen nicht anstrengend und teilweise sogar ganz amüsant werden könnte. „Das ganze Buch besteht nur aus Gesprächen von zwei Leuten“, meinte Noel. „Es ist kein trockener, wissenschaftlicher Text, bei dem man immer diesen erhobenen Zeigefinger vor der Nase hat.“ Dann beendeten beide ihr Telefonat - voller Zuversicht hinsichtlich ihrer bevorstehenden Lese- und Ermittlungsaufgaben.
„Das sind sokratische Dialoge“, antwortete Heumann zeitversetzt auf Noels Satz vom unsichtbaren Zeigefinger, bei ihrem nächsten Telefonat drei Stunden später. „Man merkt sofort, dass Aporius ein echter Wissenschaftler ist und der junge Journalist, mit dem er immer spricht, gut darauf vorbereitet ist.“ Noel fragte Heumann dann, was denn eigentlich sokratische Dialoge seien. Er hatte zwar auch eine gewisse Vorstellung davon, weil er der Kommunikationsstratege in der Mordkommission war. Er wollte das mit den sokratischen Dialogen aber von seinem neuen Kollegen persönlich formuliert hören. „Auf Sokrates zurückgehende, ursprünglich philosophische, Unterrichtsmethode, die zu eigenverantwortlichem Denken, Reflexion und Selbstanalyse anleitet“, antwortete Heumann sehr überraschend nach einer kurzen Pause. „Anscheinend hat mein Partner so etwas gerade auf der Hochschule im Bereich Führungslehre gelernt“, dachte Noel. In Wirklichkeit aber schaute Heumann während des Sprechens in Wikipedia nach und zitierte von dort. Heumann konnte das wirklich gut, drei bis vier Dinge gleichzeitig zu machen, zum Beispiel Recherchieren im Internet, Zitieren, Denken und Sprechen. Heumann war ein Computer-Freak und, auf neuhochdeutsch gesagt, ein Multitasking Typ.
Noel und Heumann verabredeten, jeden Tag wirklich nur ein Kapitel des Buches lesen und anschließend, jeweils am nächsten Tag, besprechen zu wollen. Sie wollten also täglich und konsequent die Feindbilder und möglichen Gegner oder andere Hinweise durch die Lektüre finden, um dem Geheimnis des Mordes an Professor Walter Aporius auf die Spur zu kommen. Heumann war fest davon überzeugt, dass das eine ganz neue Art der Ermittlung und ein äußerst systematisches Vorgehen sei.
Ein gewisses zeitliches Problem stellte für Noel und Heumann die Rufbereitschaftszeit in der Mordkommission dar. Gerade zum augenblicklichen Zeitpunkt hatten die Kommissare Rufbereitschaft. Im Zwei-Wochen-Turnus werden die Berliner Mordkommissionen dafür eingeteilt. Jede Verabredung steht in dieser Zeit unter Vorbehalt. Man traut sich kaum, in die Sauna oder ins Theater zu gehen, weil man dort sein Handy nicht mitnehmen kann oder es ausschalten muss. Wenn irgendwo in Berlin jemand bedroht oder gar getötet wird, dann klingelt es möglicherweise. Dennoch verabredeten sich die beiden, jedenfalls für das vorhersehbare Ende ihrer nächsten Arbeitstage, einmal am Tag miteinander telefonieren zu wollen, um sich über Aporius, seine Gespräche und seine Gedanken auszutauschen. Sie wollten also, wie schon gesagt, seine möglichen Feinde und Gegner kennenlernen und Anhaltspunkte für das Mordmotiv und den Mörder durch das Lesen eines Buches finden. Noel und Heumann fanden, dass das eine ganz außergewöhnliche Methode sei und etwas gänzlich anderes, als das gewöhnliche Ermitteln oder das Lesen eines Kriminalromans, bei dem am Ende zwar meistens auch ein Mörder überführt wird, aber nicht wirklich die Leser oder die Lektüre eines wissenschaftlichen Textes, wie in ihrem Fall. Eine halbe Stunde vor Dienstschluss, so um 19.00 Uhr herum, planten sie ihre Telefonierzeiten. Sie wollten sich in einer selbstgewählten Bildungsrufbereitschaft täglich maximal 15 bis 20 Minuten über den Aporius-Fall unterhalten. Wenn das klappte, würde es insgesamt 25 Lese- bzw. Ermittlungstage dauern, bis sie die 25 Buchkapitel gemeinsam und kriminalistisch erfolgreich, wie sie hofften, durchgearbeitet hätten. Noel wollte zusätzlich am nächsten Tag, ihrem ersten Besprechungstag, bei Spartacus / Mändle anrufen, um zu erfahren, wie denn solche anonymen E-Veröffentlichungen dort überhaupt zustande kämen und wie die Anonymität der Autoren dann vertraglich vereinbart wird. Er war sich sicher, den anonymen Autor schnell als Walter Aporius identifizieren zu können, einen toten Professor, der seine eigenen Gespräche veröffentlicht und sich als Autor den amüsanten Namen A. Nonymus gegeben hatte. Für Noel war der im Buch interviewte Aporius ein Mordopfer und gleichzeitig sein wichtigster Zeuge. Das pikante Element ihres Vorhabens war, dass ein Ermordeter sogar persönlich zu ihnen sprechen würde und ein Toter der sprechende Zeuge des an ihm selbst verübten Verbrechens wäre, dachte Heumann, sprach es aber nicht aus, weil es ihm irgendwie zu despektierlich erschien. Er war voller Zuversicht und hegte die Erwartung, sich schon als junger Kommissaranwärter, in seinem ersten großen Fall, an der Entdeckung einer originellen Ermittlungsmethode zu beteiligen und sich noch dazu gleichzeitig weiterzubilden zu können.
Teilung und Verdopplung
Noel kann man einen waschechten Berliner Kommissar nennen. Er fühlte sich als Leser des nachfolgenden Gesprächs zwischen Aporius und dem Journalisten aber eher wie ein Besucher in seiner Heimatstadt. Heumann fühlte sich zwar auch als Berliner, aber als ein zugereister Wahlberliner, den lediglich die Ereignisse im Zusammenhang mit der Deutschen Einheit auf recht verschlungenen Wegen in die deutsche Hauptstadt geführt hatten. Heumann wurde in Freital, einem kleinen Ort nahe bei Dresden, geboren. Für beide sollte die Lektüre des ersten Kapitels im Buch eine Lesereise in eine ganz besondere Stadt werden, die auf der intensiven Suche nach ihrer Einzigartigkeit ist und deren Aufgabe u. a. darin zu bestehen scheint, immer noch die Folgen der deutschen Teilung und der Vereinigung bewältigen zu wollen. Aporius und der Journalist sprechen über die „Initiative Weltkulturerbe Doppeltes Berlin“. Es geht um Architektur, Städtebau, Kultur und Stadtleben sowie um verschiedenartigste Teilungen und Verdoppelungen und insbesondere um die jüngere Geschichte der Berliner Universitäten.
Journalist
In Berlin ist im September 2012 eine Initiative mit dem Titel „Weltkulturerbe Doppeltes Berlin“ gestartet worden. Ist Berlin überhaupt schon in der Welterbe-Liste der UNESCO vertreten?
Aporius
Berlin ist bislang in der Weltkulturerbe-Liste dreimal verzeichnet, erstens als Welterbe der Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin, zweitens mit der Museumsinsel des 19. Jahrhunderts und drittens mit den Siedlungen der Berliner Moderne aus der Zeit der Weimarer Republik. Damit steht Berlin als ein Mitglied der Weltkulturerbengemeinschaft repräsentativ für die Epochen des Feudalismus, der Bürgerlichen Gesellschaft und der Ersten Moderne.
Journalist
Die herausragenden historischen Beispiele für die Verdopplung der Berliner Verhältnisse durch die Teilung und die Wiedervereinigung der Stadt machen die jüngere Geschichte Berlins erst in der aktuellen Gegenwart lesbar.
Aporius
Das Berlin im Jahr 2013 hat, zeithistorisch betrachtet, ein doppeltes Erbe angetreten.
Zwischen 1945 und 1989 stand Berlin für die Repräsentanz zweier politischer Systeme und zweier Lebenswelten als Konsequenz der deutschen Teilung. Die geteilte Stadt brachte zahlreiche Staats-, Arbeits-, Wohn- und Kultur-Bauten sozusagen in verdoppelte Gestalt hervor. Es sind die Spiegelungen von Bauen und Architektur in den ehemaligen Teilstädten West- und Ost-Berlin. Erst durch die Maueröffnung im Jahr 1989 ist die politische Einheit der Deutschen und der Stadt Berlin wieder hergestellt worden. Ost-Berlin, die Hauptstadt der DDR, ist nur die halbe Hauptstadt im wiedervereinigten Deutschland. An der kulturelle Wiedervereinigung von Ost und West und an der Einheit der Lebensverhältnisse, denke ich, arbeitet man im Augenblick noch. Die Teilung Deutschlands und die Teilung Berlins hinterließen verdoppelte Architekturen und auch verdoppelte Ideen von Architektur.
Journalist
Bitte nennen Sie doch bitte einige Beispiele für die Verdoppelungen.
Aporius
Beispielhafte Paarungen für die fast spiegelbildlichen Verdopplungen in Berlin sind:
Axel-Springer-Haus – Komplex Leipziger Straße
Hansaviertel – Karl-Marx-Allee
Zentrum West Zoologischer Garten – Zentrum Ost Alexanderplatz
Kongresshalle West – Kongresshalle Ost
Freie Volksbühne – Volksbühne
Großsiedlung West: Märkisches Viertel – Großsiedlung Ost: Marzahn
Freie Universität Berlin (FU) – Humboldt-Universität zu Berlin (HU)
Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 hat das schnelle Zusammenwachsen der Teilstädte in Ost und West durch die Entwicklung Berlins zu einer Weltmetropole sehr rasch das doppelte Erbe verwischt. Die architektonische Verdoppelung Berlins von einer geteilten, über eine gedoppelte, zu einer vereinigten Stadt wird erst jetzt plastisch und sinnhaft erfahrbar. Die Sichtbarkeit des Doppelten Berlin zu erhalten und zur Sensibilisierung für dieses Berlin-spezifische Phänomen beizutragen, sind Anlass und Ausgangspunkt für die Initiative Weltkulturerbe Doppeltes Berlin.
Ziel der Initiative ist die Aufnahme des „Doppelten Berlin“ in die Nominierungsliste für das UNESCO-Weltkulturerbe.
Journalist
Wie muss man sich konkret eine solche Weltkulturerbe-Initiative in den Arbeitsschritten vorstellen?
Aporius
Organisation und Verlauf der Initiative sind wie eine Kampagne.
In einer interdisziplinärem Architektur- und Geschichtswerkstatt, begleitet durch diverse Veranstaltungsformate, ist die Kampagne im September 2012 durch die Ausstellung „Between Walls and Windows“ im Haus der Kulturen der Welt in Berlin gestartet worden. Das Eröffnungswochenende begann mit einer Ausstellung, einer Konferenz und der Einweihung eines temporären Initiative-Büros. Über die Website der Initiative können sich Interessierte beteiligen. Darüber hinaus stellen Studierende in Zusammenarbeit mit der Berliner Universität der Künste Architektur-Filme her, die das „Doppelte Berlin“ dokumentieren sollen. Diese Filme sind während des gesamten Ausstellungszeitraums zu sehen. Zum Tag des Offenen Denkmals werden darüber hinaus Führungen zu Schauplätzen verdoppelter Straßen, verdoppelter Gebäude und Einrichtungen angeboten.
Journalist
Wer sind die Initiatoren?
Aporius
Die Weltkulturerbe-Initiative geht zurück auf das Netzwerk Akademie c/o mit den Architekten, Stadtplanern und Kulturtheoretikern Arno Brandlhuber, Tobias Hönig und Christian Posthofen. Architektur wird nicht als Addition ästhetischer, ökonomischer und konstruktiver Elemente verstanden. Sie wird vielmehr, nach Auskunft der Initiatoren, über die Frage des Gebrauchs, des Nicht-, Warum- und Für-Wen-Bauens definiert. Brandlhuber und Hönig sind als Architekten in Berlin tätig. Posthofen ist Philosoph, Historiker, Verleger für die Kunstwissenschaftliche Bibliothek und für zahlreiche Architektur- und Kunstpublikationen verantwortlich.
Journalist
Auch die Kongresshalle im Berliner Tiergarten hat ein Spiegelbild in Ost-Berlin. Die im Volksmund „Schwangere Auster“ genannte Konstruktion im Westen der Stadt gilt als Architekturikone und als Paradigma der Nachkriegsmoderne. Wer hat die Kongresshalle im Tiergarten gebaut?
Aporius
1956/1957 ist sie im Auftrag der US-Regierung vom Gropius-Schüler Hugh Stubbins entworfen und anlässlich der Internationalen Bauausstellung den Westberlinern geschenkt worden. Die Kongresshalle ist ein Musterbeispiel für skulpturale Architektur.
Mit ihrer voluminösen Plastizität, dem Spiel von großen Betonflächen und Glasfassaden, die unter zwei architektonisch gewagte Stahlbetonträger gespannt sind, steht das Gebäude stellvertretend für die West-Moderne. Die Kongresshalle galt in der Zeit des „Kalten Krieges“ als ein Symbol für Demokratie und Freiheit. Stubbins sagte, dass er damals seinen Entwurf vom sozialistischen Realismus der Ost-Moderne im sowjetischen Sektor Berlins abgrenzen wollte.
Journalist
Die Kongresshallen in West-Berlin und Ost-Berlin sind einzelne Gebäude und, wenn man so will, auch einzelne Denkmäler, die unter bestimmten kulturellen, historischen und ideologischen Bedingungen entstanden sind. Aber nicht nur einzelne Gebäude sind verdoppelt entstanden, sondern auch die Institutionen und ihre Menschen, wie zum Beispiel die Ensembles der Freien Universität Berlin und der Humboldt Universität zu Berlin. Zur Architektur der Universitätsensembles gehören die Geschichten ihrer Entstehung, ihrer unterschiedlichen Entwicklung und ihres Erhalts nach der Wende.
Wie sind die Entscheidungen zum Erhalt und zur Fortführung beider Universitäten nach der Wiedervereinigung zustande gekommen? Die Verdopplung von Architektur und Kultur in einer wiedervereinten Stadt ist doch gewissermaßen bedeutungslos, wenn Gebäude und Einrichtungen nicht in ihrer ursprünglichen Funktionen weitergeführt werden, wenn Universitäten oder Kirchen zu Kaufhäusern werden. Funktionen muss man dann zweifellos etwas allgemeiner verstehen als nur das technische Funktionieren eines Gebäudes. Funktionieren ist überhaupt immer nur ein Ziel des Architektenentwurfs. Ein einzelnes Gebäude oder auch eine Straße sind Räume in der Kultur. Adolf Hitler habe die Autobahnen gebaut, so sagt man. Geplant hat er sie nicht, sondern das waren die Weimarer Demokraten, und genutzt werden sie heute in einer Form, die man sich damals noch gar nicht vorstellen konnte.
Aporius
Genau, diese Fragen nach der Einheit von Architektur, Funktion, Politik und Kultur müssen gestellt und beantwortet werden.
Journalist
Die Freie Universität Berlin ist in der Zeit der Teilung der Stadt als ein direktes Signal kultureller Verdoppelung entstanden.
Aporius
Die Freie Universität Berlin wurde am nasskalten 4. Dezember 1948, während der Berlin-Blockade durch die Sowjets, im Titania-Palast in Berlin-Steglitz gegründet. Die FU-Gründung war keine schicksalhafte Kriegs- oder Teilungsfolge. Akademisches Leben und akademische Institutionengeschichte sind beileibe keine Automatismen. Es waren engagierte Studierende, die für eine freiheitliche Alternative zur politisch-ideologisch gesteuerten Berliner Universität unter den Linden kämpften. Das kritisch-politische Engagement von Studierenden, vor allem auch aus Berlin-Mitte, wurde dann politisch und später architektonisch umgesetzt. Flankiert durch erzieherische Maßnahmen und einem verständnisvollen Umgang mit ihrem ehemaligen Kriegsgegner, leisteten die Amerikaner großzügige Aufbauhilfe bei der Entstehung einer neuer demokratischen Universität im Südwesten Berlins. Im Gegensatz dazu gab es auch akademische Traditionalisten, von denen nicht wenige kritisch gegen die vermeintlich „politische“ Gründung der FU im Westteil der Stadt eingestellt waren. So blieben beispielsweise die geladenen Rektoren der Universitäten der Westzonen wegen Krankheit oder aus anderen Gründen dem FU-Gründungsfestakt fern. Zweifellos war es auch so, dass zum Ende des Jahres 1948 die Entwicklungsperspektive der Linden-Universität in Berlin-Mitte für viele noch nicht genügend überschaubar gewesen war. Die Gründung der FU war ein Teil des ideologischen Ost-West-Konflikts und eine Folge der nationalsozialistischen Herrschaft. Die politische Gesellschaftsideologie von Ost und West war der schwelende Brandherd für die nächsten Jahrzehnte in einem vielbeschriebenen „Kalten Krieg“.
Rückwärtsgewandt und zugleich prophetisch sprach der FU-Gründungsrektor, der Historiker Friedrich Meinecke, anlässlich des Gründungsakts im Berliner Titania-Palast nicht von Konkurrenz zwischen den beiden Berliner Universitäten. Er sagte: „Nicht Kampf gegeneinander, sondern Wetteifer miteinander sei unsere Losung.“ Der altersweise Friedrich Meinecke bringt uns die Geburt der neuen Universität FU auf eine sehr vorsichtige Weise nahe. Er führt ein „akademisches Brautpaar“ vor den „Traualtar“, das aber leider, von diesem Zeitpunkt, an getrennt voneinander leben sollte. Das „Brautpaar“ war damals eine akademische Vision. Inzwischen ist diese Vision organisierte Wissenschaftspraxis im „Ehebetrieb“ der Berliner Universitäten geworden. Der Familienname des „Ehepaars“ ist ein Doppelname. Er lautet „Wettbewerb und Kooperation“.
Journalist
Friedrich Meinecke beschreibt die Gründung und Entwicklung der Freien Universität wie eine Art von Partnerschaftsoffensive. Wie ist die Entwicklung des einen Partners, der FU Berlin, in den 1950er und 1960er Jahren dann weiterverlaufen?
Aporius
Spaltung und Teilung lösen Verbindungen auf und erzwingen Distanzen. Differenzen und Distanzen aber liefern auch die Basis dafür, von einem Beziehungsgefüge sprechen zu können.
Die Entwicklung der FU in den frühen 1950er Jahren kann man als eine späte Konsequenz und die Erfüllung eines „Kindheitstraums“ beschreiben. Der Traum geht auf den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. In dieser Zeit sprach man von einem möglichen „Deutschen Oxford“ am Standort der damaligen Villenkolonie in Berlin-Dahlem. In den 1950er-Jahren ist dieser Traum dann gewissermaßen in Erfüllung gegangen. Ein geflügeltes Wort machte seinerzeit die Runde: „Dort, wo viele Villen sind, ist auch ein Weg.“
Allerspätestens seit dem Mauerbau im Jahr 1961 wurde dann die Inselstadt West-Berlin ein Symbol politischer Freiheit und politischen Widerstands. Die Freie Universität Berlin stand speziell für akademische Freiheit und akademische Selbstbestimmung.
Journalist
Was machte den Unterschied der getrennt lebenden „Ehepartner“ damals aus? Waren die akademischen Verhältnisse und Lebensumstände im Westen und im Osten Berlins denn wirklich so weit auseinander?
Aporius
Institutionell und politisch betrachtet zweifellos. Beide Universitäten lagen zwar räumlich relativ nahe beieinander. Politisch, institutionell und lebensweltlich betrachtet, ging man aber getrennte Wege, getrennt auch durch Mauer, Stacheldraht, Politik und Ideologie.
Die Freie Universität Berlin war in den Folgejahren, insbesondere in den 1960er und 1970er Jahren, eine bewegte und sehr bewegende Universität. Sie erscheint uns heute, in dieser Zeit, wie ein akademisch-lebensweltlicher Gegenentwurf und ein Kontrapunkt zur Humboldt-Universität in der DDR.
Journalist
Sie denken dabei wahrscheinlich in erster Linie an die Studentenbewegung?
Aporius
Ja, unbedingt! Mitte der 1960er Jahre entwickelte sich an der FU, wie auch an vielen anderen westdeutschen Universitäten, eine Protestbewegung, die man später, viel umfassender und kultureller, die 68er-Bewegung nannte. Die 68er-Bewegung war mehr als eine Studentenbewegung. Sie war Aufbruch, Emanzipation und Abrechnung mit dem kulturellen, politischen und auch akademischen Erbe der 1950er und 1960er Nachkriegsjahre. Rebellen gab es vernehmlich nur im Westen. Die Rebellion in der FU war zudem auch Repression, die sich gegen FU-Hochschullehrer, gewissermaßen als Standesvertreter ihrer Zunft, richtete. Das waren auch rebellische Kämpfe, die sich gegen demokratische und zivilisierte Gepflogenheiten im akademischen Betrieb richteten. Viele gute Hochschullehrer kehrten in der Folge der 68er-Ereignisse der FU den Rücken. Am wenigsten schien dieses studentische Rebellarium übrigens die Amerikaner zu stören, die sich doch ihrerseits in ganz bedeutsamer Art und Weise, natürlich auch mit speziellen Eigeninteressen und Wünschen, an der Gründung der FU Berlin beteiligten.
Journalist
Was ist dann nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung 1989 passiert?
Aporius
Der Fall der Mauer und die Deutsche Einheit stellten Berlin vor ganz neuartige, politische und vor allem finanzielle Aufgaben. FU und HU rückten politisch gänzlich unvorbereitet zusammen. Die Phänomene der Teilung und die verdoppelte Existenz Berliner Akademiker und akademischer Institutionen wurden erfahrbar, sichtbar und fühlbar. Die Berliner Teilungsgeschichte ist auch eine Teilungsgeschichte der Berliner Wissenschaft und Universitäten. Die Einheit musste verhandelt werden. Die Wiedervereinigung Deutschlands war ein Glücksfall und ein historisches Weltereignis. Die Vereinigung Berlins stellte die Bildungs- und Wissenschaftspolitik, wie auch alle anderen Politikbereiche des Landes, vor die größte Aufgabe, die Menschen und Administrationen in Friedenszeiten haben können. Vereinigung und Einheit schaffen besondere Probleme, die man in den Zeiten von Teilung und Abgrenzung nicht hat.
Journalist
Die Aufgabe bestand darin, die verdoppelten Einrichtungen nach 1989 weiterzuführen oder bestimmte Einrichtungen zu schließen. Das heißt, man stand vor allem vor einem Finanzierungsproblem. Wer entschied in welcher Form über Schließung, Erhalt bzw. Weiterführung?
Aporius
Politische Entscheider waren der Senat von Berlin und die Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses. Die Aufgabe bestand darin, neben den Westberliner Wissenschaftseinrichtungen auch viele Hochschulen, Klinika und Forschungseinrichtungen der ehemaligen DDR in Ost-Berlin aus dem Berliner Landeshaushalt weiter zu finanzieren. Letztere waren nicht wenige Einrichtungen, denn die DDR hatte vieles in ihrer Hauptstadt Berlin konzentriert bzw. zentralisiert. Das war eine Herkulesaufgabe für den damaligen Wissenschaftssenator Manfred Ehrhardt und seine Administration im nunmehr gemeinsamen Bundesland Berlin. Natürlich stellten sich sofort die entscheidenden Fragen nach Qualität, Quantität, Bedeutung und Zukunftsfähigkeit der einzelnen Institutionen. Welche Einrichtung soll überleben? Warum und wie schließt man überhaupt eine Einrichtung, wenn man gleichzeitig die andere Einrichtung weiterbestehen lässt? Welche Werturteile legt man den Entscheidungen zugrunde? Würden nun die vermeintlichen „Sieger“ im Westen die vermeintlich „Besiegten“ im Osten verspeisen? Im Zentrum stand die Aufgabe des Ab-, Um- und Neubaus von verdoppelten Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen in einer vereinten Stadt. Wie sollte das nun organisatorisch geschehen?
Journalist
Ja, wie denn? Warten Sie, ich ahne es. Es gab Kommissionen.
Aporius
Ja, was denn sonst. Durch Mitwirkung von vielen renommierten Wissenschaftsexperten, die zwischen 1990 und 1992 die Landeshochschulstrukturkommission Berlin bildeten, scheint die Neugestaltung Berlins als ein Ort „verdoppelter“ Akademiker und „verdoppelter“ Wissenschaftseinrichtungen heute, wenngleich auch schmerzhaft für viele, gut gelungen zu sein. Es waren nicht nur prominente Architekten, die die „Mitose“ der Berliner Universitäten erschufen, sondern am Ende die Stars aus der modernen Wissenschaft, die mithalfen, das verdoppelte Berliner Wissenschaftsensemble zu sanieren und neu zu konstruieren. Entscheidend beteiligt waren als Mitglieder der Landeskommission der Philosoph Jürgen Mittelstraß als Vorsitzender, der Historiker Christian Meier aus München, der Mathematiker Friedrich Hirzebruch aus Bonn, der Mediziner Kurt Kochsiek aus Würzburg, der Biologe Helmut Altner aus Regensburg, der Philologe Wilfried Barner aus Göttingen, der Psychologe Franz Emanuel Weinert aus München, die Sozialwissenschaftlerin Renate Mayntz aus Köln, der Rechtswissenschaftler Ernst-Joachim Mestmäker vom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, der ehemalige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Heinz August Staab und für die Wirtschaftswissenschaften Hans-Jürgen Ewers aus Münster, der spätere Präsident der TU Berlin, nur um einige der Persönlichkeiten zu nennen. Die Landeskommission schaute sich zwei Jahre lang jede Universität, jede Fachhochschule, jeden Fachbereich, jedes Fach und jeden einzelnen Studiengang in Berlin an, um am Ende erkennen und verantworten zu können, mit welchen Kapazitäten, welchen Strukturen und auch mit welchen neuen Ideen sich die Berliner Einrichtungen weiterentwickeln konnten. Entsprechende Empfehlungen gingen dann 1992 an den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen.
Die Landeshochschulstrukturkommission Berlin gab insgesamt 33 Empfehlungen ab. Es lohnt sich, die Themenfelder der Empfehlungen einmal aufzuzählen. Sie lauten:
Profile der Universitäten, Campus Berlin-Adlershof, Kapazitäten, Personalstruktur-Ost im Übergang, Struktur der Fachbereiche an den Berliner Hochschulen, Kooperationen in und zwischen den Hochschulen, Organisation und Weiterentwicklung der Berliner Lehrerbildung, Zentral- und Regionalinstitute, Frauen an Hochschulen, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaft, Psychologie, Geschichtswissenschaft, Philologien, Altertumswissenschaften an der HU Berlin, Kleine Fächer, Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Sportwissenschaft, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Museum für Naturkunde, Geowissenschaften, Pharmazie, Informatik, Universitätsmedizin, Ingenieurwissenschaften und - last but not least - Fachhochschulen.
Das „verdoppelte“ akademische Gesamtensemble Berlins blieb weitgehend erhalten, weil man es wissenschaftlich und organisatorisch neu bewertete. Erhalt und Entwicklung setzen Erneuerung und gleichzeitige das Bewusstsein von Tradition und Moderne voraus.
Journalist
Waren die wissenschaftlichen Berater und die politischen Entscheider damals wissenschafts- und universitätsfreundlich eingestellt?
Aporius
Man hatte zum Anfang der 1990er Jahre ein gutes Gespür für die positive Rolle von Bildung, Wissenschaft und Universitäten in der Gesellschaft. Als Interessenvertreterin der Wissenschaft verstand sich die Berliner Landeskommission selbstverständlich nicht als „Totengräber“ von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen. Es ging gewissermaßen auch um den Erhalt und die Erweiterung der Bildungs- und Wissenschaftscommunity. Man begründete Verdoppelungen und Vervielfachungen von gleichen oder ähnlichen Fächern an verschiedenen Universitäten oder Fachhochschulen mit starken Argumenten des Wettbewerbs, der Kooperation und der notwendigen Kapazitäten für besondere Schwerpunktsetzungen.
Journalist
Das kostete dann alles sehr viel Geld. Geld war aber in Berlin nicht doppelt vorhanden.
Aporius
Wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg. Der finanzielle Kollaps im Land Berlin blieb aus, nicht nur, weil im Berliner Landeshaushalt umverteilt wurde. Der FU-Wissenschaftler Klaus Schroeder hat es erst vor kurzem gewagt, eine mutige gesamtdeutsche Transferbilanz der Einheit zu ziehen und dabei viel Kritik aus dem Osten einstecken müssen, möglicherweise nur deshalb, weil der Begriff Transfer in Verbindung mit Kostenüberlegungen sehr einseitig wirkt. Die Transferbilanz im Steuerbudget des Landes Berlin zur Wendezeit war eindeutig: Ein knapper Berliner Haushalt musste für viele neue „Familienmitglieder“, die am Tisch Platz nahmen, ausreichen. Zusätzlich spielten der Länderfinanzausgleich und viele andere zentrale Programme des Bundes sowie auch der EU eine entscheidende Rolle, ebenso wie der mit Umsicht agierende Präsident der FU, Johann Gerlach.
Journalist
Was hatte der damalige Präsident der Freien Universität Berlin damit zu tun?
Aporius
Präsident Gerlach hatte in der Folge der Wende-Ereignisse in den 1990er Jahren einen beispiellosen Abbau wissenschaftlichen Personals in der FU zu verantworten, den er geschickt mit neuen akademischen Leistungsüberlegungen zu verbinden suchte. Haushaltsbezogen ging es von ca. 900 Lehrstühlen vor der Wende zunächst auf 600 Lehrstühle bis auf nunmehr 350 Lehrstühle an der FU herunter. Die Zahlen der Studierenden an der FU lauten: 1948 - ca. 2000, 1968 - ca. 20.000, 1992 - ca. 60.000, 1998 - ca. 43.000, 2013 - ca. 33.000.
Man erkennt an solchen Zahlen, dass sich alle im Doppelten Berlin existenziell bewegen und neu orientieren mussten, weil der Landeshaushalt der gemeinsame Deckel für alle war. Verdopplungen und Vereinigungen erfordern immer das Engagement aller Beteiligten. Sehr vereinfacht und frech gesagt, gab die FU Berlin Kapazitäten an die HU ab. Sie wurde kleiner und gleichzeitig leistungsfähiger gemacht. Für die HU galt, sie für die Anforderungen an eine moderne und international leistungsfähige Universität in Freiheit und Demokratie fit zu machen. Die große zentrale DDR-Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin wurde aufgelöst. Bedeutende Teile blieben erhalten und wurden in andere Einrichtungen überführt.
Beide Berliner Universitäten haben aus heutiger Sicht vom Prozess der Umgestaltung profitiert und wetteifern nun gemeinsam, so, wie Friedrich Meinecke es sich damals, im Jahre 1948, vorgestellt hatte. Der historische Zusammenschnitt konnte nur als „schmerzhafte Neugeburt erwachsener Kinder“ gelingen.
Journalist
Nunmehr gibt es in Berlin zwei Exzellenz-Universitäten, die Humboldt Universität und die Freie Universität. Ich gehe davon aus, dass auch die Technische Universität Berlin und die Universität der Künste Berlin exzellent sind, auch wenn sie einen solchen Titel nicht tragen.
FU und HU waren im deutschen Exzellenzwettbewerb am Ende doppelt, getrennt und gemeinsam erfolgreich, wie wir beide in unserem Gespräch hoffentlich auch.
Ich denke, ich kann auch in Ihrem Namen sprechen, wenn wir der Weltkulturerbe-Initiative „Doppeltes Berlin“ alles Gute und viel Erfolg wünschen. Wie lange wird es dauern, bis man über den Antrag zur Aufnahme in die Weltkulturerbeliste, wenn sie denn zustande kommt, entschieden hat?
Aporius
8 bis 10 Jahre - im Durchschnitt.
Journalist
Herr Aporius, vielen Dank für das Gespräch.
Das erste gemeinsame Telefonat im Aporius-Fall begann für Noel und Heumann, wie geplant, am nächsten Tag pünktlich um 19.00 Uhr. Es ging mit dem beschriebenen Kapitel über die „Teilung und Verdopplung“ Berlins los. Die beiden Kommissare telefonierten, vor ihren Computerbildschirmen am Schreibtisch sitzend, miteinander, in einer Art von Vorfreude auf ihre Ermittlungsergebnisse. Sie nahmen den Aporius-Fall ebenfalls verdoppelt und geteilt in Angriff, ähnlich wie die Stadt Berlin, die ihre Einheit und Gleichzeitigkeit nach der Teilung suchte. Man konnte mit Händen greifen, wie ratlos beide zunächst waren. Heumann, der wieder zum Fenster hingewendet sprach und seinen Fuß auf dem Heizungskörper abstellte, fing fast gelangweilt an zu sprechen: „Also interessant ist das schon, wie so eine Weltkulturinitiative funktioniert“, sagte er. „Ich habe mir zunächst einmal alle Namen notiert, die im Kapitel vorkommen. Aber keine der genannten Personen kann sich meines Erachtens durch Walter Aporius auf den Schlips getreten fühlen oder gar ein potenzieller Mörder sein.“ Heumann fügte noch hinzu, dass das Kapitel tatsächlich, wie im Vorwort angekündigt, eine Art von Feuilleton in einer Zeitung oder wie ein Radiointerview oder auch wie ein Gespräch im Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL sei. Alles klinge sehr plausibel und sei auch ausgesprochen informativ.
Noel hatte einen anderen Ersteindruck, weil er sich beim Lesen des Gesprächs den Zusammenhang des Kapitels als erste Etappe in einem Gesamtwerk vorstellte. Er sagte, dass „Teilung und Verdopplung“ mehr als ein Stadtgespräch über Architektur sei. Es solle gewissermaßen ein historisch-philosophischer „Fensterrahmen“ für Universitäten, Wissenschaft und Kultur darstellen. „Also, da gibt es bestimmt auch Leute, die etwas ganz anderes sehen, wenn sie durch das Berliner Fenster schauen. Die Leute konstruieren meistens ihre eigenen Rahmen, durch die sie dann ganz unterschiedliche Blicke auf die Stadt, ihre Universitäten und ihre Architektur haben. Es gibt Leute, die die Einheit Deutschlands, die Einheit Berlins oder gar den Erhalt von verdoppelten Berliner Einrichtungen gar nicht wollten. Diese Verdopplungsgegner in Ost und West gibt es noch heute, in Hülle und Fülle, 25 Jahre danach. Die Ostler und die Westler beobachten sich immer noch mit Argusaugen.“ Noel redete eigentlich nur für sich selbst und gewissermaßen laut vor sich hin.
Heumann nickte am anderen Ende der Telefonleitung. „Ja genau! Die Berliner in Ost und West wollten zwar die Deutsche Einheit, einige aber nur solange, bis dann der Preis der Einheit zu zahlen war. Es ging in Berlin vor allem um die Frage des knappen Geldes im Landeshaushalt. Verdoppelte Architektur und verdoppelte öffentliche Institutionen verschlingen im Prinzip auch verdoppeltes Steuergeld. Wenn man alle Einrichtungen einfach fortgeschrieben hätte, wäre das wahrscheinlich nicht finanzierbar gewesen. Also musste es zwangläufig Gewinner und Verlierer geben, im Osten wie im Westen. Die doppelte Mentalität von Gewinnern und Verlierern gehört zur Teilung und auch zur Einheit der Deutschen mit dazu. Der ‚Verlierer‘ fühlte sich als Unterlegener in einem Standortkampf, und es ist durchaus denkbar, dass einige Leute den verantwortlichen Vereinigungsmanagern immer noch den Hals umdrehen wollten. Aporius sagt doch, dass die Freie Universität Berlin in der Folge der Ereignisse wesentlich kleiner gemacht und die zentrale Akademie der Wissenschaften der DDR abgewickelt wurde. Kann jemand Walter Aporius an den Kragen gegangen sein, nur weil der so etwas erzählt?“
„Aporius ist Berichterstatter und nicht Manager. Romane, Aufsätze oder auch wissenschaftliche Feuilletons bringen, wenn sie gut sind, immer große Emotionen hervor, aber Mordmotive sind das zum Glück nicht, denn sonst würde es vielen Autoren und Journalisten ziemlich schlecht ergehen“, antwortete Noel in einem Anflug von Überheblichkeit. Er fügte dann noch hinzu: „Aber Sie haben Recht, Kollege Heumann, diese Gedankenkonstruktion des Doppelten Berlin und diese ganze Weltkulturinitiative sind in gewisser Weise eine Provokation, insbesondere aus Sicht vieler West-Berliner Bürger. Unter den West-Berlinern gab es damals nicht wenige Leute, die die Einrichtungen im Ost-Teil der Stadt lieber geschlossen hätten.“
„Und umgekehrt gab es noch viel mehr Leute, die die deutsche Vereinigung und dann auch die Bewältigung der Teilung kritisch sahen“, antwortete Heumann. „Schließlich sind vor allem die Einrichtungen im Osten ‚treuhänderisch‘ abgewickelt worden. Im Kern geht es, wie mir scheint, um die Erinnerungen an die Feindbilder und Kriegserklärungen aus der Zeit der Teilung des Landes. Diese Feindbilder sind immer noch in den Köpfen der Berliner latent und unterschwellig vorhanden. Die älteren ‚Krieger‘ geben ihre Erinnerungen an die jüngeren Leute weiter. Man kann nur hoffen, dass wenigstens die Leser des Fensterfeuilletons von Aporius die ganze Entwicklung dann doch als eine Versöhnungschronik auffassen.“
„Versöhnungsversuche können auch Verbrechen hervorbringen oder sogar Mordmotive sein. Ich kann Ihnen einige Fälle nennen“, antwortete Noel grübelnd. „Im Grunde wären dann aber die Erfinder und Organisatoren der Weltkulturinitiative Doppeltes Berlin die potenziellen Opfer und nicht ein Wissenschaftler, der nur davon erzählt und uns lediglich klarmachen will, wie sich die beiden Berliner Universitäten im Prozess der Deutschen Einheit fortentwickelt haben. Teilung, Verdopplung und Vereinigung sind existenzielle Probleme für viele einzelne Leute. Im Grunde will uns Aporius das nur erklären. Alle Universitäten sind wichtige Einrichtungen in einer Kulturstadt wie Berlin. Klar ist dann aber auch, dass sich die einzelnen Wissenschaftler und die Univerantwortlichen dann höchstpersönlich bewegen müssen, weil die Stadt und das Land sich politisch bewegt und verändert haben. Und eine Sache steht fest: Die Einheit Berlins und die Einheit der Deutschen ist auf alle Fälle besser, als die Existenz politischer Verdopplungen oder die Bildung falscher Einheiten. Freiheit, Wissenschaft und Kultur sind im Prinzip unteilbar, auch wenn man zwischenzeitlich alles in doppelter Ausfertigung hat. Wichtig ist natürlich auch die Frage nach der Demokratie, das heißt, zu welcher Einheit die Leute überhaupt gehören wollen.“
Heumann war fasziniert von Noel Worten und stellte fest: „Die Einrichtungen im geteilten Deutschland nach der Wende im Jahr 1989 waren nicht nur doppelt vorhanden, sondern sie waren vor allem ganz unterschiedlich vorhanden. Sie haben ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften gehabt.“
„Das stimmt“, antwortete Noel. „Die Einrichtungen in Ost und West mögen zwar funktional und architektonisch ähnlich gebaut worden sein. Inhaltlich waren sie aber höchst unterschiedlich. Gerade vorgestern habe ich mit einem guten Bekannten über die Unterschiede der politischen Wahlsysteme in Ost und West geredet: im Westen der Parteienpluralismus mit diesen ganzen Wahlkämpfen und politischen Auseinandersetzungen, im Osten das Strammstehen der Leute vor der Wahlurne. Das ist so ähnlich wie bei der Abstimmung über die Zugehörigkeit der Leute auf der Krim. In der DDR durfte man zwar in ganz ähnlich aussehende Wahlkabinen gehen. Man hatte dann aber nur einen Wahlzettel mit den Kandidaten der Einheitsliste der SED darauf. Auf diesen Wahlzetteln konnten diejenigen, die etwas anderes als den DDR-Sozialismus wollten und sehr mutig waren, die SED-Kandidaten wegstreichen. Also von allen, die in der Wahlkabine etwas geschrieben oder vermerkt haben, wusste man dann ganz genau, dass die keine Parteikonformen sein konnten. Ist das nicht absurd? Ich kann mich nicht erinnern, dass die linken 68er-Aktivisten dagegen mal protestiert hätten.“
„Wenn man etwas denkt, was der herrschenden Meinung und den herrschenden Politikern widerspricht, dann sollte man vor allem verdoppelt denken können. Man kann eine vernünftige eigene Meinung eigentlich nur in Kenntnis von anderen Meinungen und Interessen vertreten“, antwortete Heumann. „Das System der DDR war eine falsche Form der Einheit. Kürzlich habe ich dazu eine lustige Geschichte in den Nachrichten gehört: Die DDR war doch mit Nord-Korea befreundet. Dem Staatschef Nord-Koreas, Kim Il-sung, wurde während eines DDR-Besuchs im Jahr 1956 eine gut funktionierende LPG in Döberitz gezeigt, von der er wohl stark beeindruckt war. Jahrzehnte später wollte Kim Il-sung bei einem weiteren Staatsbesuch in der DDR genau diese landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft noch einmal sehen, um sich davon zu überzeugen, wie wunderbar sich doch alles weiterentwickelt habe. Die LPG Döberitz war aber inzwischen total verrottet. So führte man den befreundeten Staatschef diesmal in einen anderen Landwirtschaftsbetrieb, wobei man nicht vergaß, das Ortschild zu überkleben. Der koreanische Staatsgast befand sich nämlich im DDR-Vorzeigeort Golzow, den man dann nur kurzfristig in Döberitz umbenannte. Man sieht also, die DDR war nicht nur eine Kämpferin gegen den Westen, sondern sie hat auch ihre politischen Freunde hinters Licht geführt. Die DDR war keine echte Demokratie. Sie war im Prinzip, von Anfang bis Ende, eine Art von Antisystem, für das man Mauern baute und überklebte Schilder brauchte.“
Noel grinste ins Telefon.
Mit dieser politik- und gesellschaftshistorischer Einschätzung von Heumann über die DDR endete das relativ kurze Gespräch der beiden Kommissare über das „Doppelte Berlin“.
„Schauen wir doch mal ins nächste Kapitel hinein, ob wir dort neue Erkenntnisse über mögliche Feinde und Freunde bzw. fragwürdige Einheiten und Verdoppelungen finden können“, meinte Heumann noch zum Schluss.
Beide fühlten sich am Ende ihres ersten Ermittlungsgesprächs sichtlich erleichtert, weil sie es so knapp und bündig und noch dazu sehr einvernehmlich hinter sich bringen konnten.
Noel verabschiedete sich mit den Worten: „Na dann bis morgen, mein verdoppelter Kollege.
Rebellarium
Im zweiten Aporius-Gespräch geht es um die politischen und kulturellen Auseinandersetzungen zur Zeit der 68er-Bewegung in West-Berlin. Man spricht über Ursachen, Verläufe und Folgen der Rebellion.
Journalist
Die 68er-Revolte ist nun schon nahezu ein halbes Jahrhundert Vergangenheit. Meine ersten beiden Fragen lauten: Was ist 1968 in Berlin passiert? Um welche Entwicklungen geht es?
Aporius
Die 1968er-Bewegung war der Kreuzungspunkt für eine ganze Reihe von Entwicklungen in Deutschland und in der westlichen Welt. Es gab im Laufe dieser Entwicklung emanzipatorische und repressive Momente.
Journalist
Was war denn 1968 emanzipatorisch und was war repressiv?
Aporius
Es waren zweifellos viele Dinge positiv, die man gewissermaßen als Abrechnung mit dem kulturellen, politischen und akademischen Erbe der 50er und 60er Nachkriegsjahre verstehen kann. Das historische Erbe Deutschlands und vieler anderer Länder der Erde hat vor allem einen Erblasser, nämlich die Hitlerdiktatur. Es ging den 68ern um die kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, speziell also auch mit dem Nationalsozialismus. Die öffentliche und private Schweigemauer, die nach dem Krieg um die Nazi-Vergangenheit herum errichtet worden war, wurde lautstark auf den Straßen, aber auch ganz leise und verbissen in den Familien durchbrochen. Die positive Erkenntnis aus der 1968er Rebellion und ihren Folgen lautet: Wenn man Vergangenheit bewältigen will, dann muss man vor allem autoritäts- und medienkritisch sein. Junge Leute müssen sich engagieren und organisieren, mit dem Mut der Verzweiflung und einem sozialkritischen Blick auf die herrschende politisch-gesellschaftliche Ordnung und ihrem Establishment.
Der Umgang mit Geschichte und mit den konservativen, kriegsmüden Deutschen in der Nachkriegszeit ist dann in der 68er-Zeit zuweilen auch überkritisch geworden - insbesondere in Berlin und an der Freien Universität Berlin. Wenn man Herrschende und Herrschaftskritik überall sucht, dann wird man sie zweifellos auch überall finden können. Die 68er waren Fundamentalopposition gegen alle alten und konservativen Werte, aber auch gegen gute, neue und demokratisch-akademische Umgangsformen, die sich inzwischen entwickelt hatten. Die Uni wurde von vielen 68ern als charakterloser Teil des politischen Herrschaftssystems und seiner Repräsentanten betrachtet. Die Stimmung war aggressiv und auf Systemveränderung gerichtet. Für viele waren das akademische Geschehen politische Ereignisse und die Wissenschaftler falsche Sympathisanten. Anlässlich des 50jährigen Jubiläums der FU im Jahr 1998 wählte Tilman Fichter im „Tagesspiegel“-Beitrag vom 23.10.1998 die Überschrift: „Meine Universität war der SDS“. In der gleichen Jubiläums-Ausgabe titulierte der ehemalige Berliner Wissenschaftssenator George Turner (1986-1989): „Zeitweilig aus den Fugen geraten“. Heinrich August Winkler, 1964 als Assistent an die FU gekommen und von 1991 bis 2007 Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität, fand, dass sich das Otto-Suhr-Institut „zeitweilig als Parteihochschule auf der Suche nach einer Partei präsentierte“. Winkler selbst ist übrigens seit 1962 Mitglied der SPD.
Journalist
Kann man auch „zeitweilig“ davon ausgehen, dass die moderne deutsche Frauenbewegung ihren Ursprung in der 68er-Rebellion hatte?
Aporius
Die Ursachen der Frauenbewegung sind vielschichtiger als die der 68er-Bewegung, wie ich finde. Die Ursprünge liegen national, international, historisch und kulturell betrachtet zweifellos viel weiter zurück und sind komplexer. Dennoch hat die 68er-Bewegung entscheidende Anstöße auch für die Frauenbewegung gebracht. Wenn man ein Frauenflugblatt vom „Weiberrat“ des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes (SDS) aus der Frankfurter Universität als Quelle nimmt, in welchem sich die 68er „Weiber“ ironisch mit den 68er „Machos“ der Szene auseinandersetzten, kann man die 68er-Männerrebellen auch als unfreiwillige Verantwortliche für die neuen Impulse der Frauenbewegung sehen. Viele Frauen haben vom 68er-Habitus der antiautoritären Sozialisierung und Selbstorganisierung gelernt, davon profitiert, ihn für sich entdeckt und geschlechtsspezifisch definiert. Es ging um alternative Lebensentwürfe, Kinderläden, Wohngemeinschaften, sexuelle Befreiung, Schwulen- und Lesbenverbindungen, neue Formen von Arbeitsteilung und Gleichstellungs- bzw. Verschiedenheitsfragen in allen Bereichen der Lebens- und Arbeitswelt. Jede einzelne Frau wird am Ende selbst entscheiden wollen, wer oder was sie bewegt und emanzipiert hat. Ob es die 68er-Bewegung war oder die Quotendiskussion, die Erfindung der Anti-Baby-Pille, die persönliche Infragestellung familiärer Verhältnisse, die Zeitschrift Emma mit Alice Schwarzer oder gar der 1926 gegründete Deutsche Akademikerinnenbund, darüber kann man nur spekulieren. Die Frauenbewegung in Deutschland hat jedenfalls viele unterschiedliche Auslöser und Entwicklungsmomente. Aber eines ist festzuhalten: Es sind immer Frauen gewesen, die ihre Rolle und Freiheit suchten, auch in der 68er-Zeit, weil auch diese Zeit im Kern eine Männerzeit war. Die Frauenbewegung ist in vielerlei Hinsicht komplexer als die 68er-Bewegung, weil Frauenthemen, geschlechtsspezifische Kritik und feministischer Widerstand alle Organisationsformen des Lebens betreffen.
Journalist
Haben die 68er und der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) an der Unterwerfungsbereitschaft und einem Konformismus der Linken in Deutschland mitgewirkt?
Aporius
Die 68er waren zunächst einmal leidenschaftlich, unorthodox, antifaschistisch, antikapitalistisch und auch antikonsumistisch. Viele haben ganz persönliche sowie gemeinschaftliche und gesellschaftliche Alternativen gesucht, und viele haben sie auch gefunden. Eine relativ große Gruppe war streng etatistisch. Man hatte sich auf den Staats- und Medienapparat als Feindobjekt eingeschossen. Das kann man, wenn man möchte, eine falsche Unterwerfungsbereitschaft nennen. Es gab für einige politische 68er-Aktivisten kaum ein kulturelles oder akademisches Leben, kaum ein gesellschaftliches Reden neben dem politischen. Im Zentrum der gesellschaftlichen Überzeugung stand die kritische Haltung gegenüber dem herrschenden politischen Apparat. In gewisser Weise ist man so auch selbst ein Teil des Apparats geworden. Die Kritik am Hegemon hat einige Leute leider auch selbst zu Hegemonisten gemacht.
Journalist
Der FU-Philosoph Peter Furth, neben Urs Jaeggi einer der Betreuer der Doktorarbeit von Rudi Dutschke an der FU, war es, der von einem Phänomen der Unterwerfungsbereitschaft gesprochen hat.
Aporius
Viele 68er haben ihre Kritiker argwöhnisch beobachtet, auch die Akademiker und Intellektuellen in den eigenen Reihen. So ist dann mit der Zeit eine Form von Wachturm-Mentalität entstanden. Man durfte nicht naiv glauben, dass man im inneren Kreis als jemand, der sich als dazugehörig betrachtete, ohne Kontrolle irgendetwas Kritisches oder Eigenkritisches unbemerkt äußern oder gar veröffentlichen konnte. In der 68er-Bewegung ist ein fragwürdig kontrollierendes und leider auch antiintellektuelles Gemeinschaftsgefühl mit Meinungsführern, Mitläufern, Abtrünnigen und Verrätern entstanden. Das war der organisierten DDR-Praxis gar nicht unähnlich.
Man wollte sich und andere öffnen und orientierte sich leider auch an geschlossenen Denk- und Gesellschaftssystemen sowie an einem autoritären Polit-Habitus.
Journalist
Gab es unterschiedliche Formen des deutschen Antifaschismus?
Aporius