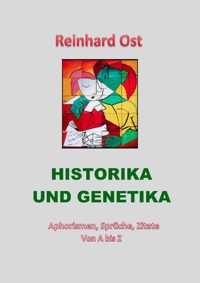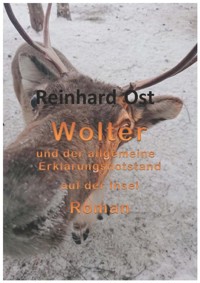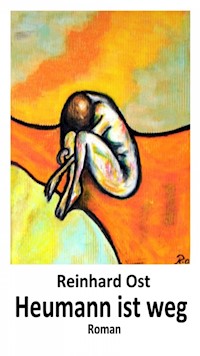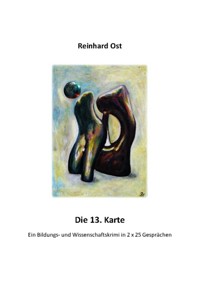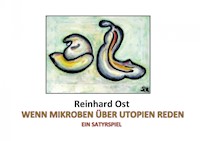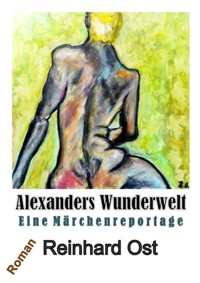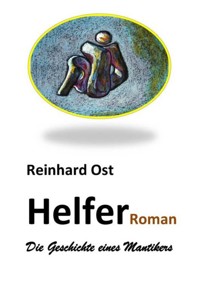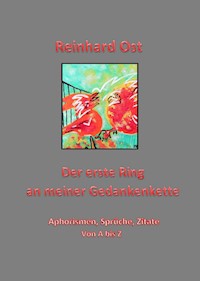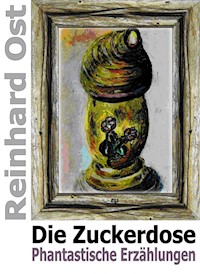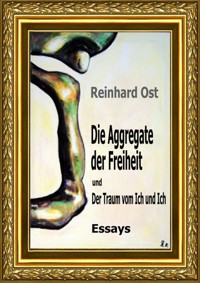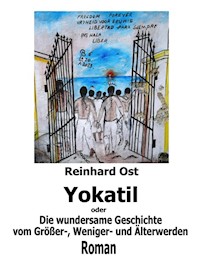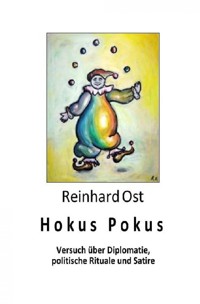
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
"Eine satirische Schrift über Diplomatie und politische Rituale zu verfassen, ist einfacher als man vermutet. Vieles rutscht inzwischen fast unfreiwillig heraus. Eine Satire über Satire zu schreiben, ist möglicherweise schwieriger, denn man muss die Unterschiede zwischen Fälschung, Verfremdung und Wirklichkeit, zwischen Humor und Ernsthaftigkeit noch genauer interpretieren und kennzeichnen, als es den Ironikern, Sarkasten, Zynikern, Komödianten und Humoristen im Allgemeinen gelingt." Gretchen, die Freundin des Autors fragt sich ernsthaft, warum es einigen Leuten unmöglich sei, satirische Elemente sinnstiftend von Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit zu unterscheiden. "Die Macht der Sprache scheint so viele Facetten zu besitzen, so dass sich das ehrlichste Bekenntnis nur durch ein einziges Wort an der falschen Stelle in eine satirische Stellungnahme verwandeln kann. Sie guckt mich fassungslos an: 'Es ist ein glücklicher Zufall, dass du deinen Herrn Keiner, also die Summe vieler Präsidenten und Minister nicht noch am Ende umgebracht hast, um dann die feierliche Begräbniszeremonie kritisch zu hinterfragen."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhard Ost
Hokus Pokus
Versuch über Diplomatie,
politische Rituale und Satire
Copyright: @ 2024 Reinhard Ost
Published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.com
Eine satirische Schrift über Diplomatie und politische Rituale zu verfassen, ist einfacher als man vermutet. Vieles rutscht inzwischen fast unfreiwillig heraus.
Eine Satire über Satire zu schreiben, ist möglicherweise schwieriger, denn man muss die Unterschiede zwischen Fälschung, Verfremdung und Wirklichkeit, zwischen Humor und Ernsthaftigkeit noch genauer interpretieren und kennzeichnen, als es den Ironikern, Sarkasten, Zynikern, Komödianten und Humoristen im Allgemeinen gelingt.
Wer bin ich denn, der Ihnen diese gedanklichen Verbindungen zumutet?
Ich bin ein Studierender der Germanistik und Politikwissenschaft an
einer kleineren deutschen Universität, keine Exzellenzuniversität, aber eine gute. Mein ganz praktisches Ziel ist es, einmal ein ordentlicher Sozialkundelehrer zu werden. Allerdings: Ich wäre am liebsten Schriftsteller. Ganz zweifellos verfüge ich aber noch nicht über genügend Erfahrung, um mich als Buchautor einem solch komplexen Thema wie Diplomatie und den politischen Ritualen angemessen zu widmen, sagt meine Freundin. Sie heißt Gretchen.
Dr. Faustus bin ich nicht, will ich nicht sein, und trotzdem lässt mich der Gedanke nicht mehr los, eine Verknüpfung zwischen Sozialkunde, Germanistik und Politikwissenschaft herstellen zu wollen, um später einmal vor meinen Schülerinnen und Schülern nicht mit leeren Händen dazustehen. Zurzeit bin ich wahrscheinlich nur ein guter Kenner des Internets, der mit Hilfe von Google und Wikipedia die Welt zu erklären sucht. Nun gut, das Thema Satire habe ich mir ausgedacht, weil die Themen Diplomatie und Rituale allein mich zurzeit stark irritieren - im Grunde wie die moderne Wirklichkeit in Gänze.
Wie also geht ein potenzieller Autor an die Komplexität der Realität als Erzählweise heran? Ich suche mir ein Thema, eine Überschrift, die ich persönlich unterscheiben kann. Dann schon geht die Recherche im Netz der internationalen Ereignisse los.
Wenig hilfreich, mich dem Thema zuzuwenden, scheint mir die aktuelle Satirezeitschrift im Netz „Postillon - ehrliche Nachrichten seit 1845“ zu sein. „Schluss mit der Verwirrung um die Satiretexte im Netz“, heißt es dort. „Dank einer neuartigen Kennzeichnung durch das soziale Netzwerk Facebook sollen Links zu satirischen Beiträgen künftig leichter von nichtsatirischen Nachrichtenbeiträgen unterschieden werden können. (…) Diese Kennzeichnung sei notwendig, weil ansonsten kein nennenswerter Unterschied zwischen ordentlich recherchierten journalistischen Beiträgen und grobem satirischem Unfug bestehe. (…) Pfannkuchen mit Würstchen und Kartoffelsalat passen auch nicht zueinander, so ein Sprecher des Zarenhauses an Gründonnerstag in Istanbul.“
Der Vorstand des „Deutschen Verbands zur Kennzeichnung von Satire“ meint, diese neue Kennzeichnungspflicht sei extrem unerlässlich. Konsequenterweise wolle Facebook seine leichtgläubigen Nutzerinnen und Nutzer künftig nicht nur bei satirischen Beiträgen vor Fehlinformationen schützen. Schon bald könne neben den Artikeln von BILD.de wahlweise Lüge, Hetze oder substanzloses Gerücht stehen. Multiple Choice? Aber Vorsicht! Der Autor der Meldung ist Mitglied in sieben transatlantischen Bündnissen.
Das Alles ist selbstverständlich ebenfalls nur eine Satire.
An dieser Stelle seien noch schnell einige aktuelle Überschriften des „Postillon“ aus dem Netz eingefügt, um sich in die satirische Denk- und Artikulierungsweise einlesen zu können:
„Erdogan fragt sich, wie viele Journalisten er noch einsperren muss, bis er nicht mehr als Tyrann dargestellt wird.“
„SPD läutet traditionelles linkes Halbjahr vor wichtigen Wahlen ein.“
„Trump spricht japanischer Regierung Beileid für Godzilla-Angriff aus.“
„Geistig verwirrter Mann stürmt Pressekonferenz im Weißen Haus und pöbelt Journalisten an.“
„Amtsmissbrauch: Von der Leyen ließ Privatwagen regelmäßig aus der Luft betanken.“
„Kauft Ivankas Sachen: Weißes Haus startet TV-Shoppingkanal WhiteHouse24.“
„Kampf gegen illegale Einwanderung: Trump will Indianer nach Indien abschieben. Sie sollen wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind.“
„Sieben muslimische Staaten verhängen Einreiseverbot für amerikanische Drohnen.“
„Börder Wåll“: IKEA bietet Trump günstige Lösung für Mauer an.“
„Mexiko beginnt, riesige Tunnel an der Grenze zu den USA zu graben.“
Was also kann man tun, um sich nicht ständig über die schrecklich originellen Vereinfachungen zu Tode zu amüsieren oder zu ärgern?
Übrigens: Die persönlichen Überzeugungen, an die ein „Schmutz- und Schmierfink“ anknüpft, sind zunächst die Überzeugungen anderer Leute, nicht die eigenen, also bevor der Fink sie sich verdreht zu den eigenen macht.
Nun, es gibt eine vermeintlich sehr gute Lösung gegen all das satirische und unvernünftige Gequatsche - nämlich die Wissenschaft: Ein wissenschaftlicher Autor lasst sich nicht den Vorwurf gefallen, er habe die Herrschaftsverhältnisse oder die Religion übertrieben dargestellt. Diese Aussage wird er schließlich auch wissenschaftlich beweisen wollen. Auf Motive und Intentionen kommt es an.
Die populäre Aussage, „Je intelligenter, desto wissenschaftlicher“ und umgekehrt, stimmt allerdings leider nicht. Die Wissenschaftsgeschichte scheint das zu beweisen.
Man muss sich als Kritiker eines Satirikers notgedrungen auf den Sprachduktus einlassen, um seine eigenartige Widerspruchsform und Widerspruchshaltung kennzeichnen zu können. Gewissermaßen muss man sich dadurch von seiner Unkorrektheit leiten lassen.
In der modernen Medienwelt scheint inzwischen vieles zur Realsatire mutiert zu sein. Sogar die Wissenschaftswelt ist außerordentlich anfällig dafür geworden. Das betrifft zum Beispiel den Kosmos des Sozialen und des Wissenschaftlichen, der Politik und ihre Rituale. Sofern Satiriker größere Freiheiten als Politikerinnen und Politiker oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genießen, weil sie grundgesetzliche Berechtigungen besitzen, so sind sie ebenso zu nehmen, ebenso wie das (und diejenigen), was (und die) sie bearbeiten bzw. ersinnen und erfinden. Sie sind anscheinend ein zunehmend wichtigerer Teil des Realitätssystems geworden.
Ist denn eine satirisch gemeinte Kritik an kritischer Satire überhaupt möglich? Ist sie sogar notwendig oder überflüssig?
Das gilt es zu klären.
Der Literaturwissenschaftler kennt in der Literaturgeschichte gute Beispiele für gelungene Formen von Satire, also für die wirksame Satire, denke ich.
Voltaires kritische Schrift „Candide“, mit welcher der berühmte französische Schriftsteller auch die Naivität des deutschen Universalphilosophen Gottfried Wilhelm Leibniz karikieren wollte, oder Salman Rushdies Buch „Satanische Verse“ über den Korantext und seine Auslegungen sowie „Der Untertan“ von Heinrich Mann, der das Wilhelminische Deutsche Kaiserreich auf die Schippe nimmt, mögen als Lektürebeispiele ausreichen, um die oben genannten Fragen zu beantworten.
Ja, ohne Zweifel, man darf Voltaire, Rushdie und H. Mann angemessen kritisieren. Kritik an berühmten Autoren ist niemals überflüssig und zweifellos dringend notwendig, wie auch der kritische Blick auf prominente Politiker und ihre Rituale.
Für viele Menschen in Deutschland beginnt ihr satirisches Tagesprogramm allerdings nicht mehr mit dem Werk eines großen Autors, sondern möglicherweise schon frühmorgens - während des Frühstücksfernsehens - und endet, nach einem gemütlichen Abend vor dem Bildschirm mit „Indiana Jones und der Tempel des Todes“, tief in der dunklen Nacht mit den neuesten Spätnachrichten. Dazwischen liest man vielleicht noch einige Artikel in der Tagespresse oder fertigt Blogbeiträge im Internet an - aus ganz persönlichem Interesse - oder man arbeitet sich auf der Dienststelle zwecks Gelderwerbs die Finger an der Tastatur wund. Die Schulter schmerzt vielen Büromenschen schon längst.
Wer ein IPad besitzt, kann etwas sanfter über die magische Glasscheibe von Apple streichen, wenn er bzw. sie sich den „Eulenspiegel“ oder den alten „Simplicissimus“ im Netz reinziehen möchte.
Die großen und kleineren historischen Werke, die wichtigen und die weniger wichtigen, aus der eindrucksvollen Wunderweltgeschichte kritischer Satiriker, Komödianten und Spaßmacher stehen inzwischen fast alle im großen Netz der Informationsereignisse.
Moderne Ironiker im Fernsehen besuchen sich inzwischen gegenseitig abwechselnd in den Fernsehshows. Das bringe doppelten Spaß.
Die Realität scheint nicht nur sie selbst zu sein, sondern auch die vielen Kontrastierungen zwischen unterschiedlichen Wahrheiten, welche der gute Alltagssatiriker wundervoll vermitteln kann.
Es sind inzwischen nicht nur die minderkorrekten männlichen Kabarettisten wie Nuhr, Welke, Böhmermann, Richling oder Hildebrandt, die den Widerspruch zwischen Schein und Sein, zwischen Wesen und Erscheinung humorig thematisieren können, sondern auch mehr und mehr Frauen wie die Stratmanns, Illners, Schwarzers oder Hella von Sinnens.
Einige Gespräche auf Geburtstagsfeiern beginnen inzwischen möglicherweise mit einer entscheidenden Frage: „Hast du gestern die ‚Anstalt‘ gesehen?“
„Also am letzten Wochenende, waren wir bei Rainald Grebe gewesen, der als Indianer verkleidet die Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs verhohnepiepelt hat: ‚Zwischen Dänemark und Prag liegt ein Land, das ich sehr mag, zwischen Belgien und Budapest liegt Thüringen‘.“
Die Gesprächspartner auf der Party antworten stets in sehr aktueller Form - zum Beispiel: „Donald Trump hält das, was die seriöse Presse in Amerika hervorbringt, ohnehin für reine Fakes.“
Dann geht es weiter und immer tiefer in den Wald der Vermutungen hinein: „Gestern habe ich eine Fernsehreportage gesehen, in der sie aufgedeckt haben, dass alle Kriegsnachrichten in den USA seit vielen Jahrzehnten streng zensiert und konstruiert werden.“
Die Antwort lautet: „Ich habe gestern noch spät nach Mitternacht
interessante Dinge über die Pharmaindustrie erfahren, wie sie sich ganz gezielt bestimmter Mikroben bedienen, um den neuen Krieg gegen die Patientinnen und Patienten vorzubereiten. Die Gefahr lauert inzwischen überall. In der Sendung über die Forschung im Pharmakomplex haben sie auch die ‚Atombombenversuche‘ von Bill Gates kritisiert. Der will mit Drohnen über die Seuchengebiete fliegen, um Impfstoffe abwerfen zu lassen, die über den eigenen Schweiß in die Haut der Schwarzafrikaner eindringen und dann in die Blutkreislaufbahn gelangen. Ärzte seien dann in Zukunft nicht mehr nötig. Schrecklich das Ganze. Oder?“
Ich hatte dieses Gespräch zufällig belauscht, mich aber nicht beteiligt. Dieses Gespräch war jedoch der Punkt, an dem ich mich entschied, ich müsse etwas Konstruktives zu der Angelegenheit beisteuern, also nicht nur daherreden wie die anderen, sondern etwas Nützliches zu Papier bringen.
Das größte aller Themen habe ich mir nun ausgewählt, um den Satirikern und ihren Rezipienten zu beweisen, dass es auch noch vernünftige Formen der Kritik, des Denkens, des Schreibens und des Redens gibt. Ich habe mir das Thema „Politische Rituale“ gewählt, letztendlich um zu beweisen, dass es noch einige wenige Tabus gibt, die man nach wie vor sehr sachlich beschreiben kann.
Und siehe da: Als ich mein Vorhaben den beiden Gesprächspartnern auf der Geburtstagsfeier mitgeteilt hatte, haben sie mich ausgelacht und hielten es ebenfalls für einen Gag.
Zuhause angekommen, noch am gleichen Abend, habe ich mich
sogleich an den Schreibtisch gesetzt, um in ruhig sachlicher Art und Weise loszulegen.
Das Merkwürdige nahm nun gewissermaßen einen Laufstil an. Man kann wirklich nichts dafür: Als mein sachliches Buchmanuskript schon zwei Wochen später fertig gestellt war, ist es leider auch wieder eine satirische Schrift geworden - freilich ein ungewollter Versuch. Das hat mir jedenfalls meine Freundin in recht drastischer Form mitgeteilt, schon, als sie erst wenige Seiten Korrektur gelesen hatte. „So ein Werk dauert wesentlich länger“, hat sie gesagt.
Für mich ist die Sache klar: Die Wirklichkeit selbst trägt so viele Keime des Widerstands und Widerspruchs in sich, dass es kaum noch gelingt, die Sachlichkeit in einem Wort zu schreiben. Zuerst sagte Gretchen, sie habe erst in der übernächsten Woche ein wenig Zeit, um das Manuskript zu lesen, dann aber hatte sie es schon in drei Stunden durchgearbeitet.
Die praktische Lösung des Problems, nämlich die satirischen Teile zu entfernen, war schnell gefunden: „Ich streiche dir beim zweiten Durchgang alle Stellen grün an, die ich für satirisch oder ironisch halte. Dann kannst du sie ja überarbeiten. Wie lautet der Titel der Schrift schnell nochmal?“
Ich habe ihr geantwortet: „Die Überschrift heißt ‚Hokus Pokus‘.“
Gretchen erwiderte: „Na ja, ich glaube, diesem großen Thema wird
ohnehin leider niemand gerecht werden können - durch Ironie schon gar nicht.“
Ich war wieder einmal irritiert: „Mein Text ist nicht satirisch gemeint und auch nicht journalistisch. Es ist ein historisch epochenübergreifend systematischer Text. Es geht um die Phänomene der Diplomatie und um einige biografische Fragen im Leben von berühmten Außenministern und Außenministerinnen, also den Leuten, die am häufigsten mit politischen Ritualen zu tun haben.“
Gretchen antwortete daraufhin: „Wenn du die echten Namen weglassen würdest, dann könnte der Coup vielleicht gelingen. Oder warte mal, möglicherweise sind die Namen der Persönlichkeiten doch sehr wichtig, jedenfalls, wenn man wirklich wissenschaftlich argumentieren möchte.“
Angestrengt überlegte ich: „Wenn man politische Strukturen, politische Handlungsmuster, Symbole und Rituale systematisch beschreibt, dann sind Namen oft wie lästige Fliegen. Eigentlich benötigt nur der Satiriker den vollständigen Namen. Für ihn sind Namen extrem wichtig, damit man weiß, wer schuldig sein könnte. Ein Historiker benötigt sie aber eigentlich auch, weil die berühmten Namen und Biografien gewissermaßen die Epochen in der Geschichte ausmachen und die Geschichtsschreibung gewissermaßen strukturieren.“
Ich hatte mich auch wieder einmal selbst korrigiert, wohl erst während des Sprechens nachgedacht.
Eigentlich dachte ich sehr ernsthaft, mir sei mit dem nachfolgenden Textentwurf mühevoll ein sachliches Werk über politische Rituale gelungen. Dann aber das! Gretchen sagt zum wiederholten Mal: „So geht das nicht.“
Was ist zu tun? Man muss in diesem Fall weitere Gutachter bemühen, wie es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Forschung tun.
Hier nun folgt der Abdruck meines nicht korrigierten Manuskripts unter der Überschrift Hokus Pokus. Bitte urteilen Sie selbst.
Mein Manuskript über den Hokus Pokus
H.K. stellt plötzlich fest, dass wohl auch das deutsche Zauberwesen auf den Prinzipien der jüdischen Kabbala beruhe. Aber alle Methoden, so meint er, die in der Kabbala noch einen gewissen Sinn machen, hätten im ganz außerjüdischen Hokus Pokus