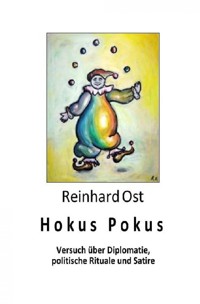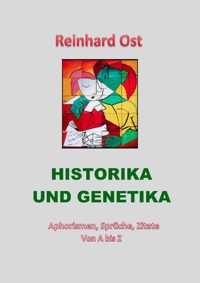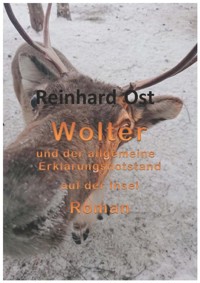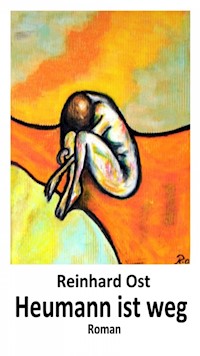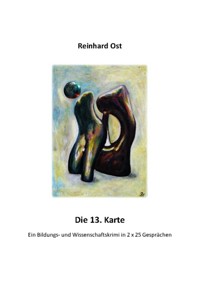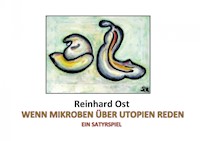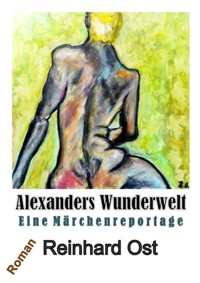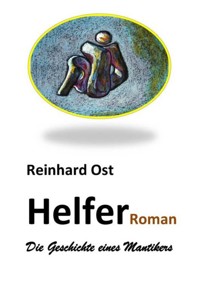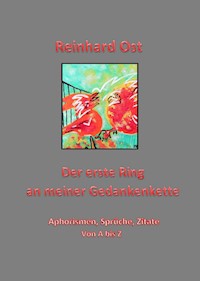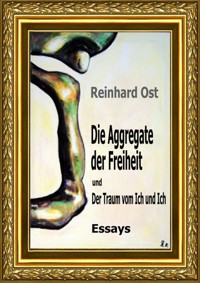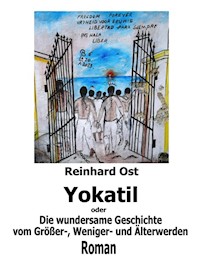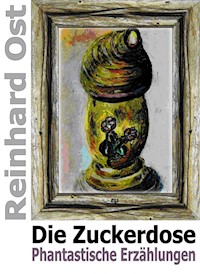
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
1. Ein Archivar wird durch den Ring des Gyges zu einem Geist. 2. Luise, das Angler Sattelschwein, ist die Philosophin des "Schweinesystems". 3. Durch einen Hypertext wird Herbert Grone "Gott". 4. Eine Biologin macht mit Hilfe von Flugsalbe eine Zeitreise in die Vergangenheit. 5. Eine Bestseller-Autorin wird zum Opfer der Werbekampagne für ihren Roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhard Ost
Die Zuckerdose
Phantastische Erzählungen
Impressum
Copyright: @ 2015 Reinhard Ost
Published by: epubli GmbH, Berlin www.epubli.com
ISBN978-3-7375-5234-9
Die Zuckerdose
Meine Frau Susanne hat eine originelle Zuckerdose mitgebracht. Ihre Großmutter hat ihr das gute Stück überlassen, also eine vorzeitige Erbschaft gewissermaßen, ein Vorlass, wenn man das so bezeichnen möchte. „Die Dose sieht alt aus, eigentlich gar nicht wie eine Zuckerdose“, sage ich, als sie damit stolz in unsere Küche tritt. „Sie sieht eher wie eine Blumenvase aus, der man einen originellen Deckel verpasst hat“, füge ich hinzu. Also jedenfalls ist sie durch einen sehr merkwürdigen Deckel verschlossen. Der Deckel sieht eigentlich auch nicht wie ein richtiger Deckel aus, sondern eher wie ein kleines kugelförmiges Gewölbe, das sich über den Rand der Blumenvasendose stülpt oder wie eine Art von Pudelmütze, die geringelt ist und oben sich zur Seite neigt, ohne Bommel allerdings, aber dafür mit einer kleinen Öffnung, die aber nicht tief hinein geht. Wenn man den Finger hineinsteckt, kann man das leicht ertasten. Es ist natürlich auch keine Dose im modernen Sinne, kein in der Fabrik geschweißter Blechbehälter für Getränke oder etwas Ähnliches. Eine Schmuckdose und eine Tabaktiere oder gar eine Spieldose ist es auch nicht. Ein Behälter, den man gut herumtragen kann, sieht ebenfalls anders aus. Einen Henkel gibt es nicht.
„Großmutter hat wohl über viele Jahre hinweg Zucker darin aufbewahrt“, sagt meine Frau, „und danach auch irgendwelche anderen Dinge. Was aber nun darin enthalten ist, weiß sie nicht mehr genau, weil sie das Ding nicht mehr aufkriegt. Auch ihre Erinnerungen sind wie eingeschweißt. Ursprünglich wäre es aber eine Zuckerdose gewesen, sagt Eli. Nun könne sie die Dose aber nicht mehr gebrauchen, denn sie würde inzwischen schon viele solche Gefäße besitzen, in denen man seine Vergangenheit aufbewahren kann.“ Elisabeth, meine angeheiratete Großmutter, ist inzwischen 84 Jahre alt. Sie hat schon seit über zwei Jahrzehnten Diabetes, deshalb verwendet sie nur noch Süßstoffpillen aus den viereckigen Plastikschächtelchen. Durch die Apparatur des Spenders zum Portionieren kann man jede einzelne Süßstofftablette, Stück für Stück, sauber abzählen und den Tee nach dem Tagesgeschmack süßen, allerdings eben normiert durch die genaue Menge des Süßstoffs, der in jeder einzelnen Tablette enthalten ist. Mit gewöhnlichem, weißem oder braunem Industriezucker geht das nicht. Es wird niemandem gelingen, die einzelnen klitzekleinen Zuckerkristalle abzuzählen.
Wie nun sieht die Zuckerdose farblich aus? Wie groß ist sie? Aus welchem Material besteht sie?
Sie ist zirka 30 Zentimeter groß und aus ockergelbem Ton gefertigt. Sie hat ein Blumendekor mit dunkelroten Blüten auf der Vorderseite. Jedenfalls waren sie mal dunkelrot. Jetzt sind sie verblasst. Sie ist geschwungen wie eine bauchige Vase und hat einen eleganten Fuß, der wie aus Tonwürsten gefertigt aussieht. Leider sieht alles ein wenig schmuddelig aus, weil schon der Staub von Jahrzehnten in den Ton und in das Blumendekor eingezogen zu sein scheint. Man kann nicht erkennen, was es ursprünglich mal für eine Blumensorte gewesen ist, die man auf die Oberfläche des Gefäßes, wie ein nachträglich angemaltes Stück Stuck, aufbrachte. Es ist ein Sonntag im Hochsommer. Die Zuckerdosenvase steht auf unserem Esstisch genau in der Mitte. Und nun passiert etwas nicht so Ungewöhnliches. Mir gelingt es auch nach vielen Versuchen nicht, die Dose zu öffnen. Der kugelförmige Verschlussdeckel ist verrottet und wie mit Sekundenkleber festgeklebt. Nicht einmal der kleinste Spalt ist zu erkennen, in den man vielleicht ein Messer stecken könnte, um eventuell durch die Hebelwirkung die Dose auf zu bekommen. Es gibt auch keinen Trick, wie man das Ding öffnen kann. Ich drehe die rundliche Dosenvase nach allen Seiten und in alle Richtungen. Ich schüttle sie. „Irgendetwas ist da drin. Zucker ist es jedenfalls nicht“, sagt Susanne. „Es ist schon etwas sehr Altes, denn wenn Eli die Dose schon lange Zeit nicht mehr geöffnet hat, dann kann nichts Neues darin enthalten sein. Wenn sie Diabetes hat, wird sie niemals Zucker darin aufbewahren. Was soll man denn eigentlich überhaupt mit einer Dose, die man nicht aufbekommt?“, sage und frage ich. „Es wird vielen alten Leute so gehen, wenn sie dir etwas vererben. Sie wissen kaum noch richtig, was drin steckt“, antwortet Susanne. In der Folgezeit entwickelt sich bei meiner Frau und mir ein fast schmerzliches Gefühl wegen der Unmöglichkeit in die Dose hineinschauen zu können. Schon lassen wir von der Zuckerdose ab, so wie Oma Elisabeth es getan hat. „Lass uns morgen noch einmal in Ruhe überlegen, wie wir das Ding aufkriegen. Eine Bombe mit Zeitzünder wird es ja nicht sein, schließlich lebt Eli ja noch“, sagt Susanne schließlich. Mit einem etwas mulmigen Gefühl stimme ich zu und lasse die Dose in Ruhe.
Es ist Montag. Wir beide müssen an diesem Tag nicht, wie sonst, früh aufstehen, weil wir heute nicht zur Arbeit gehen. Es ist unser erster Urlaubstag, und morgen wollen wir für zwei Wochen ins Land unserer Träume, nach Vietnam, fliegen. Die Koffer sind schon fertig gepackt und stehen im Flur. Alles ist, wie immer eigentlich bei uns, recht gut vorausgeplant. Ich habe in der letzten Nacht sehr schlecht geschlafen, nicht etwa wegen unserer bevorstehenden Reise nach Vietnam oder gar wegen der Amerikaner und Franzosen, die dort so viel Elend und Zerstörung hinterlassen haben, sondern wegen unserer neuen Zuckerdose. Am gestrigen Abend während des Einschlafens habe ich intensiv gegrübelt, was die Dose enthalten könnte. Die ganze Biografie von Oma Elisabeth, soweit ich sie kenne, ist mir durch den Kopf gegangen. Sind es vielleicht Hitlerbilder oder andere Hochglanzfotos der Nazis, wie etwa die Propagandafotos über den „Raubstaat England“, mit auf Räder gespannten und gefolterten Indern zum Beispiel, die damals in Millionenauflage unter den Deutschen Bürgern verteilt wurden. Eli steht nicht den Nazis nahe. Einige solcher Bilder hatte ich aber bei Elisabeth schon einmal gesehen. Beim Schütteln der Dose kann man erahnen, dass es Papier- oder Papp-Stückchen sein könnten, die die Dose verbirgt. Selbst Gedanken über die Büchse der Pandora schossen mir noch am späten Abend durch den Kopf. Epimetheus, der Bruder von Prometheus, hatte Pandora geheiratet. Und Zeus wies Pandora an, den Menschen eine Büchse zu schenken. Er hatte ihnen durch Pandora mitteilen lassen, dass sie unter keinen Umständen geöffnet werden dürfe. Doch sogleich nach ihrer Heirat öffnete Pandora selbst die Büchse. Daraufhin entwichen aus ihr alle Laster und Untugenden. Als einzig Positives enthielt die Büchse aber zum Glück auch die Hoffnung. Bevor diese aber entweichen konnte, wurde die Büchse zuvor wieder geschlossen. So wurde die Welt der trostlose Ort, der sie war und ist, bis Pandora die Büchse erneut öffnete und so die Hoffnung in die Welt kam. Nietzsche allerdings war ganz anderer Auffassung, wäre doch seiner Meinung nach die Hoffnung in Wahrheit das größte Übel von allen und der Fluch aller in der Büchse befindlichen Dinge gewesen, weil Zeus nämlich wollte, dass der Mensch fortfahre, sich immer von neuem durch Qualen quälen zu lassen. Diese Qualen der Menschen seien also unendlich, wie das Stiften von Unheil, welches sich nicht wiedergutmachen lässt. Aus meinem Grübeln ist schließlich am frühen Morgen ein echter Albtraum geworden, an den ich mich aber zum Glück nicht mehr genau erinnern kann. Ich weiß nur noch, dass der Albtraum etwas mit dem Öffnen von Dosen und dem Entweichen von Übeln zu tun hatte. Susanne hat, wie sie mir sagt, einen ganz ähnlichen Traum gehabt, der aber sei gar nicht gruselig gewesen. Wir beide haben sozusagen parallel geträumt.
Als wir an unserem runden Frühstückstisch sitzen, steht nun wieder diese neue Zuckerdose genau in der Mitte vor uns. Sofort ist wieder dieses mulmige Gefühl bei mir vorhanden. Ist es überhaupt eine Zuckerdose? Nein es ist keine Zuckerdose, denn nur weil ein Gefäß einen Deckel hat, muss es noch lange keine Dose sein. Man könnte davon ausgehen, dass Oma Eli sie nur als eine solche ansah, weil sie vielleicht irgendwann einmal Zucker hinein füllte, es dann aber wieder verdrängte. Vielleicht ist das Gefäß noch niemals geöffnet worden, und Elisabeth kann sich deshalb daran nicht mehr richtig erinnern. Möglicherweise kann sie sich gar nicht vernünftig an ihre Erinnerungen erinnern.
Beim nochmaligen Schütten der Dose fällt mir wieder auf, dass der Deckel gar kein Deckel sein kann, weil ich keine Möglichkeit entdecke, wie man ihn abkriegt. „Das Tongefäß muss wahrscheinlich schon verschlossen hergestellt worden sein, so dass man also gar keine Erinnerungsstücke hineinpacken kann“, erzähle ich. Susanne nickt und sagt: „Es ist eine sehr alte Vase, eine griechische Antiquität vielleicht, die Eli nur irgendwo aufgegabelt hat.“ Mir schießt wieder diese Pandora durch den Kopf. Nirgends ist ein Hinweis zu finden, kein Zeichen, kein Aufdruck oder so etwas, was auf das Alter oder den Hersteller schließen ließe.
Meine Frau hält die Zuckerdose inzwischen für Aladins Wunderlampe. Nur dass wir leider den Zauberspruch für das Öffnen nicht kennen. Ich reibe tatsächlich an der Lampe und sage: „Sesam öffne dich.“ Nichts geschieht. Die Dose beginnt sich in unseren Gedanken ständig zu verformen und zu verändern. Nicht in Wirklichkeit, aber zwischen Lampe, Vase und Dose geht es immer hin und her. Immer mysteriöser wird die Angelegenheit. „Wir könnten sie einfach auf den Boden werfen und zerschlagen“, sage ich. „Das werden wir nicht tun“, antwortet Susanne, „denn wenn es unserer Oma gelang, das Ding über eine so lange Zeit aufzubewahren, dann werden wir es nicht gleich am ersten Tag kaputt machen.“ Ich überlege mir, ob man vielleicht tatsächlich Gegenstände fabriziert, in die man etwas hinein töpfert, weil man es gar nicht herausbekommen soll. Was sollte das für einen Sinn machen, wenn man ein Gefäß zerstören muss, nur um an den Inhalt heran zu kommen? Bei Sparschweinen ist das allerdings so, fällt mir ein. Nur wenn ein guter oder böser Dschinn entsteigen würde, den man nicht wieder einsperren soll, würde es einen gewissen Sinn machen. Wir beschließen, die „Wunderlampe“ in Ruhe stehen zu lassen und zu Ende zu frühstücken.
Unsere Phantasien allerdings gehen weiter. „Ist eventuell das Original der Unabhängigkeitserklärung der USA darin verborgen? Das wäre doch toll und ausgesprochen wertvoll“, kommt mir in den Sinn. „Vielleicht ist es auch die Kapitulationsurkunde, die die Deutschen und die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg unterzeichnet haben“, antwortet Susanne. „Vielleicht sind es aber auch wirklich nur alte Postkarten, wie sie Eli über viele Jahre gesammelt hat“, so meine Frau. „Ich werde sie vorsichthalber mal fragen, ob sie noch alle ihre Urkunden beisammen hat, zum Beispiel ihre eigene Geburtsurkunde, ihre Heiratsurkunde oder auch die Geburtsurkunde von mir.“ Sie ruft wieder unsere Großmutter an. Elisabeth ist inzwischen völlig verwirrt, als Susanne nach den Urkunden fragt. Sie sagt, dass sie überhaupt nichts mehr wisse, wenn sie so direkt angesprochen werde. Sie wisse lediglich noch, dass die Dose immer irgendwo in der Gegend herumstand und sie sie regelmäßig abgestaubt habe.
Ich denke nicht mehr, wie so häufig in den letzten Tagen, an unseren Vietnam-Urlaub, sondern nur noch an das merkwürdige Gefäß. Unvorstellbar, dass wir fröhlich in den Urlaub fahren und das Ding hier in unserer Wohnung herumsteht, grüble ich. Mein Urlaub scheint inzwischen so in meinem Kopf verdrängt zu sein, dass er gewissermaßen schon auf dem Spiel zu stehen scheint. Kann man denn überhaupt fröhlich in Urlaub fahren, wenn man ein solches Problem hat?
Es klingelt. Unsere Kinder Anne und Helge, 23 und 26 Jahre alt, stehen vor der Tür und wollen sich, wegen unserer Urlaubsreise, verabschieden. Mein Sohn Helge arbeitet in einer kleinen Firma für Edelhölzer und Furniere. Meine Schwiegertochter Anne ist Sozialarbeiterin und kümmert sich im Berliner Stadtteil Moabit um verhaltensauffällige Jugendliche. Beide haben sich für zwei Stunden auf ihren Arbeitsstellen frei genommen, und so stehen sie nun bei uns in der Küche. Helge ist ein echter Experte für seltene Baumsorten und vor allem für das Holz, das man aus ihnen schneiden kann. Wir zeigen ihnen sofort die vermaledeite Zuckerdose, die ja auch sie wahrscheinlich einmal erben werden. Unser Sohn ist hellauf begeistert. Anne ist zurückhaltender. Helge macht nur Spaß, als er die Dose wie ein Jongleur in die Luft wirft und virtuos wieder auffängt. Der Scherz gefällt mir leider gar nicht. Anscheinend kann er mit alten Dosen weniger gut umgehen, als mit edlen Hölzern. Würde man denn eine teure chinesische Vase auch nur so zum Spaß in die Luft werfen? „Erben bringt sterben“, sagt Anne zum Scherz. Und ich denke sogleich wie- der an die geheimnisvolle Pandora. Dann fällt Helge etwas sehr Merkwürdiges ein. Er könne sich, so erzählt er, nur ganz schwach daran erinnern, dass Uroma Eli ihm irgendwann einmal sagte, dass die Dose aus einem Lager für Fundstücke stammen würde, die Uropa Ewald eines Tages, vor vielen Jahren, mitbrachte. Ewald ist schon über zehn Jahre tot. Er war bei der Polizei beschäftigt, und dort würden sie einmal jährlich die Lager mit den Sachen aus den Gefängnissen räumen, zum Beispiel von den Insassen, die verstorben sind. „Ein Verbrecherstück also“, ruft Susanne sofort. „Umso interessanter ist die Frage, was drin steckt“, erwidere ich. „Vielleicht sind es ganz konkrete Hinweise auf die Schuld oder Unschuld eines Serienmörders.“ Wir können die Sache nicht ausdiskutieren. Nach 20 Minuten sind unsere Kinder schon wieder weg, und wir sitzen wieder alleine mit unserer Zuckerdose da. An unserem ersten Urlaubstag lässt uns die spezielle Sehnsucht nicht mehr los, das Geheimnis dieser Dose endlich zu lüften. Am Abend gehen wir sehr früh zu Bett, weil wir schon um sechs 6 Uhr früh des nächsten Morgens am Flughafen Schönefeld sein müssen, um unsere Reise nach Vietnam anzutreten. Nur sehr widerstrebend, fast traurig, lassen wir von der Dose ab.
Unsere Urlaubsreise geht von Berlin-Schönefeld über Frankfurt nach Hongkong und dann nach Đà Nẵng, eine Stadt, die etwa in der Mitte Vietnams liegt. Dort haben wir uns ein Appartement in einem recht teuren Hotel direkt am Meer gebucht. Von dort aus wollen wir die Gegend erkunden, die vietnamesischen Menschen sowie ihre Lebensweise studieren und vor allem die alte Kaiserstadt Huế besuchen, die nicht weit von Đà Nẵng entfernt liegt. Mit dem Motorroller, so ist es geplant, wollen wir durchs Umland fahren. Insbesondere auf das vietnamesische Essen sowie den berühmten Süß-Kaffee freuen wir uns. Noch im Flugzeug nach Hongkong wollen meine Gedanken über unsere Erbdose nicht verfliegen. Und auch noch auf dem Balkon unseres Ferienappartements denke ich hoffnungsvoll und intensiv über die Öffnung der Dose nach, die leider auf dem Tisch unseres Zuhauses zurückbleiben musste. Erst am Ende unserer ersten Urlaubswoche, nachdem wir schon einiges erlebt haben, verflüchtigen sich meine Erinnerungen an das besonders schöne und geheimnisvolle Stück.
Wir machen uns fertig, um nun endlich die alte Kaiserstadt zu besuchen. Der Motorroller steht fahrbereit vor dem Hotel. Zwei Wasserflaschen und mehrere Müsliriegel haben wir in unseren Rucksäcken verstaut. Los geht es. Die Wegstrecke ist lang, aber für uns sehr kurz, weil wir ein blühendes Land mit vielen freundlichen Menschen im Vorbeifahren erkennen können. Die Vegetation ist eine ganz andere als Berlin. Das Lebensgefühl ist freier und unaufdringlicher als das in Deutschland. In Huế müssen wir schließlich Eintritt zahlen, um an die zugewachsenen alt-kaiserlichen Gemäuer heranzukommen. Sie besitzen eine magische Anziehungskraft für uns, fast wie die Dosenvase auf unserem Tisch. Huế war von 1802 bis 1945 die Hauptstadt Vietnams. Sie wurde 1993 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Wir erfahren etwas über die Zitadelle und die verbotene Stadt im 19./20. Jahrhundert, über die Thiên Mụ- oder Linh Mụ-Pagode aus dem 17. Jahrhundert, über die Grabmäler von Kaisern der Nguyen-Dynastie, einige Kilometer den Huong-Fluss aufwärts gelegen. Grabmäler über Grabmäler begegnen uns, wie die des Nguyễn-Königs Minh Mang, des Tự Đức und des Khải Định. Wir erfahren auch etwas über die systematische religiöse Diskriminierung der Menschen, die mit dem Verbot von Scheidung, Empfängnisverhütung, Tanzen, Schönheitskonkurrenzen, Glücksspiel, Wahrsagen, Hahnenkämpfen und Prostitution einhergingen.
Dann spüre ich urplötzlich ein Entsetzen oder besser, umgekehrt, ein überwältigendes Glück. Vor einer der grün umrankten Ruinen entdecke ich zwei Vasen, links und rechts festgemauert auf einer kleinen vierstufigen Treppe. Die Vasen sehen exakt genau wie unsere Erbvase zu Hause auf dem Küchentisch aus. Allerdings sind sie nicht mit merkwürdigen Deckeln verschlossen, wie das gute Stück von Oma Eli. Sie sind auch viel größer, etwa einen Meter hoch. Aber die gleiche Form, Farbe und Bemalung haben sie. „Das kann gar nicht sein“, sagt Susanne, während auch ihr ein Schauer über ihren Rücken läuft. „Wie kann das sein, dass man hier in Vietnam genau dieselben Vasen hat. Solche Zufälle gibt es nicht. Niemand weiß doch, dass wir hier sind“, sagt sie. „Du denkst wohl, wir leben noch im Mittelalter“, antworte ich, „denn wenn dort jemand mit dem falschen Fuß aus dem Bett gestiegen ist, so sagte man, hätte es Regen gegeben oder ein Unglück wäre passiert. Dass wir ganz persönlich hier sind, hat doch nichts mit den Vasen zu tun.“ Wir inspizieren sehr gründlich die beiden Vasen. Alles sieht haargenau so aus wie bei unserer, nur eben der Deckel fehlt. Ich mache Fotos, immer und immer wieder. Ein vietnamesischer Besucherführer erklärt uns, dass die beiden Vasen allerdings noch gar nicht so alt seien. Auf Bảo Đại, den letzten - in Frankreich verstorbenen - Kaiser aus der Nguyen-Dynastie, der im 19. Jahrhundert in Nord- und Süd-Vietnam regierte, würden sie wohl zurückgehen, bevor ab Mitte des 19. Jahrhunderts alles zunehmend von der Kolonialmacht instrumentalisiert wurde. Wir glauben ihm.
Auf unserer Rückfahrt zum Hotel stellen wir aber nunmehr kategorisch fest, dass unsere Zuckerdosenvase auf alle Fälle aus einem anderen Jahrhundert stammt. Vielleicht ist es nur eine kleinere Nachbildung der großen vietnamesischen Vasen. Oma Eli wird sich wundern.
Unsere Vorfreude auf die Rückkehr nach Berlin wachst in der letzten Urlaubswoche von Stunde zu Stunde. Das Geheimnis unserer Vase ist aber natürlich noch lange nicht gelüftet, weil sie ja schließlich noch immer verschlossen ist und wir ihr Geheimnis also noch lange nicht kennen. Die Urlaubstage verfliegen rasend schnell und schon stehen wir wieder auf dem Flughafen in Berlin. Viele Male auf den Rückflügen sehe ich mir die insgesamt 14 Bilder an, die ich von den vietnamesischen Vasen gemacht habe. Nichts kann mich jetzt mehr daran hindern, den Deckel der Vase irgendwie zu öffnen, ob mit Gewalt oder ohne, um endlich eine Bestätigung zu erhalten, was sie verbergen will. Schon auf der Taxifahrt vom Flughafen nach Hause schmiede ich entsprechende Pläne und denke mir einige technische Verfahren aus.
Wir halten noch kurz bei Oma Elisabeth an, um uns aus dem Urlaub bei ihr zurückzumelden. Wir erzählen ihr sogleich von unseren eigenartigen Erlebnissen in Vietnam. Wir zeigen ihr auch die Fotos der beiden Vasen aus Huế. Sie ist aber leider an diesem Tag recht unaufmerksam und sagt: “Das sind nicht meine Zuckerdosen. Die sehen nur so aus. Aber meine Dose ist völlig anders. Ich hätte doch gemerkt, wenn sie aus Vietnam gewesen wäre.“ Susanne und ich sind enttäuscht über Elis Reaktion. Nicht einmal die bewachsenen Ruinen auf den Fotos schaut sie sich interessiert an. Irgendetwas scheint sie zu verdrängen. „Uralt bin ich selber“, hat sie noch gesagt. Susanne sagt dazu nichts mehr. Auf der Autofahrt von Elisabeths Wohnung zu uns nach Hause, es ist der Freitag nach unserer Rückkehr und noch das ganze Wochenende liegt vor uns, verabreden wir uns, dem Geheimnis endlich auf die Spur zu kommen. Allerdings müssen wir, nachdem wir ankommen sind, erst einmal schnell ins Bett, weil die Flüge doch sehr anstrengend waren. Am drauffolgenden Morgen geschieht dann etwas sehr Mysteriöses. Als ich mir die Vasenfotos aus Vietnam noch einmal anschauen will, weil ich die Vasen miteinander vergleichen will, sind die Fotos plötzlich verschwunden. „Was ist denn nun los?“, bricht es aus mir heraus. „Jemand hat die Fotos gelöscht. Wie kann das passieren?“, schreie ich. „Als wir sie Eli gezeigt haben, waren sie doch noch da. Alle anderen Fotos sind vorhanden, nur die Bilder von den Vasen sind weg. Die Sache wird gruselig. Steckt Oma Eli dahinter?“ Susanne starrt mich fast entsetzt an. Dann blättert sie elektronisch auf unserem Fotoapparat alle Urlaubsbilder durch. Die Vasenfotos bleiben verschwunden. Unsere Bemühungen, die Dosenvase endlich zu öffnen, scheitern erneut. Erst am Sonntag kann ich mich wieder einigermaßen beruhigen und besser konzentrieren.
Endlich kommt mir der rettende Einfall. „Ich werde einen sauberen Schnitt machen und den Zauberdeckel von der Dosenvase einfach abschneiden. Dann kann man ihn wieder draufsetzen, wenn man möchte, aber wir wissen wenigstens, was drin ist“, strahle ich Susanne an. Sie zögert, aber schließlich ist sie doch einverstanden und willigt ein. Es zeigt sich aber, dass es doch nicht ganz so einfach ist, einen sauberen chirurgischen Schnitt an einer Vase aus Ton zu vollziehen. Erst als ich verschiedene Techniken ausprobiert habe, gelingt es mir, den Deckel mit einer Handkreissäge einigermaßen ordentlich abzutrennen, direkt unter dem pudelmützenartigen Aussatz. Beim Öffnen kommt es mir dann so vor, als sei das Licht auf einmal etwas dunkler geworden. Es ist schon 22.30 Uhr. Auch riecht es sehr stark nach verfaultem Holz. Meine Hände zittern ein wenig. Als ich die Trennung endgültig vollzogen habe und vorsichtig den Deckel abnehme, ist es im Inneren der Vase stockdunkel. Mutig fasse ich mit der Hand in das Gefäß hinein.
Ich taste mich langsam mit den Fingern in der Vase vor. Lediglich ein vergrautes pappartiges Kärtchen, etwa 10x10 Zentimeter groß, befindet sich darin, sowie ein kleines Stofftäschchen, in das ein Ring aus Messing eingewickelt ist. Der Stoff scheint nicht sehr alt zu sein, aber der Ring wirkt antik. Das Allerwichtigste ist für mich das Papp-Kärtchen, denn es steht etwas in vergrauten Buchstaben darauf geschrieben. Den Text können wir allerdings nicht lesen. „Das ist nicht vietnamesisch, sondern eher griechisch“, sagt Susanne. Es ist nur ein einziger Satz, der auf dem Kärtchen steht. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf.
Am nächsten Tag auf meiner Dienststelle, ich arbeite als Archivar im Uni-Archiv der Humboldt Universität, versuche ich mich inhaltlich dem Text zu nähern. Wie versuche ich das? Ich gebe die beiden Zeilen in ein Übersetzungsprogramm für griechisch-deutsch ein, das mir Google bereitstellt. Zuvor habe ich den Satz mit einem Scanner eingelesen, um dann mit Paste und Copy die Zeilen einzufügen zu können. Leider kommt nichts Vernünftiges dabei heraus, weil ich gar kein Texterkennungsprogramm habe. Das Übersetzungsprogramm kann die griechischen Zeilen einfach nicht lesen. Meine Kollegin Erika meint schließlich, dass der Text vielleicht sogar altgriechisch sein könnte. Ich lasse mich darauf ein. Da ich an einer Uni arbeite, in der auch Altphilologie unterrichtet wird, rufe ich sogleich einen mir persönlich bekannten Hochschullehrer an, der mir eventuell dabei behilflich sein könnte, den Text zu übersetzen. Erst am nächsten Tag bin ich erfolgreich. Professor Scheur, ein Altphilologe und Gräzist, arbeitet nur zwei Häuser weiter. Ich gehe einfach zu ihm, und er kann mir den Text ganz problemlos übersetzen. Ich habe ihm allerdings nichts darüber erzählt, wo der Zettel herkommt und was ich mit der Übersetzung überhaupt will. Lediglich um einen kleinen Gefallen, die Übersetzung eines einzigen Satzes, habe ich ihn gebeten. Weil der Text tatsächlich altgriechisch ist, kann Herr Scheur mir den Wunsch sogleich erfüllen. Die Übersetzung der Zeilen lautet:
„Wir werden euch zeigen, wie es auch ohne Mord und Totschlag geht, bis ihr den Krieg verachten und ihn verfluchen werdet.“