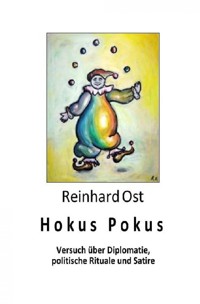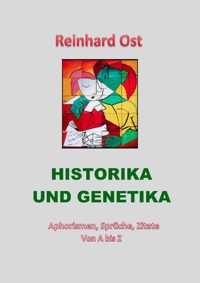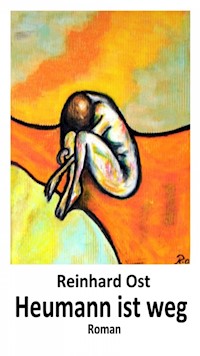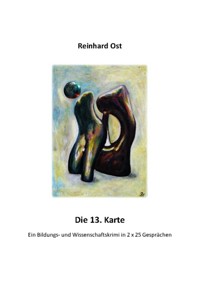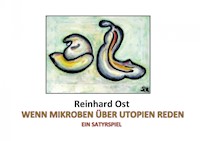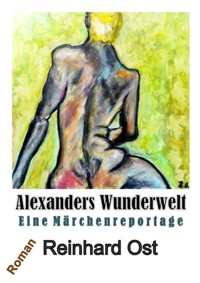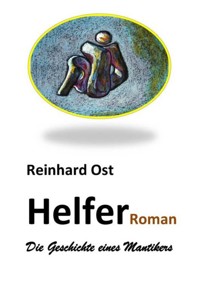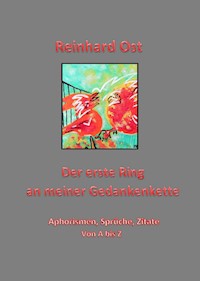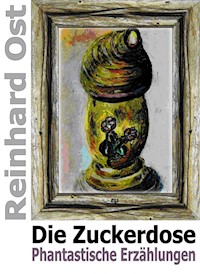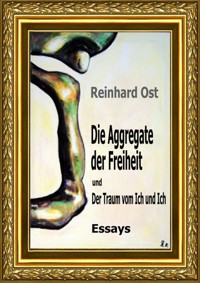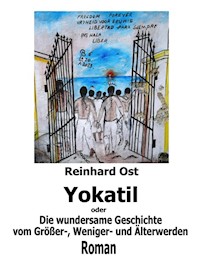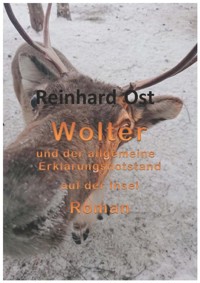
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn es ernsthaften Politikerinnen und geschwätzigen Rhetorinnen zugeschrieben wird, viele der Intrigen des Alltags deuten und gestalten zu können, so besteht die Aufgabe von Dichterinnen und Erzählerinnen darin, die weiblichen Fabelwesen auf imaginären Inseln zu preisen, die toten Männer im Hades zu begraben und die Un-geborenen auf allzu fremden Planeten zu besuchen. Zuvor aber haben kreative Menschen ihre Alltagsaufgaben zu bewältigen. Sie müssen das Sprechen sowie die Sprache von Schrift und Zahlen erlernen. Erst dann können sie nach den Anfängen für ihre Geschichten suchen und ihre Namensrechte vergeben. Zahlen und Zeiten sollten stets variabel gehalten bleiben, um die Mächtigen und Ohnmächtigen etwas erträglicher zu machen. Aber alle erzählerische Mühsal dient im Regelfall nur drei besonderen Zwecken: dem Phänomen des zeitgemäßen Unterwegsseins, dem Ge-schlechterspiel und zugleich einem autobiografischen Lebenswerk zu entsprechen. Dann endlich werden eigene Zeitreisen angetreten, um im unendlichen Kosmos his-torischer Zahlenwerke und deren Kombinationen zu baden - Reisen in der Vergan-genheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, damit am Ende unsere Erinnerungen an verstaubte Altertümer und das große Ungeheuer, an die Visionen im unglaublich Mannigfachen und die triste Alltagslyrik sowie an die Hypermoderne mit all ihren Verführungs- und Überlebenskünsten uns über eine gewisse Zeit lang verzaubern können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Reinhard Ost
Wolter
und der allgemeine Erklärungsnotstand
auf der Insel
Copyright: @ 2024 Reinhard Ost
Published by: epubli GmbH, Berlin
www.epubli.com
Zeitgemäßes Unterwegssein
Geschlechterspiel
Autobiografisches Lebenswerk
Alltagslyrik
Kirche-Glaube-Politik
Diakonie im Wandel
Bildung-Erziehung-Schule
Sprechen-Sprache-Gestus
Über zwei Jahrhunderte
Statt eines Vorworts
Wenn es ernsthaften Politikerinnen und geschwätzigen Rhetorinnen zugeschrieben wird, viele der Intrigen des Alltags deuten und gestalten zu können, so besteht die Aufgabe von Dichterinnen und Erzählerinnen darin, die weiblichen Fabelwesen auf imaginären Inseln zu preisen, die toten Männer im Hades zu begraben und die Ungeborenen auf allzu fremden Planeten zu besuchen. Zuvor aber haben kreative Menschen ihre Alltagsaufgaben zu bewältigen. Sie müssen das Sprechen sowie die Sprache von Schrift und Zahlen erlernen. Erst dann können sie nach den Anfängen für ihre Geschichten suchen und ihre Namensrechte vergeben. Zahlen und Zeiten sollten stets variabel gehalten bleiben, um die Mächtigen und Ohnmächtigen etwas erträglicher zu machen. Aber alle erzählerische Mühsal dient im Regelfall nur drei besonderen Zwecken: dem Phänomen des zeitgemäßen Unterwegsseins, dem Geschlechterspiel und zugleich einem autobiografischen Lebenswerk zu entsprechen. Dann endlich werden eigene Zeitreisen angetreten, um im unendlichen Kosmos historischer Zahlenwerke und deren Kombinationen zu baden - Reisen in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, damit am Ende unsere Erinnerungen an verstaubte Altertümer und das große Ungeheuer, an die Visionen im unglaublich Mannigfachen und die triste Alltagslyrik sowie an die Hypermoderne mit all ihren Verführungs- und Überlebenskünsten uns über eine gewisse Zeit lang verzaubern können.
_____________________________________________________
„Es ist nun schon über zwei Jahrzehnte her, dass zwei mutige Frauen, meine Freundin Leonora Bauer und ich, sich vorgenommen haben, eine neue Schule zu gründen. Und diese Schule sollte endlich frei sein, ohne die üblen Magenschmerzen, ohne Befürchtungen oder gar Ängste, damit die Lehrenden und Lernenden ihr Zusammenleben gemeinsam austesten und sich wechselseitig unterrichten können.“
So frech, so unbekümmert und auch ein wenig vorlaut formuliert die kesse Schulleiterin den Anfang ihrer Grußbotschaft und kritzelt diese Zeilen auf einen schmutzig-gelben Spickzettel, um anschließend in einer großartigen Abschiedsrede den Absolventinnen des aktuellen Jahrgangs herzlich zu danken und sie zu beglückwünschen. Aber ja doch, ja! Um welche Danksagung geht es? Warum ist der Spickzettel überhaupt gelb und schmutzig? Welche Form von Glück soll das sein, wenn die allerbesten Wünsche beim Abgehen von der Schule entgegengenommen werden? Ist Glück und Erfolg der einen Person möglicherweise für alle anderen ein großes Unglück? Wie häufig schon ist Undank der Welten Lohn gewesen? Wir sollten uns solcher Fragen auf keinen Fall schämen oder ihrer überdrüssig werden. Meistens sind sogar deren Antworten längst auf einem vergilbten Papier niedergeschrieben oder in einer Datei versteckt worden. Immer und überall geht es um den Fortgang von Geschichte und zugleich um die Fortgänge vieler kleinerer Erzählungen.
Die oben zitierten einleitenden Worte der Schulleiterin sind allerdings für die nachfolgend erzählte Ereigniskette völlig belanglos. Der gelbe Spickzettel ist nur einer von vielen möglichen klebrigen Startpunkten. Und so schreiben wir, um wenigstens im zweiten Anlauf etwas präziser zu sein, den kalten siebten Tag im Januar 2016 in unseren Kalender und markieren ihn wie einen Termin mit zwei gekreuzten Strichen in dunkelblau, zusätzlich malen wir schwungvoll noch einen hellgrünen Filzstiftkreis um das Kreuz herum. Von diesem Erinnerungspunkt aus wollen wir loslegen und uns dabei tief in die Augen schauen, während wir auf keinen Fall vergessen dürfen, vor- und zurückzublicken und uns weder zu weit hinaus noch zu stark hinunter zu lehnen. Sicherheit wird auch beim Reisen immer wichtiger. Nun, genau so wollen wir gemeinsam zu Beginn in die Vergangenheit zurückkehren, um uns dann langsam wieder in die andere Richtung vorwärts zu bewegen, bis endlich das Aktuelle und die Gegenwart erreicht sind. Zu guter Letzt riskieren wir noch einen kurzen scheuen Blick voller Hoffnung und Zuversicht, voller Träume und Ängste, in die Zukunft.
Unterdessen sind die zu Beginn beglückwünschten Mädchen, nunmehr sind es gebildete Mädchen mit einem Abitur in der Tasche, schon sehr viel älter geworden. Einige liegen schon als Aschewesen in urnenförmigen Vasen in der Erde vergraben. Andere existieren noch, doch wirken diese nur noch wie Lebende in Körpern von unbeweglichen Schildkröten - mit schweren Panzern auf ihren gekrümmten Rücken. Man kann das Alter von stark gepanzerten Lebewesen, die weit zurückliegend in der Vergangenheit geboren werden, oft später nur unpräzise schätzen. Aber eben auch durch ungenaues Gewichts- und Wertschätzen rettet man sie in die Gegenwart hinüber. Wie wir inzwischen wissen und viele Leute glauben, sind einige Personen allen Menschen bestens bekannt. Diese Personen bleiben uns sozusagen präsent. Sie sind im Laufe der Zeit prominent geworden. Manche der Prominenten können sogar bedeutend werden. Im Fortfolgenden wollen wir uns aber auch diesem hypermodernen Gedankenphänomen verweigern und die Idee vom heiligen Stuhl, auf dem die Prominenz Platz nimmt, verwerfen. Stattdessen wollen wir uns mit einem weithin unbekannten Lebewesen beschäftigen. Die Rede soll von Wolter sein - einfach nur Wolter - ohne irgendeinen irritierenden Vornamen. So haben ihn seine Entdeckerinnen in einer frühen Morgenstunde getauft und dann nur in einem Wort zusammengefügt. Wolters Geschichte beginnt abgekürzt also vor ungezählten Jahren - so etwa gegen halb acht Uhr morgens früh.
Schon recht kurz nachdem Wolter entstanden ist, haben sich in seinem noch kurzen Leben ganz eigenartige Dinge abgespielt. Einige schreiben diese Seltsamkeiten Wolters unbekannter Familie zu, andere seinem attraktiven Lebensumfeld, manche auch dem imaginierten ländlichen Geburtsort mit dem rasch vorüberfließendem Fluss oder andere dem Zeitpunkt, an dem er kreischend und im Körbchen strampelnd aus dem Wasser gefischt wird.
Je nachdem, was eine mutige Erzählerin für wichtig oder notwendig hält, was sie persönlich für interessant hält oder für andere sensationell erscheint, genau das kann später zu jener Form von Bedeutsamkeit führen, die eine Lebensgeschichte ausmachen kann. In biografischen Notizen, wie in einer von Wolter, also in den kurzen Erzählungen über ihn, fliegt eine philosophisch orientierte Biografin hoch über die Berge und Ozeane hinweg, oberhalb der großen Paläste sozusagen, eine andere Biografin wiederum riskiert lediglich einen scheuen Blick in die einfachen Hütten der armen Leute.
Das erste Ziel der Erkenntnis soll eine Orts- oder Zeitangabe sein, sozusagen die Feststellung von Fakten, in denen Wolter physisch und psychisch entstehen kann. Nachfolgend wird er dann auf einem vergilbenden Papier in unleserlicher Handschrift festgehalten oder als Datei im Drucker sauber ausgedruckt, um dann sehr resolut mit dem amtlichen Dienststempel versehen zu werden. Insbesondere das auf solche Weise dokumentierte Geburtsgehege wird nicht selten zum allerersten Maßstab für die spontane Selbst- bzw. die Fremderkenntnis. Immer geht es in biografisch-orientierten Erzählungen um das Fremde und das Eigene zugleich. Beide Aggregatszustände des Sozialen - quasi in einem persönlichen Weltenlauf festgehalten - gibt es nur ineinander verschränkt, stark verwoben und zu einem Alltagsmuster verstrickt. Das Eine existiert nicht ohne das Andere, das Ich nicht ohne die vielen Gegenüber. Manche Autorin erklärt sich auf diese Weise sogar die Anfänge ihrer Selbst, wenn beispielsweise eine weithin unbekannte Frau des rührigen Landpfarrers, zum Ende des 19. Jahrhunderts, zu einem philologischen bzw. historischen Forschungsgegenstand im 21. Jahrhundert wird oder wenn diese evangelische Pastorenfrau sogar eine Autobiografie verfasst, die erst 150 Jahre später im Archiv des Vatikans freigegeben und dadurch entdeckt wird. Dann, ja dann, gehören - wie automatisch - schon einige Zeitreisen der Vergangenheit an.
Unser eigentümlicher Wolter ist seit jeher vollkommen anders geartet. Er hat schon in frühesten Kindheitstagen erfahren dürfen, dass er sich selbst viel zu wenig ist und er gerne anderen Menschen zuhört und ihnen folgen möchte, insbesondere denjenigen, die ihm nahe stehen und sich mit ihm verständnisvoll beschäftigen, denen er sozusagen ein eigenes sinnerfassendes Fremdverständnis unmittelbar entgegenbringen kann: zum Beispiel den Eltern oder den Großeltern, den Geschwistern, Tanten, Onkeln oder auch der Bürgermeisterin des kleinen Heimatorts, wenn diese selten genug zu Besuch kommt. Im Prinzip kann Wolter ad-hoc jedem beliebigen Menschen wertschätzend folgen - ja sogar bei den Tieren und anderen Fabelwesen wie den Pflanzen klappt das. Ja, es stimmt: Schon als Kleinkind hat er ausdauernd genug probiert, mit stummgeschwätzigen Pflanzen zu kommunizieren, um sie in ihrem Verhalten zu verstehen, um ihnen sein Engagement und seine Aufmerksamkeit zu schenken. Seither kann Wolter Pflanzendenken und Pflanzenreden grundsätzlich entschlüsseln, immer gerne dann, wenn er etwas Persönliches und Phantastisches daraus gewinnt. So entwickeln sich im Laufe seiner frühen Jahre zwei wichtige und geradezu universale Eigenschaften - das tiefsinnige verallgemeinernde Denksprechen und das aufregendere konkrete Denkübersetzen. Prinzipiell ist er fortan in der Lage, viele unterschiedliche Sprachen und Sprechweisen zu entschlüsseln, ja sogar die dazugehörigen Gesten weiß er recht exakt auf die Sprechakte zu beziehen. Blitzschnell löst er komplizierteste Rätsel, wie zum Beispiel die vielfach ineinander verschlungenen Formen von Geschichts- und Vergangenheitsinterpretationen - weil er eben ein aufmerksamer Zuhörer und Beobachter geworden ist. Wolter werden die meisten Menschen zweifellos männlich nennen. Im Prinzip könnte er auch weiblich sein und Lisbeth Woltering heißen, ohne das Geschlecht wechseln zu müssen. Aber keinesfalls würde er sich selbst als non-binär bezeichnen.
Die ersten beiden Menschen, die Wolter ausreichend gut versteht, reden ausgerechnet über ihn persönlich. Zwei ihm wildfremde, riesengroße Gestalten erzählen sich tolle Geschichten über die allerkleinsten Lebewesen auf dem Erdball, also sie reden auch über ihn in seinem frühen Lebensstadium. So denkt er gleichzeitig intensiv über sich selbst nach, während er gespannt lauscht, als sich die beiden Fremdlinge in recht drastischen Formen und mit einprägsamen Gebilden seltsamer Wörter angeregt und amüsiert unterhalten. Sie sprechen über die verschlungenen abendländischen Lebenswege, die sie wie ihre persönlichen Erfahrungen aufbereiten und bis in die Zeit der großen Abenteurer und Weltumsegler zurückverfolgen. Wolter kann noch keine Abenteurerinnen oder Seglerinnen kennen, wie sollte er auch. Er weiß weder, was ein Abenteuer ist, noch woran man eine Weltumseglung erkennt. Trotzdem verkörpern die beiden Fremden für ihn etwas Weites und Gescheites, auch etwas Seltsames und Anregendes, vielleicht sogar etwas Wahres oder Wahrhaftiges. Auf jeden Fall liegen viel Magie und einige Wirkungskräfte in ihren Erklärungen. Es kommt Wolter so vor, als würden sie sich bestens mit dem Verstehen des Lebens auf dem runden Erdball auskennen, zum Beispiel auch mit den Geburtsvorgängen oder den Stadien der frühkindlichen Entwicklung. Die Beiden unterrichten sich wechselseitig darüber, wie die bedeutenden Ideen über die Entstehung der Arten auf der Erde, im laufenden 19. Jahrhundert, die Runde gemacht haben. Zuerst zitiert man sich selbst, dann zitiert eine die andere und eine andere wissenschaftliche Autorin wiederum die übernächste. Wolter nimmt viel Unverständliches und auch Übles aus den Geschichtsberichten in sich auf. Und so bringt er, weil er daran glaubt, seine eigene Form von Nachdenklichkeit hervor, die er später einmal „meine Wolterität“ nennen wird.
Einige Wichtigtuerinnen in den aufregenden Jahrzehnten großer Entdeckungen, darunter viele Royalistinnen, Sozialistinnen, Nationalistinnen, Liberalistinnen und auch einige Anarchistinnen haben allesamt für Wolter etwas Gemeinsames. Sie beherrschen wundervoll grausam die apodiktische Redeweise, so glauben jedenfalls auch die beiden Personen, die Wolter so sehr nahe gekommen sind. Kleine Geschöpfe sollen angeblich zwischen den Jahren 1831 und 1836 bei der Weltumsegelung des großen Engländers Charles Darwin mit an Bord des Forschungsschiffs „Beagle“ gewesen sein. Genau davon erzählt die eine der beiden, die sich am trüben Spätsommertag so ausgesprochen unbekümmert miteinander unterhalten. Der Eine trägt eine dunkle, fast pechschwarze Kleidung am Körper und eine weißgekräuselte Krause um den Hals. Die Andere scheint sich nur sehr mühsam in eine viel zu enge Militäruniform gezwängt zu haben. „Dann müsste er doch viel älter sein“, erwidert plötzlich die weiblichere Gesprächspartnerin. Jedenfalls stehen die beiden Sprechenden so eng beieinander, dass ihr Gesprochenes wirklich unfrisch riechen könnte. Schreckliche wirbelnde Stürme und Angriffe riesiger Kraken habe die Crew der „Beagle“ auf ihrer großen Expeditionsreise überstehen müssen, heißt es mit echter Bewunderung. „Mitten auf dem weiten Ozean und weit entfernt vom Land.“ So lautet die Antwort. Dann meint der theologische Mann, dass im Grunde alle Menschen an Bord seekrank gewesen sein müssten. Daraufhin vermutet Wolter, er könne sich speziell daran gut erinnern - nämlich an den Geruch. Aufgeregt wie in einem Augenblick der Selbsterkenntnis nimmt er die kleinen Scherze der uniformierten Frau über die Barttracht Darwins in sich auf. Viele solcher Bartscherze seien damals unter den Seeleuten der „Beagle“ ausgetauscht worden. Einige unter ihnen meinten schon zu Beginn ihrer Reise, sie seien bereits in Südamerika angekommen, dabei hätten sie erst auf der Insel Teneriffa nahe der Küste Marokkos den Anker ins Wasser gelassen, so hat es jedenfalls die Frau in ihrer Soldatenkleidung mit einem recht überheblichen Tonfall berichtet. Zeitenspannen und Wegestrecken seien noch nicht für alle präzise erfassbar gewesen. Über solche Sachen unterhalten sich die beiden Fremden, in Wahrheit sind sie jedoch zu dritt. Dann nehmen die Kostümierten sogar noch auf einem dicken Baumstamm Platz. Wolter sitzt direkt neben ihnen in einem alten Waschtrog voll des warmen Wassers. Er hebt unablässig seinen Kopf und glotzt fast wie eine Schildkröte nach oben in den blauen Himmel. Völlig ungeniert plaudern die Beiden weiter, dabei guckt er doch unentwegt und konzentriert diesen Riesenmenschen in die Augen, gleichzeitig hört er sehr intensiv zu. Man unterhält sich sogar über bestimmte Quarantänemaßnahmen, die seinerzeit, aufgrund des Ausbruchs der Cholera auf der englischen Insel, über die Besatzung des Forschungsschiffs verhängt worden seien, noch bevor das Schiff zum ersten Mal den Anker gelichtet hat. Das könne man in einer glaubwürdigen Quelle genau so nachlesen, behauptet der Theologe. Wolter schwitzt plötzlich sehr stark, obwohl er doch immer noch fröhlich in lauwarmem Wasser herumplantscht. Pitschnass grübelt er weiter, weil er nach Anhaltspunkten sucht: „Wie kann ich von alledem wissen? Ich kann gar nicht mit an Bord gewesen sein, sonst würde ich ja ein Brite wie Darwin sein.“ Die beiden Fremden kommen ihm plötzlich nicht gerade logisch vor. Als nächstes erzählt die weiblichere der beiden Personen, in ihrer hohen singsanglichen Stimmlage, dass der berühmte britische Forscher unentwegt damit beschäftigt gewesen wäre, auch noch die allerkleinsten Organismen einzufangen, um sie anschließend untersuchen zu können. „Die kleinen Lebewesen hat er dann sehr sauber beschrieben. Er malte sie ab, er definierte und katalogisierte sie: Kleintiere, Pflanzen und viel des Übrigen. Im Schleppnetz des Heckwassers wurde alles nur Denkbare mitgezogen und anschließend an Bord gehievt.“ Bereits zwischen Marokko und Teneriffa sei dieses Schleppnetzangeln losgegangen. „Könnte ich wirklich ein solch kleiner Organismus gewesen sein, wegen dem der große englische Naturgelehrte die Einträge in seinem Notizbuch machte?“ Jedenfalls kann man zweifellos und wahrheitsgemäß behaupten, so Wolters Gedankengang weiter, dass Darwin, während er segelte, angelte und fischte, viel vom Schreib- und Malpapier verwendete. Was er nicht beschreibt oder abzeichnet, konstruiert er eben aus dem Gedächtnis phantasiereich hinzu. Wie Körner an einem endlosen karibischen Sandstrand sammelt Darwin seine Entdeckungen auf. Immer geht es um das Neue und Interessante bei ihm, um das Originelle und Erinnerungswürdige, um das Aufbewahrungswerte. Seinen eigenen Ursprung definiert Wolter fortan und nun endgültig neu. Er denkt sich seine eigene Entdeckung mit einer größerer Erregung: „Ich bin ein Wesen unbekannter Art gewesen, vielleicht so drei bis fünf Zentimeter groß und ausgesprochen klug. Von einer fernen Pazifikinsel mit einem schier unaussprechlichen Namen stamme ich, denn ferne Inseln mit vielen unbekannten Lebewesen sind für Charles Darwin am Ende seiner Forschungsstrecke zur Herzensangelegenheit geworden.“
Nun kann Wolter wenigstens bruchstückhaft seinen Ursprung selbst deuten. Aber es gibt auch solche Dinge, die er sich noch nicht erklären kann. Wie ihm, so grübelt er ernsthaft, gehe es vor allem den älteren Menschen. Das hat er einige Tage zuvor von einer alten Frau gehört, die darüber mit ihrer noch sehr jungen und hübschen Tochter gesprochen hat. Erst habe man Probleme mit der Namensgebung, später mit den Knie n und dann zum Schluss auch noch mit der Erinnerung. Kurioserweise könne sich der anfängliche Mangel an Namens- und Erinnerungssicherheit sogar fortentwickeln. „ (...) am Ende der bildungsgemäßen Ereigniskette möglicherweise sogar bei Historikerinnen. Vermutlich ist das Phänomen wirklich vererbbar“, hat sich Wolter eingeredet. „Einigen Verträumten in der großen Stadt gelingt es nicht einmal mehr, sich ohne Eselsbrücken die bekanntesten Namen und die dazugehörigen Gesichter zu merken. Oft stehen dann genau diese Menschen plötzlich vor der Aufgabe, sich Phantasienamen für seltsame Gesichter ausdenken zu müssen, die gut wirken könnten, schön oder schrecklich klingen, die jedenfalls irgendwie plausibel oder gar sensationell sind.“ Nun, Wolter hat über einige Monate, fast ein ganzes Jahr, gewisse Probleme damit gehabt, sich spezielle Adjektive zu merken, nämlich diejenigen, die allgemein üblich sind und an den einschlägigen Namen bestimmter Menschen kleben bleiben. Zum Beispiel die Adjektive „bekannt“, „berühmt“ und „berüchtigt“ kann er schlecht sinnerfassend einordnen. Nur mit gewissen Bauchschmerzen lernt er langsam, wie kompliziert schon eine kleine Wertschätzung sein kann - und dann erst die enorme Menge aller meinungsbildenden Einschätzungen oder gar die Theorien in den großen Weltanschauungen und Religionen. „Wie sehr doch eine Einschätzung nur eine Schätzung ist und am Namen klebt.“ Diesen Spruch findet Wolter ausgesprochen einprägsam. Er fragt sich in jenen Wochen und Monaten auf der Suche nach sich selbst, wie er eines Tages auf einer deutschen Insel landen konnte. Darauf weiß er bis heute keine vernünftige Antwort. Es könnte purer Zufall sein oder auch eine sinnstiftende Notwendigkeit. Niemand kann das wissen, und wenn eine Biografin, die gut recherchiert hat, sich mal eine Antwort zutraut, dann haben andere schon die Frage wieder vergessen. Im Prinzip fühlt sich dadurch niemand gestört - Wolter aber schon. Inzwischen glaubt er, durch große Selbstsicherheit und Zuversicht getragen, dass er pazifischen Ursprungs sei. Von dort stamme er her, lautet seine autobiografische Vermutung, dort ist er eines Tages entstanden, denn von dort würden Windstöße können. Nach Deutschland ist er lediglich an einem sonnigen Morgen hingetrieben worden und dann angekommen. Das nimmt er als eigenes zusätzliches Herkunftsereignis in Kauf. Es sind ganz spezielle Geburtsorte und Geburtszeitpunkte, die gelegentlich sogar wie Merkmale eines echten Glaubens wirken können, wie Bethlehem und Mekka zum Beispiel. Manchmal wirken diese Orte oder Zeitpunkte wie auf der Landkarte höchstpersönlich eingezeichnet, aus der Ferne überlebensgroß und überlebenswichtig, aus der Nähe wie ein kleines, Bedeutung tragendes wundervolles Zeichen. Im Grunde beginnen Wolters famose Eigenschaften, zuhören, verstehen, sprechen und sehr gut erzählen zu können, wie eine eigene kleine wundervolle Schöpfungsgeschichte, jedenfalls wenn man sie von seiner Selbstwahrnehmungsseite her betrachtet.
So richtig nützlich und tragfähig werden Wolters Eigenschaften allerdings erst in jenen besonderen Tagen, als er die kleine Marika kennenlernt. Tagelang schleicht das Mädchen Marika nur schüchtern auf der Insel umher. Als sie Wolters Garten und ihn selbst entdeckt, spricht sie ihn sofort freundlich lächelnd an. Ja man kann sagen, sie strahlt ihm gewissermaßen von Anbeginn ins Gesicht. Und er strahlt zu ihr zurück. So lernen sie sich täglich immer besser kennen. Monatelang sind Marika und Wolter dann an jedem Tag der Woche zusammen. Oft sitzen sie ebenfalls auf jenem dicken Baumstamm wie damals die beiden fremden Uniformierten, die sich ohne Abschiedsgruß wieder verdrückt haben. Inzwischen nennt Wolter dieses spezielle Baumstück seinen Stammbaum: ein getöteter und zugeschnittener Stamm als Platz, auf dem man sitzen, sich ausruhen, in Ruhe sprechen und sich verstehen kann. Marika erzählt Wolter tolle Geschichten über ihre große Familie, die sie gern habe und von einem Heimatgefühl mit sechs Geschwistern. Sie ihrerseits bekommt anfangs nur Wolters zustimmendes Nicken als Belohnung zurück, welches sie aber wie die goldenen Ähren auf einem Kornfeld, die sich ihr wohlwollend zuneigen, aberntet. Damals konnte Wolter beim besten Willen noch nicht erahnen, dass seine neue kluge Freundin Marika eines Tages eine sehr „einflussreiche Tochter“, eine „berühmte Gattin“ und auch die „Mutter Marika“ werden würde - sozusagen die perfekte Verkörperung der sich sorgenden Fraulichkeit. An einem der späten Nachmittage erfährt Wolter sogar den Tag und den Ort, an dem Marika geboren wird. Just in jenem Augenblick besitzt sie im Alter von sieben Jahren insgesamt sechs Geschwister. Sie ist die jüngste der Schwestern. Das macht Sinn für ihn und bildet einen ordentlichen Bezugsrahmen, an welchem er sich zukünftig orientieren kann. Marika nennt Wolter hin und wieder ihr allerliebstes Lebewesen der dritten Art, welches für sie ganz persönlich heranwächst und tagtäglich immer kräftiger wird. Wolter wird aber nicht nur immer kräftiger, sondern er kann auch sehr sensibel sein, zum Beispiel wenn er Marikas Gefühle liebevoll vorausempfinden kann. Sie macht ihm dann kleine niedliche Komplimente. Zu dieser Zeit, in der sich Wolter und Marika so oft begegnen, ist seine Lebenswelt wie zu einem Ritual geworden - jeden Tag entstehen immer wieder neue und herzliche Begrüßungs- und Abschiedsszenen. Mit Marika kann er sich einfach über alle Geheimnisse im Leben austauschen, und gemeinsam können sie sogar darüber lachen. Man kann sich sicherlich schon denken, einige mögen das vielleicht sogar irgendwo herleiten können, dass Wolter und Marika sich lieb haben und pudelwohl fühlen. Diese Zeit kindlicher Nähe seien die größten Glücksmomente in seinem ganzen Leben gewesen, wird Wolter später einmal sagen. Dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel mit der Unterscheidung zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit anfangen können, ist ein besonderer Vorteil gewesen. Als ihnen diese besondere Kunstfertigkeit dann gelingt, sind all die kuriosen Unterschiede zwischen Mann und Weib in den folgenden Monaten ausgesprochen inspirierend für sie. „Innerhalb und zwischen den Geschlechtern passiert viel Bewegendes und auch einiges Unerhörte“, sagt Wolter, im Inneren dadurch tief bewegt. Beide vertrauen sich sogar einige der verbotenen Einzelheiten im körperlichen Teil des Geschlechterunterschieds liebevoll an. Dann aber ist das große Unglück plötzlich da. Der Himmel über der Insel scheint mit dicken Wolken verhangen vorüber zu ziehen. Wolter und Marika sehen sich lange Zeit nicht mehr. Marika kommt nicht mehr zu ihm auf die Insel.
Wie kann so etwas geschehen? Hat er Marika womöglich verletzt? Ist sie krank geworden? Beide kennen noch keine Telefonnummer oder gar ein Handy. Also geht nichts mehr. Wolter ist enttäuscht und traurig, bis später endlich ein allererstes Gerücht die Runde macht. Es lautet folgendermaßen: Ein sehr erfolgreicher Prediger sei Marikas Ehemann geworden, und dieser verlange mit Nachdruck ihre volle Aufmerksamkeit. „Deshalb also ist sie nicht mehr zu mir auf die Insel gekommen“, begründet er schließlich sogar selbst ihre lange Abwesenheit, bis er eines Tages Näheres erfährt. Es hat sich tatsächlich so zugetragen, dass viele Menschen Gefallen an den Reden des Predigergatten von Marika gefunden haben und ihm folgen möchten. Auf diese Weise folgen diese Menschen dann gewissermaßen auch Marika - nämlich als Gattin des Mannes mit dem charismatischen Reden und dem heiligen Schein. Wolter kann viel über Leonhard in der Zeitung lesen, und sogar in einigen Büchern steht etwas über ihn geschrieben , in kleinen Geschichtenerzählbändchen nämlich, die man nur entsprechend interpretieren muss. Auch er findet schließlich Gefallen an einer Gefolgschaft zu Leonhard. „Aber die Tiere halten sich merklich zurück“, wundert sich Wolter, „den Pflanzen scheint’s vollkommen egal zu sein.“ Um die Angelegenheit abzukürzen: Zwei Menschen der gleichen Herkunft sprechen eine verständnisvolle Sprache, sie mögen sich und heiraten - Punkt aus. Marika berichtet immer häufiger von ihrer Beziehung zum Prediger fast wie in einem öffentlichen Bekenntnis. Voller Stolz und völlig ohne Argwohn teilt sie allen Menschen ihre Hoffnung mit, dass die Ambitionen ihres Ehegatten göttlich seien und die Menschen ihn deshalb gut verstehen könnten. Umgekehrt scheint Leonhard Marikas eigene Liebenswürdigkeit und Umtriebigkeit im religiösen wie auch im geschäftlichen Sinn nutzen zu können. Viele nennen es fortan Gründerleistungen, die das Paar über Jahrzehnte hinweg einbracht habe. Der besondere Sinn zweier außergewöhnlicher Personen für Menschlichkeit und soziale Verantwortung führt zum wachsenden Einfluss in einem gemeinschaftlichen Betriebsamkeitssystems, welches von Vertreterinnen gegnerischer Parteien auch grobschlächtig angefeindet wird, andere sprechen sogar von einem Glaubensstreit, wieder andere über positiven Wettbewerb. Einige sehr strenge Kämpferinnen sind nur erbost über die unerbittliche Konkurrenz.
Aber zurück zu Wolter auf die Insel. Wolters Haus ist inzwischen größer geworden, es scheint wie automatisch mit ihm zu wachsen und immer prächtiger zu werden. Anfangs hatte das Inselgrundstück, auf dem man Wolter kaum entdecken konnte, die Maße von etwa 1100 bis 1200 Quadratmetern mit einem direkten Zugang zum Wasser. Viele Büsche und Aufwüchse haben schon immer den ungeübten Blick versperrt. Aber die Eingeweihten wussten Bescheid, Wolter ist da. Wer ihn sucht, der kann ihn auch finden. Auf diese Weise wird Wolter gewissermaßen nicht nur durch die Menschen auf der Insel entdeckt, sondern er selbst lässt alle anderen immer wieder neu entstehen. Ursprünglich ist Wolters Grundstück mit Haus, Garten und einem Zugang zum Wasser in der Hoffnung auf Wachstum und Weitläufigkeit ausgewählt worden. Zwar gibt es einige vergleichbare fabelhafte Wassergrundstücke auf der Insel, aber nur wenige sind ein so kraftvoller Raum zur Kommunikation. Wichtig dabei erscheint in jedem Fall der direkte Zugang zum Wasser. Der Gitterzaun, der Wolters Grundstück eingrenzt und der sich bis ins seichte Uferwasser hineinzieht, ist von fleißigen Handwerksgesellen aus einem engmaschigen Edelstahldraht geflochten worden. Das ist in jener Zeit gewesen, als viele ihn noch für unschuldig hielten und man in steter Sorge war, er könnte entwischen, wenn man ihn nicht genügend einzäunte. Die Immobilie, die Wolter einstmals überlassen wurde, ist architektonisch betrachtet ein kleines Landhaus auf einem niedlichen kleinen Grundstück mit Sicherheitszaun. Für die einen ist nur die Behausung wichtig - für andere der Zaun. Jedenfalls geht es oft um die Fragen der Behaglichkeit, der Sichtbarkeit und Prüfbarkeit, auch um das Verstecken und die Gefahrenabwehr. So ähnlich könnte man die Angelegenheit sogar allgemeingültig interpretieren. Im Laufe der Zeit wird Wolters Gartenzaun immer großmaschiger gemacht, bis das silberglänzende Edelmetallgitter nur noch ein System großer Öffnungen ist und nach allen Seiten gut durchschaubar. Wolter selbst war schon seit jeher klar, dass ein Zaun grundsätzlich überflüssig ist. Er verspürte niemals Lust, sich auf Wanderschaft zu begeben. Aber genau das ändere sich durch den technischen Fortschritt, sagen auch in jener Zeit viele Leute, denn der Fortschritt fahre inzwischen überall auf den Straßen und Wegen umher, oder er schwirre in der Luft herum. Vor allem ältere Leute meinen, das Fortschrittliche sei viel zu schnell und ungewöhnlich geworden, aber nur weil sie selbst so bequem seien. Zu groß, zu mächtig, zu schwer beladen sei man in den letzten Jahren geworden und zu unbeweglich, so dass man nur noch langsam vorankäme - quasi wie ein am Rücken gepanzertes Wesen. Dieser Prozess laufe wie naturgesetzlich ab, sagt eine junge Medizintheoretikerin in ihrem Vortrag an der Akademie, nun aber, so führt wiederum eine andere Medizinalpraktikerin auf der gleichen Veranstaltung aus, gebe es die Medizintechnik mit sehr guten Holzprothesen, mit Gehhilfen und Armschienen, mit neuen Medikamenten und alten Gurgelmitteln im großen Park der gesundheitlichen Möglichkeiten oder mit Schminkmitteln, um die Menschen zu heilen, sie mobiler zu machen oder sie flotter wirken zu lassen. Aber das alles belaste auch Menschen, sagen die Kritikerinnen, gleichzeitig müssen diese jedoch eingestehen, dass manch ein massenhaft verabreichtes neues Medikament sogar wirksam sein kann. Wolter lässt sich gern durch solche Werbekampagnen beeinflussen und schon so etwas verändert ihn. Er begegnet dann den Kränkelnden und Gebeutelten, den älteren Beladenen und den übergriffigen Jüngeren auf der Insel auf eine andere Art und Weise. Insbesondere mag er jedoch am liebsten die allerkleinsten Tagträumerinnen, andere mag er gewissermaßen als Kontrast sehr viel weniger - wie die Geschwätzigen oder Verstummten, wie die Dreisten, Kleinkarierten oder die Großspurigen. „Stets mischt sich alles wie wild durcheinander“, murmelt er gelegentlich und unverständlich vor sich hin. Er müsse unbedingt noch viel dazulernen, lautet dann sein Resümee. „Verschiedene Menschen müssen unbedingt in unterschiedlichen Formen angesprochen werden.“
Eines Tages ist es dann endlich soweit. Wolter und Marika begegnen sich wieder. Es passiert in der Weihnachtszeit. Und dann dazu noch das: Leonhard ist auch dabei. In Wolters Haus, in dem sich alle treffen, um das Fest zu feiern, ist es schön warm geheizt und kuschelig, die Weihnachtskugeln klingeln aneinander, und der Nadelbaum verliert schon wieder viel zu früh sein dunkelgrünes Kleid. Marika sitzt auf dem großen Sofa und spricht ununterbrochen. Sie rekapituliert dabei ihre aufregendsten Erlebnisse. Sie formuliert so komprimiert und intensiv, dass Wolter gar nicht auf die Idee kommt, sich zu entfernen, sogar als ihn seine schwache Blase drückt. Marikas Leonhard interpretiert das, was sie erzählt, anschließend noch zusätzlich viel weitläufiger, noch viel abstrakter und auch philosophischer. Marika redet plötzlich auch sehr viel über geschäftliche Dinge und mischt dabei neuartige Wörter wie Weltanschauung, Produkte, Waren, Input und Output wie wild durcheinander. Wolter glaubt bisweilen, sie wolle ihm ihr ganzes Leben, ihre Ehe und ihre Bekenntnisse irgendwie vorrechnen. Wolters Zuneigung zu Marika bleibt trotz solch kleiner Ungereimtheiten enorm groß. Seine Ehrfurcht vor dem Prediger Leonhard und seiner Partnerschaft mit Marika scheint sogar von Stunde zu Stunde zu wachsen. Die beiden Eheleute fühlen sich für ihn wie zwei große rotgoldbraune Blätter im Inselherbst an, die von Baum oder Strauch auf den Boden gefallen sind, um für ihn einen weichen Teppich zu bilden.
Weihnachten ist leider schnell vorüber gegangen, und Wolters Alltag hat ihn wieder normalisiert. Fortan scheint sich aber seltsamerweise sein Aktionsradius auch noch ein Jahr später vergrößert zu haben, sozusagen von Weihnachtsfest zu Weihnachtsfest. In seiner Phantasie und durch gute Ideen wächst die Kraft seiner Gedanken schier ins Unermessliche an. Die Fernbeziehung zwischen Marika und Wolter hält sich auf diese Weise in einer gewissen Balance. Man balanciert sich wechselseitig aus, so versteht man sich, auch ohne dass man sich treffen muss. Das Vertrauensverhältnis kann stabil und robust bleiben.
Wolter wählt sich im Frühjahr des übernächsten Jahres ein neues Haus als sein neues Heim aus. Ein prachtvolles Steinhaus wird es diesmal sein, ein Haus mit abgerundeten Ecken als sein Zuhause, in das er sich nun noch besser zurückziehen oder in dem er sich verstecken kann. Und dennoch könnte ihm sein neues Domizil auch schnell wieder zu klein werden, denn er weiß nur zu gut, dass man sein eigenes Wachstums- und Entwicklungspotenzial nicht unterschätzen darf. Wolters neues Haus wird schließlich von einem eleganten Schieferwalmdach geschmückt. Direkt hinter der großen Eingangstür gibt es nun ein glänzendes Foyer fast wie in einem schicken Hotel. Das alles ist nicht umsonst in der Zeitepoche von Otto von Bismarck geschehen, dem Träger des damals wohl berühmtesten aller deutschen Namen, welchen sich sogar Wolter gut merken kann. Von Bismarck, das klingt für ihn nicht nur wie der aalglatte Hering oder eine gutgemeinte Eselsbrücke, sondern der korpulente Mann kommt, wie unter Fischersleuten üblich, auch oft gesprächsweise beim Flicken von desolaten Fangnetzen vor. Wolter schätzt diesen Politikriesen sehr, er bewundert ihn sogar, weil zu dieser Zeit nicht nur er selbst sehr viel über die Notwendigkeit sozialpolitischer Orientierungen nachdenkt und Bismarck als besonderer Menschenfischer der Angelpunkt sein könnte. Letztlich geht es um die Idee des sozialen Fortschritts in einer Zeit der Kriege. Es geht um soziale Verantwortungsgefühle als gesellschaftliche Emotion, die man in dieser Zeit so sehr vermisst. Wenn zum Beispiel über die notwendigsten Versorgungsansprüche von Arbeitern und Arbeiterinnen in einem kapitalistischen Betrieb gesprochen wird, so scheint es Wolter zutiefst realistisch und notwendig zu sein, sehr sorgfältig nachzurechnen und gleichzeitig mitzufühlen. Aber erst als Wolter dem einzelnen arbeitenden Menschen ein Geschlecht zuordnet, kann er den aktuellen Zeitgeist noch besser deuten und seine persönlichen Empfindungen genauer darstellen. Die gesellschaftliche Vorstellungskraft in jenen Jahren scheint - vor allem auch durch die mediale Aufbereitung von Krieg und Tod - geradezu zu explodieren. Die Fragen zu Hinterlassenschaft und Erbschaft spielen ebenfalls eine zunehmend wichtigere Rolle. Man weiß inzwischen sogar, dass auch der einfache Soldat etwas vererbt, wenn er als Kriegsfolge, heldenhaft oder nicht, verstirbt und seine Frau zur Witwe macht. Wochenlang, monatelang, manchmal jahrelang weinen in jenen schlimmen Kriegszeiten viele Frauen, todähnlich traurig, ihrer Allerliebsten beraubt - und sei es auch nur in der Vorahnung. Es dauert bisweilen Jahrzehnte, bis der gewaltsame Tod eines geliebten Menschen in Vergessenheit gerät, bis man sich wirklich endgültig verabschieden kann. Wolter fühlt sich ganz im Gegensatz dazu im Augenblick sehr lebendig und schier lebenshungrig - wie eingebunden in den Einflussbereich von Marika und Leonard. Er muss nur kurz an Marika denken, und schon ein oder zwei Minuten später kann er die eigene Vergangenheit denkerisch hervorzaubern. Die Gegenwart selbst bleibt für ihn allerdings ein Grusel. Er fühlt sich durch die gesellschaftlichen und politischen Ereignisse des späten 19. Jahrhunderts stark belastet und wie persönlich geknechtet. Er will auf keinen Fall ein heldenhafter Sieger im Todeskampf sein. Er denkt lieber grundsätzlich über das Wesen von Partnerschaften nach. Uneingeschränkt geschäftstüchtig oder gar politikfähig wie Marika wird er wohl niemals werden, dazu ist er nach eigener Aussage viel zu behäbig und nicht fit genug.
Die Zentrale des Betriebs der beiden geliebten Eheleute Marika und Leonhard liegt im Weichbild der deutschen Hauptstadt Berlin - also gar nicht so weit weg von der Insel gelegen. Schon immer scheinen sich jedoch die weichen schwabbeligen Arme aus der Hauptstadt dem Brandenburger Umland entgegen zu strecken, bis dann zuweilen auch einige Leute im Umland entschlossen sind, das Lebenswerk einer einflussreichen Berlinerin fortzuführen. Wolter wird es hautnah miterleben können.
Ein Zeitpunkt besonderer Veränderung kommt näher und näher, ein neues Wunder geschieht. Wolter kann plötzlich sehr laut schreien und sich dadurch vielen Menschen gleichzeitig bemerkbar machen. Und er versteht es, wie von Geisterhand geführt, gute Texte zu schreiben. Wenn er gut zuhört oder sich selbst etwas vorliest, ist er sofort in der Lage, das Allerbeste sogar in einem Drohbrief zu erwidern. Allem kann er freundlich zustimmen oder falschen Behauptungen eloquent entgegentreten. Vor allem kann er an den richtigen Stellen heftige Kritik üben. Warum er plötzlich die eigene Expressivität so fabelhaft beherrscht, zum Beispiel das laute Sprechen oder das kritische Schreiben, kann er selbst nicht erklären. Die persönliche Lebenszeitspanne, um die Muttersprache oder das Vaterlandsgeschrei und gleichzeitig das exakte Formulieren zu erlernen, ist lebensweltlich-biografisch betrachtet vergleichsweise kurz. Eltern, Lehrerinnen oder Dozentinnen an den Schulen und Universitäten, denen man davon erzählt, halten allerdings weniger von der These. Es gibt auch einige Menschen auf Wolters Insel, die seine Denk-, Sprach- und Sprechfähigkeit eher für einen Spleen halten, und so kann es bisweilen passieren, dass er versagt, nämlich wenn er zu aufgeregt seine Fähigkeiten vorführen und unter Beweis stellen möchte - insbesondere mündlich. Im Grunde ist er ein schüchterner Mensch. Möglicherweise will er nur für Marika existieren und für sie allein ein gut Sprechender und Schreibender sein. Gelegentlich schlüpft er in die Rolle einer bedeutenden Herrscherin, die vielleicht schon längst verstorben ist, um sie verstehen zu lernen und dann im Nachhinein zu bekämpfen. Vielleicht ist sein Ziel, Marika eines Tages ersetzen zu können, um ihr Werk und das ihres Partners fortzusetzen. Möglicherweise will er auch einfach nur freundlich und verständnisvoll sein. Jedenfalls kann er mit seiner Sprachfähigkeit unendlich tief in sein Körperinneres hinein oder auch nach außen in die Welt hinaus blicken. Menschen der dritten Art wie er können sich anscheinend viel besser als andere lösen, weil sie gut in der Lage sind, von sich selbst zu abstrahieren, um in die Haut anderer schlüpfen zu können. Deshalb sind Woltermenschen auch in der Lage, auf viele unterschiedliche Interessenlagen angemessen klug zu reagieren. Aber leider ist es so, dass nur wenige solcherart Spezialkenntnisse von ihm abfordern. Stets muss er eine diesbezügliche Nachfrage selbst erschaffen. Im Grunde will er aber nur ein nützlicher Ratgeber und Meinungsbildner sein - in jedem Fall aber ein wichtiger Teil Marikas. Er möchte am besten lebenslang ein guter Zuhörer bleiben, der wirklich versteht, sowie auch ein positiv Handelnder und ein intelligenter Deuter. So wird er schließlich einer der seltenen Verhandlungspartner, der echte Partnerschaften zwischen einer Auftraggeberin und einer Auftragnehmerin zum wechselseitigen Vorteil entstehen lassen kann.
Marika hat inzwischen leider die allergrößten Sorgen, denn sie möchte keine der typisch tatenlosen Witwen des 19. Jahrhunderts sein, die sich nach dem Tod ihres Mannes, wenn er in den Himmel aufgestiegen ist, in die Vereinsamung fügen. Sie ist fest entschlossen, sich ihrem Leben und ihren sozialen Beziehungen verantwortungsvoll zu stellen. So beschreibt Wolter eines Abends bei Kerzenschein Marikas prekäres Lebensstadium in einem recht traurigen Brief. Hauptsächlich geht es aber darum, dass Leonhard nicht mehr existiert. Viele Jahre später wird sein Brief sogar in der Regionalzeitung abgedruckt. Marika gelingt die Kunst des eigenen Überlebens tatsächlich perfekt - indem sie aktiv wird und bestrebt ist, ihrem geliebten Partner ein Denkmal zu bauen. Gleichzeitig verabschiedet sie sich aus der Frauenrolle ihrer Zeit und lässt das Leben als Teil einer Beziehung hinter sich. Sie avanciert zur erfolgreichen Geschäftsfrau mit großen Visionen. Vielleicht hat Wolter ihr dabei helfen können, wahrscheinlich ist das sogar so, obwohl er sich selbst immer als relativ unflexibel und bescheiden versteht. Einige seiner eigenen Wünsche scheint er in Marikas Zukunft hinein zu projizieren.
Zwischenzeitlich ist überall im Land der Deutschen das Geldwesen explodiert. Alle Menschen werden gezwungen, sich am Wirtschaften und an Geschäften zu beteiligen. Verschiedene Währungen werden vergleichbar gemacht und auf einen gemeinsamen zentralen Nenner gebracht. Geld, Einkommen und Arbeitsteilung scheinen plötzlich auf immer mehr Anstrengung und Vertrauen zu basieren. Der Deutschen Mark liegt der Goldstandard zugrunde. Münzen werden nur noch zentral geprägt und Werte nicht mehr durch Landesherrlichkeit verordnet. Neue Begehrlichkeiten beharrlicher Steuerbehörden entstehen, die Marika oft nur aufgrund weitreichender Verbindungen in höchste Regierungskreise hinein gütlich geregelt bekommt. Wolter ist inzwischen für Marika - ähnlich wie das Geldwesen - auch geschäftlich sehr nützlich geworden, vor allem, um die vielen unübersichtlichen finanziellen Einzelprobleme zu entwirren, die wie bunte Wollfäden kreuz und quer verheddert im Nähkörbchen entknotet werden müssen. Ein so fest geknotetes Wollknäuel ist zum Beispiel der Versuch der Löschung eines eingetragenen Unternehmens durch eine deutsche Universalerbin. Es geht um die erteilte Prokura beim königlichen Amtsgericht. Wolter kann als Marikas fleißiger Notizenschreiber hilfreich sein, weil er juristische Zahlenprozesse mit vielen Kurven und Schwankungen auf wundersame Weise abarbeiten kann. Zahlen und Prozesse in Zeitintervallen stellt er sich nämlich bildhaft vor. Er verwendet seine eigene Bildersprache, die aus der Lebenswelt von Tieren und Pflanzen stammen könnte: Ort? Zeit? Wann? Wie viel davon? Vitalität! Resultat! Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, in die sich Marika verstrickt hat, scheinen nach Leonhards Tod immer komplizierter zu werden. Sie muss deshalb das Geschäftsgeschrei erlernen. Sie muss Geschäftspartnerinnen auszahlen und Wohngebäude räumen lassen, sie hat Menschen davon zu überzeugen, loszulassen. Am Ende zieht sie selbst aus der großen Stadt auf die Insel. „Nicht wegen der steuerlichen Vereinfachung, sondern aus meiner tiefen inneren Verbundenheit“, begründet sie ihren bedeutsamen Schritt. Wolter und Marika sind sich also wieder näher gekommen. Sie können sich inzwischen auch heftig streiten, aber man kann vermuten, dass am Ende doch immer die Versöhnungsbereitschaft überwiegt. „Das Wesen eines Streits ist die anschließende Versöhnung“, sagt Wolter, und er schließt dabei die staatskonforme Propagandasprache explizit aus. Nach der großen Wirtschaftskrise und der anziehenden Konjunktur in Deutschland erwirtschaftet die Berliner Firma Marikas einen stolzen Jahresgewinn. Ihr Gesamtguthaben in Geld beträgt zwei Millionen Mark und steigt nach einer kurzen Baisse auf vier Millionen an. In ihrer Vermögensverwaltung beschränkt man sich keineswegs auf Pfandbriefe und Grundstücksgeschäfte, sondern bisweilen wagt man riskante Börsengeschäfte. Insbesondere osteuropäische Aktien haben es Marika angetan. Von den Anteilen an einem englischen Versicherungsriesen bis zur Teilhabe am sibirischen Bergwerk verfügt sie über ein Portfolio im Wert von über einer Million Mark. Wolter hat ihr zwar vom Kauf der Anteile an den vergifteten Kohlebergwerken abgeraten. Sie jedoch besitzt immer ihren eigenen Trotzkopf, den sie auch durchzusetzen vermag. In eine der prosperierenden Geschäftsphasen fällt dann im August der überraschende Tod von Marikas älterem Bruder Georg. Wolter kennt ihn nur vom Hörensagen. In der Folge geht es auch um die Liquidation des erfolgreichen Berliner Unternehmens. Liquidation, darüber können sich Marika und Wolter schnell einigen, komme überhaupt nicht in Frage. Eine solch negative Festlegung stößt bei beiden auf ihren inneren weltanschaulichen Widerstand - aber leider nicht ebenso bei allen Teilhaberinnen der Firma. Es folgen tiefgehende Auseinandersetzungen in der kleinen Gemeinde der engeren Verwandtschaft. Es kommt Wolter so vor, als würde es bei den Erbstreitigkeiten um Himmel und Hölle gehen oder um den weiten Horizont des Himmels der Erwartungen und die Hölle der Niedertracht. Marika schafft es immer wieder, manchmal nur unter Preisgabe aller familiären Rücksichten, ihre Position durchzusetzen. Sie ist die Haupterbin der Firma und zum Erhalt unter ihrer Führung entschlossen. Dann, zur Mitte des Dezembers, kurz vor dem Weihnachtsfest, einigt man sich innerhalb der Erbengemeinschaft auf die Fortführung des Unternehmens und auf einen neuen Gesellschaftsvertrag, welcher die Geschäftsführung durch Marika und die älteste Tochter ihres Brudersvorsieht. Die Einlagen werden jeweils zur Hälfte eingebracht. Entsprechend sind die Einnahmen zu halbieren. Gewisse Schwierigkeiten ergeben sich aus dem Umstand, dass alle Entscheidungen künftig im Vorfeld mit der gesamten Erbengemeinschaft abgestimmt werden müssen. Wenn Marikas Verwandtschaft wüsste, dass Wolter an vielen Entscheidungen meinungsbildend beteiligt ist, würden sie wahrscheinlich ihre Mitwirkung vollständig einstellen. Die potenziellen Erben mögen Wolter nicht, weil er vergleichsweise neutral die Dinge zu analysieren pflegt, ihnen aber geht es nur um das Geld. Marika ist die Seele der Firma, die anderen sind nicht einmal mehr ihre Seelenverwandten. Stets jedoch bemüht sie sich intensiv um eine einvernehmliche Geschäftsführung. In ihrer Tüchtigkeit kümmert sie sich einfach um alle Fragen von Bedeutung: von Personalfragen bis Gehaltsabrechnungen, von baulichen Angelegenheiten bis zu komplizierten strategischen Richtungsentscheidungen. Langsam, aber kontinuierlich entwickelt sie einen siebten Sinn für alle wirtschaftlichkeitsrelevanten Angelegenheiten. Chancen und Risiken kann sie frühzeitig erkennen und Spezialkenntnisse zur Durchsetzung ihrer Ziele zu nutzen. Durch billige Importschwemmen aus den Vereinigten Staaten von Amerika und einer Trendwende auf dem einheimischen Markt entwickelt sich in der Folgezeit eine schwere Absatzkrise in Deutschland. Der internationale Handel kann den Absatzschwund in Marikas Firma zwar einigermaßen auffangen, viele gutbürgerliche Unternehmen überleben diesen krisenhaften Einbruch jedoch nicht. Die Jahresbilanz von Marikas Firma hat zum ersten Mal erhebliche Defizite zu verbuchen. Dies ist die Zeit, in der sogar Wolter darunter leidet. Jedoch lernt er in dieser krisenhaften Zeit auch etwas hinzu. Er kann nun in Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten rechnen und damit kalkulieren. Er scheint es nicht mehr nötig zu haben, alles persönlich erleben zu müssen, um die wichtige Entwicklungen und Ereignisse vernünftig interpretieren zu können. Weil er inzwischen weiß, dass er selbst einmal recht alt werden könnte, bekommen seine Gedanken eine immer längere Vor- und Nachlaufzeit. Wolter beginnt prinzipieller und nachhaltiger zudenken, sich gelegentlich sogar zwischen den historischen Dimensionen zu bewegen. Mit jedem neuen Jahr werden Marikas Bilanzen schlechter und bringen immer mehr Unruhe in ihre Verwandtschaft. Persönliche Vorwürfe aufgrund angeblich hausgemachter Defizite führen schließlich zur Kündigung des Gesellschaftsvertrags. In gewisser Weise scheinen dabei schon alle beteiligten Verwandten mit Marikas Ableben zu spekulieren, weil sie auf die große Erbschaft hoffen. Einige der zutiefst Unzufriedenen wollen „den Insel-Wolter“, gleichso wie die ganze Firma, mit abwickeln. Wolter empfindet die Gedanken an Marikas Tod als unerhörten Affront, als ungehörig und verachtenswert. Aber sogar er spielt hin und wieder mit diesem schrecklichen Gedanken. Was, wenn sie nicht mehr da wäre? Inzwischen ist es aber in der Wirtschaftsentwicklung des Landes wieder bergauf gegangen. Doch dann das! Unmittelbar nach der Jahrhundertwende brechen plötzlich neue heftige Konjunkturschwankungen wie Donner und Blitz über den deutschen Wirtschaftsraum herein. Der Hypothekenmarkt wackelt bedenklich, die Preise für Rohstoffe steigen und steigen. Wolter muss sich eingestehen, dass er im Grunde nicht viel von solchen Konjunkturen versteht. Er ist beileibe kein Ökonom, vielleicht ein wirtschaftsinteressierter Historiker mit einigen wenigen betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, gesteht er sich ein. Dagegen sehr gut weiß er, dass Ebbe und Flut durch die Bewegung des Mondes und das Kreisen der Erde ausgelöst werden. So ähnlich könnte auch der Prozess an den Märkten und Börsen ablaufen, vermutet er.
Eines trüben Regentags steht Marikas gesamte Erbenverwandtschaft direkt vor Wolters Haus. Alle gemeinsam haben sie einen Spaziergang über die Insel gemacht. Er kann sie durch ein halb geöffnetes Fenster mit flatternder Gardine davor heimlich belauschen. Er versteht alles und ist entsetzt. „Niemand mehr nimmt ein Blatt vor den Mund. Es ist niemand unter diesen Sozien, der die geringste Pietät für das eigentliche Geschäft besitzt, dem man doch das eigene behagliche Dasein verdankt“, berichtet er Marika danach. Wolter lernt allerdings wieder etwas daraus. Er weiß nun, dass er noch viel besser mit moralischen Fragen in Verbindung mit den großen Zahlen oder Zahlungen umzugehen hat. Aber seine Art zu zählen ist anders als die übliche Zählweise. Er macht philosophische Unterschiede beim Zählen von Rundem und Länglichem, von Sachen, Dingen und organischer Materie, von Moral und Unmoral, von Tieren, Pflanzen, Menschen und Erbberechtigten - jeweils untereinander elegant kombiniert. Sogar das Wort für einzelne Zahlen differenziert er aus – eins, acht , neun, null. Letztlich zählt er das unvermeidliche Geld aber wie alle anderen auch, wie beim Schreiben der Preis-Etiketten oder der Rechnungen, wie beim Mogeln mit Würfeln oder beim Zinken von Karten, wie eben bei allen modernen Identitätsfragen inzwischen so üblich. Wenn Wolter ehrlich zu sich selbst ist, dann ist ihm das Ende von Marikas Firma eigentlich vollkommen egal. Er selbst hat nie Marikas Firmengeld benötigt, sondern er besitzt sein eigenes persönliches Vermögen. Als es schließlich am Ende doch um das Verteilen des großen Erbes geht, steht für Marikas Verwandtschaft fest: Ihr Geschäft habe sich in den zurückliegenden fünf Jahren nicht mehr auf der Höhe der Leistungsfähigkeit befunden, die wirtschaftliche Konkurrenz sei Marika enteilt. Wolter schwächelt in dieser Zeit der größeren Auflösung und des Neubeginns ein wenig, aber mit klaren Worten kann er seinen Zustand beschreiben. Im Grunde wolle er Vererbung und Enterbung auch gar nicht verstehen, sagt er. Sie bereiten ihm Übelkeit. Die fortwährenden Probleme um die Firma haben der inzwischen betagten Marika arg zugesetzt und ihre altersgemäßen Beeinträchtigungen verschärft, bis sie plötzlich akut bettlägerig wird. Eine Lungenentzündung verschlimmert sich, ihr Zustand wird lebensbedrohlich. Sie kommt in dieser Zeit nicht mehr zu Wolter. Auch möchte sie selbst keinen Besuch empfangen. Marika scheint sich von ihrer Firma verabschieden zu wollen, indem sie sich selbst auflöst. Sie ist alt, krank und einsam geworden. Noch sieben Tage vor ihrem Tod berechnet sie in einem allerletzten Kraftakt die Zahlen im Betrieb in den für sie so typischen Kolonnen, die sie auf die Rückseiten alter Rechnungen schreibt. Nur noch ein einziges Mal kommt sie zu Wolter aufs Grundstück, um sich zu verabschieden. Eine treue Begleiterin schiebt sie in einem rollenden Stuhl bis an den See heran. Das eigene Laufen gelingt nicht mehr, so als trüge sie einen schweren Panzer mit sich herum, der auf den Rückenwirbel drückt. Sie rollt sitzend auf einem hergerichteten Stuhl zu Wolter an den See. Nichts scheint mehr von allein zu gelingen, sogar das Sprechen fällt ihr schwer. Wolter hat dicke Tränen in die Augen bekommen. Marika selbst ist viel zu schwach um zu weinen. Es gelingen ihr auch keine verständlichen Sätze mehr, aber in ihrem Gesicht scheinen Dankbarkeit und Freude zu leuchten. Später erinnert sich Wolter oft an diesen Abschiedszustand von Marika. Dabei zitiert er für sich selbst jeweils nur zwei Zeilen aus dem Gedicht „Memento“ von Mascha Kaléko: „Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur; doch mit dem Tod der andern muss man leben.“ Immer kommen ihm Tränen in die Augen, immer, wenn er an den Tag des Abschieds zurückdenkt.
Die Jahresbilanz des Unternehmens weist in Marikas Todesjahr nur einen relativ kleinen Verlust aus, dennoch gibt man am Ende des Jahres die Fabrik zur Liquidation frei. Alle Vorahnungen scheinen sich nun zu bewahrheiten. In ihrem Testament, welches vor der gesamten Verwandtschaft von einem Notar verlesen wird, betont Marika, dass für alle Arbeiterinnen und Angestellten in der Firma „für Auskömmlichkeit bestens gesorgt“ sei. Ein Vertrag mit einer Versicherungsanstalt ermögliche Pensionsfortzahlungen, schreibt sie. Einige ihrer engsten Wegbegleiterinnen werden mit großzügigen Legaten bedacht. Und dann? Dann vor allem das! Marika hat über ihren Tod hinaus vorgesorgt und eine Stiftung gegründet. Kann es ohne sie weitergehen? Die enterbte Verwandtschaft ist entsetzt Wolter sorgt sich derweil um den Fortgang der Dinge auf der Insel. Der Blick in Marikas und seine eigene Vergangenheit ist für Wolter eine Rückbesinnung und die Rückschau in viele kleine, oft halsbrecherische Kopfgeschichten. Schauen wir, um das zu verstehen, einige Jahrzehnte zurück.
Die politische Herrscherin der Deutschen hat gerade eine neue kaiserliche Medienanstalt gegründet und pflegt ihre persönliche Aversion gegen alle vermeintlichen Gefahren von außen. Insbesondere die Fremdlinge aus anderen Ländern würden diese Gefahren unentwegt neu heraufbeschwören. Auch furchtbare Äußerungen über Tiere und Pflanzen sind von der Herrscherin überliefert. In jeder Hinsicht gilt für sie Andersartigkeit als verdächtig. Es geht ihr um die Abwehr fremder und ungewohnter Ideen und Ideale. Herrschaftliche Willensstärke und Zielstrebigkeit lassen eine einmal gefasste Meinung gewissermaßen für alle Zeiten bestehen. Auch mit berühmten Wissenschaftlerinnen, insbesondere Medizinerinnen vermeidet sie in diesen Jahren keine persönliche Auseinandersetzung. „Ohne sichtbaren Kampf und Streit ist niemals eine große Vision zu realisieren“, lässt die Kaiserin nach außen verlautbaren. Gleichzeitig gehen aufgrund von Mechanisierung und Industrialisierung der Wohlstand für wenige und die Verarmung großer Teile der Bevölkerung parallel einher. Durch den Niedergang der traditionellen Hausproduktion im Textilgewerbe entsteht viel Elend im Land. Die Verarmung der Kinder spürt Wolter am eigenen Leibe - sogar auf der Insel. Wolters diesbezügliche Erinnerungen fügen sich wie kleine dramatische Ereignisabschnitte wie in einem Mosaik ineinander. Die kleinen Bauklötzchen stapelt er dann gedanklich zu größeren Türmchen oder er verknüpft sie wie magische Fäden zu einem teppichartigen Gewebe. Geschichtsabschnitte sind für ihn bildhaft zusammengesetzte kleine Nacherzählungen vom großen Ganzen.