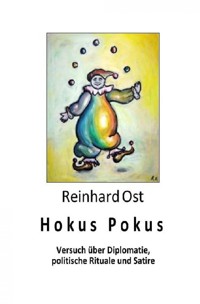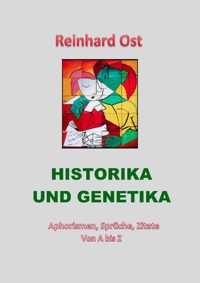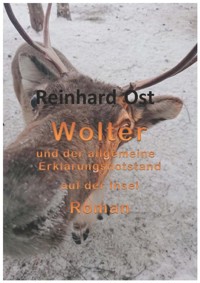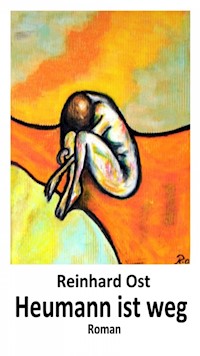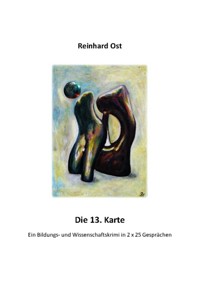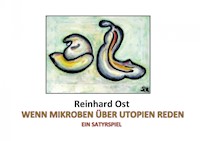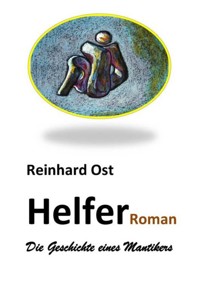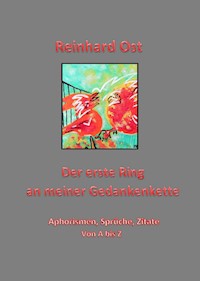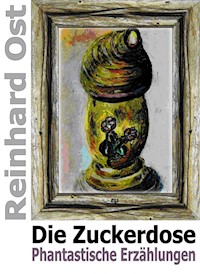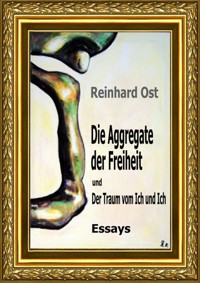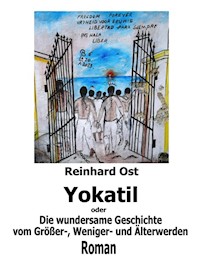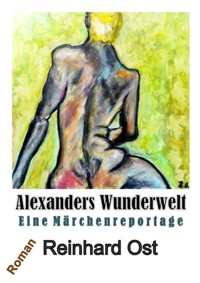
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Reinhard Ost legt mit seinem Roman "Alexanders Wunderwelt" eine besondere Form der Märchenreportage vor. Im Fortgang der Lebensgeschichte von Alexander Kappel werden 61 alte und neue Märchen erzählt. Was Märchen sind, was sie sein sollen, was sie bedeuten, wie sie uns bezaubern und wie sie uns nützen können, sind Teil von Alexanders eigener Wunderwelt und sein Lebens- und Sprachstil geworden. Er ist Ganymed, Rübezahl, Hänsel, Gretel oder auch Cornelia Funke, je nachdem, wie er sich gerade fühlt und mit wem er sich gerade einlässt. Immer ist er derjenige, den er sich ausmalt, den er als Schriftsteller bearbeitet, den er verwandelt. Warum haben Kinder so viel mehr Phantasie als Erwachsene? Haben Kinder mehr Phantasie als Erwachsene? Wolf, der kleine Sohn seiner Lebenspartnerin Erika, ist ihm behilflich dabei, die richtigen Fragen zu stellen und gelegentlich auch zu beantworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexanders Wunderwelt
Eine Märchenreportage
Impressum
Copyright:@ 2015 Reinhard Ost
Published by: epubli GmbH, Berlin www.epubli.com
ISBN 978-3-7375-6719-0
Geburt und Kindheit
Das hat man nun davon, wenn man sich mit Literatur, Musik oder Malerei einlässt. Man ist nicht mehr Herr seiner selbst. Wahrnehmungen, Gedanken, Ideen und Phantasien machen sich selbstständig und fortwährend an dem fest, was es bereits schon in ästhetisch ansprechender Form gibt. Das Leben scheint wie verdoppelt und bildhaft vorgezeichnet zu sein.
Der Schriftsteller Alexander Kappel macht sich auf den morgendlichen Weg zu seinem Schreibtisch. Es ist die Strecke von der Küche über den langen Flur bis ins Arbeitszimmer, wo seine vielen Bücherregale stehen. Das Arbeitszimmer istverqualmt, wie immer eigentlich. Fenster zu öffnen und zu lüften nutzt nicht mehr viel, weil der süßliche Geruchsgeschmack schon in alle Bücher und Manuskripte eingezogen ist. Selbst die leichte Gardine flattert nicht mehr im Wind. Er kann einfach nicht auf das Rauchen verzichten. Das würde seine Konzentrationsfähigkeit vermindern, sagt er. Hoffnung allerdings besteht. Immerhin hat der Maler Emil Nolde am Ende seines Lebens gesagt, er habe es über 2000 Mal geschafft, „endlich“ mit dem Rauchen aufzuhören.
Alexander ist immer wie derjenige, den er sich gerade ausmalt, den er bearbeitet, den er verwandelt. Er ist sozusagen alle in einer Person. Im Augenblick ist er Emil Nolde aus Schleswig-Holstein, der im Jahr 1867 geboren und im Jahr 1956 verstorben ist, einer der führenden Maler und Aquarellisten des deutschen Expressionismus. Wie man allerdings einen Roman als Aquarell schreiben könnte, weiß er noch nicht genau. So etwas Kompliziertes ergibt sich für ihn immer erst ganz von allein, wenn er es ausprobiert und herumexperimentiert. Gestern war er der Philosoph Arthur Schopenhauer, vorgestern Cornelia Funke, und heute ist er eben Emil Nolde. So geht das fortwährend, Tag für Tag, rückwärtsgewandt, in die Vergangenheit zurück, weil er natürlich auch diejenigen Künstler ausprobiert, die schon lange verstorben sind. Alles was geschrieben und komponiert wird, ist für ihn Vor- und Nachzeichnung.Sein Ich ist vielfältig und buntfarbig, eben nicht nur an eine einzelne Person gebunden oder gar nur an ihn selbst. Oft fragt er sich, ob er möglicherweise zu häufig den Sender Arte im Deutschen Fernsehen einschaltet, die Folgen von „1000 Meisterwerke” zum Beispiel. Und immer sucht er dann die Meisterschaft auch bei sich selbst. Er scheitert natürlich unaufhörlich. Das produktive Scheitern ist gewissermaßen schon sein Lebensmotto geworden. Darin fühlt er sich inzwischen wohl, wie in einer warmen Badewanne, in der das Wasser über den Rand läuft, weil unterhalb der Wannenkante kein vernünftiges Überlaufventil existiert.
Er wohnt schon eine ganze Weile mit Erika Schmitz zusammen. Erika hat ihren kleinen Sohn Wolf mit in die Beziehungsgemeinschaft gebracht. Und dieser Wolf ist inzwischen sein „Ein und Alles“ geworden. Mit ihm versteht er sich fabelhaft. Vor allem versteht Wolf umgekehrt auch ihn sehr gut. Wolfs Aufmerksamkeit und seine Phantasie sind einzigartig. Sieben Jahre alt ist er. Alles, was Alexander ihm erzählt, kann der Junge in eine neue Wundergeschichte verwandeln und allem eine besondere Wendung geben. Das hilft ihm bei seiner Schriftstellerarbeit in hohem Maße. Manchmal schreibt er sich Wolfs Erzählungen wortwörtlich auf und versucht sie hinterher literarisch zu verarbeiten, ein Roman als direkte Nacherzählung gewissermaßen. Wolf ist sein Medium, nicht ein andere oder gar x-beliebige Person, sondern im Grunde auch er selbst.
Haben Kinder mehr Phantasie als Erwachsene? Warum haben Kinder so viel mehr Phantasie als Erwachsene? Sie haben doch viel weniger erlebt, fragt er sich. Sie besitzen doch wesentlich weniger Anhaltspunkte, an denen ihre Gedanken- und Gefühlswelt anknüpfen kann. Alexander ist zum Resultat gekommen, dass Kinder sich im Regelfall sehr viel mehr zutrauen als Erwachsene, weil sie noch nicht so stark domestiziert sind und noch jenen Mut besitzen, den ein erwachsener Mensch längst verloren zu haben glaubt.
Er seinerseits möchte eigentlich immer kindlich bleiben, hofft er, denn sonst könnte er niemals ein guter Schriftsteller sein, der etwas Vernünftiges über die Geheimnisse der Kindheit zu schreiben vermag. So banal es klingt, die ständige Entwicklung und Verwandlung sind seine feste Überzeugung. Deswegen kann er sich, tagtäglich immer wieder neu, in einen anderen Menschen hineinversetzen. Jeden Tag möglichst nur einer oder maximal zwei, so plant er, was ihm aber nicht gelingt.
Alexander ist darüber hinaus auch deshalb wie ein Kind geblieben, weil er fest daran glaubt, seine Kindheit, seine Jugendjahre, seine Bildungs- und Ausbildungszeit und vor allem die ersten zwei Jahre im Job gut überstanden zu haben, als er noch Lektor in einem großen Belletristik-Verlag war. Erst als man dort glaubte, man würde keine Lektoren mehr, sondern nur noch Entscheider, benötigen, reifte der Entschluss, seine eigenen „Geschäfte“ machen zu wollen. Das Eigene, so nennt er seinen derzeitigen Zustand, in welchem die Anderen und das Andere in ihn hineingespeist werden. Er kann selbst bestimmen, wie viel er davon benötigt, verdaut und wieder ausscheidet. Das ist sein Ich-Gefühl. Sein Leben ist diesbezüglich eine streng körperliche Angelegenheit, insbesondere sein Verdauungsprozess und auch seine Sexualität. Sein Verdauen ist das Vertrauen in die Naturgegebenheit und Richtigkeit der Aufbewahrung der Dinge in seinem Körper und in seinem Kopf, welche Partnerin oder welcher Partner ihm zum Beispiel gefällt und welches Buch er gerade liest, was man vergessen kann. Was allerdings die Sexualität im Allgemeinen für ein merkwürdiges Phänomen ist, hat er im Grunde noch nie richtig verstanden. Nur dass sie sich körperlich stark bemerkbar machen und sich furchtbar in den Vordergrund schieben kann, das weiß er genau.
Die Dinge, die Wolf ihm erzählt, woher der Junge sie auch immer herhaben mag, von den Gebrüdern Grimm vielleicht, von Hans Christian Andersen, von Wilhelm Busch oder aus Fantasy-Filmen, alle ist auch schon Teil seines Ichs geworden, kleine Bausteine, die er niemals freiwillig wieder herausrücken würde. Erst, wenn er alles verdaut und sozusagen preisgegeben hat, wird er zufrieden sein können. Gestalten aus vielen Märchen und Sagen sind in ihm drin, ein Teil seines Ichs. Speziell mit Rübezahlhat er keine Probleme.Das ist er selbst.Mit dem kann er Nützliches verbinden. Er ist Rübezahl, weil er die Königstochter Erika eines Tages heiraten und sie dann endgültig in sein unterirdisches Reich entführen wird. Mit Hilfe von Rüben kann er sie schon jetzt in jede gewünschte Gestalt verwandeln und zum Beispiel die Sehnsucht nach einem gemütlichen Zuhause stillen. Wie ein Berggeist macht er sich tagtäglich an die Arbeit, damit die Anzahl der Rüben stimmt. Er zählt mindestens zwei Mal. Und jedes Mal kommt ein anderes Ergebnis heraus. Macht nichts. Immer wieder versucht Erika, seine freiwillige „Gefangene“, in seiner eigenen Imagination wie ein Zuckerrübenpferd zu entfliehen. Manchmal verspottet sie ihn sogar, wenn sie ihn mit seinem Märchennamen Rübezahl anredet. Er wird nicht zornig, nein, auch wenn er Märchennamen als Spottnamen überhaupt nicht mag. Als Rübezahl ist er schließlich nur ein geschwänzter Dämon, der aus dem Riesengebirge stammt, wobei die Schneekoppe auch eine botanische Rarität aus der Apotheke sein kann. So ist er der Geist des Widersprüchlichen, der in einem Moment gerecht und hilfsbereit, im nächsten allerdings auch arglistig und launenhaft sein kann. Alexander Rübezahl ist eben launisch, ungestüm, sonderbar, roh, unbescheiden, stolz, eitel, schalkhaft, bieder, störrisch, wankelmütig. Der wärmste Freund und ein eiskalter Bengel kann er sein. Wenn nicht im alltäglichen Leben, so dann doch wenigstens in seinen Romanen. Wolf hat einmal gesagt, dass er ihn als Mönch mit grauer Kutte am allerbesten findet, wenn er unerwartet Blitze und Donner abschießt und danach großzügig die armen Leute beschenkt. Aber, dass er aus Äpfeln oder gar Laub Gold machen könne, wird leider das Wunder in einem Märchenbuch bleiben müssen. Allerdings, umgekehrt betrachtet, geht es schon ganz gut. Alexander kann Geld auf unspektakuläre Weise in eine wertlose Währung verwandeln. Er kann esvor Wolfs Augen demonstrativ in den Papierkorb werfen. Er weiß allerdings, dass Wolf das Geld dann hinter seinem Rücken wieder herausrausholt, wenn er auf die Toilette muss.Eine Stunde später ist durch Wolf das Geld dann wieder rückrückverwandelt.
Für Alexander Kappel gibt es einen ganz bestimmten Autor, den er über alle Maßen bewusst missverstehen will. Warum das so ist, wird er vielleicht noch genauer herausbekommen. Bruno Bettelheim heißt der Wissenschaftler. Er hat ein weithin berühmtes Buch geschrieben, welches „Kinder brauchen Märchen“ heißt. Das Buch ist für ihn das spektakuläre Anti-Antimärchenbuch. Es stört ihn wahnsinnig, wenn der bekannteste MärchenerzählerOberösterreichs, Helmut Wittmann, in den Oberösterreichischen Nachrichten schreibt, dass Bruno Bettelheims Klassiker bis heute nichts von seiner Aktualität verloren habe. Bis 1973 lehrte Bettelheim übrigens als Professor in Chicago, wo denn auch sonst.
Weil Märchen grausam und Instrumente bürgerlicher Repression seien, müsse man sie aus der Kindererziehung verbannen, erklärten noch vor wenigen Jahrzehnten die ganz fortschrittlichen deutschen Pädagogen, zumBeispiel während der Heidelberger Märchentageim Jahr 1972. Die entgegengesetzte Ansicht vertritt nun der amerikanische Psychoanalytiker Bettelheim. Um Therapieerfolge bei seelisch schwer gestörten Kindern zu erzielen, würden Märchen sehr gut weiterhelfen. Das Chaos in ihrem Unbewussten könne bewältigt werden. Realistisch betrachtet, seien die Geschichten zwar manchmal grausamer, als der Reporter des Satans sie ersinnen könnte, aber dennoch therapeutisch wichtig. Zwei Jungen werden zur Strafe für ihre Naschhaftigkeit geschrotet und gebacken. Ein kleines Mädchen wird lebendigen Leibes von einem wilden Tier verschlungen, ein anderes sogar von einem Schwein begattet. Eine böse Frau will unentwegt ihr Stiefkind vergiften. Ein alter Mann beschläft jede Nacht eine neue Jungfrau und lässt sie im Morgengrauen töten. Verbrechen, Sadismus, Neid, Hass, Kannibalismus und Sodomie gehören zum gefährlichen Repertoire in den Wunderwelten der Märchen, in denen viele Helden auf grausame Weise den Sieg erkämpfen. Soll das etwa pädagogisch wertvoll sein?
Bettelheim hat an autistische Kinder und geisteskranke Erwachsene gedacht, als er über Märchen im Allgemeinen, aber im Grunde speziell über die Märchenhasser schrieb, findet Alexander. So fällt dann Bettelheims Urteil für ihn auch sehr drastisch aus. Die Märchenwelt entspräche dem kindlichem Erleben und Denken. Dabei, so argumentiert er, seien die Strukturen von Märchen mit kindlichem Denken, die Märcheninhalte mit Entwicklungsaufgaben und die Märchenthemen mit kindlichen Entwicklungskrisen verbunden. Vergiftete Stiefkinder? Getötete Jungfrauen? Geschrotete Knaben? Eingesperrte Prinzessinnen? Eigenartig findet Alexander auch den zweiten Teil in Bettelheims Märchenbuch, wenn er Märchen aus psychoanalytischer Sicht deutet, wenn Märchen und Wunder bei ihm entwicklungsfördernde Projektionshilfen werden, die Erkenntnisse des Lebens von innen her böten. Am meisten stört Alexander, dass er selbst nun beileibe kein Kind mehr ist, weder autistisch noch geisteskrank, aber gerade ihm helfen die Märchen voranzukommen. Alle Märchen und auch Bettelheims Märcheninterpretationen haben in seinem Kopf einen festen Platz gefunden. Wie er meint, kommen Märchen in seiner eigenen Märchenwelt sogar in Gestalt täglicher Nachrichten für Erwachsene daher. Tagtäglich werden in immer neuen Formen und Variationen Märchenstunden erfunden und Märchen nacherzählt. Schließlich sind es Erwachsene, wie er, die im Regelfall Märchen sammeln, aufschreiben, erzählen und auch darüber berichten.
Was hatte Bruno Bettelheim für ein Bild von der Kindheit? Ist es das Bild von Kindheit in einem psychoanalytischen Gruselgemälde, in dem autistische, „behinderte“, therapier- und resozialisierbare Kinder gemalt werden? Weit gefehlt wahrscheinlich, aber irgendwie doch auch zutreffend, wie Alexander meint.
Für ihn sind Wunder, Kinder und Märchenwelt lediglich die Wirklichkeit selbst, wie man sie sieht und für sich sowie den eigenen Gebrauch entsprechend zubereitet, um mit dem eigenen Leben besser klarzukommen. Der Wissenschaftler Bruno Bettelheim wollte jedenfalls realitätsnah und empirisch forschen. So entstand dann seine eigene verwandelte Wirklichkeit.
Kappel als Mensch und Autor unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen Kinder-, Erwachsenen- und anderen Märchengeschichten. Warum sollte man das auch tun? Erwachsene spielen unentwegt ihre Kindheit aus, und Kinder leben in der Welt ihrer Eltern und Lehrer. Hänsel hält der blinden Hexenlehrerin statt seines Fingers nur ein kahles Stöckchen hin, um ihr zu zeigen, dass er immer noch viel zu mager zum Verspeisen sei.
Für Alexander wollen Kinder niemals Grausamkeiten erleben, sondern nur wie Odysseus durch die weite Welt reisen. Sie wollen Abenteurer sein, um Jason zu treffen, der seine Argonauten, die besten Spezialisten aus allen wichtigen Fachgebieten, um sich schart, um für alle Eventualitäten des Lebens gerüstet zu sein.
Wahrscheinlich haben die meisten Menschen noch nie ernsthaft daran geglaubt, Märchen, Sagen und Legenden wären wirklich frei erfunden. Die phantastische Form entspricht der Phantasie des Erzählers, der Geschichten aus der Wirklichkeit erzählt. Die guten Autoren und Erzähler erfinden noch zusätzlich klug handelnde Tiere und die Zauberwelt von Riesen, Zwergen, Geistern, Einhörnern oder Drachen mit dazu. Diese zauberhaften Wunderweltautoren gab es natürlich schon immer, von der Antike bis in die Gegenwart und weit in die Zukunft hinein vorausgedacht. Nicht erst seit der Zeit, in der wir ordentlich schreiben und drucken gelernt haben, existieren diese wundervollen Geschichten. Schon der Steinzeitmensch konnte Phantasie an die Felswand malen.
Die „Rettung“ der Märchen durch die Brüder Grimm ist für Alexander ein wissenschaftliches Zivilisierungsmärchen, welches vor allem an die Entwicklung der Schriftsprache geknüpft ist, aber auch an die Erfindung der Germanistik und die Sammelleidenschaft der Bibliothekare inder Berliner Universität. Ein jähes Ende, wie das der Gegner des kleinen Hobbit, kann er allerdings all den Versuchen, Märchen wirklich zivilisieren zu wollen, schon voraussagen. Sein Verstehen von Märchen und Märchenwelten ist eine reine Welt der Kunst und der Phantasie, jene Welt, die prinzipiell nur aus einzelnen kleinen Schöpfungen besteht. Es sind die Schöpfungen aller Menschen, die tagtäglich fantastische Wundergeschichten vom Unwirklichen und der Realität, von verschiedenen Weltanschauungen und der Romantikhören, erfinden und erzählen. Das, was Interesse weckt und weiterhilft, ist für Alexander ein bedeutender Teil des Wesens der Märchen. Die koboldhaften Gestalten sind die Märchenschreiber, Erzähler und Leser, die wie Märchenfiguren verzaubern, wobei der Märchenton und auch die Märchenlautstärke den wertvollen Gehalt einer einzelnen Geschichte ausmachen können.
„Peterchens Mondfahrt“ ist das Abenteuer des Maikäfers Sumsemann, der mit Peter und Anneliese zum Mond fliegt, um von dort sein verlorengegangenes sechstes Beinchen wieder zu holen. Der Autor und seine Figuren sind Schöpfung und Schöpfer zugleich. Gerdt von Bassewitz hatte sich als Vorbild die Geschwister Peter und Anneliese genommen, jene gleichnamigen Kinder vom Ärzteehepaar Eva und Oskar Kohnstamm, denen er 1911 im Sanatorium, wo er sich zur Kur aufhielt, begegnete. Wer ist Schöpfer? Wer ist Schöpfung? Entscheidend ist, was Bassewitz aus Peter und Anneliese geformt hat, wie er sie kunstvoll umgestaltet und verwandelt hat.
„Die Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen“, von der die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf erzählt, ist ein gutes Lesebuch für die Schule, um nicht nur den schwedischen Schulkindern die Heimatkunde nahezubringen. Aber nicht nur deshalb gibt es die bösen Streiche des Wichtelmännchens und den zahmen Gänserich, der über die Ostsee herüberkommt und nach Lappland fliegen will. Nils sitzt auf dem Gänserücken in Freiheit und will lieber mit den Wildgänsen durch Schweden ziehen, als dass er als kleiner Mensch auf der Schulbank sitzt. Er erlebt gefährliche Abenteuer, wobei er oft über moralische Fragen zu entscheiden hat und sich bewähren muss, so als säße er in der Schule. Als Nils mit den Wildgänsen aus Lappland zurückkehrt, bevor sie dann über die Ostsee nach Pommern weiterfliegen wollen, schleichen sich Nils und sein Gänserich auf den Hof von Nils’ Eltern. Nils kann auf keinen Fall zulassen, dass seine Eltern den Gänserich töten. Warum sollten die eigenen Eltern sie so etwas Schreckliches tun? Allerdings erst nachdem er seine Schamhaftigkeit besiegt hat, weil er so winzig klein ist, wird er schließlich ein größerer Mensch. Was ist das Wunder, das Märchenhafte? Es ist die schlichte alltägliche Verwandlungsmöglichkeit, die jeder Mensch nun einmal hat und von der man wundersam erzählen kann. Größer werden und sich kleiner fühlen ist die alltäglichste Sache der Welt. Zum allergrößten Glück haben gerade Schulkinder diese fabelhafte Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, Wandlungen und verschiedene Größen auszuprobieren.
Über Märchenparodien kann sich Alexander Kappel furchtbar aufregen. Was hatte der Politikwissenschaftler Iring Fetscher eigentlich davon ein „Märchen-Verwirrbuch“ zu schreiben und sich zu fragen, wer denn das reale „Dornröschen“ wachgeküsst habe? Was bewegte Mary M. Kaye dazu, unbedingt eine ganz gewöhnliche Prinzessin konstruieren zu müssen? Welche Erkenntnis will Peter Rühmkorf übermitteln, wenn er sich als „Hüter des Misthaufens“ sieht? Was hat man überhaupt davon, Märchen als aufgeklärt oder weniger aufgeklärt darzustellen?
Schlimm verbogen ist für Alexander ein computer-animierter, amerikanischer Familienfilm aus dem Jahr 2005 mit dem Namen „Die Rotkäppchen-Verschwörung“. Ein Märchen in einen Krimi umgemünzt. Den hätte ein frecher Regisseur auch schon nach der Veröffentlichung von Bettelheims psychoanalytischem Märchenbuch drehen können. Könnte es sein, dass Parodien grundsätzlich auch am Elend und den vielen Übeln in der Welt beteiligt sind? Niemals würde Alexander Kappel als Autor ein Parodist sein wollen, wie Charlie Chaplin, der verkleidet als deutscher Reichskanzler „Der große Diktator“ Adolf Hitler ist. Eine Hollywoodfigur brüllt vor sich hin und spielt mit der Erdkugel als Luftballon herum. Oder wie jener Schulaufführer, dem die Aufführung seiner anvertrauten Schülerinnen und Schüler immer wieder misslingt, weil die Schüler den Text ironisch empfinden, ihn nicht ernst genug nehmen und das Leben überhaupt so furchtbar komisch sei. In echten Märchen gibt es dagegen kaum diese Beziehungsfalle Ironie, nur wenn man Märchen möglicherweise falsch erzählt.
Die modernen digitalen Formen der vielen Fantasy-Spiele in Film, Funk, Fernsehen und Computer sind besser als nichts, sagt sich Alexander, aber häufig genug bleibt die Phantasie auf jener Strecke, die man zurücklegen müsste, weil man sie nicht nur beiläufig mitnehmen kann. Wenn er intensiv über Parodien nachdenkt, fragt er sich, gibt es sogar einen Parodismus. Zwei Filme scheinen ihm dann doch sehr gut gelungen zu sein. Der eine ist „Spaceballs“ von Mel Brooks, der ein anderes Film-Epos auf den Arm nimmt. Der andere Film heißt „Das Leben des Brian“ von Monty Python, die sich erfolgreich an Jesus und den Bibelgeschichten zu schaffen machen. Sie schaffen jene steile Gradwanderung über die Gebirgskette der ironisierenden Phantasie hinweg, weil sie die richtige, versöhnliche Form finden, wie man eben das Kind auf den Arm nimmt, welches man nicht so tiefgründig, ernst und schwer nehmen sollte.
Wolf mag inzwischen im Fernsehen die langen Serien mit vielen Folgen am allerliebsten. Er wird eben auch älter, glaubt Alexander. Wolf sagt, dass Serien immer eine Fortsetzung böten, weil man eigentlich kein Ende sucht oder findet. Die normalen Märchenfilme seien ihm inzwischen viel zu kurz geraten, wie zum Beispiel „Die Unendliche Geschichte“ von Michael Ende oder auch die Geschichte von „Momo“, in der die Phantasiediebe in allerkürzester Zeit besiegt werden und dann alles wieder in Ordnung zu sein scheint. Nichts ist in Ordnung. Alles geht immer weiter, sogar der Diebstahl der Zeit. Alexander sagt zu Wolf, dass auch der Tod immer nur ein vorläufiges Ende ist, weil alles in vielen Formen und Gestalten weiterlebt. „Michael Ende ist im August 1995 in Filderstadt gestorben. Beerdigt wurde er auf dem Waldfriedhof in München. In seinen Geschichten wird er noch eine unendlich lange Zeit weiterleben.“
In japanischen und chinesischen Märchen ist für Alexander vieles anders geordnet. Häufig sind es dort Chroniken, in denen die einzelnen Lebensgeschichten und Abenteuer eingebunden werden. Auch die Verstorbenen leben weiter, wie die Götter in der griechischen Mythologie. Alles auf der Welt existiert schon vor der Entstehung der Phantasie des jeweiligen Erzählers. Besonderen Wert legen die Asiaten auf genealogische Verbindungen zwischen Göttern, Herrscherpersönlichkeiten und normalen Alltagsmenschen. Wunder werden dadurch zu einer menschlich-göttlichen Übernatur, zu einer Vererbungslehre gewissermaßen, die uns von einer Generation zur nächsten trägt.
Maos Geschichte
„Wie waren die Roten Garden so?“, fragt ein Chinese. „Wir haben fürchterliche Verwüstungen angerichtet. Wir haben gegen unsere Schulrektoren, gegen unsere Lehrer, gegen unsere Nachbarn, sogar gegen unsere eigenen Eltern gekämpft. Wir haben sie auf die Straße getrieben. Wir haben sie erniedrigt und gedemütigt. Wir haben sie öffentlich zur Schau gestellt. Wir haben sie zu Tode geprügelt. Alles wegen unseres Führers, dem großen Vorsitzenden Mao. Wir haben gezwungenermaßen bewiesen, dass wir Mao mehr liebten als unsere Familie. Allerdings haben wir ihn auch wie einen großen alten Ahnen verehrt.
Dann starb Mao eines natürlichen Todes, aber er lebt in uns weiter. Wir haben nun durch ihn die Hebel der Geschichte in der Hand. Wir sind durch ihn ein engagiertes System und endgültig das Reich der Mitte geworden. Wir haben die Macht erkannt, die unsere Träume wahr machen kann. Allein, noch wissen wir nicht ganz genau, was unsere Träume eigentlich bedeuten. Wir wissen nur, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen können, wenn wir es wollen.“
Nach dem Sieg der Alliierten Mächte über Nazideutschland und dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist auch in Europa die Generationenfrage umfangreich aufgearbeitet worden. Wir Deutsche möchten uns eigentlich nicht mehr an die Ideen der Nationalsozialisten erinnern, deshalb beschäftigen wir uns viel mit ihnen, weil wir sie dadurch noch nachträglich bekämpfen wollen. Vielleicht sogar weil wir wissen, dass wir zuvor zutiefst versagt haben. Nicht einmal an die Idee des Widerstandkampfes gegen die Nazis wollen einige mehr erinnert werden. Ansonsten aber sind wir Deutsche gute wissenschaftliche Aufarbeiter unserer schrecklichen Vergangenheit. Vermutlich sind wir sogar historische Mentalitätsführer, was uns dabei behilflich sein könnte, uns selbst durch das Fremde im eigenen Ich zu führen.
Was ist das alles für ein merkwürdiges Kuddelmuddel in der Geschichte?
Wir Deutschen sind nach dem letzten großen Krieg, den wir eigenwillig angezettelt haben, eigentlich immer noch gutmütig krakeelende Seeleute. Wir sind betrunkene Matrosen, wie „Kuttel Daddeldu“, den einst der Lyriker Joachim Ringelnatz erfand. Kuttel ist jener deutsche Leichtmatrose, den man vor ein Artilleriegeschütz setzen kann und auf die große Reise in den Krieg schickt, den man mit ihm nicht gewinnen kann.
Kuttel
Wir singen moritatenhafte Seemannslieder, in denen Kuttel von wilden Seefahrten und chaotischen Landgängen berichtet, von Bordellen und Hafenkneipen, von seiner Braut Marie, die aus Bayern stammt, und nicht zu vergessen, die Berichte über seine verstreuten Kinder in aller Welt. Die Abenteuer des Seemanns und der Lokomotivführer sind das Sitzfleisch, mit dem wir, wie auf Schienen, durch das Land reisen. Es sind die Märchenvisionen vom täglichen Beruf in unserer männlich-deutschen Kindheit früher einmal gewesen. Heutzutage scheint es die Kuttelvision vom modernen Computerfachmann zu sein, der im Chaos-Club organisiert ist und ein weltweit einflussreicher Hacker werden möchte. Die deutsche Frau, die Kuttlerin dagegen ist etwas anderes. Sie ist die ewig deutsche berufstätige Hausfrau, Geliebte und Krankenschwester, die nach dem Kampf aufräumt und mit ihren Händen die Gedärme sortiert. In Deutschland ist vieles von schlichter und einfacher Natur, wie alle Berufsvisionen eigentlich. Die Verse in der Metrik wirken zwar uneinheitlich, aber die Reime sind durch hohe Geschlossenheit gekennzeichnet. Kuttel zeigt uns die Welt aus Sicht der vermeintlich kleinen Leute: Außenseiter, Deklassierte, Arme, Hartz IV-Empfänger. Die Reichen und Gebildeten haben sie erfunden. So sind wir Deutsche eben. Deutsche Armut wird mit parodistischem Ideenreichtum bekämpft. Der tägliche Existenzkampf wird hauptsächlich mit dem Mundwerk gemeistert. Keiner schert sich groß um Konvention und Etikette, nur wenn man sie uns streng befiehlt. Das breite Publikum beschert Kuttel stets den überwältigenden Erfolg.
Die Nationalsozialisten schätzten seinerzeit den anarchischen Frohsinn des Seemanns Daddeldu nicht und setzten die Balladen von Ringelnatz auf ihre „Schwarze Liste“. Wir Deutschen sind nämlich die allerbesten Listenschreiber.
Sind wir Deutsche noch größere Verlierer als die Chinesen, weil wir immer auch gegen uns selbst noch einmal verlieren? Genügend Bildung scheint uns nicht aus der Patsche helfen zu können. In Maos Reich dagegen sieht alles klipp und klar aus:
Maos Geschichte (Fortsetzung)
„Geht aufs Land. Wir gingen aufs Land. Lest das kleine rote Buch. Wir haben es gelesen. Wir verließen unsere Wohnungen in der Stadt und mussten die örtlichen Beamten bestechen, um wieder in die Städte zurückkehren zu können, in denen wir aufgewachsen und zu Hause sind.“
Ist das nicht ebenfalls schlicht und einfach? Ist das nicht das Märchen von „Frau Holle“? Goldmarie muss ordentlich belohnt und Pechmarie ordentlich bestraft werden.
Die schrecklichen, ganz einfachen Lehrmärchen in den jüngsten deutschen Elterngenerationen sind Hitler, Stalin und Mao. Ihre mörderischen Weltmachtträume in jener Welt, die man erobern und politisch verändern müsse, sind Teil von uns allen, ob wir nun wollen oder nicht. Wölfchen versteht so etwas schon sehr gut. Alexander hat ihm nämlich vom Gruseln in den Soldatenmärchen erzählt. Der Gruseleffekt reicht aber leider immer nur für etwa eine Woche, wenn überhaupt. Dann möchte Wolf doch lieber wieder Fantasy-Serien gucken oder an seinem Handy herumspielen, um den Vogel abzuschießen oder ein neues virtuelles Imperium aufzubauen.
Fast selbsterklärend scheint dagegen zu sein, wenn man als historisch begabter Wissenschaftler einen sogenannten Märchen-Index erstellt, ein Realitätsmärchen gewissermaßen. Antti Aarne hat für die internationale Erzählforschung einen Index erstellt. Stith Thompson ergänzte die Klassifikation der Märchen- und Schwankgruppen. Aber erst als der deutsche Erzählforscher Hans-Jörg Uther aus dem Harz, im Jahr 2004, den Märchenindex überarbeitet hatte, trug er von da an die bekannte Markenbezeichnung ATU, Aarne-Thompson-Uther. 2005 hat Uther den Europäischen Märchenpreis der Walter Kahn Märchen-Stiftung bekommen und im Jahr 2010 den Brüder-Grimm-Preis der Philipps-Universität Marburg. Wofür wurde er damals ausgezeichnet?
Wie schön und aufschlussreich, dass es das Wunder der Indexierung gibt. Man hat alles und nichts schnurstracks auf einen Blick. Man hat einen sogenannten Index. Man hat die Märchenwelt in rationelle Stichworte eingepasst und aufgelistet - fast ein Stichwortmärchen:
Der Märchenindex
Entstehung und Aufbau - Bedeutung und Kritik - Beispiele - ein Typenkatalog - übernatürliche Gegenspieler - übernatürliche und verzauberte Ehefrauen oder andere Verwandte - Ehemann, Bruder oder Schwester - übernatürliche Aufgaben - übernatürliche Helfer - magische Gegenstände - übernatürliche Kraft und Wissen.
Das Märchenhafte kann man also auch in totalitärer Form festhalten. Der Geist der Liste leuchtet uns den Weg. Welchen Weg? Das weiß keiner so recht. Nur die ganz intelligenten und strebsamen kleinen Nachwuchswissenschaftler in der Schule, wird er möglicherweise ein wenig erleuchten können.
Alexander hasst Listenschreiben wie die schlimmen Symptome einer schweren Krankheit. Warum sollte man so etwas Grausames tun? Er selbst hat nur ein einziges Mal in seinem Leben eine längere Liste von Märchen und Wundern zusammengestellt. Es ging schief. Er wollte sehen, ob es vielleicht doch einige wundersame Gemeinsamkeiten zu entdecken gäbe. Allerdings, seine Liste war ausschweifend, international und weltumspannend. Man denkt nur am Anfang, dass Märchen überall ähnlich klingen, wegen der Überschriften wahrscheinlich. Überall gibt es Prinzessinnen und arme Menschen, die sich in Tiere und Kaiser verwandeln. Ganz sonderbare Wesen haben sich als Männer, Frauen und Kinder verkleidet und tragen originelle Namen.
Alexanders kurze Liste
„Kwaku Ananse und die Weisheit (Ghana), Legende der Prinzessin von Guatavita (Kolumbien), Die Prinzessin auf der Erbse (Dänemark), Der Wanderer (Indonesien), Wie das Krokodil zu seinen Zähnen kam (Malaysia), Vom dummen Honza (Tschechien), Das Krokodil und der Affe (Indien), Die vier Freunde (Indien), Ein wirklicher Freund (Indien), Gagliuso (Italien), Das Beutelchen mit zwei Talern (Rumänien), Lappi und Loppi (Estland).“
Am Ende hat Alexander seine listige Anstrengung schnell wieder beendet, weil ihm im Grunde schon vorher klar war,dass Listen unendlich lang werden können, aber die kleinste oderjüngste Tochter nicht unbedingt immer die schönste sein muss. Auch die Armen, Benachteiligten und Phantasielosen werden am Ende nicht überall siegreich oder erfolglos sein können. Neue Freunde und Feinde werden sie überall finden. Das Allerjüngste der sieben Geißlein entkommt dem bösen Wolf, aber auf keinen Fall wegen einer ordentlichen Auflistung.
Nun, wie sieht es mit der Weisheit in Wundermärchen aus?
Man unterstellt oft, dass Märchen von sich aus weise seien, eine Seelennahrung ohne Anstrengung gewissermaßen, welche Kindern zentrale Weisheiten und Werte naherbringt. Tua res agitur. Genau diese Sache wird verhandelt.
Joana Feroh, eine Sängerin jiddischer Chansons aus der Schweiz, sagt, mit Kindern müsse man Geschichten suchen und sie dadurch gleichzeitig neu erfinden. Das sei etwas ganz Normales. „Wer mit offenen Augen durch den Alltag geht, kann sich eine aufwändige Suche ersparen. Denn: Geschichten liegen überall herum, man braucht sie nur aufzuheben!“
Ist das möglicherweise das Wunder der Weisheit? Alexander hat intensiv darüber nachgedacht. Liegt die Weisheit wirklich überall herum? Muss man sie wirklich nur noch aufsammeln?
In den 1970er Jahren wurden im Westen Deutschland wenig Volksmärchen erzählt, weil man Kinder vor Grausamkeiten und bösen Geistern beschützen wollte. Einige Literaten erfanden in dieser Zeit allerdings auch neue gesellschaftskritische Märchen. Man wollte die schreckliche Nazizeit hinter sich lassen. Man wollte nichts Unwahres mehr erzählen. Doch wenn man vor dem Bösen in der eigenen Geschichte zurückschreckt, dann erschrickt man gleichsam auch vor sich selbst. Die Märchen selbst hingegen sind stets nur verkleidete Geschichte. Sie zeigen vor allem Auswege, sodass am Ende das Gute das Böse doch besiegen kann. Sie sind Aufmunterung, für das Bessere zu kämpfen, weil man das Gute sucht und sich mit dem Bösen höchstpersönlich auseinandersetzen muss. Manchmal zeigen Märchen auch, dass die bösen Wesen recht einfach zu besiegen sind. Besser jedoch scheint es zu sein, Kinder erwarten das höchstwahrscheinlich auch, dass das Böse im engagierten Kampf und mit viel Glück ausgelöscht wird. Eben genau das ist auch das Erfolgsrezept des Schalks in Hollywood, vermutet Alexander. Man darf aber niemals das Wichtigste vergessen: die Feier des großen Festes, des universellen Botschafterfestes, am Ende der Erzählung. Dieses Hochzeitsfest ist stets viel mehr, als es zunächst erscheinen mag. Nicht nur zwei, die sich mögen, erhalten den offiziellen Segen, sondern man gewinnt auf dem Fest viele Freunde und Zuschauer. Fette Wildschweine werden in fröhlicher Runde, um den runden Dorftisch sitzend, nach dem großen Abenteuer grölend verzehrt. Der Schwiegervater wird eine Rede halten. Und wenn sie noch genügend Kraft haben und nicht gestorben sind, so feiern alle Menschen immer weiter, auf immer eindrucksvolleren goldenen Veranstaltungen und verspeisen Kalbsköpfe, wie auf der Fußball-Fan-Meile in Berlin. Gute Märchen hingegen zeigen diesbezüglich doch eher Einfaches und Überschaubares. Der Festakt kann nicht entscheidend sein, wenn das Märchen zeigt, wie ein fairer Umgang mit den Ängsten aussehen kann, wie man erfolgreich hofft und bangt, wie man mit nur einem echten Freund oder einer besten Freundin das Leben meistern kann. Es geht um das gemeinsame Bangen und Hoffen mit vielen Freunden und gegen unendlich viele Feinde.
Die Fragen
Ist das Hoffen und Bangen der ganzheitliche Wert, die Wahrheit oder vielleicht sogar die Weisheit? Freundschaftliches Handeln, Friede, Liebe, Gewaltlosigkeit: Sind diese Verbündeten des Glücks die guten Wesen im dunklen Märchenwald der Geschichte? Was ist mit dem Anderssein und dem Ganz-anders-denken-wollen oder -können? Folgt man der Intuition des Herzens etwa nur auf den Heldenwegen der eingeübten Entwicklungsgeschichte? Stellt man nur eine schon vorhandene Ordnung wieder her, die dann auch noch die Ordnung der Phantasie und der Zukunft wird? Sind alle wundervollen Geschöpfe, die Feen und Zwerge, überhaupt bereit, die Schöpfung in Ordnung zu bringen? Werden, während man das fragt, die Fressfeinde ihre Opfer nicht längst verspeist haben?
Alexander hat dieses schwierige Thema mit der Frage nach der Ordnung mit Wolf durchdiskutiert. Sein kleiner Sohn sagte: „Scheiß was auf die Ordnung.“
Zunächst war Alexander entgeistert. Dann aber konnte er Wolf gut verstehen. Man kann niemals vorgeben oder voraussehen, wie eine gute Ordnung auszusehen habe und wohin die Phantasie uns führen kann.
Wie also läuft die praktische Ordnung der Dinge in der Welt der Märchen ab?
Wolf kann natürlich darauf keine vernünftige Antwort kennen. Aber in einem hat er Recht, weil Alexander es ihm in den Mund gelegt hat: „Der Wert des Geldes lässt sich nicht aus dem Edelmetallbestand ableiten.“ Wolf hat dannunfreiwillig Foucault zugestimmt, weil er erklärte, dass er auf Geld gar keinen großen Wert legt.„Nur für den Schokoriegel muss das Geld reichen“, hat er gesagt.Der wundersame Homo Faber aus dem „Frischregal“ dagegen, muss nicht nur für Geld immer und überall etwas leisten und tatkräftig hervorbringen. Ständig wird er durch den Schaffenswillen seines Autors in Bewegung versetzt. Ein Schweizer Manager eben. Er steht unter Druck und ist im Dauerstress. Homo hat keine echte freie Zeit mehr, um sich eventuell noch grundsätzliche Gedanken zu machen. Erst am Ende, als er todkrank geworden ist, will er sein Leben, seine Versäumnisse und seine Verfehlungen aufarbeiten. Das Märchenhafte im Menschen ist durch die Eindimensionalität von Arbeit und Ökonomie auch in der Phantasie dahin, dahin.
Die urdeutsche Tugend, nämlich der Fleiß, ist auch in der Sammlung der Grimmbrüder ein hochgeschätztes Thema, wie uns insbesondere die Geschichte über die Belohnung der Arbeitsmoral bei der „Frau Holle“ erklärt: „Kikeriki, unsere schmutzige Jungfrau ist wieder hie.“
Männliche und weibliche Figuren stehen nach Alexanders Auffassung für die märchenhaften Seelenteile Ying und Yang. Davon hat Frau Holle natürlich nichts gehört. Riesen und Zwerge haben extrem gegensätzliche Fähigkeiten in Bezug auf ihre körperlichen und intellektuellen Kräfte.
Ziel der märchenhaften Seelen- und Körperwanderung ist meistens die Erlangung der Königswürde oder des königlichen Wohlgefallen. Prinz und Prinzessin zu sein, heißt Selbstbeherrschung anzustreben. Niemand kann natürlich beweisen, ob die uneigennützige Hingabe und das uneingeschränkte Vertrauen in die Seele des Herrschens und Beherrschens unbeirrbar zum Guten führen werden. Diese Elementargeister bescheren uns zunächst nur das unmittelbare Abenteuer, das mit vielen unterschiedlichen Verhaltensweisen bewältigt werden kann. Da kann dann auch derjenige qualvoll zu Grunde gehen, der ganz wenig egoistisch gewesen ist. Das reinigende Feuer kann niemals die Erlösung der Seele sein, weil die reine Seele unsterblich und nicht verkohlt ist, weil sie stets nach der Verbindung mit den königlich-göttlichen Kräften des Geistes sucht.
Alexander Kappel ist nur für heute am Ende seiner Gedankenreise auf der Suche nach Weisheit in Märchen angekommen. Zum Ende des Tages ist er allerdings häufig auch verwirrter als morgens. Wirklich klar ist ihm heute nur noch, dass man die Weisheit in Märchenbüchern bei Amazon kaufen kann. Er sagt sich praktischerweise: Deshalb schreibe auch ich einen neuen Roman, just nach dem Bilde von Vater Täuschgold und Mutter Trugsilber, mehr Schein als Sein, Märchen als Abendspinnerei auf einem finanziellem Hintergrund. Aber auch so gehört sein Abenteuer ihm ganz allein: Honigseim und Pfefferschoten,Lichterglanz und Sternentanz. Das ist es, was Alexander seinem Publikum verkaufen möchte. Nichts weiter, weiter nichts, nicht weniger und nicht mehr. Sein Schaffen ist wie der Honig, welcher klebrig aus der Bienenwabe fließt. Es ist wie Pfeffer, der in viele Wunden hineingehört. Märchenwesen und wundersame Gestalten streuen alles Mögliche in sein Leben hinein, und er pustet alles in veränderter Form nach draußen. Irgendwann zur Weihnachtszeit wird er sein Märchenbuch, als kleiner Bub, unter den Tannenbaum legen. Dann wird der Weihnachtsbaum abbrennen und sein allerallerletztes Exemplar mit ihm.
Erika kommt ins Arbeitszimmer. Sie hat eine Sprechausbildung als Schauspielerin und eine weiteres Zertifikat als Atem- und Stimmlehrerin vom Institut für Atemlehre. Sie schaut immer sehr genau hin, wie ihr treuer Alexander jeweils gerade atmet. Für ihn erzählt Erika jeden Tag aufs Neue die seltsamsten Geschichten, wenn sie ihm zum Beispiel mitteilt, er solle doch nun endlich bald fertig werden oder Wolf müsse sich beeilen, um in die Schule zu kommen. Ihre Stimme ist aber auch seine tägliche Sternstunde im Alltagsleben, wenn Erika zum Beispiel frühmorgens aus der Wohnung zur Arbeit geht und sich freundlich von ihm verabschiedet. Er kann dann in aller Seelenruhe weiterschreiben oder weiterschlafen, je nachdem, wie ihm zumute ist. Er weiß längst, dass er für Erika ein sonderbarer Schreiberling ist. Verkleidet als Schmarotzer und Verweigerers ist er für sie nicht.
Alexander hat eine Menge geerbtes Geld und sogar die große Eigentumsaltbauwohnung, in der sie jetzt zuhause sind, in die Beziehung eingebracht.
Er ist ein Kind wie Wolf und eine Frau wie Erika, denkt Alexander, der aber die Schule und den Beruf schon glücklich hinter sich gebracht hat. Erika ist für ihn leider noch berufstätig, weil sie es unbedingt will. Gleichheit vor dem alten Herrn wird es in dieser Frage wahrscheinlich niemals geben können.
Erika bringt ihm eine Brezel mit einer dicken Salzkruste und einen Pott mit heißem Kaffee ins Arbeitszimmer. Dann wird sie schnurstracks, mit Wolf dicht an ihrer Seite, wie immer pünktlich, aus dem Haus gehen.An diesem Morgenreicht die Zeit nicht mehr, um ihr die schwäbische Brezel-Saga, vom Frieder, dem Uracher Hofbäcker des Grafen Eberhard im Barte, zu erzählen, an der er in der Nacht herumgebastelt hat. Überhaupt hat er ihr schon viele Brezelvarianten in der letzten Woche vorgestellt. Sie alle handeln von Backen der Geschichten.
Schwäbische Brezel-Saga