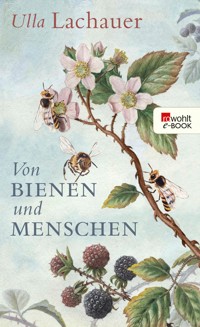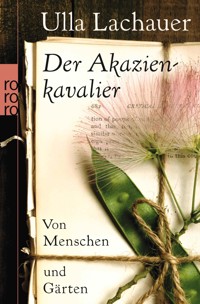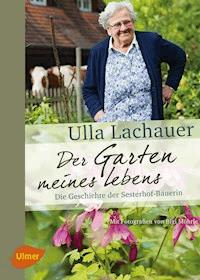9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Magdalena Eglin, Jahrgang 1933, hat von Geburt an schwache Augen - im Laufe ihres Lebens wird sie völlig erblinden. Aber ihre anderen Sinne sind umso mehr geschärft, und sie lernt es, sich in der Welt zu orientieren. Zum Lebenselixier werden ihr die Natur und der eigene Garten, und an der Seite eines Lehrers findet sie ihr privates Glück. Ein ungewöhnliches Buch über die Geschichte einer Außenseiterin und über das Sehen - poetisch und anrührend zugleich. «Ein sprachmächtiger literarischer Lebensroman.» (Literaturblatt) «Frisch, lebendig, oft mit einer Prise Humor, aber auch nachdenklich und intensiv.» (NDR)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Ulla Lachauer
Magdalenas Blau
Das Leben der Magdalena Eglin
Über dieses Buch
Magdalena Eglin, Jahrgang 1933, hat von Geburt an schwache Augen - im Laufe ihres Lebens wird sie völlig erblinden. Aber ihre anderen Sinne sind umso mehr geschärft, und sie lernt es, sich in der Welt zu orientieren. Zum Lebenselixier werden ihr die Natur und der eigene Garten, und an der Seite eines Lehrers findet sie ihr privates Glück.
Ein ungewöhnliches Buch über die Geschichte einer Außenseiterin und über das Sehen - poetisch und anrührend zugleich.
«Ein sprachmächtiger literarischer Lebensroman.» (Literaturblatt)
«Frisch, lebendig, oft mit einer Prise Humor, aber auch nachdenklich und intensiv.» (NDR)
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel «Magdalenas Blau» im Rowohlt Verlag
Rowohlt Digitalbuch, veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2013
Copyright © 2013 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Lektorat Uwe Naumann
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München, nach einem Entwurf von Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Foto: Stephanie Schweigert)
ISBN Buchausgabe 978-3-499-62728-6 (1. Auflage 2013)
ISBN Digitalbuch 978-3-644-02691-9
www.rowohlt-digitalbuch.de
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Der Papierkorb
Januar
Großvaters Farben
Pflanzen- und Menschenkunde
Februar
Zimmerschule
Mein Freiburg
Blindgänger
März
Böses Kind
Ich sterbe nicht
Jungmädel mit Sonderaufgaben
April
Der Sommer chez Colette
27. November 1944
Schafe hüten
Mai
Lebenstüchtig
Ich bin blind
Die Liebe zum Wind
Juni
Büro und Jazzkeller
Im wilden Tal
Ich will ein Kind
Juli
Frau Lehrer!
Gärtnern und Schreiben
Guter Hoffnung
August
Der Lichtfänger
Frostige Zeiten
Paradies-Garten
September
Haus mit sieben Zimmern
Konrads Hände
Gegen den Strom
Oktober
Ein Hut voll Welt
Das große ferne Blau
Nachwort von Ulla Lachauer
Nachwort von Magdalena Weingartner
Der Papierkorb
An einem Morgen vor sehr langer Zeit habe ich meine Mutter gefragt:
«Warum träume ich so oft vom Rascheln? Warum mag ich es so gern, wenn es irgendwo knistert?»
«Ganz einfach», hat sie gesagt. «Du bist als Kind schrecklich lebhaft gewesen. Um dich ruhig zu kriegen, haben wir dich in den vollen Papierkorb gesetzt. Da hast du alles Papier rausgeschmissen, zerknüllt oder zerrissen. Nachher brauchte man nur den Besen nehmen und Magdalena ins Bettchen legen.»
Mir ist heute ganz klar, warum. Weil ich so wenig gesehen habe. Ungefähr nach meiner zweiten Augenoperation muss das gewesen sein, ich war gerade sechzehn Monate alt. Normalerweise ist alles, was der Mensch vor seinem dritten Geburtstag erlebt, dem Erwachsenen nicht mehr zugänglich, so sagen die Gedächtnisforscher. Aber ich schwöre, etwas in mir erinnert sich an diesen Papierkorb unter Vaters Schreibtisch und an etwas Weiches, Haariges gleich daneben. «Ein Dachsfell!», hörte ich etwas später die Eltern sagen, ich war dem Papierkorbalter gerade entwachsen und begann, den Wörtern zu verfallen. Ich saß unter dem großen Schreibtisch auf dem Fußboden, wo mich, wie ich glaubte, keiner sah, und rief Wörter in die Stille: «Dachssssfffell.» Das zischte ganz wunderbar in der Mitte, das gefiel mir. «Bachstelze» gehörte auch in die Gruppe der Laute, die ich liebte. Oder «Kekse», das knackte, da war so ein kleiner Luftzug, der im Rachen anfing und dann mächtig gegen die Zähne drängte. Aber «Dachsfell», diese dichte Folge von Konsonanten, war von allen das beste. Vielleicht weil sie dem Rascheln des Papiers ähnelt? Ich konnte das Wort viel schöner aussprechen als Vater und Mutter, bei ihnen klang es irgendwie flach. Für sie war das Wort nur eine Mitteilung, eine mehr oder weniger bedeutungsvolle Sache. Dieses zum Beispiel versahen sie gern mit einem Ausrufezeichen. Anscheinend handelte es sich bei dem Dachsfell um eines der Dinge, die den Wert unserer Familie beweisen sollten. Als ich schon fast erwachsen war und den Geheimnissen, die mein Leben umgaben, auf der Spur, fand ich heraus: Es war gar kein Dachs, es war ein toter Hund.
Im Rischel-Raschel des Papiers fühle ich mich bis heute geborgen. Töne aus Papier, in unendlichen Variationen, das war mein erstes großes Glück, und damit verbunden die helle, weiche Stimme meiner Mutter.
Meine Mutter hat mir berichtet, ich hätte schon früh ziemlich genau erfassen können, was um mich herum vorging. Wie ein hellwaches, flinkes Tierchen war ich. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, kaum dass ich laufen konnte, war, mir eines der Sofakissen zu schnappen. Egal ob Samt oder Seide, und schwupp! saß ich auf der Treppe und bin vier Etagen bis zum Erdgeschoss runtergerutscht. Stufe für Stufe, nach acht Stufen kam immer ein Absatz. Das hat fürchterlich gerumpelt, daran hat meine Mutter gemerkt, dass ihre Tochter mal wieder unterwegs ist. Oft hat sie mich schon im dritten Stock erwischt und mich im Genick gepackt. Sie lachte, steckte mich an mit ihrem Lachen. Und ab in die Küche, wo ich bis auf weiteres unter Aufsicht war. Wenn ich mehr Glück hatte, ging meine Treppenreise bis ins Parterre. Unten angekommen, stand himmelhoch über mir eines der Wunderdinge dieses Hauses, ein auf dem Schlusspfeiler des Geländers angebrachter weißer, geschliffener Glasknauf. Er glitzerte, besonders bei Sonnenlicht. Wenn ich mich satt gesehen hatte, bin ich auf allen vieren, so leise es ging, wieder hochgekrabbelt. Nicht nur wegen meiner Rutschpartien hat meine Mutter viele Ängste ausgestanden.
«Unsere Magdalena hat was mit den Äugle», sagten meine Eltern, wenn Fremde zu Besuch kamen.
«Armes Mädle!», hörte ich manchmal auf der Straße, wenn ich an Großvaters Hand spazieren ging.
Was hatten die Erwachsenen nur? Für mich war die Welt vollkommen in Ordnung. Ich sah doch! Vor dem Fenster im vierten Stock schimmerte es Grün, das waren die Bäume vom Freiburger Schlossberg. Kleine und größere, überragt von einer riesenhaften Kastanie, die im Sommer anders gefärbt war als im Herbst, im Winter nur eine dunkle Silhouette. Alle Menschen, glaubte ich, sehen Bäume so. Und sie erkennen einander vor allem an ihren Stimmen. Jede ist völlig anders, Mutter und Vater, Großvater und Tante Regina waren für mich mühelos zu unterscheiden, selbst wenn sie flüsterten oder sich nur räusperten. Außerdem roch jeder von ihnen anders.
Und dann gab es ja zur Orientierung die Farben. Mutters rote Strickjacke leuchtete, wenn sie sich mir näherte. Auf eine gewisse Entfernung waren sie da, das Rot und das Blau, Orange und Weiß, sprangen mich freundlich an oder belästigten mich. Ganz besonders verabscheute ich das komische Gelbgrün, in dem unser Treppenhaus gestrichen war. Umrisse von Menschen und Dingen nahm ich wahr, deutlich oder weniger deutlich, an einem hellen Morgen mehr, nachts gar nicht. Natürlich nicht, Nacht ist eben Nacht. Vater war dick, ein Zweizentnermann, der Großvater zierlich und ein wenig krumm. Dass ein Mensch einen anderen sehen kann, wenn dieser auf der gegenüberliegenden Straßenseite geht, wusste ich nicht. Auch nicht, dass man ein Gesicht aus der Nähe betrachten kann, wie verschieden Augenbrauen sein können, was Sommersprossen sind. Was für ein Spiel ist das «Mienen-Spiel», das die Erwachsenen manchmal erwähnten? Ich kannte es nicht, und mir fehlte es damals, in meiner Kindheit, nicht. Konnte ich doch alles, was ich brauchte. Zum Beispiel war ich sehr geschickt darin, auf dem Teller das größte Radiesle zu finden. Wenn ich mit der Hand darüberstrich, spürte ich, welcher Stiel am höchsten war, und ich hatte das größte Knübbele erwischt.
In unserem Haus bewegte ich mich absolut sicher. Es hatte vier Stockwerke, nur eines wurde vermietet, ansonsten war es von Verwandten bewohnt. In der vornehmen Beletage lebten die Großeltern, oben unterm Dach wir, Johann und Else Eglin und ich, Magdalena Eglin. Bald nach meinem zweiten Geburtstag zogen wir ins Erdgeschoss um, so waren wir näher am Hinterhof, wo sich das Gärtchen befand und die Malerwerkstatt meines Großvaters, deren Chef nun mein Vater wurde.
Viel Platz für kindliche Abenteuer. Besonders aufregend war das Zimmer der Modistin, einer langjährigen Mieterin. Wenn sie Hüte änderte und der neuen Mode anpasste, war immer etwas übrig: buntes Ripsband, Schleifen und Schleierchen, das schenkte sie mir zum Spielen. In dem großen Haus gab es Zonen der Stille – im Sommer, wusste ich, würde mich auf dem Trockenboden niemand finden – und Orte, wo häufig Spannung in der Luft lag. Meistens konnte ich sie wittern, bevor das Geschrei losging, und rechtzeitig das Weite suchen. Ich erinnere mich an Worte, die mich den Kopf einziehen ließen, und an eine untergründige Traurigkeit.
Die Ursachen habe ich natürlich erst viel, viel später verstanden: Mein Großvater Daniel Eglin hatte als junger Mann, 1894, das Haus als Bauruine erworben und dafür sein ganzes Erspartes, das er als wandernder Malergeselle verdient hatte, eingesetzt, zusätzlich eine Riesenhypothek aufgenommen. Er hatte es tatsächlich geschafft, nicht pleitezugehen, sich hochzuarbeiten, und war ein angesehener Malermeister geworden. Acht Gesellen und ein eigenes Haus in der Erasmusstraße, nach einer geradezu irrsinnigen Anstrengung ein gewaltiger gesellschaftlicher Aufstieg. Weil keine der drei Töchter einen Maler zum Mann nahm, musste schließlich der widerstrebende Sohn, Johann Eglin, das Erbe antreten – für meinen Vater lebenslang ein Unglück. Er hatte mittlere Reife gemacht, eigentlich Buchhalter werden wollen. Sein Traum war, einer Gesellschaftsschicht zuzugehören, wo man saubere Hände hat.
Vater war herrisch, auch in der Familie, und reizbar. Ich kenne ihn nur so, selten habe ich ihn ruhig reden hören. «Magdalena, mach das! Mach es so, wie ich es dir sage, Magdalena!» Mir sind vor allem Befehle im Kopf geblieben.
Eines der hässlichen Wörter, die mit schöner Regelmäßigkeit durchs Haus flogen, lautete: «evangelisch». Am furchterregendsten wirkte es kombiniert mit anderen Wörtern. «Evangelische Schlampe!», kreischte meine Tante Regina über den Flur. Die zweitälteste Schwester meines Vaters lebte mit ihrer Familie im dritten Stock, Rufe von dort fürchtete ich sowieso. «Evangelisch» war meine Mutter Else gewesen. Sie war, während sie mich im Bauch trug, konvertiert, hatte sich im Kloster St. Lioba, nicht weit von hier, das Katholische angeeignet. Ihre evangelische Herkunft galt jedoch nach wie vor als Makel. In meiner väterlichen Verwandtschaft, bei den Eglins, blieb sie eine Fremde. Meine Tanten fingen immer wieder davon an, sie horchten mich aus: Ob meine Mutter uns mit Weihwasser besprenge? Ob sie zu Tisch bete, ob sie auch nicht fluche? Ich beantwortete alles wahrheitsgemäß. Eine seltsame Zeit: Bevor ich richtig von Gott wusste, wurde mir eingebläut, dass es zwei Glauben gab, einen rechten katholischen und einen falschen.
Und ich, Magdalena, war mit meiner ganzen Existenz in diesen Konflikt verwickelt. «Evangelische Schlampe!» ist in meinem Gedächtnis verbunden mit einem anderen Satz, den dieselbe Tante Regina Jahre später auf mich losließ: «Du bist unser Kreuz! Du bist die Strafe Gottes!» Das muss kurz nach dem Krieg gewesen sein, ich war damals in der Pubertät und tief getroffen. Sie wollte offenbar damit sagen, Gott hat meine Eltern für ihre Mischehe gestraft, indem er ihr erstes Kind mit einem Makel versah. Mein Lebtag werde ich diesen Satz nicht verwinden, und würde ich hundert Jahre alt, nicht einmal tausend würden dazu ausreichen. Was kann ein Mensch auf einen solchen Satz entgegnen? Nichts! Du kannst nur davor flüchten, du kannst versuchen, irgendwo Schutz zu finden.
«Katarakt» nennen die Mediziner den Makel, ein Wort, das ich mag, obwohl ich medizinische Bezeichnungen hasse. Katarakt: das altgriechische Wort für Wasserfall. In der Antike nahm man an, ein Mensch mit stark getrübter Augenlinse sehe die Welt wie durch einen herabstürzenden Wasserfall. Eine andere Bezeichnung dafür ist «grauer Star». Wann und wie meine Eltern es damals bemerkten, weiß ich nicht genau. Beide werden traurig gewesen sein, besonders meine Mutter, denn sie hatte, bevor sie mit mir schwanger wurde, schon ein Kind verloren und war körperlich und seelisch angeschlagen. Sie stillte mich noch, als ich 1933, im Alter von sieben Monaten, zum ersten Mal in die Freiburger Augenklinik kam. Ein bekannter Arzt, der in Berlin studiert hatte und als Nazi galt, führte die Operation aus. Danach sah ich ein wenig besser, wird berichtet. Bei der zweiten Operation, mit sechzehn Monaten, sollte der sogenannte «Nachstar» entfernt werden. Ich habe mir immer vorgestellt, das ist so, wie wenn man einen Topf auskratzt und man noch einmal nachwischen muss, weil er noch nicht ganz sauber ist. Das Nachwischen misslang. «Das rechte Auge ist tot», sagte der Arzt zu meiner Mutter. Sie hat mir später diesen nüchternen, schockierenden Satz oft zitiert. Damals, nach der Diagnose des Scheiterns, haben meine Eltern davon abgesehen, das andere, linke Auge mit dem kleinen Sehrest nachoperieren zu lassen.
Mit dem bissle Augenlicht konnte ich viel anstellen. Die meisten Spiele, die ich liebte, waren Sehspiele. Wir hatten im Wohnzimmer auf dem Fußboden bunt gemustertes Linoleum und Fensterläden, die man mit Hilfe einer Stange auf und zu schieben konnte. Die kleinste Portion Helligkeit, die reinkam, das war ein Fleck, den ich «Lichtei» nannte. Mit etwas Geschick konnte ich das Licht auf bestimmte Farbornamente am Boden lenken. Gegen zehn Uhr morgens kam die Sonne ins Wohnzimmer und blieb bis etwa zwölf Uhr da. Das war meine Zeit. Ich musste nur den Schemel vom Radio ans Fenster tragen, damit ich an die Schieber rankam, und dann habe ich sie ganz präzise so gestellt, dass ein ovaler Lichtkegel auf dem Gelb im Linoleum war.
«Was tust du immer mit den Läden?», hat meine Mutter gefragt.
«Ich mache farbige Eier!»
Um diese zu sehen, musste ich wieder vom Schemel runter auf den Boden und nachschauen. Wenn es noch nicht ganz stimmte, stieg ich wieder hoch, den Schieber ein bissle nachjustieren, und dann wieder runter. Hoch und runter, bis endlich die gelben Eier fertig waren. Minutenlang konnte ich meinen Erfolg genießen, dann war die Sonne weitergewandert, ich musste wieder nach oben, sie einfangen. Ein schönes Spiel, das eine halbe Ewigkeit dauerte.
Nachdem meine Eltern mich dabei beobachtet hatten, sind sie auf die Idee gekommen, mir bunte Mosaiksteinchen zu schenken und später einen Bilderbaukasten, der aus Würfeln bestand, die verschiedene Motive ergaben, wenn man sie richtig legte. Auf einer Seite war die Sahara mit einem schönen Kamel, ringsherum die gelbe Wüste mit hohen Dünen, darüber blauer Himmel. Auf der Rückseite der Würfel eine Schwarzwaldlandschaft mit Kuh und Wiese. Eines Tages bin ich darauf verfallen, die Kuh in die Wüste zu bringen. Oder ich hab den grünen Tannenbaum in den afrikanischen Himmel gehängt. Es gab nichts Schöneres als diese Verwirrspiele, grünes Gras und die dreieckigen Sanddünen zu vermischen, dem Kamel einen blühenden, grellgelben Löwenzahn vor die Füße zu legen.
«Du machst es falsch, Magdalena», hieß es.
«Nein, das ist genau richtig!»
Ich war drei – und ganz sicher: Alles geht. Mit drei oder vier Jahren erlag ich auch einer anderen Sucht, die mich seither niemals losgelassen hat. Ich verfiel dem Radio. Es war ein «Körting», Modell «Miros», ein ziemlich feudales Ding, die meisten Leute mussten seinerzeit mit einem Volksempfänger vorliebnehmen. Vater kaufte es 1935 oder 1936, und ich bin mir ziemlich sicher, er tat es meinetwegen. Dieses Superradio thronte auf dem Rollladenschrank im Wohnzimmer, und ich konnte es nur mit dem Schemelchen erreichen. Vorne hatte es rotbraunes Glas, darin ein langer roter Zeiger, der sich bewegen ließ. Beim Drehen des Knopfes wanderte er nach rechts oder nach links, über seltsame, aus dem Inneren des Kastens erleuchtete Zeichen. Teils rund, teils eckig, «Buchstaben», sagte Mutter, «geschriebene Namen von Städten.» Einer fiel mir besonders auf: Bu-da-pest. Mit ihm habe ich mich angefreundet.
Es war nicht wirklich nötig für mich, den Ton aufzudrehen. Wenn ich es riskierte, musste ich damit rechnen, dass schnell ein Erwachsener sich einmischte und etwas anderes hören wollte. Mutter konnte Schlager und Tanzmusik nicht leiden, sie war ein großer Opernfan. Schnell lernte ich zwischen ernster Musik und «Scheißradaumusik» zu unterscheiden. Klaviermusik hat mich sehr angezogen, «die mit dem heiseren Klavier», das Wort Cembalo kannte ich noch nicht. Vater wiederum mochte Marschmusik und noch lieber gar keine, Aus-Knopf gedrückt und fertig.
Manchmal brüllten Männer aus dem Radio. «Äääkch, äääkch», ein entenartiger Singsang – das war der Goebbels. Der andere hieß Adolf Hitler. «Volksgenossen!», so begann er immer. Ein Organ hatte der, wie wenn er den lieben langen Tag nichts anderes tun würde als schreien. Brüllige Stimmen machten mir Angst, also hab ich die Ohren auf Durchzug gestellt, ob es dieser Hitler «in Berlin» war, der brüllte, oder mein Vater. Wenn mich jemand gefragt hätte, welcher Mensch meinen Ohren am angenehmsten war, hätte ich mich, ohne zu zögern, für die behagliche Stimme unseres Münsterpfarrers entschieden.
Bei gutem Wetter spielte ich oft im Garten. Dort gab es ein schmales Beet, da wuchsen Steinpflanzen, auch Phlox und zwei Rosenstöcke. Zu jeder Jahreszeit andere Blumen, mal Maiglöckle, mal Eisenhut. Unter dem Fliederstrauch Walderdbeeren und, wo es schattig war, Farne. Alles schön akkurat angeordnet von der Tante, die Evangelische hasste.
«Mach nichts kaputt, Magdalena!», rief es aus dem Fenster.
Ich musste immer damit rechnen, dass mich jemand von da oben beobachtete. Dabei bewegte ich mich im Garten ganz, ganz vorsichtig. Ich roch an den Blüten, fasste sie an. Besonders liebte ich dieses Zarte, Seidige vom Mohn. An einem Frühsommertag hab ich angefangen, Grünzeug zu essen. Begonienblüten mochte ich unheimlich gern, weil die so schön sauer waren. Das war, was ich mir holen konnte, alles andere wurde mir zugeteilt. Oft hab ich mich mit Blumen geschmückt, dieses Gefühl auf der Haut, das war das Größte. In gewisser Weise bin ich wie eine Wilde aufgewachsen. Einmal hab ich Dodo, meine Puppe, in den Hortensientopf auf der Terrasse eingepflanzt, damit sie so groß wird wie die meiner Cousine. Ich dachte, sie wächst, wenn sie im Regen steht. Und dann ist der Kopf aus Pappmaché aufgeweicht.
Bei Platzregen wurde der Hof immer zu einem gelbbraunen Drecksee, die Treppe zur Waschküche war dann ein kleiner Wasserfall. Während die Erwachsenen mit Eimern rumrannten, ruderte ich in einem kleinen Holzbottich umher, oder ich zog mir leere Farbbüchsen über die Schuhe und stolperte durch die Pfützen.
Es waren einsame Spiele. Diese kindliche Einsamkeit spüre ich heute, mit siebenundsiebzig Jahren, an gewissen Tagen immer noch. Stärker als diese war jedoch der Übermut, das immer Neue, das da draußen und überall auf mich wartete. Einen Riss bekam meine Welt erst, als mein Bruder geboren wurde und ich kein Einzelkind mehr war, im Sommer 1936.
Die neue Zeit beginnt mit einer seltsamen Szene: Ich sitze in der Schaukel, meiner Schaukel. Mutter ist schon ins Krankenhaus gebracht worden, und eine fremde Frau ist da zum Kochen und Putzen und um mich zu beaufsichtigen. Gerade zieht sie im Schlafzimmer die Betten ab, bemerkt nicht, dass ich entwischt und in die Schaukel geklettert bin. Niemand hat den Schieber vorne zugemacht, und so schaukle ich und schaukle, wild wie gewohnt, und fliege mit dem Kopf zuerst auf den eisernen Fußabkratzer. «Du blutest ja!», schreit die fremde Frau entsetzt. Sie ist meinem Schmerzensschrei gefolgt (im Krieg, im Schwarzwald, werde ich zum ersten Mal einen Esel jämmerlich schreien hören und mich an diesen Julitag 1936 erinnern) und ist nach draußen zu mir gestürzt, das abgezogene Kissen im Arm. Während sie nach meiner Wunde sieht, starre ich auf das große rote Inlet und denke: So viel Blut! Und das ist mein Blut, das in solcher Menge von mir läuft. Meine Verletzung war nicht wirklich böse, eine Platzwunde nur, die sich unter meinen Strubbelhaaren verstecken ließ, sie schmerzte nicht lange. Doch fortan war alles anders: Im Garten stand ein Kinderwagen mit dem schreienden Peter.
Er war ein Junge. Er war blond. Er hatte «gute Äugle».
Januar
Sebastianstag 2010. Es poltert. Schranktüren klappen auf, klappen zu. Beinahe wütend klingt es. Wieso ist Konrad um Mitternacht auf dem Speicher? Später höre ich seine Stiefel im Schnee, er stapft am Gewächshaus vorbei. Bei jedem Schritt ein kleines Krachen, krrrk, krrrk, also ist die Schneedecke überfroren. Jetzt macht er einen Bogen um den alten Apfelbaum herum. Was tut er bloß? Mit einem Mal dämmert es mir, natürlich, das ist es, das ist mein Konrad: Er hat da oben im Dunkel alte Wintermäntel rausgesucht, um die Päonien vor dem schärfer werdenden Nachtfrost zu schützen.
Am anderen Morgen stürzt er, sobald es hell ist, hinaus. Ich hinterher, ganz langsam. Im Winter muss ich draußen besonders achtgeben. Nicht so sehr wegen der Füße, die kennen unsere zweitausend Quadratmeter Garten in- und auswendig – die hohe Türschwelle zur Terrasse, die rauen Platten. Auf dem verschneiten Rasen kann ich mich, wenn nötig, an Bäumen festhalten, weiter hinten am Steintisch. Schwieriger als der rutschige Untergrund ist für mich das Weiß, das Gleißen des Schnees. Da ist kein Kontrast mehr, nicht ein klein wenig Farbe, die meinem Auge Orientierung geben würde.
Vor ein paar Jahren habe ich noch geahnt, wie der Apfelbaum seine Zweige in den kalten Himmel reckt. Baumsilhouetten waren für mich immer die schönsten Winterbilder. Die Bäume erschienen mir in dieser Jahreszeit viel größer, zwischen dem Dunkel von Stamm und Ästen leuchtete es weiß oder hellblau oder knallblau, und ich konnte sogar erkennen, wo die Sonne hängt, manchmal war auch der Mond da. Gelbrot und voll mochte ich ihn besonders.
Neben dem Steintisch blüht schon die Hamamelis. Ich rieche sie. Ihr Duft weckt Erinnerungen an ein Bild von früher: gelbe, spinnenartige Büschelchen, in der Mitte rostrot. Vor mir, etwa zwei Körperlängen entfernt, ist Konrad. Er hat die Mäntel über den Päonien gelüpft. Seinem ruhigen Hantieren nach zu urteilen sind sie unbeschadet über die Nacht gekommen. Ich wüsste zu gern, ob er mich anschaut.
Als Kind reichte mein Sehen immerhin für Schneeballschlachten. «Wie machst du das nur, dass du uns triffst, Magdalena?» – «Wenn ihr schwätzt, weiß ich genau, wo ihr seid.» Ich habe immer auf den unteren Bereich des Körpers gezielt, nie in Richtung Gesicht. Das Beste am Schnee ist das Spontane: Einer schmeißt sich rein, der Nächste daneben, sofort ist eine Rauferei im Gange. Im Schnee ist sie selten böse. Vom Geschrei angelockt, kommen andere Buben und Mädle, und dann fliegen die Bälle. Wir waren oft zwanzig, dreißig Kinder, damals, in Freiburg.
Der Januar ist der große Vorlesemonat, das ist geblieben. Gerade ist wieder der «Oblomow» von Iwan Gontscharow dran, schon zum zweiten oder dritten Mal im Leben. Ein Buch, das so richtig zur Jahreszeit passt, von einem faulen russischen Adeligen, der gern Winterschlaf hält. Jeden Abend liest Konrad daraus vor. Zwischendurch veranstaltet er seine Kerzenorgien – in einer alten Ofenkachel Stumpen verheizen, das liebt er, einen nach dem anderen.
Ich bin ein Januarkind.
Fast wäre ich in diesem Januar 2010 gestorben.
Großvaters Farben
Mit meinen dreieinhalb Jahren wurde mir allmählich bewusst, ich bin anders als andere Kinder. Wenn die Mutter mal wieder mit Spucke meinen Hals bearbeitete und seufzte: «Du bist so dunkel! Man sieht ja nicht, ist das Dreck oder ist deine Hautfarbe so», dann fühlte ich mich fremd in der Familie, mit meinem schwarzen Strubbelkopf und meiner Haut, die im Sommer braun wurde wie Honigkuchen. Mutter war hellblond, mein Bruder Peter auch. Das liebevolle Gerede von meinen «schlechten Äugle» hatte jetzt einen Beigeschmack – der erste Mitleidsschluck, würde ich heute sagen. Natürlich war ich eifersüchtig, jedes erstgeborene Kind, das ein Geschwister bekommt, ist eifersüchtig. Statt mich an Mutter zu hängen, nahm ich jetzt oft den Weg über den Hof und ging zu Großvater.
«Ja, geh nur zum Opa!», sagte Mutter, wenn sie mich nicht brauchen konnte, weil sie sich um den Bruder oder um Vaters Buchhaltung kümmern musste. Nichts lieber als das.
«Komm, Strubele!», rief mir Großvater entgegen. Auf, auf, schnell dorthin, wo die Liebe zu haben ist. Wie ein Hündchen mit wedelndem Schwanz lief ich quer über den Hof.
Schon in der Werkstatttür hatte mich Großvater auf dem Arm. Ich umhalste ihn und krallte meine Hände in seinen seidigen weißen Bart.
«Strubele, was machen wir zwei denn heute?»
Eigentlich spielte der pensionierte Malermeister Daniel Eglin hier nur noch eine Gastrolle. Ganz verzichten auf Arbeit mochte er nicht, er machte ein paar Dinge weiter, die er gern hatte, je nach Laune. Wie seinerzeit bei den Handwerken üblich, war unser Betrieb sehr vielseitig. Küchenschränke anmalen gehörte dazu. Vor Weihnachten stand alles voll mit Kinderkaufläden und Puppenstuben. Auf diese kleinen, kniffligen Aufträge hat sich Großvater gestürzt. Wände dagegen und andere große Flächen waren Vaters Terrain, alles, was außerhalb zu erledigen war. Heilige restaurieren wiederum war natürlich Großvaters Sache. Auf dem halbhohen Sims links von der Eingangstür standen immer Dutzende Antoniusse und Josefe, Madonnenfiguren, große und kleine, und warteten. Alle brauchten sie neue Farbe.
Und zum Farbenanrühren brauchte Großvater mich, Magdalena. Wir hatten einen Farbschrank, der war deckenhoch, er nahm die ganze Seitenwand ein und hatte lauter Schübe, wie Mehlschubladen beim Krämer. Da Großvater herzkrank war und ihm schnell schwindlig wurde, musste ich auf die lange Leiter steigen.
«Hol mir ein Becherle Umbra.» Ich wusste genau, wo sich das Umbra befand. Großvaters Anweisungen, «dritte Schublade von rechts, ganz oben», brauchte ich bald nicht mehr.
«Noch ein bissle rüberlange mit der Hand, da findest du das Siena.»
«Weiß ich doch, Großvater!»
«Und noch ein Becherle Neapelgelb.»
Das mochte ich besonders, wie Eigelb mit Sahne verrührt sah es aus. Es befand sich in der untersten Reihe. Im Zweifelsfall konnte ich die kleine Farbborte sehen. Nase drauf und das linke Auge ein klein wenig fokussieren, ja, das ist «Neapelgelb», ja, das war «Elfenbein schwarz». Mit vier oder fünf Jahren konnte ich die Reihenfolge der Farbläden von oben nach unten und links nach rechts runterbeten. «Zwei Schöpferle Schweinfurter Grün, Magdalena», ordnete Großvater vom Fuße der Leiter an, und ich hielt den kleinen Becher fest am Henkel und fuhr mit ihm in die Schublade hinein. «Das darfst du nicht einatmen, Strubele. Schweinfurter Grün ist giftig.»
So lernte ich die Farben und ihre Eigenschaften kennen und ihnen die geheimnisvollen Namen zuordnen, die die Welt für sie erfunden hat: die Farbpigmente auf natürlicher Basis, Erdfarben wie Umbra und dessen Schattierungen von Leberbraun bis Kastanienbraun, die Nuancen des Ocker. Die chemischen Farben, giftige Oxyde, zum Beispiel Kadmiumgelb, das an Zitronen erinnerte, das grelle, rosthemmende Mennige rot. Am interessantesten war das Mischen, dabei hab ich, wann immer es ging, zugeschaut.
«Was ist, wenn man Blau ins Grün macht?»
«Dann gibt es Türkis.» Großvater antwortete geduldig.
Was wäre meine Kindheit ohne ihn gewesen? Keine Woche in mehr als siebzig Jahren ist vergangen, ohne dass ich an ihn gedacht hätte. Manchmal erzählte er Geschichten aus anderen Zeiten, etwa von römischen Kaisern, die Purpurrot getragen hätten, um das Volk zu beeindrucken – ein ins Violette gehendes, respektgebietendes, manchmal furchterregendes Rot.
«Auch unser Erzbischof Gröber trägt es zu manchen Festen. Verstehst du, Magdalena?»
Von diesem Conrad Gröber war bei uns zu Hause oft die Rede. Er wohnte ein paar Straßen entfernt von uns, ein hoher Herr, beinahe so alt wie mein Großvater Daniel Eglin.
Natürlich verstand ich nicht immer alles, mir genügte, an Großvaters Seite zu sitzen und ihm zuzusehen. Er konnte mit dem Pinsel bestimmte Maserungen oder Astlöcher imitieren, dass man geglaubt hat, die Möbel wären aus Eiche oder Tanne. Je diffiziler, desto mehr Spaß machte es ihm. Mit Freude und Spannung verfolgte ich, wie er Wirtshausschilder erneuerte. Wie er den verblichenen Mantel einer hölzernen Maria mit strahlendem Blau versah und am Saum ein klares Gelb daransetzte. Der letzte Akt, während die fertige Figur auf dem Sims trocknete, war die Rechnung. Meistens war sie lustig. «Dem Josef den Bart frisch geschwärzt», schrieb er und fragte, ob mir die Formulierung gefalle. «Dem Engel neue Flügel gemalt.» Bei Engelsflügeln war oft Gold gewünscht. Dann durfte ich in der Werkstatt nicht niesen, nicht pusten, nicht lachen, sonst flog das feine, teure Blattgold durch die Gegend.
Äußerlich war Großvater ein Grandseigneur. Niemals ging er ohne seine rötlich goldene Uhrkette und seinen Kastanienstock aus. In der Familie galt er als sturer und brummiger alter Mann. Ein Choleriker, vor dem sich alle fürchteten, außer mir. Nachdem er akzeptiert hatte, dass ich Magdalena bin und wenig sehen kann, mochte er mich. Lieber als meinen Vetter Leo, der schon zur Oberschule ging und schlechte Noten heimbrachte. Lieber als Ulrike, «Ricki», meine etwas jüngere Cousine, ein typisches Mädchen, das nur mit Puppen spielte. Mir gegenüber war Großvater weich und zärtlich, die Geduld in Person, lustig und sogar schwatzhaft, er, der sonst äußerst sparsam mit Worten war.
Er ist der Mann meiner Kindheit, der Herrgott all der Jahre, die für das Wachsen so bedeutsam sind. Ihm gehorchte ich, von ihm habe ich das meiste über die Welt erfahren, sogar meinen Namen habe ich von ihm. Meine Eltern wollten unbedingt, ich solle Annemarie heißen. Woraufhin Großvater, zaghaft unterstützt von Großmutter, ein Donnerwetter losgelassen haben soll: «Annemarie ist ein Soldatenliebchen-Name, er kommt in jedem scheußlichen Schlager vor. Die Kleine kriegt einen anständigen Namen, sie wird Magdalena sein. Magdalena Gertrud Bertha.» So war es üblich, hintendran Zweit- und Drittnamen zu hängen, Gertrud war meine gestrenge Patin vom Dorf, Bertha meine sanfte, liebe Großmutter, Frau des Annemarie-Verächters Daniel Eglin.
Zu mir hat mein Rufname gut gepasst, mit Maria Magdalena, der Sünderin, die Jesus die Füße wäscht und sie mit ihren langen Haaren trocknet, konnte ich gut auskommen. Das ist nicht eine dieser süßlichen, langweiligen, immer korrekten Heiligen. Sie ist oft von Dämonen besessen gewesen, genau wie ich, und hat interessante Aufgabenbereiche – Schutzpatronin der verführten Frauen, der Winzer, der Studenten, Friseure und Handschuhmacher. Madeleine, die französische Variante, hätte mir noch besser gefallen.
Großvater ruft! Jeden Morgen um halb neun stehe ich vor seiner Tür, Mutter liefert mich dort ab.
«Ist die Kleine fertig? Ist sie sauber?»
Natürlich bin ich fertig! Blitzsauber! Gekämmt und gewaschen, mit einer kleinen Umhängetasche ausgerüstet, die ein Vesper für unterwegs enthält. Und ich weiß, dass er weiß, wie sehr ich auf ihn warte, darauf, dass er seinen Hut aufsetzt und ich an seiner Hand hinaus auf die Straße hüpfen darf. Raus und dann um die Ecke, wo die große Schlossbergstraße verläuft, die zum Schwabentor führt und der entlang eines der vielen Freiburger Bächle fließt. Großvater geht schön langsam, man muss ihm nicht nachrennen. Autos kommen damals nur alle Jubeljahre vorbei, die Lastkarren haben meistens noch Pferde vorgespannt, zum Beispiel der Mann, der Blockeis für die Eisschränke bringt.
«Schauen, Magdalena. Schauen!»
Er sagt nie wie die anderen, dass ich nicht sähe, von ihm höre ich nichts Besorgtes, sondern nur Gescheites und viel Schönes. Beim Spazieren sehe ich schemenhaft die große Villa mit Riesenvorgarten und Kiesweg, vor der der Kutscher den Eiswagen postiert hat. Das Pferd ist braun und das Schild an der Ladefläche blau, darauf steht, wie Großvater mir erzählt, «in deutscher Schrift» das Wort EIS. Galock, galock, setzt sich das Pferd in Bewegung, galock, ganz leicht, anders als der Schritt der schweren Pferde, die den Bierwagen ziehen, die machen ga-lo-ck, ga-lo-ck-ck-ck. Ich hab mir vorgestellt, die haben so dicke Beine wie die Elefanten, die ich im Zirkus gesehen hab. «Elefantenpferde» hab ich sie getauft, «Kaltblüter», die Bezeichnung, die die Erwachsenen benutzen, finde ich ganz falsch. Denn sie fühlen sich warm an, das hab ich selbst überprüft, und die Rossbollen von denen dampfen.
«Warum können Elefanten so leis laufen, Großvater?»
«Weil sie keine Eisenschuhe haben.»
«Und warum quietschen die Schuhe vom Onkel Herbert so?»
«Weil er Gummischuhe hat und es auf dem Trottoir nass ist.»
«Warum knurren die Schuhe vom Kutscher? Grrrr. Grrrr.»
«Weil er sie nicht bezahlt hat.»
«Ist das wahr?»
«Nein, Strubele. Aber sag es niemand.»
Großvater und ich hüten unsere Geheimnisse, ebenso wie wir unsere Gefühle füreinander vor den anderen verbergen. Manchmal legt er mir sachte die Hand auf den Kopf, eine Art der körperlichen Berührung, vielleicht die einzige, die ich uneingeschränkt mochte.
Von allen Fußwegen meines Lebens ist mir der auf den Schlossberg, Hand in Hand mit Großvater, am deutlichsten in Erinnerung geblieben: Die waldige Anhöhe hinauf, durch eine hellere Zone und weiter, pochenden Herzens, durch eine tiefschattige, aus der oft der Waldhüter heraustrat mit seinem riesengroßen, kohlschwarzen Hund. Ein Bekannter von Großvater, also keiner, den ich wirklich fürchten musste. Unser tägliches Ziel war der «Rastewanderer», eine Bank, in deren Rücken sich eine künstliche, bemooste Felswand erhob. Über der Sitzlehne waren Verse eingelassen, die mir Großvater jedes Mal vorlas: «Raste, Wanderer, bedenke …» Er war so außer Puste, dass ich die Worte niemals richtig mitkriegte, es ging um den Wunderbau des Münsters, das man von dieser Anhöhe so gut wie sonst nirgends betrachten konnte. Noch immer außer Atem war er plötzlich mitten im Lobpreis Gottes. Eine schnaubende höchstpersönliche Andacht, dazu ließ er meine Hand für einige Minuten los. Bei Sonne konnte auch ich den Turm erahnen, morgens war er eine spitz zulaufende Fläche aus hellrotem Sandstein, abends, wenn das Maßwerk von Westen durchglüht war, eine schwarze, durchbrochene Silhouette. Beides unvergessliche Bilder, die ich hinübergerettet habe ins Heute, in die beinahe totale Blindheit.
«Weiter!», rief ich Großvater zu. Weiter, ich wollte endlos weiterlaufen, ins Unbekannte, das man nicht sah. Das Entfernte erschloss sich ja nur, wenn ich die Beine benutzte und wenn ich da war, ganz nahe ranging. Großvater verbot mir nichts. «Lauf bis zur nächsten Wegkreuzung, Strubele», forderte er mich auf. «Lauf bis zu dem Baum.» Er setzte mir kleine Ziele. Vor allem der zweite Aussichtspunkt auf unserem Weg gefiel mir sehr. Dort lagen neben der Bank Kanonenkugeln aufgeschichtet, und die konnte ich anfassen. Wie kamen sie nur dahin? Was ist Krieg, und warum streiten sich Länder? Bei diesem Thema war Großvater immer einsilbig, denn er hatte selbst einen Krieg mitgemacht, den Ersten Weltkrieg. Statt Antworten gab es jetzt Vesper. Täglich einen Apfel, «der die Wangen rot macht», und ein wenig Schwarzbrot mit Butter. Ich kaute. Wir schwiegen eine Weile, und dann war er wieder bei den Raubrittern auf ihren Burgen, ich fragte, er erzählte – von Barbarossa, einem Kaiser mit rotem Bart, von Rehen und Eichhörnchen, bis seine Stimme dünn und krächzend wurde.
Im Weitergehen nahm Großvater eine Veilchenpastille zu sich oder ein Karlsbader Tablettchen, das sei «gut gegen Heiserkeit».
«Hast du Halsweh?»
«Ja, Strubele. Ein wenig.»
Sein Halsweh war der Vorbote einer schweren Krankheit. Er würde daran sterben, noch bevor meine Kindheit richtig zu Ende war.
Februar
Dieses Jahr ist die Amsel früh. Wir hatten Jahre, da sang sie erst im März. Voller Ungeduld lausche ich in den Morgen, meistens bin ich schon wach, bevor sie loslegt. Lieder mit vielen, vielen Strophen, unterbrochen von rauem Gezwitscher. «E-i-i-i, wi-wi, e-e-e», die richtigen Vokale dafür zu finden ist eigentlich unmöglich, fürs «Amselisch» wäre Notenschrift geeigneter. Ein Franzose soll mal probiert haben, den Gesang der Vögel aufzuzeichnen, Olivier Messiaen, ein Ornithologe und Komponist. Es heißt, er hätte mit Stift und Notenblatt hinterm Busch gesessen.
Eine ganze Handlung wird im Amsellied ausgebreitet. Es war einmal ein schönes Mädchen, das wollte nach Indien, und das hat mich ver-la-ha-has-sen. Mit Hilfe solcher Blödsinns-Sätze versuche ich, mir die Melodie einzuprägen. Ist es derselbe Vogel, der schon letztes Jahr oben im Apfelbaum saß? Konrad meint auch, es ist der Amselmann mit der weißen Schwungfeder, der schon lange in unserem Garten sein Brutrevier hat. Jeder singt ein wenig anders, und die Alten beherrschen die Kunst am besten. Der Mensch hält es für eine süße Romanze, eigentlich ist es ein Kampfgesang: Rivalen! Wer sich mir nähert, der wird in der Luft zerrissen!
Amseltirilieren und der Gestank von Dung, jedes auf seine Weise durchdringend und unverschämt, das ist der Frühling im Markgräflerland. Konrad hat von seinem Freund Edmund drei Schubkarren Kuhmist abgeholt und auf dem Kartoffelacker und dem Gemüsestück ausgestreut, der Boden ist jetzt hinreichend aufgetaut.
Gestern hat er die Tomatensamen in die Erde gebracht. «Hundertfünfzig!», verkündete er stolz, noch halb auf der Speichertreppe. Die Pflanzschalen da oben seien fertig, nach Sorten gekennzeichnet. Berner Rose, Ochsenherz, Harzfeuer, Kirschtomaten und «noch eine von der Nachbarin». Kaum zeigt der Kalender Februar, packt Konrad die Unruhe. Wer im ärmsten Schwarzwald groß geworden ist, der kann es nicht lassen. Wir werden nicht des Hungers sterben! Für die Tomatenschwemme ist schon gesorgt, die Gurken-Zucchini-Blumenkohl-Salat-Kürbis-Schwemmen werfen ihre Schatten voraus!
Und ich? Brenne auf Sparflamme. In diesem Jahr wird Konrad zum ersten Mal auf meine Fingerfertigkeit beim Tomatenpikieren verzichten müssen. Pflänzchen mit Ballen anreichen – er. Auseinanderzupfen und vereinzeln – ich. In die Erde stecken – er. Unsere alte Arbeitsteilung bei vielen Dingen: Konrad das Grobe, ich das Feine.
Kaum vorstellbar, ein Gartenjahr, in dem ich nichts oder fast nichts tue. Bis zum Oktober, bis zu der großen Operation am Herzen, werde ich Statistin sein. Schrecklich! Dieses Anschwellen der Geschäftigkeit nach der Winterruhe, das hierzulande meist zusammenfällt mit der Fasnet, habe ich immer sehr gemocht. In den Reben sind sie jetzt schon zugange. Höchste Zeit zum Rebholzschneiden, am Südhang, sagt Konrad, treibt der Wein schon aus.
Besonders in den Jahren, als wir noch neu waren im Dorf, haben wir beim Rebholzsammeln mitgemacht. «Wir bruche einander», unter dem Motto lief damals noch vieles. Rebholzsammeln war eine der Gemeinschaftsarbeiten, bei der auch die Kinder mitmachten: das abgeschnittene Holz auflesen, zu Häufle setzen, sogenannte Rebwellen, die dann im Winter in den Schlund der Kachelöfen gesteckt wurden. Dreijährige hoppelten da schon mit. Mit den ganz Kleinen bin ich auf allen vieren durch die Reihen gekrochen. Weil sie so elend lang waren, hat Konrad für die jüngsten Arbeiter alle paar Meter ein Schokolädle hingelegt, oder Weihnachtsbrötle, die noch übrig waren.
Nie habe ich morgens so viel Zeit gehabt, der Amsel zuzuhören. Die Beatles haben mal einen Song über die Amsel gemacht, ich weiß noch, wie überrascht ich damals darüber war. 1968, in dem Jahr, als wir unser Haus bauten.
«Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life, you were only waiting for this moment to arise.»
Das ist mein Lied.
Zimmerschule
Manchmal steht das Leben still. Das habe ich zum ersten Mal erfahren im Januar 1938, ich war noch kein Schulkind. Krankheit und Tod – die erste Lektion.
Den ganzen Monat über lag ich auf dem Sofa, unterm Daunenplumeau, und grub darin immer neue Mulden für meine schönen, sehr wichtigen Spielsachen: Perlen und die bunten Kugeln zum Muster auslegen, alles, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, und meinen geliebten Bilderbaukasten. Ich war krank. Eine dicke schmerzende Backe plagte mich, es hieß, ich hätte einen «Eiterherd». Großvater hätte es mir sicherlich genauer erklärt, der kam jedoch nicht, denn auch Großmutter war krank. Man sagte mir, sie würde nicht einmal mehr sprechen.
Eine himmlische Ruhe um mich herum, ich bin allein und trotzdem geborgen. Und dann, an dem Abend, als die Eiterbeule aufgeht, ist alles schlagartig vorbei. Auf einmal ist unsere Wohnung voller Verwandter. Eben noch hat Mutter mir das eklige Zeug aus dem Mund gewischt und mir erlaubt, bis um acht zu spielen, da werden mir die Spielsachen entrissen. Um acht ist komischerweise niemand still. Wenn das Deutschlandlied aus dem «Körting» kommt, muss man doch still sein! Wie es sich gehört, postiere ich mich vor dem Radio und reiße die rechte Hand hoch, so wie auf den Bildern, auf denen der Führer abgebildet ist. Jetzt noch das zweite Lied, «Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen, SA marschiert». Ich stehe stramm in meinem Pyjama, und die Erwachsenen reden über die Musik hinweg, wild durcheinander.
«Else, Johann! Kommt, es ist so weit», ruft Tante Regina. Sie ruft wie zu Weihnachten, nur ohne Glöckchen und mit zittriger Stimme. Alle verschwinden aus dem Zimmer, und ich bleibe, niemand hat mich an der Hand genommen.
Am anderen Morgen stehe ich am Bett der Großmutter. Meinen kleinen Bruder haben sie nicht zu ihr gelassen, vielleicht weil sie wissen, er wird fragen, und ich bin schon groß und weiß, dass man nicht fragen darf. «Oma ist tot.» Heimlich fasse ich unter ihre Bettdecke, ihr Bein ist kalt, es fühlt sich ganz hart an. Das ist tot? Erschrocken drücke ich mich an Großvater, er zittert.
«Großvater, du wackelst so. Frierst du?»
«Magdalena, sei still», flüstert meine Mutter. «Großvater weint.»
Wenige Monate darauf starb mein Großvater mütterlicherseits, und ich begegnete noch einmal dem Tod. Ich hatte Großvater in dem großen modernen Haus am Alten Messplatz besucht. Noch nie hatte ich ihn in dem hohen Doppelbett gesehen. Die Abendsonne schien herein und erleuchtete das Gelb der Decke, und davon hob sich ganz deutlich seine Hand ab. Meine Güte, hab ich gedacht, Großvater ist doch Schlosser, warum ist die Hand so weiß?
«Opa ist herzkrank.»
Weiße Hände und herzkrank, das eine hat sich mit dem anderen für immer in meinem Kopf verbunden. Unsere Familiengeschichte ist bevölkert von Herzkranken, das Herz ist der schwächste Punkt bei uns.
Den Schlossergroßvater mochte ich, weil er so schön von seinem Handwerk erzählen konnte, vom Bohren und von den Maschinen. Zwei, drei Mal hat er mich in seine Werkstatt mitgenommen, nach Dienstschluss, sonst wären die Sägen und all das zu gefährlich für mich gewesen. Und außerdem gehörte sein Reich ihm nicht allein, es war Teil einer großen Firma für Büromöbel. Es hat dort nach Holz gerochen, nach Lacken vor allem. «Der schafft in der Fabrik», sagte mein Malergroßvater verächtlich über den Schlossergroßvater – ein Lohnsklave in seinen Augen, der nichts zu bestimmen und nichts zu vererben hatte.
Von der Frau meines Schlossergroßvaters, also Mutters Mutter, wurde gemunkelt, sie habe sich eines jungen Mannes wegen das Leben genommen, vor langer Zeit schon. Vor Großvaters zweiter Frau, unserer strengen Stiefoma Wilhelmine, habe ich mich gefürchtet. Sie war hart, sehr genau, verlangte unbedingte Unterordnung. Eine noch ziemlich junge resolute Dame, die den gemütlichen, immer werkelnden Großvater sehr verwöhnte und so verteufelt gut bekochte, dass er binnen kürzester Zeit aus den Nähten platzte. Herzverfettung habe die Todesursache gelautet. «Mord auf Raten», sozusagen, wieder so ein Gerücht, das Familienurteil lautete «schuldig». Mit dem Tod des Schlosseropas verlor ich eines der leuchtenden, schönsten Bilder meiner Kindheit. In dessen Wohnzimmer nämlich war unterm Fenster ein kleines Podest, von dort konnte man runter auf den Freiburger Jahrmarkt gucken, auf die vielen bunten Schirme der Stände, abends auf die Lichter der Karussells, die heulende Achterbahn und die große Fläche, die immer grün wurde, «die Raupe».
Jahrmarkt! Ich war ein Jahrmarktskind! Nicht Achterbahn, nicht Raupe, ich liebte das alte Kettenkarussell. Rote Brettle, wo man drauf sitzt, an vier Ketten, vorne ein Stab, der sorgfältig zugemacht wird wie bei unserer kleinen Schaukel im Hof. Und dann fängt es langsam an, immer weiter nach außen zu trudeln, das ist für mich der größte Genuss. Ich fliege! Die Erde liegt unter mir. Ich hab die Augen aufgerissen, niemals hab ich die Augen zugemacht. Ich fliege! Über die Wiese, über den Bach, jetzt, jetzt bin ich über dem Schlossberg, jetzt über dem Münster.
In unserem Familienhaus in der Erasmusstraße ging das Leben weiter.
«Sei nicht traurig, Großvater. Du hast doch mich!»
«Ja, Strubele. Ich weiß.»
Nach Großmutter Berthas Tod ging Großvater immer in den dritten Stock zu seiner Tochter Regina zum Essen. «Männer müssen versorgt werden!» Mir war nicht ganz klar, warum Männer nicht selber kochen können. Da oben bei Tante Regina und Onkel Anton, dem dummen Leo und der affigen Ricki würde er es gut haben. Es ging feiner zu als in jeder anderen Etage, denn der Onkel war Prokurist bei einer Textilfirma, «ein halber Direktor». Auch das verstand ich nicht, wer reich ist und wer nicht, in dieser Hinsicht war ich das unaufgeklärteste Kind unter der Sonne. Mich interessierten andere Dinge an Onkel Anton. Er war ein «Kriegsverzehrter», vom Ersten Weltkrieg her. Der Krieg hatte etwas von ihm verzehrt. Wie und was? War mir ein Rätsel.
Eines Morgens kamen die Eltern ins Kinderzimmer, sie kamen beide, das passierte sonst nie. Vater sprach leise zu Mutter, er hatte eine ganz andere Stimme als die, die ich kannte, und roch nach Sonntag, nach glattem Gesicht.
«Magdalena, Vater will dir auf Wiedersehen sagen. Er muss fort. Es ist Krieg gekommen.» Auch Mutter klang bedrückt.
Mir fielen sogleich Onkel Anton ein und die Kanonenkugeln am Schlossberg. «Pass auf», riet ich Vater, «vor allem, wenn die ganz großen Bollen kommen.» Er schien gar nicht zuzuhören. Er legte mir Schokolade in die Hand und noch etwas auf den oberen Bettrand «für abends, wenn ich nicht mehr da bin». So ungewöhnlich war es nicht, dass er am Abend nicht zu mir kam, oft genug hatte er Kegelclub, und ich dachte, das wird diesmal auch nicht anders sein. Nachts lauschte ich. Und noch eine Nacht und noch eine, kein Klimpern des Schlüsselbundes. Den hatte ich noch nie überhört, wenn Vater fidel vom Kegeln kam, die Haustür sich öffnete und aus der Masse der Schlüssel ein weiterer herausgezogen wurde, der seine Privatschublade öffnete, in der seine Schokolade war. Vater war ein Nascher, und er teilte fast nie.
Vater kam nicht. Mutter schaltete viel den «Körting» an, der früher hauptsächlich samstags oder sonntags spielte. Im Radio wurde viel geschwätzt, Soldatenmusik gemacht, und mich störte den ganzen Vormittag niemand beim Spielen. Ich baute schöne, große Sterne am Wohnzimmertisch und murmelte vor mich hin: «Krieg. Krieg. Sieg.» Manchmal grölte ich «Sieg heil» wie die Männer im Radio. Später sagte Mutter: «Gott sei Dank ist Vater bei der Baukompagnie.»
«Bauen die Häuser? Und wo?»
«Fängst du schon wieder mit dem Fragen an!»
«Wo ist Vater?»
Ich erfuhr, dass sie einen «Westwall» machten, einen großen Graben mit Bunkern. Schon wieder ein neues fremdes Wort: «Bunker». Vater war im September 1939 nicht so weit weg. Er musste nicht wie viele andere Männer «nach Polen», sondern war «am Kaiserstuhl, an der Grenze zu Frankreich». Auf der anderen Seite lagen französische Soldaten auf der Lauer, diese saßen momentan nur da und schossen noch nicht.
Nach einer Weile, im Frühjahr, konnten wir ihn sonntags besuchen, auf einem Bauernhof, der ziemlich dreckig war, mit angeschlossener Wirtschaft. Ein Bach floss direkt vor der Tür her. Das genoss ich überaus, wir Kinder konnten dort wunderbar herumrennen und allerhand anstellen. «Der Fuchs geht um» und «Goldne, goldne Brücke» und «Dornröschen war ein schönes Kind» spielten wir. Unweit war das Schloss Neuershausen, wo viele Soldaten und Pferde untergebracht waren. Einmal rief ich in die Menge: «Links, hinterm Hauptmann stinkt’s!» Und der lachte und sagte, das seien die Bollen von seinem alten Gaul. Viele Soldaten lachten mit, so fürchterlich laut, dass ich mich schämte.
Im Krieg wurde ich nicht mehr so oft gescholten, weil Vater nicht da war und Mutter viel mehr im Geschäft zu tun hatte und Großvater oft zu müde war, mit mir etwas zu unternehmen. So brachte mir diese Zeit vor allem ziemlich viel Freiheit. Außerdem ging es glücklicherweise nun doch mit der Schule los. Zuerst hatte ich Angst, sie würden mich nicht lassen, ein Jahr war ich schon zurückgestellt worden.