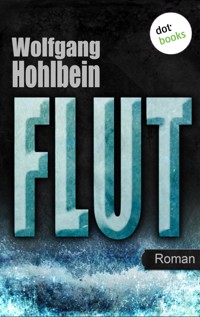5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Andrej und Abu Dun
- Sprache: Deutsch
Sonderband der spektakulären Vampir-Serie vom Fantasy-Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein!
Die Jagd nach einem bestialischen Werwolf führt die Unsterblichen Andrej und Abu Dun immer tiefer in unbekannte Länder. Deren eisige Kälte und unwirtliche Landschaften bringen sie an den Rand ihrer körperlichen und geistigen Kräfte. Täuschung und Wahrheit liegen so dicht beieinander, dass Andrej zweifelt, wem er auf dem Weg durch die Schneewüste trauen kann. Gequält von den Dämonen des eigenen Gewissens, steht er bald selbst an der Schwelle zum Wahnsinn. Es kommt zum entscheidenden Kampf mit den Werwölfen ...
"Blutkrieg" umfasst fünf zusammenhängende Episoden rund um die Chronik der Unsterblichen. Dabei werden die Abenteuer erzählt, die Andrej und Abu Dun zwischen den Band 8 ("Die Verfluchten") und Band 9 ("Das Dämonenschiff") erleben. In "Das Dämonenschiff" setzt die Handlung dort ein, wo sie in "Blutkrieg" endet.
Wolfgang Hohlbeins erfolgreicher Fantasy-Zyklus "Die Chronik der Unsterblichen" als eBook bei beBEYOND. Die weiteren Folgen:
Band 1: Am Abgrund
Band 2: Der Vampyr
Band 3: Der Todesstoß
Band 4: Der Untergang
Band 5: Die Wiederkehr
Band 6: Die Blutgräfin
Band 7: Der Gejagte
Band 8: Die Verfluchten
Band 9: Das Dämonenschiff
Band 10: Göttersterben
eBooks von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Blutkrieg
Odins Raben
Gefangen im Geisterhaus
Der Hexenfelsen
Wolfsdämmerung
Über das Buch
Band 8 der spektakulären Vampir-Serie vom Fantasy-Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein! Libyen im 16. Jahrhundert: Mitten in der Wüste werden der Schwertkämpfer Andrej und Abu Dun von Sklavenhändlern überfallen. Um sich Zugang zur Festung der Sklavenhändler zu verschaffen, lassen sich die Unsterblichen zum Schein gefangen nehmen. Ein vorschneller Entschluss, wie sie zu spät feststellen müssen, als sie dem Anführer Ali Jhin und seinen dreihundert Räubern waffenlos gegenüberstehen ...
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern am Niederrhein, umgeben von einer Schar Katzen und Hunde. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart. Seine Werke wurden in 47 Sprachen übersetzt und mit über zwanzig nationalen und ungezählten internationalen Preisen ausgezeichnet. Weitere Informationen unter: www.hohlbein.de.
WOLFGANG HOHLBEIN
BLUTKRIEG
beBEYOND
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe
© 2007 by LYX.digital, Köln
Für diese Ausgabe
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Redaktion: Dieter Winkler
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Betty4240 | Colin_Hunter | Vadmary; © shutterstock: Dm_Cherry
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-5909-1
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Blutkrieg
Mit dem ersten Grau der Dämmerung hatte es zu regnen begonnen und seither nicht wieder aufgehört. Der Wind peitschte ihnen die silbergrauen Schleier jetzt fast waagerecht in die Gesichter. Und die eisige Nässe war längst durch Andrejs Kleider gekrochen, hatte seine Knochen erreicht und ließ ihn vor Kälte mit den Zähnen klappern. Andrejs Finger waren steif gefroren, und er hatte Mühe, die Zügel zu halten.
Unsterblich zu sein, dachte er missmutig, schützt ja vielleicht gegen so manches, aber leider nicht davor, ebenso zu frieren und unter Müdigkeit und Erschöpfung zu leiden wie jeder andere auch. Aber vielleicht gilt das nur für mich, beendete er seinen Gedanken mit einem schrägen Seitenblick auf Abu Dun und einem Gefühl, das zwischen Bewunderung und blankem Neid schwankte.
Der riesenhafte Nubier hatte während des gesamten Tages nicht einen einzigen Laut der Klage von sich gegeben, ja, nicht einmal eine Miene verzogen. Obwohl Andrej sicher war, dass der an die erbarmungslose Hitze und Trockenheit seiner afrikanischen Heimat gewöhnte Nubier viel mehr unter dem rauen Klima so weit oben im Norden litt als er.
Vielleicht war die ungewöhnliche Schweigsamkeit, die Abu Dun seit einer Weile an den Tag legte, seine Art, gegen das Wetter und die ständig fallenden Temperaturen zu protestieren. Und gegen Andrejs Entscheidung hierherzukommen selbstverständlich.
Im Stillen hatte Andrej diesen Entschluss längst bereut. Es war fast sechs Monate her, dass sie das kleine Dorf an der Mittelmeerküste verlassen hatten, um der Spur des Werwolfes zu folgen, der die Menschen in diesem Teil des Landes fast den ganzen Winter über in Angst und Schrecken versetzt und einen ganzen Landstrich terrorisiert hatte.
Sie waren im Frühling aufgebrochen und in den Sommer Osteuropas hineingeritten, und mittlerweile hatten sie einen halben Kontinent durchquert und näherten sich nicht nur der Küste, sondern auch dem Ende des Jahres.
Annähernd sechs Monate, dachte Andrej, ohne dass sie die Bestie auch nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen hatten. Nicht dass er nicht sicher war, auf der richtigen Spur zu sein. Andrej hatte schon lange aufgehört zu zählen, wie viele Vampyre, Werwölfe, Dämonen und andere Ausgeburten der Hölle Abu Dun und er getötet hatten. Aber er konnte sich nicht erinnern, jemals einer solchen Spur aus Leid und Verwüstung gefolgt zu sein.
Wie viele Menschen hatte das Ungeheuer getötet: fünfzig? Hundert? Er wusste es nicht. Er wusste nicht einmal genau, was es war, das sie verfolgten, er wusste nur, dass …
Das Knacken eines zerbrechenden Zweiges riss Andrej jäh aus seinen Gedanken. Jedem anderen wäre das Geräusch möglicherweise entgangen, doch für Andrejs feine Sinne klang der Laut so scharf und bedrohlich wie ein Peitschenhieb. Neben ihm fuhr auch Abu Dun fast unmerklich zusammen und ließ die Schultern dann wieder in einer Haltung perfekt gespielter Erschöpfung nach vorne sinken.
»Links«, murmelte der Nubier, »fünfzig Schritte hinter den Bäumen.«
Andrej antwortete mit einem angedeuteten Nicken, widerstand aber der Versuchung, in die von Abu Dun bezeichnete Richtung zu sehen.
Das Geräusch wiederholte sich nicht, aber nun, einmal darauf aufmerksam geworden, spürte er die Anwesenheit eines Beobachters fast so deutlich, als könnte er ihn sehen. Ohne das seidige Geräusch des Regens hätte er vermutlich seine Atemzüge hören können.
Er ließ sein Pferd langsamer traben, hielt schließlich ganz an und drehte sich mit schon fast übertrieben wirkenden Bewegungen im Sattel nach links und rechts.
Alles rings um sie herum war grau. Der strömende Regen hatte nicht nur die Temperaturen ins Bodenlose fallen lassen, sondern auch alle Farbe aus dem Tag gewaschen. Vor ihnen fiel die mit kümmerlichem Gras und dürrem Buschwerk bewachsene Ebene, über die sie seit Stunden ritten, sanft zur fernen Küste hin ab. Die Bäume, von denen Abu Dun gesprochen hatte, entpuppten sich als die Ausläufer eines struppig wirkenden Waldstücks, das sich wie eine Hand mit viel zu vielen Fingern über den Hang erstreckte.
Links davon, vielleicht drei- oder auch vierhundert Schritte entfernt, erhob sich ein Gewirr aus Felstrümmern, die im strömenden Regen wie matte, unbehandelte Edelsteine glänzten.
Abu Dun deutete heftig gestikulierend zu diesen Felsen hin. Andrej antwortete mit einem ebenso übertrieben deutlichen Nicken. Daraufhin gab der Nubier seinem Pferd die Sporen und sprengte auf die Felsgruppe zu. Andrej sah ihm einen Moment lang reglos nach, dann lenkte er sein Pferd auf den Waldrand zu. Wer immer sich dort verbarg und sie beobachtete, musste jetzt annehmen, dass Abu Dun irgendetwas bei den Felsen überprüfen wollte, während er selbst den Waldrand ansteuerte, um dort zu rasten.
Andrej ließ sich Zeit. Er musste sein Pferd zurückhalten, das die Nähe des Waldes spürte und ihm entgegenstrebte. Vielleicht, weil es das saftige Grün witterte, vielleicht auch, weil das Tier es, genau wie sein Reiter, einfach leid war, Stunde um Stunde durch den strömenden Regen zu laufen.
Zehn Meter vor dem Waldrand sprang Andrej aus dem Sattel, ließ das Tier einfach laufen und steuerte die weit überhängenden Äste einer gewaltigen Buche an, wie um sich unterzustellen. Er wählte ganz bewusst eine Stelle, die ein ganzes Stück von der entfernt war, an der er den Beobachter vermutete. Geduldig wartete er, bis er Abu Duns Nahen spürte. Dann schlenderte er wie zufällig in die Richtung, aus der er die verstohlenen Atemzüge und das Hämmern zweier angsterfüllter Herzen hörte, und sprintete los. Mit zwei, drei gewaltigen Sätzen erreichte er den eigentlichen Waldrand und brach rücksichtslos durch das Unterholz. Die dürren Äste zersplitterten wie Glas, als er sich durch sie hindurchwarf, und Andrej sah einen Schatten davonhuschen und hörte ein erschrockenes Keuchen. Er hatte nur einen flüchtigen Eindruck von einer dunklen, sonderbar heruntergekommenen, asymmetrisch wirkenden Gestalt bekommen, die zwischen den Bäumen verschwunden war.
Blitzschnell griff er zu und bekam auch etwas zu fassen, aber nur für einen Moment, dann hörte er das Reißen von Stoff und stolperte hinter dem Flüchtenden her. Andrej musste all seine Schnelligkeit aufbieten, um ihn einzuholen und schließlich mit einer wütenden Bewegung zu Boden zu schleudern.
Ein keuchender Schrei erscholl und der Mann trat noch im Fallen nach Andrejs Gesicht und traf auch. Andrej knurrte wütend, spuckte Blut und den Splitter eines Zahnes aus und griff noch einmal fester zu.
Aus den verzweifelten Schreien des Mannes wurde ein ersticktes Keuchen. Und Andrej prallte erschrocken zurück, als ihm plötzlich klar wurde, dass der Mann verstümmelt war. Seine Kleider hingen in Fetzen und die Haut darunter war von tiefen, schwärenden Wunden übersät. Er trug ein vielleicht sechs- oder siebenjähriges Kind im linken Arm, das er selbst jetzt noch mit aller Kraft an sich presste. Sein rechter Arm fehlte, er endete dicht über dem Ellbogen in einem unordentlichen Wust blutgetränkter Verbände, von denen ein erbärmlicher Gestank ausging.
Für einen Moment weckte der Anblick eine uralte, düstere Gier in Andrej. Er kämpfte das Gefühl mit aller Macht nieder und richtete sich wieder auf.
Der Verwundete versuchte erneut, nach ihm zu treten, und ließ endlich das Kind los. Als es davonkroch, rutschte sein Kleid hoch und Andrej sah, dass es ein Mädchen war. Wieder wollte der Verwundete nach ihm treten. Andrej schlug seinen Fuß zur Seite, achtete aber darauf, nicht zu hart zu treffen. Er spürte die Qualen, die der Mann litt.
»Verdammt noch mal, hör endlich auf«, sagte er. »Ich bin nicht dein Feind.«
Der Verwundete stöhnte. Andrej warf einen raschen Blick zu dem Mädchen hin. Es hatte sich zwei oder drei Schritte weit geschleppt und kauerte nun dort – zitternd vor Angst und an einen Baumstamm gelehnt. Andrej beugte sich wieder vor und betrachtete das Gesicht des sterbenden Mannes aufmerksamer.
Erneut stieg ihm der Geruch von Blut und Fäulnis in die Nase, und wieder flackerte die archaische Gier in seinem Inneren auf, doch diesmal bereitete es ihm keine Mühe, sie zu unterdrücken, spürte er doch auch zugleich den Tod, der seine Klauen bereits zu tief in das Fleisch des Mannes geschlagen hatte. Er würde sterben. Keine Macht der Welt konnte das jetzt noch verhindern. Sein Blut war bereits vergiftet und würde selbst für Andrej zu einem Schluck aus dem Schierlingsbecher werden.
Das Gesicht des Mannes war aschfahl, Schweiß glänzte auf seiner Stirn und seine Augen hatten einen trüben, fiebrigen Glanz. Andrej war nicht sicher, dass er seine Worte überhaupt noch hörte, dennoch fuhr er fort: »Ich bin nicht dein Feind, ich will dir nichts tun. Verstehst du das? Ich will dir helfen!«
Der Mann begann, irgendetwas zu stammeln. Fieberfantasien ohne Sinn vermutlich, doch Andrej beugte sich ein wenig weiter vor, um sein Ohr näher an seine Lippen zu bringen.
Dann – plötzlich – loderte etwas in den Augen des Verwundeten auf, und das Entsetzen darin gewann eine neue, noch schlimmere Qualität, während sich sein Blick an einem Punkt irgendwo hinter Andrej festsaugte. Er hörte leise Schritte und das Rascheln von Stoff. Abu Dun war gekommen.
Im gleichen Moment stieß das Mädchen einen schrillen, sich überschlagenden Schrei aus. »Dauga!«
Und dann schien alles gleichzeitig zu geschehen.
Der Verwundete bäumte sich noch einmal und diesmal höher auf. Ein gurgelnder Schrei kam über seine Lippen und seine verbliebene Hand zuckte zum Gürtel und riss einen kurzen, beidseitig geschliffenen Dolch mit schartiger Klinge hervor, der sich wie der Giftzahn einer angreifenden Schlange in Andrejs Hals bohren wollte.
Abu Dun stieß ein überraschtes Knurren aus und Andrej warf sich zur Seite und schlug in der gleichen Bewegung mit dem Handrücken nach dem Unterarm des Verletzten. Er hatte den Angriff kommen sehen, sodass es ihn kaum Mühe kostete, ihn abzuwehren.
Was er vergessen hatte, war das Kind. Andrej sah auch diese Bewegung im letzten Moment aus den Augenwinkeln. Ein rasendes Huschen, das auf ihn zusprang, doch diesmal kam seine Reaktion zu spät. Auch das Mädchen hielt plötzlich eine Waffe in der Hand. Eine dünne bösartige Klinge, die mit einem hässlichen Geräusch durch sein Hemd schnitt und einen weiß glühenden, grässlichen Schmerz tief in seinen Leib hineintrieb.
Andrej brüllte vor Qual, krümmte sich und schlug die schmale Hand mit solcher Kraft beiseite, dass das Mädchen mit einem Schmerzensschrei zurücktaumelte und zu Boden ging. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Er fiel auf die Knie, sank nach vorne und fing seinen Sturz in letzter Sekunde mit dem ausgestreckten Arm ab. Die andere Hand presste er gegen seine Seite, in der noch immer eine unbeschreibliche Qual wühlte. Warmes Blut quoll zwischen seinen Fingern hervor und sein Blick begann sich zu verschleiern.
Wie von weither registrierte er, wie der Verletzte aufsprang und davontaumelte.
»Das Mädchen«, keuchte Andrej. »Abu Dun, hol das Mädchen!«
Für einen kurzen Augenblick schwanden ihm endgültig die Sinne. Er fiel zu Boden, und als sich die Schwärze vor seinen Augen endlich wieder lichtete und der hämmernde Schmerz in seiner Seite verebbte, war er nicht einmal sicher, diesen Kampf tatsächlich gewonnen zu haben.
Abu Dun ragte schwarz und riesengroß über ihm auf. Irgendetwas Kleines, Zappelndes an sich gepresst, das vor Angst kreischte, dennoch aber versuchte, ihm mit scharfen Fingernägeln das Gesicht zu zerkratzen. Der erste Laut, den Andrej wieder durch das Hämmern seines eigenen Herzschlages hörte, war das dunkle, gutmütig-spöttische Lachen seines Freundes.
»Kommst du allein klar, Hexenmeister, oder soll ich dir beim Aufstehen helfen?«
Andrej verzichtete vorsichtshalber auf eine Antwort und beließ es bei einem wütenden Blick in Abu Duns nachtschwarzes, breites Grinsen. Dann setzte er sich auf und sah an sich herab.
Die Wunde hatte aufgehört zu bluten, der Schmerz war erloschen und die Haut unter dem handlangen Riss, der plötzlich in seinem Hemd klaffte, war nun wieder unversehrt. Dennoch musste sich Andrej widerwillig eingestehen, dass er Abu Duns Spott verdient hatte. Es war ein Kind – so etwas hätte einfach nicht passieren dürfen.
Noch immer schweigend stemmte er sich vollends in die Höhe und bedeutete Abu Dun mit einer Geste, das Mädchen auf den Boden zu setzen.
»Du brauchst keine Angst zu haben«, sagte er noch einmal.
Seine Worte schienen nicht zu dem Mädchen durchzudringen. Es zerrte und riss wie verrückt an Abu Duns Arm, um sich loszureißen. Und schrie dabei immer und immer wieder dieses eine unheimliche Wort: »Dauga!«
Andrej sah Abu Dun einen Moment lang nachdenklich an. Er wusste nicht, was dieses Wort bedeutete, aber es war klar, dass es die Angst vor seinem Freund war, die dieses Kind fast um den Verstand brachte. Er konnte das Mädchen durchaus verstehen. Schon unter normalen Umständen war Abu Dun eine imposante Erscheinung: mehr als zwei Meter groß und entsprechend breitschultrig, ein Riese mit nachtschwarzer Haut, den er niemals anders als in einem knöchellangen, ebenfalls schwarzen Mantel und mit einem gewaltigen Turban auf dem Schädel gesehen hatte, der ihn noch größer und Furcht einflößender erscheinen ließ.
In Abu Duns Muttersprache bedeutete sein Name so viel wie »Vater des Todes«. Andrej hatte ihn niemals danach gefragt, ob dies tatsächlich sein Name war oder er ihn sich selbst gegeben hatte. Aber er war auch noch nie einem Menschen begegnet, zu dem dieser Name besser zu passen schien.
»Ich glaube, sie hat Angst vor dir«, sagte er. »Lass sie los!«
Abu Dun zögerte und Andrej wandte sich mit einem aufmunternden Lächeln an das Mädchen.
»Du wirst nicht weglaufen, wenn er dich loslässt?«, vergewisserte er sich. »Du brauchst keine Angst vor uns zu haben, wir helfen dir.«
Das Kind starrte ihn aus großen Augen an, die schwarz vor Angst waren, dann schüttelte es ganz sacht den Kopf.
Andrej gab Abu Dun einen entsprechenden Wink, blieb aber wachsam, falls das Mädchen doch noch davonlaufen sollte.
»Wie ist dein Name, Kleine?«, fragte er.
»Verinnia«, antwortete das Kind.
»Das ist ein schöner Name«, meinte Andrej und deutete erst auf sich selbst, dann auf Abu Dun. »Ich bin Andrej und das ist Abu Dun. Du musst dich nicht fürchten, er sieht nur so gefährlich aus.«
Abu Dun ließ endlich die Schulter des Mädchens los. Verinnia wich zwei, drei Schritte zurück, hielt aber dann mitten in der Bewegung inne und blieb wieder stehen.
»Ihr … seid … keine … Dauga?«, vergewisserte es sich.
»Nein«, antwortete Andrej, »auch wenn ich nicht einmal weiß, was das ist. Bist du vor ihnen geflohen?«
»Sie … sie haben alle getötet!«, stammelte Verinnia. Plötzlich schimmerten Tränen in ihren Augen. Sie begann am ganzen Leib zu zittern. »Das ganze Dorf … meine Familie … sie … sie sind alle tot. Nur Vater und ich konnten entkommen.«
Andrej machte eine Kopfbewegung in die Richtung, in der der Verwundete davongetorkelt war. Abu Dun zog fragend die Augenbrauen hoch, aber Andrej schüttelte hastig den Kopf. Er wusste, dass der Mann in seinem Zustand nicht weit kommen würde.
»War das dein Vater?«
Verinnia nickte. Sie zog lautstark die Nase hoch, ihr Blick tastete misstrauisch über Andrejs Gesicht und blieb an seinem zerrissenen Hemd hängen. Ihre Augen wurden groß.
»Hab ich Euch verletzt, Herr?«, fragte sie erschrocken.
»Andrej«, verbesserte sie Andrej rasch, »nicht Herr. Und nein, du hast mich nicht verletzt.«
Er deutete auf den Riss, wo ihr Messer sein Hemd zerschnitten hatte. Die Wunde hatte sich längst wieder geschlossen und die Haut darunter war vollkommen unversehrt.
»Siehst du, ich hatte Glück, du hast nur mein Hemd erwischt.«
Verinnia betrachtete den Schnitt in seinem Hemd stirnrunzelnd.
»Und warum ist Euer … warum ist dein Hemd dann voller Blut?«, fragte sie.
Andrej zog es vor, nicht darauf zu antworten.
»Also, Verinnia«, sagte er, »was ist passiert?«
Verinnia kam nicht dazu, zu antworten. Aus der Richtung, in die ihr Vater verschwunden war, erscholl ein gellender Schrei und ein schreckliches, grauenhaftes Splittern, wie Andrej es noch niemals zuvor im Leben gehört hatte.
Verinnia schrie auf und schlug die Hand vor den Mund. Und auch Abu Dun und er fuhren in einer einzigen blitzartigen Bewegung herum und zogen ihre Waffen.
»Bleib hier!«, schrie Andrej dem Mädchen zu, während er und Abu Dun bereits losstürmten.
Die Schreie hörten auf und auch das furchtbare Geräusch, das an das Zerbrechen eines riesigen, trockenen Astes erinnert hatte, wiederholte sich nicht. Aber Andrej konnte die Gewalt regelrecht spüren, die vor ihnen explodiert war. Irgendetwas Schreckliches ging dort vor.
Sie mussten nicht sehr weit laufen. Verinnias Vater war kaum weiter als drei oder vier Dutzend Schritte gekommen. Der Platz, an dem ihn sein Schicksal ereilt hatte, war unübersehbar. Der aufgeweichte Waldboden war aufgewühlt und nicht nur vom Regen dunkel. Tief hängende Äste und Unterholz waren geknickt und zerfetzt und bewiesen, dass der Kampf vielleicht nur kurz, dafür aber umso erbarmungsloser gewesen war.
Von Verinnias Vater war keine Spur zu sehen. Aber der Blutgeruch in der Luft war nun so intensiv, dass er Andrej fast den Atem nahm.
»Da!« Abu Dun deutete auf den Stamm einer mächtigen Eiche, unmittelbar neben dem Kampfplatz. Andrejs Blick folgte der Geste und ein eisiger Schauer lief ihm über den Rücken. Der Stamm war blutbesudelt und trotzdem waren die tiefen, wie von gewaltigen Klauen in das harte Holz gerissenen Furchen in seiner Rinde deutlich zu erkennen.
Andrej versuchte vergeblich, sich ein Tier vorzustellen, das solche Spuren hinterlassen konnte.
Hinter ihnen war ein entsetztes Schluchzen zu hören und Andrej fuhr herum und trat gerade den Bruchteil eines Augenblickes zu spät zwischen Verinnia und die unübersehbaren Spuren dessen, was ihrem Vater zugestoßen war, um dem Kind den Anblick zu ersparen.
Das Mädchen hatte beide Hände vor den Mund geschlagen und begann, immer heftiger zu zittern.
»Vater«, stammelte es. »Wo … wo ist mein Vater?«
Abu Dun wollte etwas sagen, doch Andrej brachte ihn mit einer raschen Geste zum Verstummen. Sein Hals war plötzlich wie zugeschnürt.
»Waren das die Dauga?«, fragte er leise.
Verinnia sagte nichts mehr. Sie hatte den Kampf gegen die Tränen endgültig verloren und ihr Gesicht schimmerte nass, doch nicht der geringste Laut kam über ihre Lippen. Sie nickte nur.
»Dann zeig uns, was passiert ist«, sagte Andrej.
Andrej hatte es längst aufgegeben, sich zu fragen, wie es Verinnias Vater in seinem Zustand gelungen war, sich von seinem kleinen Heimatdorf an der Küste bis zu der Stelle am Waldrand zu schleppen, an der sie ihn und das Mädchen gefunden hatten. Sie waren eine halbe Stunde in scharfem Tempo geritten, nachdem sie Verinnias Vater, von dem sie nur noch Blutspuren gefunden hatten, ein einfaches, symbolisches aber christliches Begräbnis bereitet hatten. Andrej hatte ein kurzes Gebet zu einem Gott gesprochen, an den er den Glauben auf irgendeinem der zahllosen Schlachtfelder seiner Vergangenheit längst verloren hatte. Danach waren sie aufgesessen und losgaloppiert. Verinnia hatte sich panisch gesträubt, zu Abu Dun in den Sattel zu steigen, ansonsten aber kein Wort mehr gesagt. Selbst auf Andrejs Fragen nach dem Weg hatte sie nur mit Gesten reagiert.
Jetzt hatten sie die Steilküste erreicht. Vor ihnen lag eine schmale, zum Teil auf natürliche Weise entstandene, zum Teil direkt in den Fels hineingehauene Treppe, die zu dem zwanzig oder mehr Meter tiefer gelegenen Strand hinunterführte.
Abu Dun war abgesessen und ließ seinen Blick abwechselnd über den steilen Kletterpfad und Verinnias Gesicht schweifen. Vermutlich stellte er sich die gleiche Frage wie Andrej auch. Nämlich die, wie es ein so schwer verwundeter Mann geschafft haben sollte, die Steigung zu erklimmen, noch dazu mit einem Kind im Arm.
»Ist das dort unten euer Dorf?«, wandte er sich schließlich an das Mädchen.
Verinnia nickte zwar zur Antwort, sah dabei aber Andrej an. Andrej wusste nicht, ob sie ihn immer noch fürchtete, auf jeden Fall schien sie sich entschlossen zu haben, den Nubier zu ignorieren.
»Hast du nicht behauptet, diese Dauga hätten das ganze Dorf zerstört und alle außer dir und deinem Vater umgebracht?«, fuhr Abu Dun misstrauisch fort.
Verinnia schwieg beharrlich weiter. Andrej warf dem Nubier einen mahnenden Blick zu, es gut sein zu lassen, auch wenn er sein Misstrauen verstehen konnte.
Das kleine, in einer tief eingeschnittenen Bucht gelegene Fischerdorf bestand aus vielleicht anderthalb Dutzend einfacher, reetgedeckter Hütten, von denen tatsächlich ein gutes Drittel in Trümmern lag. Aus manchen der brandgeschwärzten Ruinen kräuselte sich noch immer Rauch. Und im nun immer rascher abnehmenden Licht der Dämmerung erkannte Andrej hier und da Nester flackernder Glut. Der Gestank – nicht nur nach verkohltem Holz – war selbst hier oben wahrzunehmen. Zwischen den Gebäuden bewegten sich Menschen. Manche schwenkten Fackeln, und Andrej hätte seine übermenschlich scharfen Sinne nicht einmal gebraucht, um die ebenso angespannte wie angsterfüllte Stimmung zu fühlen, die dort unten herrschte.
»Wie lange liegt der Überfall zurück, sagst du?«, fragte er.
Verinnia hatte genau genommen gar nichts gesagt, und sie antwortete auch jetzt erst nach einem Zögern.
»Es war in der letzten Nacht. Sie kommen immer nachts.«
Andrej tauschte einen bedeutsamen Blick mit Abu Dun. Nach dem, was sie sahen, konnte diese Angabe nicht stimmen. Doch er sagte nichts und machte sich an den mühevollen Abstieg.
Sein Respekt vor Verinnias totem Vater stieg noch einmal beträchtlich an, bis er den weit unten gelegenen Strand erreichte. Selbst mit zwei gesunden Armen und ohne ein zu Tode verängstigtes Kind tragen zu müssen, stellte es sein Geschick auf eine harte Probe, die steile Felswand zu überwinden. Und Abu Dun erging es nicht besser.
Ihr Kommen blieb nicht unbemerkt. Schon lange bevor sie den eigentlichen Strand erreichten, versammelte sich eine Menge von dreißig oder vierzig Menschen am Fuße der Felswand. Viele von ihnen schwenkten Fackeln, aber nicht wenige von ihnen waren auch bewaffnet. Und der Ausdruck auf ihren Gesichtern war alles andere als freundlich.
Andrej musste kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass Abu Dun und er hier nicht willkommen waren. Sein Irrtum wurde ihm erst klar, als einer der Männer auf sie zutrat und anklagend auf Verinnia deutete.
Ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten, fuhr er Andrej an: »Wieso bringt Ihr dieses Unglückskind zurück? Wo ist sein Vater? Und wer seid Ihr?«
»Das sind meine Freunde«, sagte Verinnia herausfordernd, bevor Andrej antworten konnte. »Sie werden uns helfen, die Dauga zu vernichten.«
Das Gesicht des Bärtigen verfinsterte sich noch weiter. Er funkelte Verinnia an. »Hast du immer noch nicht genug Unheil angerichtet? Du und dein Vater«, zischte er. Dann wandte er sich mit einem Ruck wieder an Andrej. »Also«, fragte er noch einmal, »wer seid Ihr und was wollt Ihr hier?«
»Welche Frage soll ich zuerst beantworten?«, wollte Andrej wissen. Er lächelte, aber seine Hand senkte sich dabei wie zufällig auf den Schwertgriff, der aus seinem Gürtel ragte. Und neben ihm bewegte sich Abu Dun ebenfalls rein zufällig so, dass man seine eigene, noch viel gewaltigere Waffe unter dem Mantel sehen konnte.
»Mein Name ist Andrej Delãny«, antwortete Andrej. »Das ist Abu Dun, mein Freund und Reisebegleiter aus dem Land der Muselmanen. Wir sind harmlose Wanderer, die es durch Zufall in diesen Teil der Welt verschlagen hat.«
Er bekam keine Antwort, was vielleicht daran liegen mochte, dass der Ausdruck »harmlos« und der Anblick des nubischen Riesen an seiner Seite nicht zusammenpassen wollten. Und so fuhr er mit einem angedeuteten Schulterzucken fort: »Wir haben das Mädchen und seinen Vater eine halbe Stunde von hier gefunden. Wir wollten sie zurückbringen, das ist alles.«
Das Gesicht des Bärtigen verfinsterte sich noch weiter. »Wo ist er?«, fauchte er.
Verinnia wollte etwas sagen, aber Andrej kam ihr zuvor.
»Er ist tot«, sagte er. »Wir wollten ihm helfen, aber wir sind zu spät gekommen. Es tut mir leid.«
Der Bärtige verzog nur abfällig die Lippen. In seinen Augen las Andrej Zufriedenheit.
»Tot?«, vergewisserte er sich. »Gut, dann hat er wenigstens einen Teil seiner Schuld bezahlt.«
Andrej zog unwillig die Brauen zusammen und er hörte, wie auch Abu Dun hinter ihm scharf die Luft zwischen den Zähnen einsog.
»Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz«, sagte er vorsichtig. »Das Mädchen hat uns erzählt, ihr wärt überfallen worden und alle hier wären tot.«
»Ja – sehr viel hätte dazu auch nicht gefehlt«, antwortete der Bärtige wütend. »Dank ihres verdammten Vaters.«
Er trat auf Verinnia zu und hob drohend die Faust, blieb aber sofort wieder stehen, als Andrej ihm mit einem fast beiläufigen Schritt den Weg versperrte.
»Was geht hier vor?«, fragte Andrej scharf.
Der Bärtige stülpte herausfordernd die Unterlippe vor und der Blick, mit dem er Andrej nun maß, war eindeutig abschätzend. Plötzlich wurden hinter ihm aufgeregte Stimmen laut. Die Menschenmenge teilte sich, um einem dunkelhaarigen Hünen Platz zu machen, der mindestens so groß wie der Bärtige war, aber wilder wirkte.
Andrej riss erstaunt die Augen auf. Hätte der Mann nicht zwei gesunde Arme gehabt, hätte er geschworen, Verinnias genesenem Vater gegenüberzustehen.
»Hast du den Verstand verloren, Arnulf!«, brüllte er. »Dieses Kind hat heute seinen Vater verloren und du wagst es, ihm Vorwürfe zu machen.«
Er erwartete offensichtlich keine Antwort von dem Bärtigen, sondern baute sich herausfordernd vor Andrej auf und maß ihn mit Blicken, die kaum weniger zornig waren als die, die er Arnulf zugeworfen hatte.
Verinnia warf sich mit einem Schrei auf ihn, vergrub das Gesicht in seinem zotteligen Fellmantel und begann zu schluchzen. Wie selbstverständlich legte der Riese ihr beschützend den Arm um die Schultern und musterte nun Abu Dun ebenso aufmerksam wie Andrej gerade.
»Ist es wahr, was Ihr sagt?«, fragte er. »Ihr Vater ist tot?«
»Ja«, antwortete Andrej. »Und wer bist du?«
»Mein Name ist Lasse«, antwortete der Riese. »Verinnias Vater war mein Bruder. Und ihr kommt jetzt besser mit mir, bevor noch ein Unglück geschieht.«
Andrej hatte nicht erwartet, dass man Abu Dun und ihn mit offenen Armen empfangen würde, aber Lasses nachlässige Art, seine Dankbarkeit zu zeigen, überraschte ihn doch. Er spürte zugleich aber auch, dass die Warnung des schwarzhaarigen Riesen ernst zu nehmen war. Die Spannung, die schon bei ihrer Ankunft in der Luft gelegen hatte, nahm noch zu. Er nickte.
»Mein Haus liegt gleich dort drüben am Strand, es ist nicht weit«, sagte Lasse.
Nichts in dieser winzigen, an drei Seiten von schroffen Felsen eingerahmten Bucht war wirklich weit entfernt. Aber Andrej atmete trotzdem innerlich auf, als sie die kleine Hütte unmittelbar über der Flutlinie erreichten.
Niemand hatte versucht, sie aufzuhalten. Die Einwohner des Dorfes waren wortlos beiseite gewichen, um ihnen Platz zu machen, aber es hatte trotzdem etwas von einem Sprießrutenlauf gehabt.
Im Inneren des Hauses brannte ein Feuer unter einem schlichten Loch im Dach, das als Rauchabzug diente. Eine dunkelhaarige Frau, die ebenso schön war wie Lasse groß, kam ihnen entgegen. Als Verinnia sie sah, warf sie sich mit einem erleichterten Seufzen in ihre Arme und begann, laut zu weinen. Lasse deutete wortlos auf die Feuerstelle.
Während die dunkelhaarige Schönheit mit dem Mädchen im Nebenzimmer verschwand, nahmen Abu Dun und Andrej am Feuer Platz und streckten die Hände über die prasselnden Flammen, um möglichst viel von ihrer Wärme aufzufangen.
Unauffällig behielt Andrej Lasse aufmerksam im Auge. Die Ähnlichkeit zwischen ihm und Verinnias Vater war schon fast unheimlich, die beiden mussten nicht nur Brüder, sondern Zwillinge gewesen sein.
Schließlich trat Lasse mit einem tiefen Seufzer vom Fenster zurück und setzte sich zu ihnen ans Feuer.
»Ich muss Euch noch einmal danken«, sagte er, hob aber auch fast gleichzeitig die Hand, als Andrej antworten wollte. »Nicht für das, was ihr für Verinnia getan habt, sondern für Eure Besonnenheit. Arnulf ist ein Dummkopf, er war auf Streit aus.«
»Nun ja, das Kräfteverhältnis war ein wenig ungleich«, sagte Andrej zögernd.
»Ich bin nicht blind, Andrej Delãny«, antwortete Lasse ernst. »Ich erkenne einen Krieger, wenn ich ihn sehe.« Er machte eine Bewegung auf Andrejs Schwert. »Ihr tragt diese Waffen nicht, weil Ihr sie so schön findet. Ich hatte dort draußen keine Angst um Euch.«
Andrej schwieg; was hätte er auch antworten sollen. Schließlich war es Abu Dun, der das immer unbehaglicher werdende Schweigen brach.
»Was ist geschehen?«, fragte er. »Das Mädchen erzählt, ihr seid überfallen worden. Waren es Piraten?«
Wieder ließ Lasse eine geraume Weile verstreichen, bevor er antwortete. Sein Blick tastete über die Tür, hinter der Verinnia mit seiner Frau verschwunden war. Leise drang das Schluchzen des Kindes durch das dünne Holz.
»Nein«, sagte er schließlich. »Keine Piraten.«
»Sondern?«, fragte Andrej. »Red schon! Was ist hier passiert?«
»Das, was immer passiert«, antwortete Lasse. »Sie kommen jedes Jahr zweimal. Immer am ersten Tag des Frühlings und am ersten Tag des Herbstes.«
»Wer?«, fragte Abu Dun.
»Die, von denen Verinnia euch erzählt hat«, antwortete er. »Die Dauga!«
»Und was sind Dauga?«, wollte Andrej wissen. Er tauschte einen weiteren fragenden Blick mit Abu Dun, erntete aber auch jetzt wieder nur ein fast hilfloses Schulterzucken. »Und was wollen sie von euch?«
»Das weiß niemand«, antwortete Lasse. »Sie kommen zweimal im Jahr und holen einen von uns. Niemand weiß warum. Doch keiner von denen, die sie mitgenommen haben, wurde jemals wieder gesehen.« Er schüttelte den Kopf. »Sie sind keine Menschen, so viel steht fest.«
»Wieso?«, wollte Abu Dun wissen.
»Weil man sie nicht töten kann«, antwortete Lasse. »Ganz einfach.«
Andrej erstarrte. Er sah aus den Augenwinkeln, wie Abu Dun zusammenfuhr, und auch er selbst hatte sich nicht so gut in der Gewalt, wie es ihm lieb gewesen wäre.
»Man kann sie nicht töten, das ist lächerlich«, sagte er mit einem leisen Lachen, das nicht einmal in seinen eigenen Ohren echt klang.
»Oh, man kann sie töten«, erwiderte Lasse. »Verinnias Vater hat einen von ihnen erwischt, gerade erst in der vergangenen Nacht. Aber es ist sehr schwer, sie zu töten. Man muss ihnen den Kopf abschlagen oder ihr Herz mit einem Speer durchbohren.«
Diesmal tauschte Andrej einen entsetzten Blick mit Abu Dun. Was Lasse da beschrieb, das waren nahezu die beiden einzigen Möglichkeiten, Wesen von der Art zu töten, zu denen auch Abu Dun und er selbst gehörten.
»Es ist schwer, aber man kann es schaffen«, sagte Lasse noch einmal. »Doch ihr habt gesehen, was dann geschieht.«
»Nein«, antwortete Andrej, »das haben wir nicht. Wovon redest du?«
Lasse atmete hörbar ein. »Die Dauga kommen so lange, wie wir uns zurückerinnern können, um ihr Blutopfer zu holen«, sagte er. »Am Anfang haben wir uns gewehrt, aber irgendwann haben wir angefangen, uns in unser Schicksal zu fügen. Zwei Leben im Jahr für das aller anderen, das erschien den meisten von uns ein geringer Preis.«
»Den meisten, aber nicht allen«, vermutete Andrej.
»Nein«, bestätigte Lasse, »nicht allen. Meinem Bruder nicht, und auch mir nicht. Trotzdem haben wir nie etwas getan, wir waren feige. So wie alle anderen hier.«
»Und was ist letzte Nacht geschehen?«, fragte Andrej leise.
Lasses Blick verdüsterte sich noch weiter. »Die Schwarze Gischt ist gekommen«, antwortete er, »das Schiff der Dauga. Sie taucht immer mit der höchsten Flut auf. Sie hat ein schwarzes Segel, daher der Name. Wir hatten das Opfer vorbereitet wie jedes Jahr, doch diesmal wollten sie ein anderes …«
»Verinnia«, vermutete Andrej, als Lasse nicht weitersprach.
Der schwarzhaarige Riese nickte. »Ja«, sagte er düster. »Mein Bruder war verzweifelt, er hat sich geweigert. Doch Arnulf und die anderen haben ihn überwältigt und wollten Verinnia den Dauga ausliefern. Im letzten Moment hat er sich losgerissen und einem von ihnen das Schwert entrungen.« Er lachte, bitter und sehr leise. »Er war ein Fischer wie ich, Andrej. Er konnte nicht mit einem Schwert umgehen, aber die Angst verlieh ihm übermenschliche Kräfte. Das Ungeheuer hat ihm den Arm abgerissen, doch meinem Bruder ist es dennoch gelungen, es zu enthaupten. Er konnte Verinnia nehmen und entkommen.«
Andrej ließ ihm ausreichend Zeit, die Erinnerung zu verarbeiten, bevor er ganz leise fragte: »Und dann?«
»Die schwarze Gischt ist verschwunden«, antwortete Lasse. »Doch heute, kurz vor Sonnenuntergang, ist sie wieder aufgetaucht. Ihre Kanonen haben das Feuer auf uns eröffnet, sie haben das halbe Dorf in Schutt und Asche gelegt. Vier von uns sind tot und mehr als ein Dutzend verletzt. Und sie haben gedroht wiederzukommen. Morgen … und am Tag danach … und an dem danach. So lange, bis wir ihnen ihr Opfer ausliefern.«
Andrej verspürte ein eisiges Frösteln. Was Lasse nicht laut ausgesprochen hatte, das las er überdeutlich in seinen Augen.
»Aber nicht irgendein Opfer«, vermutete er.
Lasse schüttelte den Kopf, seine Augen wurden leer. Er antwortete nicht. In diesem Moment flog die Tür in ihrem Rücken auf und Arnulf trat ein.
»Nein«, sagte er, »sie wollen kein anderes Opfer, sondern das, das ihnen zusteht. Sie wollen Verinnia, niemanden sonst.«
Seine Augen loderten vor Zorn. Andrej warf einen Blick durch die offen stehende Tür in seinem Rücken. Arnulf war nicht allein gekommen. Er hatte nahezu das ganze Dorf mitgebracht.
»Ich kann mich nicht erinnern, dich hereingebeten zu haben«, sagte Lasse ärgerlich.
Arnulf machte eine wütende Handbewegung, wie um Lasses Worte beiseite zu fegen. »Ich verstehe und achte dich, Lasse«, sagte er mühsam beherrscht und in einem Ton, der das genaue Gegenteil verstehen ließ. »Aber begreifst du denn nicht, was …«
»Ich begreife vor allem, dass du ein Feigling bist«, unterbrach ihn Lasse und stand auf.
Arnulf straffte kampflustig die Schultern, und für einen Moment war Andrej überzeugt, dass die beiden riesigen Männer nun aufeinander losgehen würden. Aber dann, ganz plötzlich, trat Arnulf einen halben Schritt zurück und verzog sein Gesicht zu einer verständnisvollen Miene.
»Glaubst du denn, ich verstehe dich nicht, Lasse?«, fragte er sanft. »Auch mir tut Verinnia leid. Ihr Vater war ein guter Freund und ich weiß, dass du ein tapferer Mann bist. Aber du hast gesehen, was geschieht, wenn wir versuchen, uns gegen das Schicksal zu wehren. Sind fünf Tote denn noch nicht genug?«
Andrej tauschte einen Blick mit Abu Dun. Der Nubier zögerte einen winzigen Augenblick, und der Ausdruck auf seinem Gesicht erschien ihm undeutbarer denn je. Dann aber nickte er fast unmerklich. Und Andrej fragte: »Und ist nicht einer mehr zuviel, Arnulf?«
Der schwarzhaarige Riese fuhr herum wie eine wütende Schlange. »Was mischt Ihr Euch ein«, zischte er. »Ihr wisst doch gar nicht, wovon Ihr redet.«
»Wir wissen, dass sie zweimal im Jahr kommen und ein Menschenopfer von euch verlangen«, sagte Abu Dun an Andrejs Stelle. »Wie lange wird es noch dauern, bis keiner mehr von euch übrig ist, um mit seinem Leben das der anderen zu erkaufen?«
»Was können wir schon tun?«, fauchte Arnulf.
»Ihr könntet kämpfen«, schlug Andrej vor.
Arnulf lachte böse. »Kämpfen! Man kann nicht gegen diese Kreaturen kämpfen. Sie sind keine Menschen, sondern Ausgeburten der Hölle! Wie willst du etwas töten, das bereits tot ist?«
»Was meinst du damit?«, fragte Abu Dun. »Das bereits tot ist.«
Arnulf zögerte einen Moment, dann hob er die Schultern. »Niemand weiß genau, was sie sind«, sagte er. »Es heißt, sie wären verfluchte Seelen. Männer, die vor mehr als einem Jahrhundert einen Pakt mit dem Teufel selbst geschlossen haben. Seither sind sie weder tot noch lebendig. Sie altern nicht und es ist fast unmöglich, sie zu töten. Aber sie brauchen dann und wann frisches Blut, um ihren Pakt mit dem Satan zu erneuern.«
»Was für ein Unsinn!«, sagte Abu Dun. »Mit solchen Geschichten erschreckt man in meiner Heimat kleine Kinder.«
»Und hier macht man das mit Geschichten von schwarzen Männern, an die auch niemand glaubt«, schnappte Arnulf. »Du kannst glauben, was du willst. Ich weiß, was ich gesehen habe. Sie sind unsterblich.«
Andrej verspürte ein kurzes, aber eisiges Frösteln, als er an Verinnias Vater zurückdachte und an das, was er in seiner Gegenwart gespürt hatte. Etwas wie eine jahrhundertealte Fäulnis, die schlimmer war als der Tod. Er hatte gedacht, es wäre der Wundbrand, der das Blut des Mannes vergiftet hatte. Aber vielleicht war es ja die Berührung von etwas gewesen, das viel schlimmer und böser war.
»Und wenn wir euch helfen?«, fragte er leise. »Abu Dun und ich sind schon auf Untote gestoßen. Du hast recht, sie sind schwer zu töten, aber es ist möglich.«
»Verinnias Vater hat es getan«, fügte Abu Dun hinzu. »Und wir würden euch helfen.«
Arnulf wirkte unschlüssig. Aber schließlich schüttelte er doch den Kopf. »Es ist unmöglich«, beharrte er. »Selbst wenn wir es wollten, wie sollte das gehen? Sie schicken niemals mehr als einen an Land, und nach dem, was gestern passiert ist, wahrscheinlich nicht einmal mehr das.«
»Ich dachte, das hier wäre ein Fischerdorf«, sagte Abu Dun spöttisch. »Habt ihr denn keine Schiffe?«
»Ein paar Boote«, antwortete der bärtige Riese abfällig. »Das größte misst keine zwanzig Fuß, und die Schwarze Gischt hat Kanonen. Sie würde jedes Schiff versenken, bevor es ihr auch nur nahe kommt.«
Andrej wollte antworten, doch in diesem Moment wurde die Tür aufgestoßen und Verinnia trat ein. Lasses Frau folgte ihr, versuchte aber vergeblich, das Mädchen zurückzuhalten. Andrej musste nur einen einzigen Blick auf das Gesicht des Kindes werfen, um zu wissen, dass es jedes Wort gehört hatte.
»Dann sorgen wir eben dafür, dass sie zu uns kommen«, sagte Verinnia. »Die Dauga wollen mich, oder? Dann sollen sie mich doch haben.«
Abu Dun ließ sich vorsichtig an der nass glänzenden Flanke des Felsens heruntergleiten und überwand das letzte Stück mit einem Sprung, unter dem das gesamte Boot erzitterte. Andrej suchte hastig Halt und auch Lasse und Arnulf warfen dem Nubier einen ärgerlichen Blick zu.
»Ein gutes Dutzend Männer, es könnten auch weniger sein«, fuhr Abu Dun ungerührt fort, während er mit der linken Hand seinen Turban richtete, der den Abstieg nicht so unbeschadet überstanden hatte wie sein Besitzer. »Schwer zu sagen. Das Schiff liegt nicht gerade ruhig. Wenn ich an Bord wäre, wäre ich vor Seekrankheit wahrscheinlich schon gestorben.«
Andrej warf dem riesigen Nubier einen schrägen Blick zu, zog es aber vor, seinen Kommentar für sich zu behalten. Er bezweifelte, dass Abu Dun überhaupt wusste, was das Wort Seekrankheit bedeutete. Als sie sich kennengelernt hatten, hatte Abu Dun seinen Lebensunterhalt als Pirat verdient. Was Andrej anging, er hasste die Seefahrt. Auch wenn er mehr als einmal gezwungen gewesen war, zur See zu fahren, waren ihm Schiffe doch immer zutiefst zuwider gewesen. Er war nicht einmal ein besonders guter Schwimmer. Und wozu auch? Immerhin war es für ihn unmöglich zu ertrinken.
Die Einzige, der weder das ununterbrochene Schaukeln des Schiffes, noch der schneidende Wind etwas auszumachen schien, war Verinnia. Das Mädchen stand hochaufgerichtet und so ruhig im Heck des kleinen Schiffchens, als befänden sich unter seinen Füßen die massiven Grundmauern einer tausend Jahre alten Festung. Mehr noch – der Ausdruck auf ihrem Gesicht bewies Andrej, dass sie die Situation regelrecht genoss.
Für ein Mädchen, dachte er, das gerade seinen Vater verloren hatte, ist sie auf eine geradezu unangemessene Art fröhlich. Aber vielleicht war das auch einfach ihre Art, mit dem Schmerz fertig zu werden. Kinder besaßen manchmal ein beneidenswertes Talent, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Andrej sah kurz zu Lasse hin, und wieder fiel ihm auf, wie groß die Ähnlichkeit zwischen ihm und Verinnias totem Vater war. Kein Wunder, dachte er, dass er sich so um das Mädchen sorgt, für ihn muss sie fast wie eine Tochter sein.
Ein dumpfer Knall riss nicht nur Andrej aus seinen Gedanken, sondern ließ auch alle anderen erschrocken aufsehen. Nicht viel später wehte ein zweiter dumpfer Schlag aus der entgegengesetzten Richtung an ihr Ohr. Allerdings so leise, dass vermutlich nur Abu Dun und er ihn überhaupt hörten. Andrej tauschte einen raschen, besorgten Blick mit Lasse, bekam allerdings nur ein angedeutetes Achselzucken zur Antwort. Die Schwarze Gischt hatte eine ihrer Kanonen abgefeuert. Und Andrej konnte nur hoffen, dass die Menschen im Dorf auf Abu Duns und seinen Rat gehört und ihre Häuser verlassen hatten, um Unterschlupf in den Felsen der Steilküste zu suchen.
»Jetzt?«, fragte Abu Dun.
Andrej antwortete nicht gleich, sondern warf einen zweifelnden Blick in Verinnias Richtung. Letzten Endes hatte er sich der Logik gebeugt – und, nicht zu vergessen, Verinnias kindlicher Sturheit. Aber ihm war nicht wohl dabei, ein Kind an Bord zu wissen.
Schließlich nickte er. Abu Dun gab die Bewegung an Arnulf weiter und der riesige Nordmann griff nach dem Ruder des kleinen Bootes. Ein sachtes Zittern lief durch den Rumpf, und Andrej stand auf und überprüfte ein letztes Mal den sicheren Sitz seines Schwertes.
Während Abu Dun Mantel und Turban ablegte, trat Andrej an die andere Seite des Bootes und steckte prüfend die Hand ins Wasser. Er schauderte, als er spürte, wie kalt es war. Als er sich aufrichtete, begegnete er Verinnias Blick, die den Riss in seinem Hemd anstarrte, wo ihn ihr Messer getroffen hatte.
»Ich weiß, wer du bist«, sagte sie.
»Wie?«, machte Andrej.
»Ich weiß, wer du bist«, wiederholte Verinnia und machte eine Handbewegung auf Abu Dun. »Ich weiß, was du bist. Ich weiß, was ihr beide seid. Mein Vater hat es mir gesagt.«
Andrej richtete sich alarmiert auf, doch es war zu spät. Das Boot war schon halb hinter dem Riff hervorgeglitten, hinter dem sie seit einer guten halben Stunde auf der Lauer lagen. Und Abu Dun war bereits im Wasser und hielt sich nur noch mit einer Hand an der Bordwand fest. Noch ein Augenblick und sie kamen in Sichtweite der Schwarzen Gischt. Wenn er sich dann noch an Deck befand, war ihr Plan zunichte gemacht.
Hastig glitt auch er über Bord. Er musste die Zähne zusammenbeißen, denn das Wasser war noch viel kälter, als er angenommen hatte. Dennoch ließ er sich rasch tiefer sinken, während das Boot vollends hinter seiner Deckung hervorglitt und die Schwarze Gischt in Sicht kam. Andrej nahm einiges von dem zurück, was er über Arnulf und die anderen Bewohner des Fischerdorfes gedacht hatte. Die Schwarze Gischt war das unheimlichste Schiff, das er jemals gesehen hatte. Sie war kein Kriegsschiff, jedenfalls war sie nicht als solches gebaut worden, und sie war nicht einmal besonders groß. Es war eine mindestens hundert Jahre alte Kogge, hundert Fuß lang und mit dem typischen klobigen Bug und dem Achterkastell, das diese Schiffe auszeichnete. Jemand hatte drei Kanonen auf jeder Seite des Decks aufgestellt und