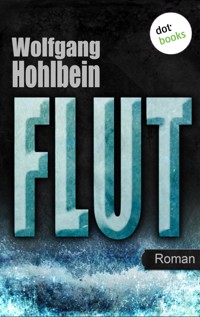7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Andrej und Abu Dun
- Sprache: Deutsch
Andrej kann es noch immer nicht fassen: Sein Sohn Marius lebt! Von Schuldgefühlen gequält sucht er nach dem Totgeglaubten und findet Marius in den Fängen eines mysteriösen Arztes in Venedig. Etwas Böses scheint von dem Jungen Besitz ergriffen zu haben, doch als Andrej ihn aus dem Spital befreien will, geschieht etwas, das er nie für möglich gehalten hätte: Andrejs treuer Freund Abu Dun wendet sich gegen ihn ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 741
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Impressum
Der zwölfte Roman der Chronik der Unsterblichen
Kapitel 1
Auch in dieser Nacht träumte er wieder von seinem Sohn. Es begann wie immer: Gesichter, zu Grimassen verzerrt, wirbelten in einem rasenden Kaleidoskop des Schreckens um ihn herum; er hörte sinnlose Laute, spürte die Hitze von Flammen, schmeckte den puren Geschmack von Gewalt, von Schmerz und unendlich viel Leid, das er über die Menschen und die Welt gebracht hatte, ohne es auch nur zu ahnen.
Er träumte diesen Traum seit einem Jahr, nicht jede Nacht, nicht einmal regelmäßig, aber doch mit bestürzender Häufigkeit, und auch das Wissen, nur einen Traum zu erleiden, nahm diesem rein gar nichts von seinem Schrecken.
Vielleicht, weil er zugleich auch wusste, dass es eben nicht nur ein Traum war, sondern die Erinnerung an schreckliche Dinge, die er niemals getan und niemals erlebt hatte und die doch wahr waren.
Heute jedoch war etwas anders. In dem Traum, den er jetzt träumte, hatte der Schrecken ein Gesicht. Es war das Antlitz eines weißhaarigen Jünglings mit den Zügen eines Engels und den brennenden Augen eines Dämons, die er in Wahrheit nie gehabt hatte, in diesem Traum aber höllische Wahrhaftigkeit erlangten.
Er war wieder im Borsatal und der Bauernburg, die zum Grab aller geworden war, die er jemals gekannt und geliebt hatte, und wieder hatte er Stunde um Stunde in stummer Verzweiflung dagesessen und um seinen Sohn geweint, bis seine Tränen schließlich versiegten und aus dem Schmerz in seinem Herzen unerbittlicher Hass geworden war.
Irgendwann wurde er sich seiner Umgebung und seiner selbst bewusst und machte sich an die letzte und schrecklichste Aufgabe dieses Tages, nämlich die, den Leichnam seines Sohnes zu begraben. Von Männern zu Tode gefoltert, die er nicht kannte, um für etwas bestraft zu werden, von dem er nicht einmal wusste, dass er es getan hatte.
Er begrub ihn tief, damit sich keine Tiere an ihm vergingen (hatte er damals ein Kreuz auf seinem Grab aufgestellt? Es war so lange her, dass er sich nicht mehr daran erinnerte, aber in diesem grässlichsten aller Nachtmahre tat er es), und ging dann zu seinem Pferd, um diesen Ort des Schreckens zu verlassen und sein Leben fortan der Rache zu widmen. Und an dieser Stelle dann zeigte der Traum, was vielleicht gewesen war, er aber niemals erlebt hatte.
Auf halbem Wege hörte er ein Geräusch und blieb noch einmal stehen, um sich umzudrehen, und obwohl er diesen Moment schon hundertfach durchlitten hatte, spürte er auch jetzt zuerst nichts als blankes Entsetzen, als er sah, wie sich das schlichte Holzkreuz zur Seite neigte und hob, gehalten von einer bleichen Kinderhand, die aus dem Grab emporwuchs. Es folgten ein Arm, eine Schulter und schließlich ein schmales Gesicht, umrahmt von schmutzigem weißem Haar. Unzählige Male hatte er diesen Augenblick durchlebt, und doch schlug sein Herz auch jetzt wieder in maßlosem Entsetzen bis in seine Schläfen und die Fingerspitzen.
Und doch war der Gipfel des Schreckens noch nicht einmal erreicht. Er wusste zwar, was kommen würde, aber auch, dass ihm dieses Wissen keinen Schutz vor dem Grauen bieten konnte, zu dem der Traum ihn führte.
Langsam, unendlich mühevoll, aber auch mit der Unaufhaltsamkeit eines Albtraumes arbeitete sich der tote Junge aus dem Grab heraus, in das er ihn mit eigenen Händen gelegt hatte. Feuchtes Erdreich und Schmutz klebten an seiner Haut. Doch das verdeckte die schrecklichen Wunden nicht, die seine Folterknechte ihm zugefügt hatten, sondern schien sie ganz im Gegenteil nur noch zu betonen.
Er machte einen Schritt auf seinen wiederauferstandenen Sohn zu, der niemals gestorben war, dann verweigerten ihm seine Muskeln den Dienst. Ein unsichtbares eisernes Band legte sich um seine Brust und seine Kehle, schnürte ihm den Herzschlag und dann den Atem ab, bis er nur noch Entsetzen und alles verzehrende Schuld empfand. Er wusste, was nun kam, doch wie hätte ihn dieses Wissen schützen sollen?
Vater.
Der Junge konnte nicht sprechen. Sein Herz schlug nicht. In seinen Adern floss kein Blut mehr. Seine Kehle war verstopft mit der weichen Erde, mit der er sein Gesicht bedeckt hatte. Aber seine Lippen bewegten sich, erbrachen Schleim und geronnenes Blut.
Warum hast du mir das angetan, Vater?
Wie hätte er es denn wissen sollen? Niemand hatte ihn gewarnt. Niemand hatte ihn auf das vorbereitet, was kam oder was er war, was sein Sohn war. Er hatte es doch nicht gewusst!
Aber wann hätte Unwissenheit jemals Schuld gemildert?
Der Junge kam näher. Er wollte herumfahren, schreien, davonlaufen, doch er war wie gelähmt, sah, wie der Knabe mit dem Gesicht eines mörderischen Engels mit torkelnden Schritten näher kam, eingehüllt in den schrecklichen Odem aus Tod und Zerfall, der unmöglich schon nach so kurzer Zeit entstanden sein konnte und ihm doch schier den Atem nahm. Seine Hand, deren Fingernägel sich lösten und an langen, schleimigen Fäden zu Boden tropften, hielt noch immer das schlichte Holzkreuz umklammert. Grauer Rauch kräuselte sich zwischen seinen Fingern empor, der nach verkohltem Holz und schmelzendem Fleisch und den Qualen tausend verdammter Seelen roch, und nun begann auch das Gesicht des Knaben zu zerfließen, wie eine Maske aus Wachs, die dem Feuer der Hölle zu nahe gekommen war.
Warum hast du das getan, Vater? Warum hast du mich …
Andrej fuhr mit einem Schrei in die Höhe, registrierte eine Bewegung aus den Augenwinkeln und riss ganz instinktiv den Arm hoch, um sich zu schützen, vielleicht auch um zuzuschlagen. Im letzten Moment noch begriff er seinen Irrtum und hielt im Hieb inne. Trotzdem erklang ein erschrockener Laut, und er spürte, wie sich jemand hastig zurückzog, wenn auch nur ein kleines Stück.
Sein Herz raste. Er war zurück in der Wirklichkeit, aber der Traum ließ ihn nicht los, sondern hielt seine Gedanken weiter gefangen, wie ein klebriges Spinnennetz, in das er sich nur immer unrettbarer verstrickte, je verzweifelter er es zu zerreißen versuchte. Etwas tat sich in ihm auf, ein schwarzer Abgrund, in dem der Albtraum lauerte, um ihn endgültig zu sich hinunterzuziehen, zu verschlingen und vielleicht nie wieder freizugeben. Da waren unsichtbare Augen, die ihn voller Hass anstarrten, und –
Andrej ballte die Hände so heftig zu Fäusten, dass seine Gelenke knackten und es wehtat. Er presste die Augenlider fest zusammen und konzentrierte sich auf ein paar einfache mentale Übungen, um seine Gedanken zu beruhigen und die letzten Spinnwebfäden zu zerreißen. Es half, wenn auch nicht vollständig. Nicht einmal annähernd so gut, wie er gehofft hatte. Aber die Augen erloschen, und der Abgrund schloss sich. Langsam.
»Ist … alles in Ordnung, gnädiger Herr?«
Die Stimme schien aus keiner bestimmten Richtung zu kommen. Er hörte die Worte, aber sie ergaben keinen Sinn. Zitternd setzte er sich auf, zog die Knie an den Leib und fühlte raues Holz im Rücken. Alles drehte sich um ihn, selbst die Dunkelheit, als er die Augen wieder schloss. Er wusste nicht, wo er war, für einen schrecklichen Moment wusste er nicht einmal mehr, wer er war.
»Gnädiger Herr?«
Diesmal erkannte er, woher die Stimme kam, und konnte deutlich die Angst darin hören. Sein Gefühl sagte ihm, dass er sich an das Gesicht, das zu dieser Stimme gehörte, erinnern sollte, aber es wollte ihm nicht gelingen, so angestrengt er es auch versuchte.
Endlich öffnete er die Augen, doch er fand sich in nahezu vollkommener Dunkelheit wieder. Erdrückende Enge umgab ihn und ein Hauch von staubig-grauem Licht, das durch ein winziges trapezförmiges Fenster über seinem Kopf fiel.
»Gnädiger Herr?«, fragte die Stimme zum dritten Mal, und jetzt klang sie mehr besorgt als ängstlich. Etwas war hier nicht so, wie es sein sollte, aber er konnte nicht sagen, was.
Mit schierer Gewalt zwang er sich, sich zu erinnern, wo er war. Die raue Wand in seinem nackten Rücken gehörte zu der schäbigen Dachkammer, die Abu Dun und er seit einer Woche bewohnten, und es war Nacht. Außerdem war er nicht allein. Doch damit hörte sein Wissen über das Hier und Jetzt auch schon auf. Dieses Mal hatte der Traum ihm wirklich zugesetzt.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte er mit einiger Verspätung und einer Stimme, die so brüchig und schwach wie die eines uralten Mannes klang und ihn selbst erschreckte. »Ich wollte dich nicht erschrecken. Es tut mir leid.«
»Das habt Ihr nicht, gnädiger Herr.« Was wohl kaum der Wahrheit entsprach und nicht einmal besonders überzeugend klang. Mühsam drehte er den Kopf, blinzelte und erkannte jetzt immerhin einen Schatten, der auf dem Rand des schmalen Bettes saß und das andere Ende der zerschlissenen Decke an sich presste, die auch ihn bis zur Hüfte bedeckte. Darunter trug er nichts, und trotz des Dämmerlichts erkannte er, dass dasselbe auch für die schmale Gestalt galt. Vielleicht erinnerte er sich auch daran. Wenn auch nicht an mehr.
Immerhin war klar, dass nicht Abu Dun auf seiner Bettkante saß, um ihn mit einer seiner sarkastischen Bemerkungen zu erheitern (die ihm in letzter Zeit zunehmend den Nerv raubten), sondern eine Gestalt, die höchstens halb so groß und um drei Viertel leichter war und außerdem ein anderes Geschlecht hatte. So viel zu der Frage, was er getan hatte, bevor er eingeschlafen war. Aber warum konnte er sich an nichts erinnern?
»War es schlimm?«
Zuerst verstand er die Frage nicht. Der Schatten rutschte wieder näher an ihn heran. Er hörte ein leises Knistern und roch den Duft von lockigem schwarzem Haar, das vor Kurzem noch über jeden Zoll seines Körpers geglitten war. Wenigstens sah er jetzt ein Profil, auch wenn es ihn irritierte und er es nicht zuordnen konnte.
»Was?«, fragte er.
Warme Haut, die klebrig von eingetrocknetem Schweiß war und andere Erinnerungen in ihm weckte, glitt an seiner Schulter herauf, und eine sehr schmale, warme Hand berührte seine Seite, tastete sich fast scheu weiter und blieb dann mit leicht gespreizten Fingern auf seinem Bauch liegen. Lippen, so weich wie Samt und süßer als der kostbarste Honig, berührten seine Halsbeuge und wanderten auf der Suche nach seinem Mund weiter.
Andrej drehte den Kopf weg und griff zugleich nach ihrer Hand, lockerte seinen Griff aber auch sofort wieder, als er spürte, wie dünn und zerbrechlich das Gelenk war. Aber er ließ nicht los.
»Nicht«, sagte er.
»Wart Ihr nicht zufrieden, gnädiger Herr?« Ihre Stimme klang leise und ehrlich besorgt, und prompt meldete sich sein schlechtes Gewissen.
»Ich meine: Habe ich Euch nicht gefallen?«
Er konnte sich nicht einmal erinnern. Oder doch: Es hatte ihm gefallen. Aber das machte es eher schlimmer. Ihre Zerbrechlichkeit und ihre mädchenhaft kleinen Brüste an seiner Haut schürten nur noch sein schlechtes Gewissen, jemand mit auf sein Zimmer genommen zu haben, der ihm beim besten Willen nicht gewachsen war.
»Das ist es nicht«, sagte Andrej, indem er sich weiter aufsetzte und ganz automatisch die Decke enger um sich schlang, sodass der schlanke Körper neben ihm nun fast völlig entblößt war. »Wirklich, es hat nichts mit dir zu tun. Ich war nur … es tut mir leid.«
Einen Moment herrschte Stille, dann sagte sie mit einer Stimme, die plötzlich sehr viel energischer klang: »Ihr hattet einen schlechten Traum, nicht wahr?«
»Habe ich dich erschreckt? Das wollte ich nicht.« Er hatte ihr doch hoffentlich nicht wehgetan, so zerbrechlich, wie sie war!
»Das habt Ihr auch nicht, gnädiger Herr … oder wenigstens nur ein bisschen.«
Gegen seinen Willen musste Andrej lächeln, auch wenn da noch immer etwas Fauliges auf seiner Seele lag, wie der schlechte Geschmack im Mund, nachdem man versehentlich etwas Verdorbenes gegessen hat, der einfach nicht weggehen will, ganz egal was man auch versucht. Behutsam setzte er sich noch weiter auf, schob ihre Hand endgültig von sich weg und fuhr sich mit der Zungenspitze über die Lippen. Sie waren so rissig und spröde, als wäre er stundenlang durch die Wüste geirrt. Sein Herz schlug noch immer schneller, als es sollte.
Die junge Frau hauchte ihm noch einen Kuss auf die Wange, der diesmal aber eher freundschaftlich ausfiel, dann glitt sie unter der Decke hervor und stand auf. Als es raschelte, vermutete Andrej, dass sie sich nach ihren Kleidern bückte, um sich anzuziehen. Trotz seines schlechten Gewissens empfand er ein sachtes Bedauern. Er wollte jetzt nicht allein sein.
Statt sich anzukleiden, richtete sie sich jedoch bald wieder auf, tappte vorsichtig in der Dunkelheit zum Tisch. Dann klickte es, Funken sprühten, und danach erhellte die Flamme einer ruhig brennenden Kerze die winzige Dachkammer. Schatten flohen auf lautlosen Pfoten vor dem Licht, verschwanden aber nicht ganz, sondern kauerten in Ecken und Winkeln, um ihn von dort aus zu belauern.
Die junge Frau schenkte zwei Gläser Wein aus einem Krug ein, kam zurück und sah ihn so lange auffordernd an, bis er die Decke zurückschlug und sie sich an seine Seite kuscheln konnte. Andrej nahm das Glas entgegen, das sie ihm reichte, nippte vorsichtig daran und behielt den Schluck länger im Mund, als nötig gewesen wäre. Nicht etwa, um das Aroma des billigen Fusels zu genießen, sondern um den üblen Geschmack loszuwerden, den der Albtraum auf seiner Zunge zurückgelassen hatte – wie feuchte Erde, in der etwas bei lebendigem Leib vermodert.
»Wollt Ihr darüber reden, gnädiger Herr?«, fragte sie, als er auch nach einer ganzen Weile nichts sagte, sondern nur an ihr vorbei ins Leere starrte.
Er wollte nicht einmal daran denken, geschweige denn über das Grauen sprechen, das ihn seit einem Jahr verfolgte. Dennoch wandte er langsam den Kopf und sah auf das schmale Gesicht hinab, das an seiner Schulter lehnte. Er fragte sich, warum er ausgerechnet sie ausgewählt hatte. Sie war sehr hübsch – in einigen Jahren würde sie selbst im Vergleich zu Meruhe eine wahre Schönheit sein –, aber so zart und zerbrechlich, dass er sich besorgt fragte, ob er vorsichtig genug mit ihr gewesen war.
»Meiner Großmutter ging es genauso«, fuhr sie fort, offenbar nach wie vor fest entschlossen, ihm zu helfen, ob er es nun wollte oder nicht. »Sie hatte oft schlimme Träume. Manchmal hat sie darüber gesprochen, und das hat ihr geholfen.«
Ihre Naivität rührte ihn. Zu wissen, dass sich jemand um ihn sorgte, tat ihm gut. Er streichelte mit den Fingerspitzen über ihre Wange und zog die Hand dann fast erschrocken wieder zurück, als er in ihren Augen las, dass sie die Berührung falsch verstand.
»Diese Art von Traum ist es nicht«, sagte er. Etwas in ihrem Gesicht … irritierte ihn, ohne dass er genau sagen konnte, was. Sein schlechtes Gewissen meldete sich erneut, als er begriff, dass er sich nicht einmal an ihren Namen erinnerte. Vielleicht hatte er auch nie danach gefragt.
»Wer ist Marius?«, fragte sie.
»Marius? Habe ich …?«
»Im Schlaf gesprochen?« Sie nickte. »Ja, aber macht Euch keine Sorgen, gnädiger Herr. Ich konnte nichts verstehen, nur diesen Namen.«
Das mochte wahr sein oder auch nicht. Und letzten Endes konnte es ihm auch gleich sein. Sie war ein Straßenmädchen, das sich für Geld feilbot und seinen Namen und sein Gesicht genauso schnell vergessen haben würde wie er umgekehrt sie. Und doch war es ihm nicht gleich. Aus einem Grund, den er nicht benennen konnte, war es ihm mit einem Mal ungeheuer wichtig, dass sie ihn verstand.
»Er war mein Sohn«, sagte er leise.
»War?«
Andrej nickte. Er spürte, sie wartete darauf, dass er weitersprach, aber die Worte wollten nicht kommen. Sie hatte recht: Schon der Entschluss, darüber zu reden, war eine Erleichterung, aber etwas zu beschließen und es in die Tat umzusetzen waren zwei verschiedene Dinge. Seine Stimmbänder versagten ihm einfach den Gehorsam.
»Ich verstehe«, sagte sie. »Wenn Ihr nicht darüber reden wollt, dann ist das in Ordnung. Ich wollte Euch wirklich nicht bedrängen, gnädiger …«
»Andrej«, unterbrach sie Andrej. »Hör auf, mich gnädiger Herr zu nennen. Mein Name ist Andrej.«
»Wenn Ihr mich Corinna nennt.« Sie schien etwas in seinen Augen zu lesen, denn plötzlich lachte sie und schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre schwarzen Locken flogen und seine Wange kitzelten. »Zerbrecht Euch nicht den Kopf. Ihr habt meinen Namen nicht vergessen. Ihr habt gar nicht danach gefragt.«
»Oh!«, murmelte Andrej. Warum erinnerte er sich nicht einmal daran?
»Die meisten wollen ihn gar nicht wissen«, fuhr sie fort, kicherte und trank einen Schluck Wein, bevor sie hinzufügte: »Schon gar nicht, wenn sie so betrunken sind, wie Ihr es wart.«
»Betrunken?«, wiederholte Andrej verwirrt.
»Und wie!«, bestätigte Corinna. »Euer großer Freund und ich hatten Mühe, Euch die Treppe herauf und in dieses Zimmer zu bekommen.« Sie zog einen Schmollmund. »Wenn man es genau nimmt, habt Ihr mich getäuscht.«
»Weil ich zu betrunken war, um deine Erwartungen zu erfüllen?«
»Im Gegenteil«, antwortete sie. »Ich dachte, es wäre leicht verdientes Geld. Die meisten schlafen auf der Stelle ein, wenn sie so viel getrunken haben wie Ihr.«
»Aber ich bin nicht eingeschlafen.«
»Sagen wir, es war kein wirklich leicht verdientes Geld«, erwiderte Corinna. »Jedenfalls sind wir beide ins Schwitzen gekommen.«
Sie trank einen weiteren Schluck Wein und sah ihn plötzlich nachdenklich an. »Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so schnell wieder nüchtern geworden wäre wie Ihr.«
»Das liegt daran, dass Alkohol bei mir nur wirkt, wenn ich es zulasse«, antwortete Andrej. »Und auch nur so lange, wie ich es zulasse.«
Das entsprach der Wahrheit, doch es war nicht verwunderlich, dass sie ihn nur noch verwirrter ansah (vielleicht auch ein bisschen erschrocken) und sich schließlich darin rettete, noch einen dritten und größeren Schluck Wein zu trinken, mit dem sie das Glas nahezu leerte.
»Das ist schon eine verrückte Geschichte«, sagte sie. »So mancher Mann würde sich wünschen, so etwas zu können … aber wenn sie wahr wäre, dann müsste ich Euch jetzt beinahe böse sein.«
»Warum?«
»Weil ich Euch dann fragen müsste, warum Ihr es zugelassen habt, dass der Wein seine Wirkung auf Euch entfaltet – kaum dass Ihr mich gesehen habt.«
»Das muss vorher gewesen sein«, erwiderte Andrej. Ihm gelang sogar ein Grinsen, auch wenn ihm ihre scherzhaft gemeinten Worte in Wahrheit einen schmerzhaft tiefen Stich versetzten. Er konnte sich tatsächlich nicht erinnern, wie er sie kennengelernt hatte, aber das erklärte nicht, warum er dem Wein gestattet hatte, seine Gedanken zu verwirren.
Corinna sah ihn an und schien wohl zu ahnen, dass sie einen wunden Punkt berührt hatte, der besser unangetastet geblieben wäre, denn plötzlich lächelte sie nervös, griff nach dem Glas und trank einen großen Schluck, bevor sie es ihm zurückgab. Ein einzelner Tropfen blieb auf ihrer Lippe zurück, wie eine blutrote Träne, und Andrej beugte sich vor und küsste ihn weg. Er schmeckte süß, sehr viel süßer als derselbe Wein, den er gerade aus seinem Glas getrunken hatte, und seine Lippen blieben, wo sie waren, auch nachdem seine Zungenspitze den Tropfen längst aufgenommen hatte. Ihre Lippen wurden noch weicher. Das Glas fiel zu Boden und zerbrach, als sich ihre Arme hinter seinem Nacken schlossen. Sein schlechtes Gewissen wollte sich noch einmal regen, aber es kostete ihn keine große Anstrengung, es zum Schweigen zu bringen.
Vielleicht war es ein Fehler. Seine Lippen ruhten noch immer auf denen des Mädchens, und während seine Hände über ihren Körper glitten, erwachte seine Lust erneut und mit ihr ein anderes, düstereres Begehren, ein Hunger, den er zeit seines Lebens gekannt und bekämpft hatte, ohne ihn jemals ganz besiegen zu können. Er gab sich ganz seiner Lust hin. Konzentrierte sich vollkommen auf die wunderschöne Frau in seinen Armen. Versuchte so, dem Ungeheuer in sich Paroli zu bieten, und doch konnte er zunächst an nichts anderes denken als an die blutfarben schimmernde Träne, die er von ihren Lippen getrunken hatte, das warme Lebenselixier, das in ihren Adern floss und nach dem es tief in ihm schrie, mit solcher Urgewalt, dass es ihn ungeheure Willenskraft kostete, dieser schrecklichen Gier nicht nachzugeben. Und doch gelang es ihm irgendwie. Als er sie erneut in die Arme schloss, da war es nur noch das Mädchen, das er wollte, nicht mehr sein Leben. Sie war warm und jung und so lebendig, dass er sich beinahe verzweifelt an sie klammerte.
Sie liebten sich zweimal kurz hintereinander, das erste Mal wild und ungestüm und fast schon brutal, beim zweiten Mal dafür umso zärtlicher und behutsamer, bis sie schließlich erschöpft nebeneinanderlagen, wieder in Schweiß gebadet, der nun allmählich auf ihrer Haut zu trocknen begann.
Erneut überkam ihn Schläfrigkeit, der er nur zu gerne nachgegeben hätte. Nicht weil er müde war – Abu Dun und er konnten Tage ohne Schlaf auskommen, Wochen, wenn es sein musste –, sondern weil er jenen ganz besonderen Schlaf nach Momenten der Zärtlichkeit stets genoss. Aber er wagte es nicht, denn er hatte Angst, dass der Albtraum zurückkommen würde.
Schließlich stand er auf, schlang sich die dünne Decke um die Hüfte und trat an das schmale Dachfenster. Es war so hoch in der schrägen Decke angebracht, dass er sich auf die Zehenspitzen hätte stellen müssen, um hinauszusehen. Er wusste, dass es dort draußen nichts zu sehen gab, was diese, wenn auch nur kleine Mühe wert gewesen wäre. Das blinde Fenster ließ schon tagsüber kaum genug Licht herein, um die winzige Kammer zu erhellen. Jetzt waren selbst die Fassaden auf der gegenüberliegenden Straßenseite kaum mehr als rauchige Gespenster ihrer selbst, der Himmel darüber ein fleckiger grauer Streifen, auf dem nicht ein einziger Stern zu erkennen war. Aber immerhin passte dieser Anblick zu seiner trüben Stimmung, an der auch die zurückliegende Stunde nichts hatte ändern können.
Vielleicht würde das von heute an immer so sein, dachte er bitter. Der Traum – besser gesagt das, was ihn ausgelöst hatte – begann, sein Leben zu vergiften. Seit er ihn vor einem Jahr zum ersten Mal geträumt hatte, war sein Blick für das Wirkliche getrübt, sein Lachen tot, und das allmähliche Sterben seiner Seele hielt nach wie vor an.
Er konnte hören, wie auch Corinna aufstand und sich wieder raschelnd an irgendetwas zu schaffen machte. Er drehte sich weder vom Fenster weg, noch sah er über die Schulter zu ihr, fragte aber: »Schulde ich dir jetzt noch einmal dieselbe Summe?«
»Das Doppelte, wenn man es genau nimmt«, antwortete sie. »Andererseits …«
»Andererseits?«
Corinna hob leicht verwirrt die Schultern. »Ich nehme an, Ihr werdet jetzt glauben, dass ich das zu jedem Mann sage, weil es zum Geschäft gehört, aber Ihr wart …«
»Gut?«, schlug Andrej vor. »Du hast recht. Das sagst du zu jedem Mann. Weil es zum Geschäft gehört.«
»Ja«, bestätigte Corinna. »Ich sage es jedem. Aber bei Euch ist es die Wahrheit. Aber Ihr wart nicht gut. Es war … außergewöhnlich. Wie ich es noch nie zuvor erlebt habe.«
»Ich nehme an, das sagst du nur zu jedem zweiten.«
»Es war so intensiv«, fuhr sie unbeeindruckt fort, zwar noch immer lächelnd, aber auch auf fast furchtsame Art ernst. »Vorhin, als Ihr mich genommen habt … es war, als wärt Ihr ganz tief in mir.«
»Das war ich auch«, erinnerte Andrej sie mit sachtem Spott.
Das Mädchen blieb ernst. »Nicht so. Ich hatte das Gefühl, dass Ihr mich berührt habt, ganz tief in mir drinnen. Nicht nur meinen Körper, sondern etwas anderes. Es war fast ein bisschen unheimlich. Aber auch wunderschön.«
»Ich habe ein bisschen Erfahrung«, antwortete Andrej lahm. Sein Herz begann schon wieder schneller zu schlagen, und plötzlich hatte er Angst. Er hatte gespürt, wie sich die uralte Gier in ihm regte, aber nicht geahnt, wie nahe er daran gewesen war, ihr mehr zu stehlen als nur ein paar Küsse und eine gekaufte Umarmung.
»Ist das etwas, was Ihr auf Euren Reisen gelernt habt?«
Statt zu antworten, setzte er ein schiefes Grinsen auf und sagte: »Dann wäre es doch nur recht und billig, wenn du mir etwas bezahlen würdest, meinst du nicht?«
»So außergewöhnlich war es nun auch wieder nicht!«, protestierte Corinna. »Aber ich will nicht unbescheiden sein. Immerhin habe ich ja schon zugegeben, dass ich Euch eigentlich übervorteilen wollte … ich würde sagen, noch einmal dieselbe Summe reicht.«
Gegen seinen Willen musste Andrej lachen, wandte sich wieder um und legte den Kopf in den Nacken, um noch einmal aus dem Fenster und in den staubigen Nachthimmel hinaufzusehen. Die Sterne verbargen sich noch immer hinter einem Vorhang aus samtiger Schwärze, und auch der Mond war nun verschwunden, aber er glaubte, ein Augenpaar zu sehen, das mit kaltem Hass auf ihn herabstarrte und vor dessen Blicken es kein Versteck und kein Entkommen gab.
Als es wieder raschelte und Andrej sich erneut umdrehte, sah er, dass sie sich diesmal tatsächlich nach einem Stück Tuch gebückt hatte – allerdings nicht nach dem freizügigen Kleid, in dem sie gekommen war. Vielmehr hatte sie Abu Duns schwarzen Mantel vom Stuhl genommen und versuchte sich nun an dem Kunststück, sich in das riesige Kleidungsstück zu wickeln, ohne sich hoffnungslos darin zu verfangen – was ihr jedoch nicht gelang. Vermutlich machte ihr allein das Gewicht des Mantels schon zu schaffen, so zierlich, wie sie war.
»Bei der Heiligen Jungfrau Maria, was ist das?«, erkundigte sie sich. »Ein Zelt?«
»Für den einen oder anderen sicher«, schmunzelte Andrej. »Für Abu Dun ist es ein Mantel. Und sei vorsichtig damit. Abu Dun ist ein wenig eigen, was seine Kleider angeht.«
»Vermutlich sind sie nicht so leicht zu ersetzen«, sagte Corinna. »Ich nehme an, es braucht eine ganze Weberei, um den Stoff für dieses …Ding …herzustellen.«
Andrej antwortete nur mit einer zurückhaltenden Kopfbewegung, und das Mädchen streifte den Mantel mit einer überraschend mühelosen Geste wieder ab, bückte sich nun doch nach ihrem eigenen Kleid und richtete sich dann aber wieder auf, ohne es angerührt zu haben. Wie sie so dastand, im warmen gelben Licht der Kerze, rührte sich schon wieder etwas in Andrej, doch diesmal kämpfte er das Gefühl nieder und begnügte sich damit, sich an ihrem bloßen Anblick zu erfreuen.
Anscheinend hatte er sich doch nicht so gut in der Gewalt, wie er glaubte, oder Corinna war eine sehr aufmerksame Beobachterin, denn sie sah ihn mit schräg gehaltenem Kopf an und fragte dann: »Oder doch die doppelte Summe?«
»Hab ein wenig Mitleid mit einem alten Mann«, erwiderte Andrej lächelnd, erntete aber nur einen spöttischen Blick.
»Ihr seid vielleicht ein wenig älter als ich, aber noch nicht so alt.«
»Ich bin älter, als ich aussehe, glaub mir«, sagte Andrej. Ungefähr fünfzehnmal so alt wie du. Wenn nicht zwanzig. Um ein Haar hätte er es laut ausgesprochen, ging stattdessen aber wortlos zum Bett, bückte sich nach seinen Kleidern und zog den schmal gewordenen Geldbeutel aus der Rocktasche. Andrej war sich der aufmerksamen Blicke bewusst, mit denen sie jeder seiner Bewegungen folgte. Vermutlich dachte sie zumindest für einen kurzen Augenblick darüber nach, wie sie auch in den Besitz der übrigen Münzen gelangen konnte, die sich noch darin befanden. Er sollte sich dieses Gedankens schämen, aber das wollte ihm genauso wenig gelingen, wie es ihr übel zu nehmen. Das Leben und die Menschen waren eben, wie sie waren.
Er bezahlte das Mädchen und sah ihr mit unverhohlenem Wohlgefallen dabei zu, wie sie sich anzog – wofür sie länger brauchte, als notwendig gewesen wäre. Doch statt dann zu gehen, hob sie das Glas auf, das nicht zerbrochen war, trat an den Tisch und füllte es mit dem Rest aus dem Weinkrug. Sie trank nicht gleich, sondern hielt es ihm fragend hin – Andrej schüttelte wortlos den Kopf – und nippte dann bloß an der blutfarbenen Flüssigkeit. Auch diesmal blieb eine einzelne schimmernde Träne in ihrem Mundwinkel zurück. Andrej war sich sicher, dass das ebenso wenig ein Zufall war wie die Bewegung, mit der sie sie erst nach etlichen Sekunden mit der Zungenspitze aufnahm. Das Mädchen verstand sein Geschäft. Was es nicht verstand und auch nicht verstehen konnte, war, dass es mit seinem Leben spielte. Wäre das Ungeheuer in ihm nur ein wenig stärker –
»Warum seid Ihr so traurig, Andrej?«, fragte sie.
»Bin ich das?« Andrej begann sich anzukleiden, wobei er – mit einem Mal schamhaft – zuerst in seine Hosen schlüpfte, bevor er die Decke fallen ließ – als ob es irgendetwas an ihm gegeben hätte, was sie nicht gesehen oder mit den Lippen berührt hatte!
»Ihr gebt es nicht zu, aber ich weiß, wenn jemand einen Schmerz zu verbergen versucht«, antwortete das Mädchen.
Andrej zog sich das Hemd über den Kopf, und etwas gleichermaßen Sonderbares wie Beunruhigendes geschah: Sein Blick streifte ihr Gesicht, und aus den Augenwinkeln wirkte sie beinahe androgyn. Wäre ihr Haar weiß, statt schwarz und glatt und nicht lockig gewesen …
Andrej schüttelte den Gedanken fast erschrocken ab und beeilte sich, in die zerschlissenen Stiefel zu schlüpfen. Als Letztes legte er den Waffengurt mit dem ungewohnt schmalen und lächerlich leichten Degen um, eine alberne Waffe, die diese Bezeichnung seiner Meinung nach kaum verdiente und niemals ein Ersatz für Gunjir sein würde. Aber Klingen wie diese (Kinderspielzeuge, wie Abu Dun sie nicht ganz unzutreffend genannt hatte) waren in dieser Stadt nun einmal in Mode, und Abu Dun und er waren übereingekommen, sich so unauffällig wie möglich zu verhalten.
Was ihm in Begleitung eines Mannes wie Abu Dun allerdings schwerfallen würde.
»Hat es mit Eurem Sohn zu tun?«, fragte Corinna. »Marius?«
Zuerst wollte er sie anfahren und ihr endgültig klarmachen, dass sie das nichts anging. Stattdessen schlüpfte er nur mit einiger Anstrengung in seinen zweiten Stiefel, sah von der Bettkante zu ihr hoch und nickte stumm.
»Ist er … tot?«, fragte Corinna.
Vielleicht war es das beinahe unmerkliche Stocken, das ihn antworten ließ, statt einfach aufzustehen und zu gehen, wozu er eben noch fest entschlossen gewesen war. »Nein«, sagte er.
»Was ist ihm dann zugestoßen?«
Das Schlimmste, was einem Menschen zustoßen kann. Ich. »Was bringt dich auf die Idee, dass ihm etwas zugestoßen ist?«, fragte er.
»Ihr habt im Schlaf gesprochen, schon vergessen?«
»Und du hast behauptet, du hättest nichts verstanden.«
»Vielleicht habe ich ja gelogen«, antwortete das Mädchen, lachte kopfschüttelnd und kam dann zu ihm, um sich auf seine Oberschenkel zu setzen. »Ich habe Euch doch gesagt, dass ich es spüre, wenn jemand einen Schmerz in sich trägt. Ist ihm ein Unglück widerfahren?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete Andrej. »Ich habe ihn vor einem Jahr das letzte Mal gesehen. Abu Dun und ich sind hergekommen, um nach ihm zu suchen, doch bisher erfolglos.«
Corinna legte fragend den Kopf auf die Seite und begann mit den Beinen zu baumeln, als wollte sie plötzlich das unbedarfte Kind mimen. »Erzählt mir von ihm!«, verlangte sie.
»Da gibt es nicht viel zu erzählen«, antwortete Andrej. »Ich habe ihn kaum gekannt.«
»Euren eigenen Sohn?«
»Ich habe ihn lange nicht gesehen«, sagte Andrej. »Fast sein ganzes Leben.«
»Das verstehe ich nicht.«
Wie auch? »Es ist … kompliziert«, sagte er. »Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, da war er noch ein Kind. Ich habe ihn kaum gekannt, auch vorher nicht, und dann ist er in meinen Armen gestorben.« Er schwieg einen kurzen, aber schmerzvollen Augenblick, der sich wie ein glühender Dolch in sein Herz senkte, und als er weitersprach, klang seine Stimme selbst in seinen eigenen Ohren wie die eines Fremden. »Jedenfalls dachte ich das. Ich habe ihn für tot gehalten, verstehst du?«
Er hatte viel mehr getan. Er hatte ihn mit seinen eigenen Händen begraben. Aber wie hätte er es denn wissen sollen?
»Aber er war es nicht.«
Andrej schüttelte den Kopf. »Vor einem Jahr habe ich es erfahren«, sagte er. Die Worte taten weh, unsagbar weh. Aber zugleich tat es auch auf sonderbare Weise gut, sie auszusprechen, so wie der Schnitt, mit dem man eine eiternde Wunde öffnet, schmerzt und zugleich große Erleichterung bringt. »Es war in London, am Tag des großen Brandes. Hast du davon gehört?«
»Nein. Vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Solche Dinge interessieren mich nicht. Ihr habt Euren Sohn dort wiedergefunden, nachdem Ihr viele Jahre lang gedacht habt, er wäre nicht mehr am Leben? Das muss schrecklich gewesen sein.«
»Er war sehr krank«, sagte Andrej. »Eine … ganz besondere Art von Krankheit. Eine Freundin wusste einen guten Arzt für dieses Leiden in Konstantinopel. Ich konnte noch nicht fort, also hat sie sich angeboten, zusammen mit Marius vorauszugehen. Wir wollten uns hier wieder mit ihr treffen.«
»Aber das habt Ihr nicht?« Corinna beantwortete ihre eigene Frage mit einem Kopfschütteln und trank den letzten Schluck Wein. »Das muss nichts bedeuten. Venedig ist eine große Stadt. Eine wirklich sehr große Stadt – natürlich nicht so groß wie London, aber dennoch groß. Hier könnt Ihr einen Monat nach jemandem suchen, ohne ihn zu finden. Und es ist ein weiter Weg von London hierher. Vielleicht wurde sie aufgehalten.«
Ja, vielleicht. Aber warum schickte Marius ihm dann diese Träume?
»Entschuldigt«, sagte Corinna, nachdem er eine Weile geschwiegen hatte. »Es tut mir leid. Ich habe kein Recht, solche Fragen zu stellen. Ich wollte Euch nicht noch mehr wehtun.«
»Das hast du auch nicht«, antwortete Andrej. »Im Gegenteil. Es hilft, darüber zu reden. Und es ist wirklich eine große Stadt.«
»Wenn auch nicht annähernd so groß wie London«, sagte Corinna noch einmal. »Erzählt Ihr mir davon? Es gab ein Feuer, sagt Ihr? Das klingt nach einer aufregenden Geschichte. Ich mag aufregende Geschichten … erzählt Ihr sie mir?«
Andrej wollte ganz automatisch nicken, aber dann sah er sie nur nachdenklich an und fragte: »Das kommt ganz darauf an. Was bekomme ich denn dafür?«
Corinna seufzte. Übertrieben. Dann begann sie, ihr Kleid abzustreifen.
»Sie suchen noch Männer für den Hafen«, sagte der Wirt am nächsten Morgen, während Abu Dun und er in seiner schäbigen Gaststube saßen und ein verspätetes Frühstück einnahmen. Abu Dun grunzte nur zur Antwort und schaufelte eine weitere Portion irgendeiner lokalen Spezialität in sich hinein, von der Andrej gar nicht wissen wollte, woraus sie bestand. Zu einem der unbestreitbaren Vorteile dessen, was sie waren, gehörte es, dass sie nicht vergiftet werden konnten. Immerhin war ihnen bisher noch kein Gift begegnet, das ihnen wirklich ernsthaft zu schaden vermochte.
Dennoch maß er den zerschrammten Holzteller mit einem unverhohlen misstrauischen Blick. Denn bis er an diesem Morgen die Augen aufgeschlagen und als Erstes in Abu Duns missmutiges Gesicht geblickt hatte, war er fest davon überzeugt gewesen, vor den unangenehmen Nachwirkungen des Alkohols gefeit zu sein … und doch hatte er heute einen gewaltigen Brummschädel und einen Geschmack auf der Zunge, der noch übler war als der Anblick dessen, was auf Abu Duns Teller lag.
Fragend sah er den Wirt an. Er wusste recht gut, wovon er sprach, zumal sie diese Unterhaltung nicht zum ersten Mal führten. Aber der Mann (Andrej musste sich zu seiner Schande eingestehen, dass er nicht einmal seinen Namen kannte) war nicht nur schwatzhaft und neugierig, sondern auch überaus freundlich. Immerhin war dies das einzige Gasthaus in der nicht gerade kleinen Stadt, in dem sie überhaupt ein Zimmer bekommen hatten, das sie bezahlen konnten.
»Aha«, sagte er schließlich aus reiner Höflichkeit und weil er nicht weiteressen musste, wenn er sich unterhielt.
»Ich weiß, dass es mich nichts angeht«, fuhr der Wirt fort, wischte sich die fettigen Hände an seiner ebenso fettigen Schürze ab und nutzte die Gelegenheit gleich, um sich unaufgefordert zu ihnen zu setzen – was ihm einen schrägen Blick von Andrej und ein genießerisches Schmatzen Abu Duns einbrachte. »Ich persönlich halte nichts von all dem Gerede von Krieg und Verteidigung und der schrecklichen Gefahr durch die Türken. Ich meine: Warum sollten sie uns angreifen?«
»Venedig ist eine wohlhabende Stadt«, gab Andrej zu bedenken – wider besseres Wissen. Ihm war nicht nach einem Schwätzchen mit einem redseligen Schankwirt. Aber es war natürlich längst zu spät.
»Die reichen Pfeffersäcke aus den besseren Vierteln vielleicht«, schnaubte der Wirt. »Aber selbst die stapeln ihr Geld nicht in Säcken auf dem Dachboden, sondern haben es auf Banken getragen oder in irgendwelchen Papieren angelegt.« Er sprach das Wort aus, als handle es sich um etwas Widernatürliches. »Es sind moderne Zeiten.«
»Die Euch nicht gefallen?«
»Was würde es schon ändern, ob sie mir gefallen oder nicht?«, antwortete der Wirt. »Wer sollte uns angreifen, und warum? Wir treiben seit vielen Jahren Handel mit den Muselmanen, und sie profitieren genauso davon wie wir. Warum also sollten sie uns angreifen oder gar Krieg gegen uns führen wollen? Es wäre doch kurzsichtig, das Huhn zu schlachten, das goldene Eier legt, oder? So dumm sind nicht einmal die Turbanträger!«
»Ich glaube, es heißt die Gans, die goldene Eier legt«, sagte Abu Dun mit vollem Mund und rückte den gewaltigen Turban auf seinem Kopf zurecht.
Der Wirt sah ihn erschrocken an und fuhr dann hastig fort: »Wenn ihr mich fragt, dann sind die einzigen Räuber, die unsere reichen Mitbürger zu fürchten haben, die Steuerschätzer und ihre Eintreiber, und die Festungsmauer, die die nicht überwinden können, ist noch nicht gebaut.«
Andrej hütete sich, auch nur mit einem einzigen Wort darauf einzugehen; den Fehler hatte er nur ein einziges Mal, an ihrem ersten Abend hier, gemacht. Niemand mochte Steuereintreiber, und sich das eine oder andere Mal über sie zu echauffieren oder auch einen derben Scherz auf ihre Kosten zu machen, war etwas, das er nur zu gut verstand. Ihr schwatzhafter Wohltäter jedoch schien einen ganz besonderen Groll auf diesen besonderen Zweig der Obrigkeit zu hegen, entweder aus schlechter Erfahrung oder einfach aus Prinzip. Kam die Sprache jedenfalls auf dieses besondere Thema, dann kannte er kein Halten mehr und steigerte sich in seinem Lamentieren in schiere Raserei, die Stunden dauern konnte.
»Du meinst also, wir sollten uns dem Heer anschließen?«, fragte Abu Dun schmatzend.
»Gott bewahre!«, erwiderte der Gastwirt erschrocken. »Ich bin ein Mann des Friedens, kein Kriegstreiber! Aber wo ein Heer zusammengestellt und eine Flotte ausgerüstet wird, da fällt immer eine Menge zusätzliche Arbeit an. Es wird bestimmt noch Monate dauern, bis alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, und sie werden eine Menge weiterer Arbeiter brauchen, die schließlich irgendwo unterkommen müssen.« Er feixte breit. »Und wie es der Zufall will, habe ich ein Gasthaus.«
Andrej nickte, sah auf seinen Teller hinab und fragte sich, wie viele seiner zukünftigen Gäste er wohl vergiften würde, bevor man ihn hinrichtete oder als Ruderer auf einer der zahlreichen Galeonen zwangsverpflichtete, die gerade draußen im Golf darauf warteten, sich zu einer Flotte zu vereinen und in den Krieg zu ziehen. Der Gastwirt fuhr fort: »Aber das alles erzähle ich euch nicht umsonst. Mein Schwager – der ansonsten ein rechter Stinkstiefel ist, aber wer kann sich seine Verwandten schon aussuchen? – arbeitet am Hafen, und erst gestern hat er mir erzählt, dass sie noch nach Leuten suchen. Es ist schwere Arbeit, aber sie wird gut bezahlt, und ihr seht mir nicht aus wie Männer, die Angst davor haben, kräftig zuzupacken.«
Abu Dun grunzte zustimmend, schaufelte sich eine weitere Portion des unappetitlichen Breis in den Mund und rückte mit der anderen Hand erneut seinen Turban zurecht. »Wir sind nicht auf der Suche nach Arbeit«, sagte er mit vollem Mund und einem gierigen Blick auf den Teller, den Andrej bisher kaum angerührt hatte. Wortlos schob Andrej ihn ihm zu.
»Ich sage das auch nur, weil ich nicht umhingekommen bin, eure … nun, sagen wir: angespannte pekuniäre Situation … zu bemerken.«
»Angespannte pekuniäre Situation«, wiederholte Abu Dun.
»Er meint, wir sind bankrott«, übersetzte Andrej.
»Nicht dass es mich etwas anginge«, sagte der Wirt hastig.
»Wie wahr«, bestätigte Andrej.
»Und es ist auch ganz und gar nichts, dessen man sich schämen müsste«, fuhr der Wirt ebenso ungerührt wie gönnerhaft fort. »Ich bin Gastwirt. Ich sehe die Reichen und die Armen – um ehrlich zu sein, verirren sich die Reichen nicht ganz so oft in dieses Viertel wie die weniger Vermögenden –, aber ich kenne sie beide. Ihr seid keine armen Männer. Eure Kleider haben schon bessere Zeiten gesehen, aber sie waren nicht billig, und würdet ihr nicht so aussehen, wie ihr es nun einmal tut, dann wäre es nicht ungefährlich, mit euren Waffen an der Seite durch dieses Stadtviertel zu laufen.«
Immerhin war der Mann ein guter Beobachter, das musste Andrej ihm lassen. Vielleicht brachte das sein Beruf ja mit sich. »Ist es in dieser Stadt verboten, Waffen zu tragen?«, fragte er.
»Nein. Aber nicht ungefährlich, wenn sie so kostbar sind wie eure.«
Abu Dun schmatzte genießerisch, und Andrej begann sich nun zu fragen, worauf der Bursche eigentlich hinauswollte. Vielleicht waren seine Worte ja mehr als das Geplapper, für das er sie bisher gehalten hatte.
»Es stimmt«, sagte er, »wir haben eine lange Reise hinter uns, und unsere Reisekasse ist ziemlich erschöpft.«
»Wir hatten unvorhergesehene Ausgaben«, stimmte ihm Abu Dun zu. Andrej sah ihn überrascht an, und der Nubier schenkte ihm ein freudloses Grinsen und kaute schmatzend und mit nur halb geschlossenen Lippen weiter. Bei diesem Anblick sah Andrej rasch weg, was der Nubier zweifellos beabsichtigt hatte.
»Eure Sorge ehrt Euch«, fuhr er an den Wirt gewandt fort, »auch wenn sie unbegründet ist. Wir haben Freunde, die uns helfen werden, sollte es sich als notwendig erweisen … und Geld hat uns noch nie interessiert.«
»So wenig wie mich«, sagte der Wirt. »Außer wenn ich keines habe – was leider Gottes häufig der Fall ist. Ich helfe nun einmal gerne, wenn ich es kann. Meine Frau sagt immer, dass das mein größter Fehler ist und mir eines Tages noch einmal Ärger einhandeln wird, aber ich kann nun mal nicht aus meiner Haut. Ich meine: Wer kann das schon?«
Abu Dun hörte auf zu kauen, hob das schartige Messer, das neben seinem Teller lag, und betrachtete zuerst nachdenklich die Schneide und dann das Doppelkinn des Gastwirts. »Manchen soll es schon gelungen sein«, sinnierte er.
Andrej versuchte, Abu Duns Bemerkung mit einem leisen Lachen zu entschärfen. Er fand, dass der größte Fehler des Mannes seine Schwatzhaftigkeit war. »Warum sagt Ihr nicht einfach, worauf Ihr hinauswollt?«, fragte er.
»Ich?« Der Wirt war nicht nur ein ausgezeichneter Beobachter, sondern auch ein passabler Schauspieler. Der leicht vorwurfsvolle Blick, mit dem er Andrej maß, wirkte sogar fast überzeugend. »Ich wollte nur helfen, das ist alles. Es ist eine ehrliche Arbeit.«
»Die sogar ein Turbanträger bewerkstelligen kann«, vermutete Abu Dun.
Der Wirt starrte ihn mit steinerner Miene an, stand dann wortlos auf und trollte sich hinter seine Theke, wo er demonstrativ mit Krügen und Geschirr zu scheppern begann. Andrej sah ihm schweigend zu und wandte sich dann ruhig zu Abu Dun um.
»Musstest du ihn so reizen?«, fragte er; allerdings mit einem Lächeln und vorsichtshalber auf Arabisch, das der Wirt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verstand.
»Ich traue dem Kerl nicht«, antwortete Abu Dun in derselben Sprache. »Er ist ein Schlitzohr und Halsabschneider.«
»Der dasselbe vermutlich auch von uns denkt«, fügte Andrej hinzu. »Und uns ein Dach über dem Kopf und Essen gibt. Du bringst uns in Schwierigkeiten, Pirat.«
»In Schwierigkeiten, Hexenmeister«, antwortete der Nubier betont, »bin ich seit dem Tag, an dem ich das Pech hatte, dich kennenzulernen.«
Verärgert schluckte Andrej die scharfe Antwort hinunter, die ihm auf der Zunge lag. Manchmal wusste selbst er nicht, wann Abu Dun es ernst meinte und wann er einen seiner derben Scherze trieb. Oder ob das überhaupt einen Unterschied machte. Doch seit sie in Venedig angekommen waren, wurde der Nubier zunehmend gereizt und unduldsam. Bisher hatte er noch nichts wirklich Dummes getan, aber es war abzusehen, dass bald etwas geschehen würde, das ihnen wirkliche Schwierigkeiten einbrachte.
»Du warst gestern Nacht noch unterwegs?«, fragte er, um auf ein anderes Thema überzuleiten.
»Im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten habe ich nicht ganz vergessen, warum wir hier sind«, knurrte Abu Dun und zu Andrejs Missfallen nun wieder auf Italienisch. »Obwohl wir ja offensichtlich beide genug Bewegung hatten.«
Der Wirt hinter seiner Theke hörte zwar nicht auf, mit seinen Krügen zu klappern, sah aber ganz unverhohlen neugierig in ihre Richtung, und Andrej meinte geradezu sehen zu können, wie seine Ohren größer wurden.
»Nur kein Neid«, antwortete er. »Hast du etwas herausgefunden?«
»Ja«, grunzte Abu Dun. »Dass man Turbanträger in dieser Stadt nicht besonders mag.« Er schaufelte auch noch den Rest von Andrejs Portion in sich hinein, rülpste in einer Lautstärke, als wäre irgendwo nicht sehr weit entfernt ein Haus zusammengebrochen, und warf dem Wirt ein schiefes Grinsen zu.
»Verzeiht«, sagte er. »Eine schlechte Angewohnheit aus dem Land der Barbaren und Turbanträger.«
»Bitte hör auf«, sagte Andrej, jetzt wieder ins Arabische wechselnd und sehr ernst. »Wir brauchen den Mann vielleicht noch.«
»Ganz wie Ihr befehlt, Sahib«, antwortete Abu Dun ungerührt und weiter auf Italienisch. »Und um Eure Frage abschließend zu beantworten, Efendi: Nein, ich habe nichts herausgefunden. Außer dass die guten Leute in dieser prachtvollen Stadt anscheinend sofort mit Taubheit und Erinnerungsverlust geschlagen sind, sobald man ihnen auch nur eine Frage stellt.«
»Vielleicht stellt ihr ja die falschen Fragen«, mischte sich der Wirt ein, »oder richtet sie an die falschen Leute.« Er kam wieder hinter seiner Theke hervor und schien fest entschlossen, den kleinen Zwischenfall zu vergessen. »Ihr seid immer noch auf der Suche nach euren Landsmänninnen?«
»Man könnte meinen, du hättest uns belauscht, wenn der Gedanke nicht so absurd wäre«, sagte Abu Dun. Er hatte ein Stückchen Brot entdeckt, das er nun mit spitzen Fingern aufnahm, um damit einen Rest Soße von seinem Teller aufzutupfen. Jedenfalls nahm Andrej an, dass es Soße war.
»Ihr seid jetzt seit beinahe einer Woche hier«, sagte der Wirt. Er war wieder an ihren Tisch getreten, machte aber keine Anstalten, sich erneut zu setzen. »Und ihr habt in dieser Zeit jeden nach diesen drei schwarzen Frauen gefragt, der nicht schnell genug weglaufen konnte. Inzwischen beginnt man über euch zu reden.«
»Das sind wir gewohnt«, erwiderte Abu Dun. Der letzte Brotkrumen war vertilgt, und sein Blick wanderte suchend über die zerschrammte Tischplatte, fand aber nichts mehr.
»Vielleicht kann ich euch ja behilflich sein«, sagte der Gastwirt. »Ihr würdet bei meinem Schwager nicht nur gutes Geld verdienen, wisst ihr? Hafenarbeiter sind ein schwatzhaftes Völkchen, und Neuigkeiten erreichen die Stadt meistens auf dem Seeweg. Wenn eure Freunde mit einem Schiff angekommen sind, dann hat sie dort gewiss jemand gesehen.«
»Lass mich raten«, sagte Abu Dun. »Du bekommst eine Provision für jeden Mann, den du deinem Schwager vermittelst, die demjenigen zweifellos vom Lohn abgezogen wird … ohne dass er es auch nur ahnt.«
»Man muss sehen, wo man bleibt«, sagte der Wirt ein bisschen trotzig.
»Nehmt es meinem Freund nicht übel«, sagte Andrej rasch. »Wir … haben schon einmal in einem Hafen gearbeitet und keine guten Erfahrungen dabei gemacht.«
»Was ist passiert?«, wollte der Wirt wissen.
»Die Stadt ist abgebrannt«, antwortete Abu Dun.
»Und die Flotte gesunken«, fügte Andrej hinzu.
Das entsprach sogar der Wahrheit, auch wenn die Geschichte komplizierter gewesen war, aber das Lächeln des Mannes erlosch, und er drehte sich zum zweiten Mal mit einem Ruck auf dem Absatz herum und ging, um diesmal hinter einer niedrigen Tür hinter der Theke zu verschwinden.
Abu Dun sah ihm kopfschüttelnd nach. »Da ist man mal ehrlich, und so wird es einem gedankt.«
»Undank ist der Welt Lohn«, bestätigte Andrej und wurde dann wieder ernst. »Vielleicht sollten wir aufgeben«, sagte er. »Wir sind jetzt seit einer Woche hier und haben noch nicht einmal eine Spur von Meruhe oder Marius gefunden. Wahrscheinlich sind sie nicht hier.«
»Es war dein Vorschlag hierherzukommen.«
»Und es war eine dumme Idee«, erwiderte Andrej. »Ich hätte auf dich hören sollen. Sie sind nicht hier und waren es wohl auch nie.«
Abu Dun sah ihn so vorwurfsvoll an, dass eine Erwiderung überflüssig wurde. Andrej suchte vergeblich nach einer scherzhaften Bemerkung, um die Situation zu entspannen. Abu Dun hatte ja vollkommen recht – vor allem mit dem, was er nicht sagte. Der Nubier hatte von Anfang an keinen Hehl daraus gemacht, wie wenig begeistert er von der Idee war, Meruhe und ihre beiden Dienerinnen allein loszuschicken, um Marius in die Obhut jenes geheimnisvollen Arztes zu bringen, von dem sie behauptet hatte, er wäre der Einzige auf der Welt, der ihm helfen könnte, ein Mann in Konstantinopel, dessen Namen sie nicht einmal kannte.
Wie sich gezeigt hatte, war Abu Duns Skepsis nur zu berechtigt gewesen. Knapp zwei Monate später waren sie den drei hübschen Kriegerinnen und Marius gefolgt. Sie waren geritten wie die Teufel, einmal quer durch Europa von London nach Konstantinopel, doch weder hatten sie Meruhe gefunden, noch hatte dort jemand von ihr gehört; geschweige denn von dem Arzt, von dem ihre Dienerinnen gesprochen hatten. Wie es aussah, waren sie niemals dort angekommen.
Andrej verscheuchte die trübseligen Gedanken. In diesem Moment flog die Tür auf, und eine kleine Gestalt in einem schwarzen Mantel stürmte herein. Beinahe wäre sie über ihre eigenen Füße gestolpert, machte noch zwei hastig-ungeschickte Schritte und wäre vermutlich der Länge nach hingefallen, hätte Andrej nicht blitzschnell die Hand ausgestreckt und sie aufgefangen. Ein schmerzerfülltes Zischen erklang, und Andrej lockerte seinen Griff ein wenig, als er spürte, wie zerbrechlich der Arm unter dem schwarzen Stoff war.
»Hilf mir, Andrej!«, sagte eine vor Angst bebende Stimme.
Andrej?
Abu Dun runzelte die Stirn und legte fragend den Kopf auf die Seite, wobei er offensichtlich noch einen allerletzten Brotkrumen gewahrte, den er mit der Fingerspitze aufnahm und zwischen den Lippen verschwinden ließ. Andrej sprang auf und riss überrascht die Augen auf, als die kleine Gestalt mit der freien Hand ihre Kapuze zurückschlug und er das schwarze Lockenhaar und das schmale Gesicht erkannte, das darunter zum Vorschein kam.
»Corinna?«, murmelte er.
»Ist das der Name, den sie Euch genannt hat?«, fragte eine Stimme von der Tür aus.
Andrej ließ den Arm des Mädchens los, drehte sich herum und trat zwischen sie und die zweite Gestalt, die in der Tür aufgetaucht war. Es war so hell draußen, dass er nur einen Umriss erkannte und kein Gesicht, aber in der Stimme lag etwas, das ihm nicht gefiel. Aus den Augenwinkeln sah er, wie sich Abu Dun halb erhob und sich dann wieder zurücksinken ließ.
»Und wie ist dein Name, mein Freund?«, fragte er.
Der Schatten trat näher und wurde zu einem breitschultrigen Mann unbestimmbaren Alters mit dunklem Haar und einem kantigen Gesicht. »Der tut nichts zur Sache«, sagte er. Der Blick seiner harten Augen fixierte Corinna und verlor sie wieder, als sie sich hastig ganz hinter Andrejs Rücken verkroch. »Ihr habt sie festgehalten. Das ist gut. Jetzt gebt sie heraus und überlasst sie mir. Und vielen Dank für Eure Hilfe.«
»Nicht ganz so schnell, mein Freund.« Andrej hob die Hand, als der Fremde eine Bewegung machte, als wolle er um ihn herumgehen. »Was ist hier los?«
»Du musst mir helfen, Andrej!«, flehte das Mädchen. »Sie wollen mir etwas antun! Bitte! Diese brutalen Kerle haben mich durch die halbe Stadt gejagt!«
Die Küchentür flog auf, und der Wirt kam herein. »Was geht hier vor?«, fragte er laut und eine Bratpfanne mit einem hölzernen Griff schwenkend – die ganz so aussah, als hätte sie schon mit mehr als nur einem Schädel Bekanntschaft gemacht. »Wer seid Ihr, und was habt Ihr hier zu suchen?«
»Ich habe es schon gefunden«, antwortete der Fremde. Andrej sah nicht hin, aber er konnte hören, dass draußen auf der Straße noch mindestens zwei weitere Männer warteten, vielleicht mehr. »Wir sind hinter einer Diebin her.«
»Einer Diebin?«, fragte Andrej.
»Das ist nicht wahr!«, protestierte Corinna. »Ich habe nichts gestohlen!«
»Das ist mir gleich«, antwortete der Wirt. »Ich will hier keinen Ärger. Verschwinde!«
»Gebt uns diese kleine Diebin, und wir sind schon wieder weg«, antwortete der Fremde. Er wandte sich direkt an Andrej. »Kennt Ihr sie?«
»Flüchtig«, antwortete Andrej.
»Aber gut genug, um eine Menge Ärger zu riskieren, nur wegen einer Hure und Taschendiebin?«
Andrej zog es vor, darauf nicht zu antworten, aber nun erhob sich auch Abu Dun und nahm hinter ihm Aufstellung. Obwohl sich in den herausfordernden Blick des Fremden eine erste Spur von Unsicherheit mischte, schürzte er nur abfällig die Lippen.
»Ich glaube nicht, dass ihr Euch mit fünf Männern auf einen Streit einlasst, nur wegen einer kleinen Straßendirne. Oder war sie so gut?«
»Wer weiß«, sagte Andrej kühl. »Auf jeden Fall spricht man so nicht über eine Dame. Schon gar nicht, wenn sie dabei ist.«
»Dame?«, höhnte der Fremde. »In der Tat, sie muss wirklich Eindruck gemacht haben.«
»Hört auf!«, sagte der Wirt herrisch. »Ich dulde in meinem Haus keinen Streit! Verschwindet, oder ich rufe die Signori!«
Weder Andrej noch der hartgesichtige Fremde nahmen seine Worte zur Kenntnis, aber Andrej zollte ihm doch in Gedanken zumindest widerwilligen Respekt. Mut hatte er.
»Ich fürchte, jetzt haben wir ein Problem«, sagte Andrej.
»Oder auch nicht.« Er hörte, wie sich Abu Dun hinter ihm regte, dann das Rascheln von Stoff und einen halblauten Schrei, von dem er nicht genau sagen konnte, ob er erschrocken oder empört war. Er fuhr herum und sah erstaunt, dass Abu Dun Corinna mit einer Hand gepackt und mit der anderen Hand unter ihren Mantel gegriffen hatte.
»Ist das deiner, Mädchen?«, fragte er, als er die Hand wieder hervorzog und einen schmalen, mit einer dünnen goldenen Schnur verschlossenen Geldbeutel schwenkte.
»Natürlich ist es meiner!«, fauchte Corinna, während sie sich vergebens loszureißen versuchte.
»Es sind drei Goldmünzen darin«, sagte der Fremde, »ein halbes Dutzend Kupfermünzen und der erste Milchzahn meiner Tochter, den sie vor einem halben Jahr verloren hat. Mein Glücksbringer.«
Abu Dun zog die goldene Kordel mit den Zähnen auf (mit der anderen Hand hielt er immer noch das Mädchen fest), sah in den Beutel und zog ihn dann auf dieselbe Weise wieder zu.
»Stimmt«, sagte er, gab den Beutel an Andrej weiter und griff noch einmal unter Corinnas Mantel, um einen zweiten, abgewetzteren und schlichteren Lederbeutel hervorzuziehen und ihn dem verblüfften Andrej zu reichen. Der befestigte den Beutel wortlos an seinem Gürtel, von dem er ihm irgendwie im Laufe der zurückliegenden Nacht abhandengekommen war, und drehte sich dann zu dem Fremden um. Noch immer schweigend gab er den ersten Fund seinem legitimen Besitzer zurück, der nicht einmal hineinsah, sondern ihn in der Jackentasche verschwinden ließ.
»Das war sicher nur ein Missverständnis«, sagte er. »Es tut mir leid. Aber nun habt Ihr Euer Eigentum ja zurück, und die Sache ist erledigt.«
Der Bursche sah ihn fassungslos an, fing sich aber sofort wieder. »So einfach ist das nicht. Niemand bestiehlt mich ungestraft.«
»Ihr wollt sie den Behörden übergeben?«, vermutete Andrej.
»Aber das wäre doch reine Zeitverschwendung. Sie würde den Signori schöne Augen machen und wäre nach einer Stunde wieder frei. Da fällt uns gewiss eine bessere Lösung ein. Eine gerechtere.«
»Ich fürchte, das kann ich nicht zulassen«, sagte Andrej. »Ihr habt Euer Eigentum zurück, und damit solltet Ihr es gut sein lassen. Also geht jetzt besser, bevor die Sache hässlich wird.«
»Und was genau versteht Ihr unter hässlich?«, fragte der Fremde lauernd. »Wollt Ihr Euch hinter Eurem großen Freund da verstecken?«
»Was immer es ist, macht das unter euch aus und nicht hier drinnen«, sagte der Wirt. »Ich sage es nicht noch mal!«
Andrej seufzte. Er war nicht auf Streit aus, und sein Verstand sagte ihm, dass ihn die Sache nichts anging und er nicht den geringsten Anlass hatte, sich für eine kleine Diebin einzusetzen, die schließlich auch ihn bestohlen hatte. Aber dann schüttelte er doch den Kopf.
»Tun wir, was der gute Mann sagt, und klären die Angelegenheit draußen und wie zivilisierte Männer«, sagte er. »Ich bin sicher, wir finden eine Lösung.« Er schnallte seinen Waffengurt ab und legte den reich verzierten Degen mit einer demonstrativ vorsichtigen Bewegung auf den Tisch. »Und keine Sorge. Mein großer Freund wird sich nicht einmischen.«
Der Dunkelhaarige maß Corinna mit einem kurzen und verächtlichen Blick. Abu Dun ignorierte er. »Ich hoffe, sie ist es wert.« Und damit fuhr er auf dem Absatz herum und stürmte hinaus.
Kapitel 2
Da hast du in London etwas gründlich falsch verstanden, Hexenmeister«, sagte Abu Dun, passend zu seinen Worten diesmal in englischer Sprache. »Gentlemen setzen sich für unschuldige junge Ladys ein, nicht für kleine Diebinnen.«
»Ihr könnt durch die Küche raus«, sagte der Wirt leise. »Wenn ihr über die Hofmauer steigt, dann könnt ihr verschwinden, bevor sie es auch nur merken.«
»Und den ganzen Spaß versäumen?«, fragte Abu Dun, und jetzt selbstverständlich in einer Sprache, die der Mann auch verstand.
»Das würde Euch schlecht bekommen«, sagte Andrej rasch. »Und Ihr habt unseretwegen schon genug Ärger.«
Er bedeutete Abu Dun mit einer knappen Handbewegung, den Mund zu halten und ihm zu folgen. Der Nubier kam der Aufforderung auch nach; allerdings ließ er Corinnas Arm dabei nicht los, sondern zerrte sie einfach hinter sich her.
Andrej blinzelte, als er in das unerwartet helle Licht der Morgensonne hinaustrat, erkannte zunächst nichts als verschwommene Schemen und konzentrierte sich ganz auf seine anderen Sinne – rechnete er doch fest damit, dass die Männer seinen vermeintlichen Nachteil ausnützen und sich unverzüglich auf ihn stürzen würden. Doch er hörte nur ein überraschtes Raunen, als Abu Dun hinter ihm aus dem Haus trat. Vielleicht hatten sie ja Glück, und es ging doch noch ohne Blutvergießen ab.
Andrej blinzelte noch einmal, und die Schatten flossen zu Körpern zusammen, drei auf der linken Seite, dann noch einmal zwei weitere auf der anderen, womit sich in keiner Richtung ein Fluchtweg bot – selbst wenn die Straße nicht so schmal gewesen wäre, dass Abu Dun die Wände auf beiden Seiten mit den Fingerspitzen berühren konnte, wenn er die Arme ausstreckte.
»Und?«, fragte der Bursche, dem er nach draußen gefolgt war. »Wollt Ihr es immer noch mit uns allen aufnehmen, mein Freund?«
Bevor Andrej antwortete, ließ er seinen Blick noch einmal taxierend über die vier anderen Burschen wandern. Er las auf allen Gesichtern dieselbe Mischung aus Entschlossenheit und grimmiger Vorfreude, und ganz besonders auf dem eines vierschrötigen Burschen, dessen nackte Oberarme beinahe missgestaltet wirkten, so muskulös waren sie. Er war fast so groß wie Abu Dun ohne Turban und sah so friedfertig aus wie ein nordafrikanisches Flusspferd, dass sein Territorium verletzt sieht.
»Ich nehme an, wir können noch einmal über alles reden, wenn ich Euch das Mädchen ausliefere?«, fragte er.
»Eher nicht«, antwortete der Hartgesichtige. »Ich meine, Eure kleine Hure da bekommen wir sowieso, und Paolo hat sich jetzt schon so auf ein bisschen Spaß gefreut. Er kann ziemlich unangenehm werden, wenn man ihm seine kleinen Vergnügungen verwehrt, wisst Ihr?«
Andrej nickte, seufzte resigniert und stieß Paolo die Fingerspitzen der Linken wuchtig gegen die Kehle. Der schwarzhaarige Hüne stolperte zwei Schritte zurück, schlug beide Hände gegen den Hals und rang mit hervorquellenden Augen nach Luft. Röchelnd sank er auf die Knie und kippte von dort aus zur Seite. Andrej drehte sich wieder zu dem Hartgesichtigen um.
»So wütend sieht er eigentlich gar nicht aus«, sagte er lächelnd. »Soll ich mich jetzt noch mit einem weiteren deiner Freunde unterhalten oder gleich mit allen zusammen?«
Offenbar mit allen zusammen. Die Überraschung der Burschen dauerte nur einen kurzen Moment, dann stürzten sie sich mit einem Aufschrei auf ihn.
Andrej spürte sofort, dass er es mit erfahrenen Männern zu tun hatte, die das Kämpfen gewohnt waren. Er empfing den ersten Burschen mit einem Fausthieb in den Leib, der diesen nach Luft japsend zu seinem Kumpan am Boden schickte. Es gelang ihm auch, den Fausthieb eines zweiten mit dem Unterarm abzublocken, ein anderer jedoch schlug ihm mit solcher Gewalt in die Nieren, dass er vor Schmerz aufstöhnte, und der vierte warf sich gleich auf seinen Rücken, schob die Arme unter seinen Achseln hindurch und verschränkte die Hände hinter seinem Nacken – ein Griff, mit dem man auch einen sehr viel stärkeren Gegner mühelos halten konnte. Andrej hätte ihn trotzdem sprengen können, doch stattdessen warf er sich so wuchtig zurück und gegen die Wand, dass der Bursche mit einem sonderbar quietschenden Schrei nach Luft rang und dann kraftlos zusammenbrach. Andrej musste ihn nicht einmal mehr abschütteln.
Doch vor seinen Augen tobten rote und grüne Blitze. Er schmeckte Blut, und der rasende Schmerz in seinem Rücken ebbte nur allmählich ab. Er sah kaum mehr als Schemen, schaffte es trotzdem irgendwie, zwei weitere Schläge abzuwehren, und wurde praktisch im gleichen Augenblick von einer dritten Faust mit solcher Wucht an der Kinnspitze getroffen, dass er beinahe das Bewusstsein verloren hätte. Dennoch griff er ganz instinktiv nach dem zu der Faust gehörigen Arm, verdrehte ihn mit einem Ruck und wurde mit dem dumpfen Laut belohnt, mit dem ein Körper auf dem harten Boden aufschlug.