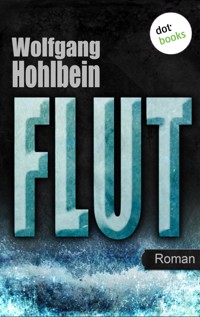5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Andrej und Abu Dun
- Sprache: Deutsch
Band 2 der spektakulären Vampir-Serie vom Fantasy-Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein!
Andrej und Frederic verfolgen das Sklavenschiffs, das ihre Familien verschleppt hat. Doch dabei geraten die beiden Vampyre in die Gewalt des Piraten Abu Dun. Als das Schiff von einem furchteinflößenden Drachenritter angegriffen wird, müssen sich die Feinde verbünden. Denn bei dem grausamen Krieger handelt es sich um keinen Geringeren als den transsilvanische Graf Clad Tepesch - auch Dracul genannt. Er will das Geheimnis von Andrejs Unsterblichkeit erfahren, und dazu ist ihm jedes Mittel recht ...
Wolfgang Hohlbeins erfolgreicher Fantasy-Zyklus "Die Chronik der Unsterblichen" als eBook bei beBEYOND. Die weiteren Folgen:
Band 1: Am Abgrund
Band 3: Der Todesstoß
Band 4: Der Untergang
Band 5: Die Wiederkehr
Band 6: Die Blutgräfin
Band 7: Der Gejagte
Band 8: Die Verfluchten
Band 8,5: Blutkrieg
Band 9: Das Dämonenschiff
Band 10: Göttersterben
eBooks von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Über das Buch
Band 2 der spektakulären Vampir-Serie vom Fantasy-Bestseller-Autor Wolfgang Hohlbein! Andrej und Frederic verfolgen das Sklavenschiffs, das ihre Familien verschleppt hat. Doch dabei geraten die beiden Vampyre in die Gewalt des Piraten Abu Dun. Als das Schiff von einem furchteinflößenden Drachenritter angegriffen wird, müssen sich die Feinde verbünden. Denn bei dem grausamen Krieger handelt es sich um keinen Geringeren als den transsilvanische Graf Clad Tepesch – auch Dracul genannt. Er will das Geheimnis von Andrejs Unsterblichkeit erfahren, und dazu ist ihm jedes Mittel recht ...
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein, 1953 in Weimar geboren, lebt mit seiner Frau Heike und seinen Kindern am Niederrhein, umgeben von einer Schar Katzen und Hunde. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart. Seine Werke wurden in 47 Sprachen übersetzt und mit über zwanzig nationalen und ungezählten internationalen Preisen ausgezeichnet. Weitere Informationen unter: www.hohlbein.de.
WOLFGANG HOHLBEIN
DER VAMPYR
beBEYOND
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe
© 2000 by LYX.digital, Köln
Für diese Ausgabe
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Redaktion: Dieter Winkler
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Betty4240 | Colin_Hunter | zegers06; © shutterstock: Dm_Cherry
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-5902-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
1
Er kannte den Tod, doch an das Töten selbst würde er sich nie gewöhnen. Aber manchmal blieb ihm keine andere Wahl, als seine Skrupel zu überwinden.
Andrej presste sich mit angehaltenem Atem in den schwarzen Schlagschatten unter der Treppe und lauschte. Ihm war entsetzlich kalt. Er zitterte am ganzen Leib. Sein Herz hämmerte so laut, dass es jedes andere Geräusch zu übertönen schien, und jeder Muskel in seinem Körper war zum Zerreißen angespannt. Er hielt das Schwert mit solcher Kraft umklammert, dass es schon beinahe wehtat.
Obwohl rings um ihn herum vollkommene Dunkelheit herrschte, wusste er, dass Blut von der Klinge tropfte und sich zwischen seinen Füßen zu einer schmierigen Pfütze sammelte. Er glaubte den Dunst des Blutes riechen zu können, vergegenwärtigte sich aber, dass es das Schiff war, dessen düsteren Odem er in sich aufnahm.
Es roch falsch. Andrej war in seinem Leben schon auf vielen Schiffen gewesen und er wusste, wie sie riechen sollten: nach Meer. Nach Salzwasser und Wind, möglicherweise nach Fisch, nach faulendem Holz und moderndem Tauwerk, nach nassem Segelzeug oder auch nach den exotischen Gewürzen und kostbaren Stoffen, die sie transportiert hatten.
Dieses Schiff jedoch stank nach Tod.
Aber schließlich war er auch nie zuvor an Bord eines Sklavenschiffes gewesen.
Schritte näherten sich, polterten einen Moment auf dem Deck über ihm und kamen noch näher, entfernten sich dann wieder. Andrej atmete auf. Er hätte den Seemann mit einem Stich ins Herz getötet, rasch, lautlos und vor allem barmherzig, aber er war froh, dass er es nicht hatte tun müssen. Sein Stiefvater Michail Nadasdy hatte ihn zu einem überragenden Schwertkämpfer ausgebildet, der im Notfall blitzschnell zu töten vermochte, aber Andrej war nicht hier, um ein Blutbad anzurichten.
Dabei war er fest dazu entschlossen gewesen, genau das zu tun, als Frederic und er sich an die Verfolgung des Sklavenschiffes gemacht hatten. Hätten sie Abu Duns Sklavensegler sofort eingeholt oder auch nur am nächsten Tag, hätte er wahrscheinlich versucht, nach und nach die gesamte Mannschaft des Seelenverkäufers auszulöschen. Aber das war nicht geschehen – und Andrej dankte Gott dafür. Es hatte in den letzten Tagen schon genug Tote gegeben und er selbst hatte Dinge getan, die weitaus schrecklicher waren als alles, was er sich je hatte vorstellen können. Mit Schaudern dachte Andrej an Malthus, den goldenen Ritter, und an das, was passiert war, nachdem er ihn getötet hatte …
Andrej verscheuchte den Gedanken. Wenn das alles hier vorbei war, hatte er genug Zeit, um nachzudenken – oder auch, um zur Beichte zu gehen, obwohl er gerade das sicherlich nicht tun würde. Im Moment galt es wichtigere Fragen zu klären: Wie sollte er ein Schiff in seine Gewalt bringen, auf dem sich mindestens zwanzig schwer bewaffnete Männer befanden, ohne sie alle umbringen zu müssen?
Er wusste, dass er gut war. Sein Schwert war nicht umsonst gefürchtet. Aber er kannte auch seine Grenzen. Einer gegen zwanzig, das war unmöglich; selbst, wenn dieser eine so gut wie unsterblich war. Unglückseligerweise bedeutete unsterblich nicht auch automatisch unverwundbar.
Andrej trat lautlos unter der Treppe hervor und sah nach oben. Die Luke zum Deck stand offen. Es war tiefste Nacht. Der Himmel hatte sich mit Wolken zugezogen, die das Licht der Sterne auslöschten und den Mond verdunkelten, der nicht mehr als ein vage angedeuteter grauer Kreis war. Abgesehen von den Schritten, die sich nun wieder dem Einstieg näherten, war es vollkommen still. Eine Wache, die vermutlich nur auf dem Deck des dickbäuchigen Seglers hin- und herging, um die Langeweile zu vertreiben und nicht im Stehen einzuschlafen; vielleicht auch, um die Kälte zu verscheuchen, die vom Wasser aufstieg und in die Glieder biss. Das Sklavenschiff hatte an einer flachen Sandbank beinahe in der Flussmitte Anker geworfen. Abu Dun war ein vorsichtiger Mann. Wenn man vom Sklavenhandel lebte, musste man das wohl sein.
Um ein Haar hätte diese Vorsicht Andrejs Plan schon in den ersten Sekunden vereitelt. Es hatte sich als nicht sonderlich schwierig erwiesen, zur Flussmitte hinauszuschwimmen. Das Donauwasser war eisig und die Strömung weitaus stärker, als er erwartet hatte. Jeder andere Mann wäre an dieser Aufgabe gescheitert und schon auf halbem Wege ertrunken, aber Andrej war kein gewöhnlicher Mann, und so war er – wenn auch erst im dritten Anlauf, weil die Strömung ihn immer wieder von der Sandbank wegspülte– lautlos an Bord des Schiffes geklettert. Der Posten oben war leicht zu täuschen gewesen. Andrej hatte gelernt, sich lautlos wie eine Katze zu bewegen und mit den Schatten zu verschmelzen, sodass er nur einen günstigen Moment abpassen musste, um über das dunkle Deck zu huschen und in der offenen Luke zu verschwinden.
Dummerweise war es die falsche Luke gewesen.
Andrejs Plan sah vor, sich in Abu Duns Quartier zu schleichen und den Sklavenhändler in seine Gewalt zu bringen, um sein Leben gegen das der Sklaven einzutauschen, die im Bauch des Schiffes in Ketten lagen. Ein simpler Plan, aber gerade das war es, was Andrej daran gefallen hatte. Die meisten guten Pläne waren einfach.
Aber unter der Luke, die er gefunden hatte, befand sich nicht Abu Duns Schlafgemach, sondern ein Raum mit einer einzelnen, äußerst massiven Tür, hinter der vermutlich die Sklavenquartiere lagen. Zwei Krieger bewachten den Raum. Andrej hatte einen von ihnen töten müssen und den anderen niedergeschlagen und geknebelt. Er war genauso überrascht gewesen wie die beiden Wächter, die angesichts der fortgeschrittenen Zeit ohnehin nicht mehr aufmerksam waren. Hätte er nur den Bruchteil einer Sekunde später reagiert, hätte es für ihn nicht so günstig ausgehen können …
Andrej verscheuchte auch diesen Gedanken.
Sein Blick wanderte noch einmal durch den Raum und blieb an der eisenbeschlagenen Tür jenseits der Treppe hängen. Er wusste nicht, was dahinter lag, aber er konnte es sich ziemlich gut vorstellen. Ein dunkler, möglicherweise mit Gitterstäben in noch kleinere Käfige unterteilter Raum, groß genug für fünfzig Menschen, in dem mehr als hundert Sklaven aneinandergekettet in ihrem eigenen Schmutz lagen. Die Überlebenden aus dem Borsã-Tal, das auch ihm einst Heimat gewesen war. Menschen, die zum großen Teil– wenn auch nur entfernt – mit ihm verwandt waren. Die von Vater Domenicus’ Schergen verschachert worden waren, um seinen inquisitorischen Feldzug gegen angebliche Hexen und Teufelsanbeter zu finanzieren.
So etwas wie seine Familie.
Nun, nicht ganz. Schließlich hatten diese Menschen ihn schon vor einer Ewigkeit aus ihrer Mitte vertrieben, hatten ihn als Ketzer und Dieb gebrandmarkt, als ruchbar wurde, dass er– wenn auch unfreiwillig – in den Kirchenraub in Rotthurn verstrickt gewesen war. Aber trotzdem konnte er nicht so tun, als wären sie ihm vollkommen fremd. Vielleicht hätte er sich sogar um ihre Befreiung bemüht, wenn ihn mit diesen Menschen gar nichts verbunden hätte, abgesehen davon, dass sie Menschen waren und er die Sklaverei für das schändlichste aller Vergehen hielt.
Außerdem hatte er seinem Zögling Frederic versprochen, alles für die Rettung seiner Verwandten aus dem Borsã-Tal zu tun.
Die Verlockung war groß, die Tür zu öffnen und die Gefangenen zu befreien. Es gab nicht einmal ein Schloss, sondern nur einen schweren, eisernen Riegel. Aber es war unmöglich, gut hundert Gefangene zu befreien, ohne dass irgendjemand auf dem Schiff etwas davon merken würde. Sie waren jetzt so lange in Gefangenschaft, dass es auf ein paar Augenblicke mehr oder weniger nicht mehr ankam.
Er überzeugte sich noch einmal davon, dass sein Gefangener nicht nur immer noch bewusstlos, sondern auch sicher geknebelt und gefesselt war, dann legte er das Schwert aus der Hand, ließ sich neben dem toten Wächter auf die Knie sinken und zog ihm das Gewand aus. Dabei bemühte er sich, so wenig Lärm wie möglich zu machen, um den Wächter oben an Deck nicht zu alarmieren. Es kostete ihn erhebliche Überwindung, den einfachen Kaftan überzustreifen, der nass und schwer war und stank. Der Mann hatte heftig geblutet und im Augenblick des Todes schien er die Beherrschung über seine Körperfunktionen verloren zu haben.
Der Turban stellte ein Problem dar. Andrej hatte keine Ahnung, wie man einen Turban band. Also wickelte er sich das Stück Tuch einfach ein paar Mal um den Kopf und hoffte, dass das etwas missglückte Ergebnis in der Dunkelheit nicht auffiel. Dann hob er sein Schwert auf und ging schnell und leicht nach vorne gebeugt, sodass sein Gesicht nicht zu sehen war, nach oben.
Der Wächter befand sich am anderen Ende des Schiffes, würde aber gleich kehrtmachen, um die zweite Hälfte seiner Runde zu beginnen. Das Schiff war nicht groß; allenfalls dreißig Schritte. Er konnte eine Konfrontation mit dem Wächter nicht riskieren, und so wich er mit langsamen Schritten zur anderen Seite des Schiffes aus und lehnte sich lässig gegen die Reling. Sein Herz klopfte. Er versuchte den Wächter unauffällig aus den Augenwinkeln heraus zu beobachten. Seine Hand fingerte nervös am Griff des Schwertes herum, das er so hielt, dass es nicht zu sehen war. Irgendetwas stimmte nicht. Er spürte es. Der Großteil der Mannschaft lag auf einem niedrigen Aufbau und schlief; ein paar schnarchten so laut, dass er es deutlich hören konnte. Der Posten, der sich nun herumdrehte, bewegte sich auf eine Art, die zeigte, dass er zum Umfallen müde war und darum kämpfte, nicht im Gehen einzuschlafen. Alles schien in Ordnung.
Aber das war es nicht. Irgendetwas war hier nicht so, wie es zu sein vorgab. Eine Falle?
Andrej konnte keinen Grund dafür erkennen. Abu Dun konnte nicht wissen, dass er hier war. Der Pirat war der Falle, die Graf Bathory ihm gestellt hatte, durch ein geradezu geniales, allerdings auch mehr als riskantes Segelmanöver entkommen. Er hatte sofort Kurs auf den Bosporus genommen, als wolle er durch das Marmarameer die Ägäis ansteuern und direkt auf die großen arabischen Sklavenmärkte zuhalten. Doch dann hatte er sein gedrungenes Frachtschiff eine überraschende Wende vollziehen lassen, um geradewegs wieder nach Norden zu steuern: An Constãntã vorbei, das sie erst kurz zuvor verlassen hatten, und bis hoch ins Donaudelta hinein. Offenbar wollte er flussaufwärts Richtung Tulcea fahren, eine Stadt, die fast so alt wie Rom war und durch ihre günstige Lage den Zugang zu allen drei Donauarmen kontrollierte.
Frederic und er hatten das Schiff fast eine Woche lang vom Ufer aus verfolgt, immer in sicherem Abstand, um von den Piraten an Bord nicht entdeckt zu werden – was alles andere als einfach war, denn das Donaudelta war ein verwirrend großes Gebiet ineinander verwobener Wasserwege, Seen, von Schilf bedeckter Inseln, tropischer Wälder und Sanddünen. Das Schiff war sehr langsam in den unteren der drei Donauarme hineingefahren und hatte einmal sogar fast einen halben Tag auf der Stelle gelegen, sodass Andrej vermutete, dass der Pirat und Sklavenhändler auf jemanden wartete; vielleicht auf einen anderen Piraten, vielleicht auch auf einen Kunden, dem er seine lebende Fracht verkaufen wollte.
Aber so weit würde Andrej es nicht kommen lassen.
Der Wächter rief ihm irgendetwas zu, was Andrej nicht verstand; es musste Türkisch oder auch Arabisch sein, die Sprache einer der beiden Völker, aus denen sich der größte Teil der Besatzung rekrutierte. Immerhin hörte er den scherzhaften Ton heraus, hob die linke Hand und gab ein Grunzen von sich, von dem er wenigstens hoffte, dass es als Antwort genügte.
Offensichtlich verfehlte es seine Wirkung nicht, denn der Mann lachte nur und setzte seinen Weg fort. Andrej atmete auf. Er konnte hier an Deck keinen Kampf anzetteln. Ganz gleich, wie schnell er den Piraten auch tötete, er konnte nicht ausschließen, dass der noch einen Warnschrei ausstieß, der die schlafenden Männer auf dem Achterdeck weckte.
Aber die Wache ging vorüber, ohne weitere Notiz von ihm zu nehmen, und nach einem kurzen Augenblick setzte Andrej seinen Weg fort. Nachdem er durch die falsche Luke geklettert war, hatte er zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, wie es unter Deck des Schiffes aussah. Er hatte Abu Dun mehrmals aus der Ferne dabei beobachtet, wie er in der Luke verschwand oder auch daraus auftauchte, einmal nur zur Hälfte bekleidet. Deshalb hatte er angenommen, der Mann schliefe dort, wo in Wirklichkeit die Sklaven untergebracht worden waren. Diesen Fehler galt es jetzt zu korrigieren. Trotzdem musste Abu Duns Quartier sich dort unten befinden.
Er bewegte sich schnell und lautlos die Treppe hinunter und blieb kurz stehen, um sich zu orientieren – was in der herrschenden Dunkelheit allerdings fast unmöglich war. Er befand sich in einem schmalen, nur wenige Schritte langen Gang, der so niedrig war, dass er nur gebückt darin stehen konnte. Der Gang endete vor einer Wand aus massiven Balken, die ihm eigentlich viel zu wuchtig für ein relativ kleines Schiff wie dieses schienen, bis er begriff, dass er nun auf der anderen Seite des Sklavenquartiers stand, das offensichtlich den Großteil des gesamten Rumpfes einnahm.
Die Erkenntnis erfüllte ihn mit neuem Zorn, denn sie bedeutete nichts anderes, als dass Abu Dun keineswegs nur ein Pirat war, der in der Wahl seiner Beute nicht sonderlich wählerisch war. Dieses Schiff war eigens für den Transport lebender Fracht gebaut worden. Sklaven. Sein Entschluss stand fest: Er würde Abu Duns Sklavenschiff auf den Flussgrund schicken. Die Mannschaft würde er schonen, obwohl sie vermutlich auch nur aus einer Bande von Mördern und Halsabschneidern bestand, aber das Piratenschiff selbst würde er versenken.
Dazu musste er jedoch erst einmal Abu Dun finden und ausschalten.
Erneut beschlich ihn das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Er versuchte, dieses Gefühl einzuordnen, aber es gelang ihm nicht, und so konzentrierte er sich wieder auf seine Umgebung. Er war schon viel zu lange hier. Frederic war am Ufer zurückgeblieben und er hatte ihm eingeschärft, sich nicht von der Stelle zu rühren, ganz egal, was geschah, aber er war nicht sicher, wie weit er sich auf Frederic verlassen konnte. Der Junge hatte sich verändert, seit sie Constãntã verlassen hatten, und Andrej war mit jedem Tag weniger sicher, ob ihm diese Veränderung gefiel.
Etwas polterte. Andrej fuhr erschrocken zusammen, bevor ihm klar wurde, dass der Lärm nicht in seiner unmittelbaren Nähe, sondern irgendwo über seinem Kopf seinen Ursprung hatte. Hinter einer der beiden Türen, die rechts und links des schmalen Ganges abzweigten, war Abu Dun.
Er umschloss sein Schwert fester, öffnete wahllos die Tür auf der linken Seite und betrat den Raum.
Er hatte Glück.
Der Raum war winzig und er wirkte noch kleiner, denn er war bis zum Bersten gefüllt mit Kisten, Truhen, Säcken und Bündeln. Eine kleine, aber anscheinend aus purem Gold gefertigte Öllampe, die unter einem schwarzen Rußfleck an der Decke hing, spendete flackerndes rotes Licht, das gerade ausreichte, den Raum mit hin und her huschenden Schatten und der Illusion von Bewegung zu erfüllen. Es gab nur ein winziges, mit buntem Bleiglas gefülltes Fenster. Abu Dun lag – nackt bis auf eine knielange baumwollene Hose– auf einer schmalen, aber mit Seide bedeckten Liege direkt unterhalb des Fensters und schlief. Er schnarchte mit offenem Mund. Auf einem kleinen Tischchen neben ihm stand ein bauchiger Weinkrug, daneben lag ein umgestürzter Trinkbecher, der ebenfalls aus Gold bestand und reich mit Edelsteinen und kunstvollen Ziselierungen bedeckt war. Roter Wein war ausgelaufen und bildete eine klebrige, dunkel glitzernde Lache. Abu Dun schien es mit den Suren des Korans nicht allzu genau zu nehmen, was die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens anging.
Er war allerdings nicht annähernd so betrunken, wie Andrej gehofft hatte. Obwohl Andrej so gut wie keinen Laut verursachte, öffneten sich Abu Duns Lider mit einem Ruck. Er brauchte nur den Bruchteil eines Atemzuges, um die Situation zu erfassen und richtig zu reagieren. Sofort sprang er in die Höhe und griff nach dem Weinkrug auf dem Tisch neben sich, um ihn nach Andrej zu werfen.
Andrej machte keinen Versuch, dem Wurfgeschoss auszuweichen, sondern brachte mit einer blitzartigen Bewegung das Schwert in die Höhe. Gleichzeitig trat er gegen den Tisch.
Der Krug prallte mit solcher Wucht gegen das Schwert, dass ihm die Waffe aus der Hand gerissen wurde, aber auch Andrejs Angriff zeigte Wirkung. Der Tisch kippte um. Die Kante aus hartem Eichenholz prallte gegen Abu Duns Knie und brachte ihn zu Fall. Der riesenhafte Pirat kippte mit einem Schmerzensschrei zur Seite und Andrej nutzte die winzige Chance, die sich ihm bot, und stürzte sich auf ihn.
Eine Mischung aus Überraschung, Schrecken und Verachtung blitzte in Abu Duns Augen auf. Der Pirat war mehr als eine Handbreit größer als Andrej – und viel breitschultriger. Jetzt, als Andrej ihn nahezu unbekleidet sah, wurde ihm erst bewusst, wie muskulös und durchtrainiert der Sklavenhändler war: ein Bär von einem Mann, gegen den er mit bloßen Händen nicht die Spur einer Chance hatte. Abu Dun schien seine Meinung zu teilen, denn er erwartete gelassen seinen Angriff.
Andrej beging nicht den Fehler, sich nach dem Schwert zu bücken, das er fallen gelassen hatte, sondern rammte Abu Dun das Knie ins Gesicht. Der Pirat keuchte vor Schmerz und kippte nach hinten, umschlang Andrej aber trotzdem in der gleichen Bewegung mit beiden Armen und riss ihn mit sich. Andrej ächzte, als er spürte, dass er den Piraten falsch eingeschätzt hatte: Er war viel stärker, als er geglaubt hatte. Andrej wurde in die Höhe gerissen und rang nach Luft. Seine Rippen knackten. Er spürte, wie zwei oder drei brachen. Der bittere Kupfergeschmack von Blut füllte seinen Mund und der Schmerz wurde für einen Moment so schlimm, dass er das Bewusstsein zu verlieren drohte.
Verzweifelt strampelte er mit den Beinen, schlug zwei-, dreimal mit der Faust in Abu Duns Gesicht und versuchte schließlich, ihm die Finger in die Augen zu bohren. Abu Dun drehte mit einem wütenden Knurren den Kopf zur Seite und drückte mit noch größerer Kraft zu. Andrejs Rippen brachen wie trockene Zweige. Dann erscholl ein lautes, trockenes Knacken. Jegliches Gefühl wich aus Andrejs unterer Körperhälfte. Er erschlaffte in Abu Duns Armen. Auch der Schmerz war nicht mehr zu spüren.
Abu Dun sprang in die Höhe, wirbelte ihn herum und warf ihn quer durch den Raum an die gegenüberliegende Wand. Andrej fiel hilflos zu Boden, schlug mit dem Kopf gegen die eisenbeschlagene Kante einer großen Holzkiste und verlor für einen Augenblick das Bewusstsein.
Er kam zu sich, als sich Abu Duns riesige Hand in sein Haar grub und seinen Kopf mit einem brutalen Ruck herumriss. Die andere Hand des Piraten war zur Faust geballt und zum Schlag erhoben.
»Nein«, sagte Abu Dun. »So leicht mache ich es dir nicht.«
Er ließ Andrejs Haar los, richtete sich auf und versetzte ihm einen Tritt, der Andrej weitere Rippen gebrochen hätte, hätte Abu Dun Stiefel oder nur Schuhe getragen. So jagte nur ein dumpfer Schmerz durch Andrejs Körper, der ihn gequält aufstöhnen ließ.
Abu Dun lachte. »Tut das weh? Nein, es tut nicht weh. Es ist nichts gegen das, was dich noch erwartet.«
Die Tür wurde aufgerissen und zwei mit Schwertern bewaffnete Männer stürmten, vermutlich angelockt vom Lärm des Kampfes, herein. Abu Dun fuhr mit einer schlangengleichen Bewegung herum, funkelte sie an und sagte einige wenige Worte in seiner Muttersprache. Andrej verstand nicht, was er sagte, aber der Ausdruck auf den Gesichtern der beiden Männer war nicht schwer zu deuten. Abu Dun war nicht begeistert, dass es einem bewaffneten Attentäter gelungen war, bis in sein Schlafgemach vorzudringen. Er würde die beiden Männer bestrafen; und Andrej war ziemlich sicher, dass er es nicht bei ein paar Peitschenhieben belassen würde.
Abu Dun verwies die beiden Männer mit einer zornigen Handbewegung des Raumes, warf Andrej noch einen verächtlichen Blick zu und verschwand dann aus seinem Gesichtsfeld.
Andrej versuchte, sich zu bewegen, aber es ging nicht. Von seinem Rücken ging ein stechender Schmerz aus. Er konnte Arme und Hände bewegen, aber es kostete ihn unendliche Mühe und es war mehr ein Zittern als eine wirkliche Bewegung.
Der Pirat hantierte irgendwo außerhalb seines Blickfeldes. Andrej hörte ein Klappern, dann das Rascheln von grobem Stoff. Erneut versuchte er sich zu bewegen und diesmal gelang es ihm wenigstens, den rechten Arm ein kleines Stück auszustrecken, wenn auch nicht besonders weit und in keine Richtung, die ihm einen Vorteil eingebracht hätte.
Abu Dun musste die Bewegung wohl gehört haben, denn er lachte roh und sagte: »Gib dir keine Mühe, Hexenmeister. Ich habe dir das Kreuz gebrochen. Deine Zaubertricks nutzen dir nichts mehr.«
Immerhin schloss Andrej aus diesen Worten eines: Dass es nicht das erste Mal war, dass Abu Dun einen Gegner auf diese Weise ausgeschaltet hatte. Wie er selbst vertraute der Pirat weniger auf seine Waffen als auf seine körperlichen Fähigkeiten. Der Kerl war so stark wie ein Bär. Andrej biss die Zähne zusammen, als ein neuerlicher Schmerz durch seinen Rücken schoss. Seine Beine begannen zu kribbeln.
Abu Dun kam auf ihn zu. Er trug jetzt einen grauen Kaftan und darüber einen blütenweißen weiten Mantel, aber noch keinen Turban.
»Ich bin noch nicht sicher«, sagte er nachdenklich, »ob ich meine Männer bestrafen oder dir Respekt zollen soll, dass es dir gelungen ist, so weit zu kommen. Das ist vor dir noch keinem geglückt. Allah hat sie entweder mit Blindheit geschlagen, oder du bist gefährlich wie eine Schlange.«
Seine Augen wurden schmal. »Der Inquisitor hat mich vor dir gewarnt. Er hat gesagt, du wärst mit dem Teufel im Bunde. Ich gestehe, dass ich ihm nicht geglaubt habe. Sie reden einen solchen Unsinn, diese selbst ernannten heiligen Männer … aber in diesem Fall hat er wohl die Wahrheit gesagt.« Er hob seufzend die Schultern. »Ich werde meine Männer wohl nicht bestrafen. Oder ich werde sie auspeitschen und dich dann ihrem Zorn überlassen, was meinst du?«
Andrej antwortete nicht, sondern biss stattdessen die Zähne so fest aufeinander, dass sie knirschten. Abu Dun mochte das für einen Ausdruck von Qual halten, und damit hatte er recht: Andrejs Rücken fühlte sich an, als würde er ganz langsam in Stücke gerissen, obwohl das genaue Gegenteil der Fall war. Das Leben kehrte in seine Beine und seinen Leib zurück, aber es war ein qualvoller, unendlich schmerzhafter Prozess.
Der Pirat beugte sich vor und schnüffelte. »Du stinkst, Giaur«, benutzte er das arabische Wort für Ungläubiger.
Andrej antwortete nicht darauf. Es gelang ihm jetzt kaum noch, einen Schrei zu unterdrücken, und er musste all seine Willenskraft aufbieten, um die Beine stillzuhalten. Die Regeneration war fast abgeschlossen. Wenn Abu Dun jetzt begriff, dass er nicht so hilflos war, wie es den Anschein hatte, dann war es um ihn geschehen.
»Bist du allein gekommen oder hat Bathory dir eine Abteilung seiner Spielzeugsoldaten mitgegeben?«, fragte Abu Dun, beantwortete seine eigene Frage aber gleich selbst, indem er den Kopf schüttelte und fortfuhr: »Nein. Hättest du Hilfe, wärst du das Risiko nicht eingegangen, dich hier einzuschleichen … aber was ist mit dem Jungen? Ist dieser Teufelsbengel auch bei dir? Man hat mir gesagt, er wäre tot, aber dasselbe habe ich auch über dich gehört. Ich denke, er ist auch irgendwo in der Nähe. Es ist wohl besser, wenn ich ein paar dieser unfähigen Narren ans Ufer schicke, um nach ihm zu suchen.«
Diesmal hatte Andrej sich nicht mehr gut genug unter Kontrolle, um Abu Dun nicht sehen zu lassen, wie nahe er der Wahrheit gekommen war. Frederic war tatsächlich am Ufer zurückgeblieben und wartete auf ihn. Natürlich würde der Junge sehen, dass nicht er es war, der zurückkam, sondern Abu Duns Männer, aber das beruhigte Andrej nicht. Frederic war ein Kind, das dazu neigte, schreckliche Risiken einzugehen, wie es Kindern eigen ist. Und er vertraute viel zu sehr auf seine vermeintliche Unverwundbarkeit.
Abu Dun lachte. »Dann wirst du deinen jungen Freund ja bald wiedersehen«, sagte er. »Ihr werdet zusammen sterben.« Er wandte sich um. »Lauf nicht weg«, sagte er höhnisch, während er hinausging.
2
Nachdem ihn der Pirat allein gelassen hatte, gestattete sich Andrej einen tiefen, lang andauernden Schmerzenslaut und ließ den Kopf zurücksinken. Seine Beine zuckten unkontrolliert. Das Leben kehrte mit Feuer und Gewalt in seine Glieder zurück. Er war schon oft verwundet worden, aber selten so schwer.
Indem er sich zu entspannen versuchte und jeden Gedanken abschaltete, konnte er die Heilung beschleunigen. Auf diese Weise gab er seinem Körper Gelegenheit, seine ganze Energie auf das Regenerieren zerrissener Muskeln und zerbrochener Knochen zu richten. Aber dieser Vorgang brauchte Zeit. Wie lange würde Abu Dun brauchen, um seinen Männern Anweisung zu geben und zurückzukommen? Sicher nicht mehr als wenige Minuten. Aber diese Zeit musste reichen.
Sie reichte.
Andrej versank in eine Art Trance, in der er zuerst jeden bewussten Gedanken, dann sein Zeitgefühl und schließlich sogar den Schmerz abschaltete. Sein Körper erholte sich in dieser Zeit, schöpfte Energie aus geheimnisvollen Quellen, deren Natur selbst Andrej nicht klar war, und kehrte in seinen unversehrten Zustand zurück. Als er Abu Duns Schritte draußen auf dem Gang hörte, öffnete er die Augen und lauschte noch einmal konzentriert in sich hinein. Er war bereit. Seine Verletzungen waren verheilt, aber er war noch sehr schwach. Die Heilung hatte ungewöhnlich viel Kraft gekostet. Er war auf keinen Fall in der Lage, einen zweiten Kampf mit Abu Dun durchzustehen.
Der Pirat kam herein – zu Andrejs Erleichterung allein –, warf die Tür hinter sich zu und lachte böse, als er sah, dass Andrej die Hand in Richtung des Schwertes ausgestreckt hatte, ohne es zu erreichen.
»Eines muss man dir lassen, Hexenmeister«, sagte er. »Du bist zäh. Du gibst nicht auf, wie?«
Dann kam er auf eine leichtsinnige Idee: Er zog einen Krummsäbel unter dem Kaftan hervor und schob mit ihm das Sarazenenschwert in Andrejs Richtung.
»Du willst kämpfen, Giaur?«, höhnte er. »Tu es. Nimm dein Schwert und wehr dich!«
Andrejs Hand schloss sich um den Griff der vertrauten Waffe, des einzigen wertvollen Besitzes, den ihm sein Stiefvater Michail Nadasdy hinterlassen hatte. Abu Dun lachte noch immer und Andrej trat ihm mit solcher Wucht vor den Knöchel, dass er haltlos zur Seite kippte und auf einen Tisch fiel, der unter seinem Aufprall in Stücke brach. Noch bevor er sich von seiner Überraschung erholen konnte, war Andrej auf den Füßen und über ihm. Sein Schwert machte eine blitzartige Bewegung und fügte Abu Dun eine tiefe Schnittwunde auf dem Handrücken zu. Der Krummsäbel des Piraten polterte zu Boden und Andrejs Sarazenenschwert bewegte sich ohne innezuhalten weiter und ritzte seine Kehle: Zu leicht, um ihn zu töten, aber doch so tief, dass sich eine dünne, rasch mit Rot füllende Linie auf seinem Hals abzeichnete. Abu Dun keuchte und erstarrte.
»Du hättest besser auf Vater Domenicus gehört, Abu Dun«, sagte Andrej kalt. »Manchmal reden die heiligen Männer nämlich nicht nur Unsinn, weißt du?«
Abu Dun starrte ihn aus hervorquellenden Augen an. Er begann am ganzen Leib zu zittern. »Aber … aber wie kann das sein?«, stammelte er. »Das ist unmöglich! Ich habe dir das Kreuz gebrochen!«
Andrej bewegte das Schwert, sodass Abu Dun gezwungen war, den Kopf immer weiter in den Nacken zu legen und sich schließlich rücklings und in einer fast unmöglichen Haltung in die Höhe zu stemmen.
»Teufel!«, presste er hervor. »Du … du bist der Teufel! Oder mit ihm im Bunde!«
»Nicht ganz«, sagte Andrej. »Aber du kommst der Wahrheit schon ziemlich nahe.« Er sah den neuerlichen Schrecken auf Abu Duns Gesicht und bedauerte seine Worte fast. Ihm war nicht wohl dabei, dass er Abu Dun nun töten musste. Jedoch: Das Geheimnis seiner Unverwundbarkeit musste gewahrt bleiben, um jeden Preis!
Trotzdem fuhr er fort: »Vielleicht solltest du dir genau überlegen, was du jetzt sagst. Du solltest dir möglicherweise mehr Gedanken um deine Seele als um deinen Hals machen, Pirat.«
»Töte mich«, sagte Abu Dun trotzig. »Mach mit mir, was du willst, aber ich werde nicht vor dir kriechen.«
»Du bist ein tapferer Mann, Abu Dun«, sagte Andrej. Er dirigierte den Piraten mit dem Schwert weiter zurück, bis er rücklings auf die Liege fiel. »Aber ich hatte nicht vor, dich zu töten. Deshalb bin ich nicht gekommen.«
Abu Dun schwieg. In seinen Augen war eine so grenzenlose Angst, wie Andrej sie noch nie zuvor im Blick eines Menschen gesehen hatte, aber gerade das machte ihn nur umso vorsichtiger.
Angst konnte aus tapferen Männern wimmernde Feiglinge machen, aber manchmal machte sie auch aus Feiglingen Helden.
»Du weißt, weshalb ich hier bin«, sagte er.
Abu Dun schwieg weiter, doch Andrej sah, wie sich sein Körper unter den Kleidern ganz leicht spannte. Er bewegte das Schwert, und an Abu Duns Hals erschien eine zweite rote Linie.
»Du wirst die Gefangenen freilassen«, sagte er. »Du wirst deinen Männern befehlen, den Anker zu lichten und ans Ufer zu fahren. Sobald die Gefangenen an Land und in sicherer Entfernung sind, lasse ich dich laufen.«
»Das ist unmöglich«, sagte Abu Dun gepresst. »Es ist viel zu gefährlich, bei Dunkelheit das Ufer dieses unberechenbaren Donauarms anzulaufen. Was glaubst du, warum wir in der Flussmitte vor Anker gegangen sind?«
»Dann wollen wir hoffen, dass deine Männer so gute Seeleute sind, wie man es von türkischen Piraten allgemein behauptet«, sagte Andrej. Er wusste, dass Abu Dun Recht hatte. Es gab Untiefen, Sandbänke und sogar Felsen in Ufernähe. Aber bis Sonnenaufgang würde noch viel Zeit vergehen. So lange konnte er nicht warten.
»Sie werden nicht auf mich hören«, sagte Abu Dun. »Die Gefangenen … sie erwarten eine hohe Belohnung, wenn wir sie abliefern.«
»Abliefern?« Andrej wurde hellhörig. »Wo? An wen?«
Abu Dun presste die Lippen aufeinander. Augenscheinlich hatte er schon mehr gesagt, als er vorgehabt hatte.
»An wen?«, fragte Andrej noch einmal; diesmal lauter. Er musste sich beherrschen, um seiner Frage nicht mit dem Schwert mehr Nachdruck zu verleihen. Zu nichts verspürte er größeres Verlangen, als diesem Ungeheuer in Menschengestalt die Kehle durchzuschneiden, und er würde es tun. Aber nicht jetzt. Und er würde ihn nicht quälen.
Abu Dun schürzte trotzig die Lippen. »Töte mich, Hexenmeister«, sagte er. »Von mir erfährst du nichts.«
Andrej tötete ihn nicht. Aber er machte eine blitzschnelle Bewegung mit dem Schwert und schlug Abu Dun die flache Seite der Klinge vor die Schläfe. Der Pirat verdrehte die Augen, seufzte leise und verlor auf der Stelle das Bewusstsein.
Er würde nicht lange ohnmächtig bleiben. Rasch durchsuchte Andrej das Zimmer, bis er zwei passende Stricke gefunden hatte. Mit einem davon band er Abu Duns Fußgelenke so aneinander, dass der Pirat zwar gehen, aber nur unbeholfene kleine Schritte machen konnte, dann wälzte er den schweren Mann mit einiger Mühe herum, band seine nach oben gebogenen Handgelenke aneinander und schlang das Ende des Stricks um seinen Hals. Wenn Abu Dun auch nur versuchen sollte, sich zu befreien, würde er sich unweigerlich selbst erwürgen; kein Akt unnötiger Grausamkeit, sondern eine Vorsichtsmaßnahme, die ihm bei einem Mann wie Abu Dun angebracht zu sein schien.
Der Pirat kam wieder zu sich, kaum dass Andrej seine Aufgabe beendet hatte. Prompt versuchte Abu Dun, sich loszureißen und schnürte sich dabei den Atem ab. Andrej sah ihm einige Augenblicke lang stirnrunzelnd zu, dann sagte er ruhig: »Lass es. Es sei denn, du willst mir die Mühe abnehmen, dir die Kehle durchzuschneiden.«
Abu Dun funkelte ihn an. Die Furcht in seinen Augen war einer mindestens ebenso großen Wut gewichen. Er bäumte sich auf, schnürte sich abermals die Luft ab, und Andrej trat zufrieden zwei Schritte zurück, legte das Schwert aus der Hand und schlüpfte aus dem besudelten Gewand. Die Sachen, die er darunter trug, waren noch immer feucht und hatten einen Teil des üblen Geruchs angenommen. In einem Punkt hatte Abu Dun Recht gehabt: Er stank.
Er steckte das Schwert ein, zog stattdessen einen rasiermesserscharfen, zweiseitig geschliffenen Dolch aus dem Gürtel und machte eine auffordernde Geste.
»Lass uns nach oben gehen«, sagte er. »Ich bin neugierig darauf, wie viel deinen Leuten dein Leben wert ist.«
Abu Dun schürzte verächtlich die Lippen, stand aber dann gehorsam auf. Jedenfalls versuchte er es. Anscheinend hatte er noch gar nicht bemerkt, dass auch seine Füße gefesselt waren, denn er fiel mit einem überraschten Laut auf die Knie und wäre um ein Haar ganz nach vorne gestürzt. Als er versuchte, sein Gleichgewicht zurückzuerlangen, schnürte sich der Strick erneut enger um seinen Hals. Er hustete qualvoll. Andrej wartete, bis er sich wieder beruhigt und umständlich in die Höhe gearbeitet hatte, dann öffnete er vorsichtig die Tür, trat einen Schritt zur Seite und machte eine wedelnde Bewegung mit dem Dolch.
»Warum sollte ich tun, was du von mir verlangst?«, fragte Abu Dun trotzig. »Du tötest mich doch sowieso.«
»Möglicherweise«, antwortete Andrej kalt. »Die Frage ist nur, ob ich auch deine Seele fresse.«
Abu Dun lachte. Aber es klang unecht und in seinen Augen loderte die Furcht höher. Er widersprach nicht mehr, sondern senkte den Kopf, um durch die niedrige Tür zu treten. Andrej folgte ihm, wobei er die Spitze des Dolches zwischen seine Schulterblätter drückte.
»Du solltest dafür sorgen, dass deine Männer nicht zu sehr erschrecken, wenn sie uns sehen«, sagte Andrej. Der Gang, in den sie traten, war leer, aber durch die offen stehende Luke am oberen Ende der Treppe drangen aufgeregte Stimmen. Die gesamte Besatzung des Sklavenseglers war nun wach und auf den Beinen. Es war ein irrsinniges Risiko, jetzt dort hinauf zu gehen, aber er hatte keine andere Wahl.
Abu Dun arbeitete sich mit ungeschickten kleinen Schritten zum Anfang der Treppe vor, blieb stehen und rief einige Worte in seiner Muttersprache. Von oben antwortete eine Stimme, dann erschien ein Schatten in dem grauen Rechteck und ein überraschter Laut erscholl. Der Schatten verschwand und für einen kurzen Moment brach oben auf dem Deck Tumult los. Dann rief Abu Dun wieder etwas in seiner Muttersprache, und nach einigen Augenblicken erschien die Gestalt erneut in der Öffnung.
»Sie werden dich in Stücke schneiden, Narr«, sagte Abu Dun. »Auf mich werden sie keine Rücksicht nehmen.«
»Dann tragen wir beide dasselbe Risiko, nicht wahr?«, fragte Andrej. »Los!«
Er verlieh seinen Worten mit dem Dolch Nachdruck und Abu Dun begann umständlich und schräg gegen die Wand gelehnt die Treppe hinaufzusteigen. Die Fußfesseln waren etwas zu kurz, sodass er kaum in der Lage war, die Stufen zu bewältigen. Oben fiel er auf die Knie. Einer seine Männer wollte ihm zu Hilfe eilen, aber Andrej fuchtelte erneut mit dem Dolch herum und Abu Dun scheuchte ihn mit einem gebellten Befehl zurück.
Als sie auf das Deck hinaustraten, begann Andrejs Herz schneller zu schlagen. Aber keiner von Abu Duns Männern machte Anstalten, seinem Anführer zu Hilfe zu kommen.
»Jetzt gib Befehl, den Anker zu lichten und das Ufer anzulaufen«, sagte Andrej.
Abu Dun sagte tatsächlich etwas in seiner Muttersprache, aber keiner seiner Männer reagierte. Die Piraten umringten sie. Die meisten hatten ihre Waffen gezogen.
»Ich habe es dir gesagt«, sagte Abu Dun. »Sie werden nicht gehorchen.«
Andrejs Gedanken rasten. Es gab nicht viel, was er tun konnte. Wenn er Abu Dun tötete, würden sich die Piraten auf ihn stürzen und ihn in Stücke reißen. Er hob das Messer höher und setzte die Spitze seitlich auf Abu Duns Hals.
»Ob sie gehorchen, wenn ich dir die erste Sure des Korans in die Wange schnitze?«, fragte er.
Der Pirat sagte nichts, aber Andrej konnte seine Furcht beinahe riechen. Er berührte mit der Klinge Abu Duns Wange und fügte ihm einen winzigen Schnitt zu, den der Pirat kaum spüren konnte, der aber sichtbar blutete. Ein erschrockenes Murren ging durch die Reihen der Piraten und Abu Dun sagte:
»Es ist gut. Sie werden gehorchen.« Er wiederholte seine Aufforderung, lauter und in herrischem Ton. Auch jetzt erfolgte nicht sofort eine Reaktion, aber der Pirat wurde lauter und schrie nun, und endlich senkten einige seiner Männer ihre Waffen und setzten sich in Bewegung. Andrej atmete auf. Er hatte noch nicht gewonnen, aber er hatte die erste und wichtigste Hürde genommen. Abu Duns Macht über seine Männer schien doch nicht so begrenzt zu sein, wie er behauptet hatte.
»Bete zu deinem Gott, dass keiner deiner Männer etwas Unbedachtes tut«, sagte Andrej. »Vielleicht bleibst du dann ja doch am Leben.«
Sein Zorn auf Abu Dun war kein bisschen kleiner geworden, aber er würde die Welt nicht besser machen, wenn er ihn tötete. Er war kein Richter. Und was Abu Dun anschließend über den Mann erzählte, dessen Verletzungen auf geheimnisvolle Art in Augenblicken heilten und der so gut wie unsterblich war, konnte ihm gleich sein. Die Welt war voller Geschichten von Zauberern, Dämonen und Hexenmeistern, die im Grunde niemand glaubte. Welche Rolle spielte es schon, ob es eine mehr gab oder nicht? Wenn Abu Dun ihm die Möglichkeit dazu gab, würde er ihn am Leben lassen.
Andrej sah sich unauffällig um. Die meisten Piraten standen immer noch mit den Waffen in den Händen da und starrten ihn finster an, aber einige waren auch davongeeilt und mit irgendetwas beschäftigt, das er nicht zu erkennen vermochte. Es war nicht das erste Mal, dass Andrej sich an Bord eines Schiffes befand, aber er war kein Seefahrer und es war einfach zu dunkel, um Einzelheiten zu erkennen. Er konnte nur hoffen, dass die Männer taten, was Abu Dun ihnen aufgetragen hatte, und nicht irgendeine Teufelei vorbereiteten.
Rückwärtsgehend und Abu Dun wie einen lebenden Schutzschild vor sich haltend, bewegte er sich bis zur Reling und lehnte sich leicht dagegen. So konnte sich wenigstens niemand von hinten anschleichen. Sein Blick richtete sich aufmerksam in die Runde. Das Deck ächzte leise und er glaubte ein Zittern zu spüren, das vorher noch nicht da gewesen war. Er vermutete, dass einer der Männer dabei war, den Anker einzuholen. Zwei weitere waren bereits in die Takelage hinaufgeklettert.
Andrej versuchte zum Ufer zu sehen, konnte es aber nicht erkennen; nicht einmal als dunkle Linie. Die Wolkendecke vor dem Himmel hatte sich mittlerweile vollkommen geschlossen. Selbst der Fluss war nur noch eine endlose schwarze Fläche, auf der sich nicht der geringste Lichtschimmer zeigte. Es war dunkel wie in der Hölle und sehr kalt.
Als hätte er seine Gedanken gelesen, sagte Abu Dun: »Wohin willst du gehen – sollte es dir tatsächlich gelingen, uns zu entkommen?«
»Ich wüsste nicht, was dich das anginge«, knurrte Andrej.
»Nichts«, antwortete Abu Dun. »Es ist nur so, dass ich mich frage, was du mit hundert befreiten Gefangenen anfangen willst, die dem Tod näher sind als dem Leben. Du willst sie nach Hause bringen?« Er lachte. »Ihr würdet Wochen brauchen, wenn nicht Monate. Keiner von ihnen hat die Kraft, das durchzustehen. Und selbst wenn – es ist Krieg, hast du das vergessen?«
»Was geht mich euer Krieg an?«, fragte Andrej. Er wusste, dass es ein Fehler war, überhaupt zu antworten. Abu Dun wollte ihn in ein Gespräch verwickeln, womöglich ablenken, damit seine Leute eine Gelegenheit fanden, ihn zu befreien.
»Bis hinauf zu den Karpaten befindet sich das Land in der Hand Sultan Selics«, antwortete Abu Dun. »Und was seine Truppen nicht besetzt halten, das verwüsten die versprengten Haufen der Walachen, Kumanen und Ungarn, die sich untereinander nicht weniger erbittert bekriegen als die großen osmanischen und christlichen Heere. Du glaubst tatsächlich, du könntest eine Karawane halb toter Männer, Frauen und Kinder durch dieses Gebiet nach Hause bringen?« Er schüttelte den Kopf. »Nein. So dumm bist du nicht, Hexenmeister.«
»Was willst du damit sagen?«, fragte Andrej.
»Ihr braucht ein Schiff«, antwortete Abu Dun. »Und ich habe eines.«
»Das ist gar keine schlechte Idee«, sagte Andrej. »Wir könnten dich und deine Männer über Bord werfen und mit dem Schiff weiterfahren.«
Abu Dun lachte. »Sei kein Narr. Selbst wenn ihr es könntet, wie weit würdet ihr kommen, bis ihr auf die ersten Truppen des Sultans trefft? Oder auf die Ungarn – was im Zweifelsfall keinen Unterschied für euch macht?« Er bewegte sich leicht, erstarrte aber sofort wieder, als Andrej den Druck auf die Messerklinge verstärkte. »Sei kein Dummkopf, Hexenmeister«, fuhr er fort. »Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du zahlst mir das, was ich für die Sklaven bekommen hätte, und ich bringe dich und deine Leute sicher nach Hause. Oder zumindest so nahe heran, wie es mir möglich ist.«
Beinahe hätte Andrej gelacht. »Wie kommst du auf die Idee, dass ich dir traue?«
»Weil du ein kluger Mann bist«, antwortete Abu Dun in einem Ton, der überzeugender klang, als es Andrej lieb war. »Ich mache Geschäfte. Mir ist es gleich, wofür ich mein Gold bekomme. Und hundert Passagiere sind angenehmer zu transportieren als hundert Sklaven, die man bewachen muss. Außerdem«, fügte er mit einem Grinsen hinzu, »hast du im Moment eindeutig die besseren Argumente.«
Obwohl er es nicht wollte, übten Abu Duns Worte eine gewisse Anziehungskraft auf Andrej aus. Die Frage, wie er die gut hundert zu Tode erschöpften Gefangenen eigentlich nach Hause bringen sollte, hatte ihn in den letzten Tagen beschäftigt wie keine andere, aber eine wirkliche Antwort hatte er noch nicht gefunden.
Natürlich war es grotesk, auch nur mit dem Gedanken zu spielen, dass er dem Piraten trauen konnte. Trotzdem fragte er: »Und Vater Domenicus? Er wird nicht erfreut sein, wenn er hört, dass du ihn verraten hast.«
Abu Dun machte ein abfälliges Geräusch: »Was geht mich dieser lügnerische Pfaffe an? Er hat mir eine Ladung Sklaven zum Kauf angeboten. Er hat mir nicht gesagt, dass sie unter dem Schutz eines leibhaftigen Dämons stehen. Ist es eine Lüge, einen Lügner zu belügen?«
»Ist es klug, einem Verräter zu trauen?«, gab Andrej zurück.
»Ich bin kein Verräter«, antwortete Abu Dun. »Ich mache Geschäfte. Aber ich verstehe, dass du mir misstraust. Ich an deiner Stelle täte es wohl auch. Gut. Dann werde ich dir den Beweis meiner Ehrlichkeit liefern. Sieh zum Bug.«
Andrej gehorchte – und sein Herz machte einen erschrockenen Satz in seiner Brust.
Vor der kurzen Rammspitze des Schiffes waren zwei von Abu Duns Kriegern aufgetaucht, die eine dritte, wesentlich kleinere Gestalt zwischen sich hielten. Es war Frederic.
»Großer Gott«, murmelte er.
»Der wird dir jetzt wohl auch nicht mehr helfen«, sagte Abu Dun ruhig. »Spielst du Schach, Hexenmeister?«
Andrej antwortete nicht, sondern starrte Frederic aus ungläubig aufgerissenen Augen an. Der Junge hing schlaff in den Armen eines der Piraten. Er schien bewusstlos zu sein. Der zweite Pirat hatte seinen Krummsäbel mit beiden Händen ergriffen und suchte mit gespreizten Beinen nach festem Stand; wohl um Frederic mit einem einzigen Hieb zu enthaupten – was selbst für einen Delãny den sicheren Tod bedeuten würde. Andrej fragte sich, ob es Zufall war oder Abu Dun ihm die ganze Zeit etwas vorgemacht hatte und er sehr viel mehr über sie wusste, als er zugab.
»Tätest du es«, fuhr Abu Dun fort, »wüsstest du, dass man eine solche Situation ein Patt nennt. Unangenehm, nicht? Wenn du mich tötest, töten sie ihn und wenn sie ihn töten, tötest du mich. Jetzt ist die Frage nur, wessen Leben mehr wert ist. Das des Jungen oder meines.«
Andrejs Gedanken überschlugen sich. Er kannte die Antwort auf Abu Duns Frage. Im Zweifelsfall würden seine Männer vermutlich wenig Rücksicht auf sein Leben nehmen. So etwas wie Piratenehre gab es nur in Legenden. Aber wenn er nachgab, bedeutete das ihrer beider sicheren Tod. Er wusste nicht, was er tun sollte.
»Ich will es dir leicht machen«, sagte Abu Dun. »Lasst den Jungen los!«
Den letzten Satz hatte er laut gerufen und er bediente sich wohl absichtlich Andrejs Sprache, damit er ihn verstand. Die beiden Männer, die Frederic gepackt hatten, reagierten nicht sofort. Auf ihren Gesichtern erschien ein unwilliger Ausdruck.
»Ihr sollt ihn loslassen oder ich lasse euch bei lebendigem Leib die Haut abziehen!«, brüllte Abu Dun.
Die beiden Piraten zögerten noch einmal einen Moment, aber dann ließ der eine sein Schwert sinken und der andere trat einen halben Schritt zurück und ließ Frederic los. Der Junge fiel auf die Knie, kippte auf die Seite und stemmte sich benommen auf Händen und Knien hoch, aber nur, um gleich wieder zu fallen. Er war mehr bewusstlos als wach. Erst beim dritten Versuch kam er in die Höhe, sah sich aus glanzlosen Augen um und torkelte auf Andrej und den Piraten zu.
»Jetzt bist du an der Reihe, Hexenmeister«, sagte Abu Dun. »Du musst dich entscheiden, ob du mir traust oder nicht.«
Selbstverständlich vertraute Andrej dem Piraten nicht. Ebenso gut konnte er einem Krokodil die Hand ins Maul legen und darauf hoffen, dass es satt war. Das Schlimme war nur: Abu Dun hatte recht. Die Gefangenen an Land zu bringen bedeutete nicht das Ende, sondern erst den Anfang ihrer Probleme. So unglaublich es ihm auch selbst erschien, er hatte die Augen vor diesem Problem bisher einfach verschlossen.
»Ich kann dir nicht trauen«, sagte er. Seine Stimme verriet mehr von seinem Zweifel, als er wollte.
»Dann wirst du mich wohl töten müssen«, sagte Abu Dun. »Entscheide dich! Jetzt! Ich bin es müde, darauf zu warten, dass du mir die Kehle durchschneidest.«
Andrej wusste nicht, was er tun sollte. »Verrate mir noch eins«, sagte er. »Wohin wolltet ihr die Gefangenen bringen? Was hat dir Vater Domenicus gesagt?«