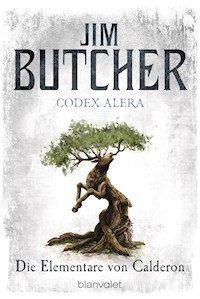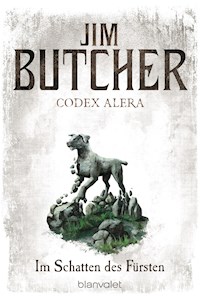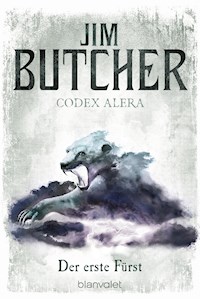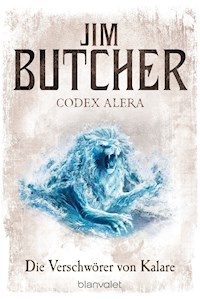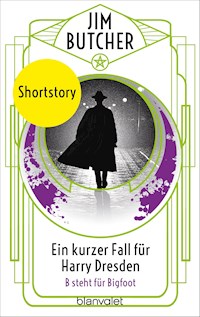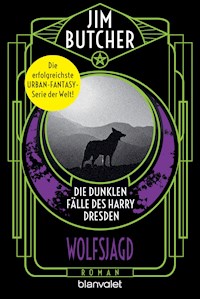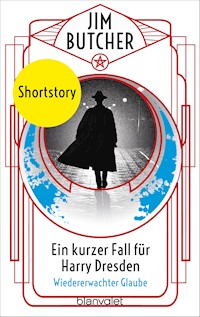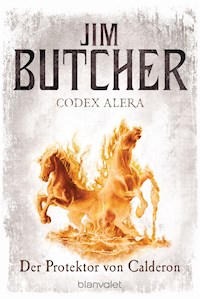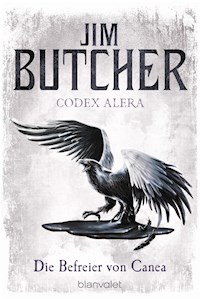9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Harry-Dresden-Serie
- Sprache: Deutsch
Die Toten wandeln in Chicago! Der siebte dunkle Fall des Harry Dresden.
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich bin ein echter Magier, kein Jahrmarktskünstler. Dieses Mal bekam ich es mit einer wirklich abartigen Magie zu tun. Totenbeschwörer rangen in Chicago, meiner Stadt, um ein mächtiges magisches Buch. Und es scherte sie nicht, was dabei zu Bruch ging. Wenn Sie mir nicht glauben, dass es kaum etwas Erschreckenderes gibt als Totenbeschwörung, dann gehen Sie doch mal ins hiesige Naturhistorische Museum. Vielleicht fällt Ihnen in der Dino-Abteilung etwas auf …
Die dunklen Fälle des Harry Dresden: spannend, überraschend, mitreißend. Lassen Sie sich kein Abenteuer des besten Magiers von Chicago entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 692
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich bin ein echter Magier, kein Jahrmarktskünstler. Dieses Mal bekam ich es mit einer wirklich abartigen Magie zu tun. Totenbeschwörer rangen in Chicago, meiner Stadt, um ein mächtiges magisches Buch. Und es scherte sie nicht, was dabei zu Bruch ging. Wenn Sie mir nicht glauben, dass es kaum etwas Erschreckenderes gibt als Totenbeschwörung, dann gehen Sie doch mal ins hiesige Naturhistorische Museum. Vielleicht fällt Ihnen in der Dino-Abteilung etwas auf …
Autor
Jim Butcher ist der Autor der Dresden Files, des Codex Alera und der Cinder-Spires-Serie. Sein Lebenslauf enthält eine lange Liste von Fähigkeiten, die vor ein paar Jahrhunderten nützlich waren – wie zum Beispiel Kampfsport –, und er spielt ziemlich schlecht Gitarre. Als begeisterter Gamer beschäftigt er sich mit Tabletop-Spielen in verschiedenen Systemen, einer Vielzahl von Videospielen auf PC und Konsole und LARPs, wann immer er Zeit dafür findet. Zurzeit lebt Jim in den Bergen außerhalb von Denver, Colorado.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Jim Butcher
ERLKÖNIG
DIE DUNKLEN FÄLLE DES HARRY DRESDEN
Roman
Deutsch von Dominik Heinrici
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Dead Beat (The Dresden Files 7)« bei Penguin RoC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2005 by Jim Butcher
Published by Arrangement with IMAGINARY EMPIRE LLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Illustrationen: © www.buerosued.de
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30438-6V001
www.blanvalet.de
Für meinen Sohn, das Beste, was mir je passiert ist.
Ich liebe dich, Kleiner.
1. Kapitel
Im Großen und Ganzen sind wir eine mörderische Spezies.
Wenn man dem Buch Genesis Glauben schenkt, reichten vier Leute, und unser Planet wäre so total überbevölkert, dass man nicht einmal mehr Platz zum Stehen hätte, und der erste Mord war ein Brudermord. Denn laut der Genesis ist das erste Kind menschlicher Eltern, Kain, aus lauter Eifersucht komplett durchgedreht und blies einem anderen menschlichen Wesen das metaphorische Lichtlein aus. Ein blutiger, brutaler und extrem verwerflicher Mord. Kains Bruder Abel hatte höchstwahrscheinlich nicht die geringste Ahnung, was da auf ihn zukam.
Als ich die Tür zu meiner Wohnung öffnete, erfüllte mich ein Gefühl empathischer Anteilnahme und intuitiven Verständnisses für den verdammten Kain.
Meine Wohnung besteht aus einem großen Raum im Keller einer hundert Jahre alten Privatpension in Chicago. In einer Wandnische ist eine Küche eingebaut, fast immer brennt ein Feuer in einem großen Kamin, das Schlafzimmer ist kaum größer als die Ladefläche eines Pick-ups, und im Badezimmer haben Waschbecken, Toilette und Dusche kaum Platz. Ich kann mir teure Möbel einfach nicht leisten, also besteht meine Einrichtung aus gemütlichen Secondhandstücken. Ich habe eine Menge Bücher, eine Menge Teppiche und eine Menge Kerzen. Es ist nicht viel, aber die Wohnung ist immer hübsch aufgeräumt.
Zumindest war sie das die längste Zeit gewesen.
Die Teppiche waren völlig durcheinandergeschoben, sodass an mehreren Stellen der nackte Steinboden freilag. Einer der Lehnstühle war umgekippt, und niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihn wieder aufzurichten. Auf der Couch fehlten Kissen, und bei einem der Fenster dicht unter der Zimmerdecke war der Vorhang heruntergerissen, wodurch ein breiter Streifen der späten Abendsonne hereinsickerte, um all die Bücher, die von ihren Regalen gepurzelt waren und sich überall im Raum verteilt hatten, in ein besonderes Licht zu rücken. Die Einbände von Taschenbüchern waren geknickt, gebundene Bücher lagen offen herum. Kurz, in meiner Primärquelle für unterhaltsamen Müßiggang feierte das reinste Chaos fröhliche Urstände.
Der Kamin war mehr oder weniger das Epizentrum des Chaosbebens, denn davor lagen achtlos weggeworfene Kleidungsstücke, ein paar leere Weinflaschen und ein Teller, der verdächtig sauber aussah – zweifellos eine Säuberungsaktion eines weiteren Bewohners der Wohnung.
Ich wagte einen benommenen Schritt in mein Heim. Als ich das tat, sprang mein großer grauer Kater Mister von seinem angestammten Plätzchen auf einem der Bücherregale herunter, doch statt mir zum Gruß wie immer seine Schulter gegen das Schienbein zu rammen, zuckte er nur verächtlich mit dem Schwanz und geisterte zur Haustür hinaus.
Ich seufzte, ging hinüber zur Kochnische und sah nach. Die Futter- und die Wasserschüssel der Katze waren beide leer. Kein Wunder, dass Mister beleidigt war.
Ein zotteliger Teil des Küchenbodens wuchtete sich hoch und kam mir in einem verschlafenen, schuldbewussten Trott entgegen. Mein Hund Mouse war einst ein pelziger, kleiner grauer Welpe gewesen, der in meine Manteltasche passte. Nun, fast ein Jahr später, wünschte ich mir manchmal, ich hätte meinen Mantel zu heiß reinigen lassen oder so. Mouse hatte sich vom Flauschball in ein Flauschschlachtschiff verwandelt. Man sieht ihm seine genaue Rasse nicht an, aber bei zumindest einem Elternteil muss es sich um ein Wollmammut gehandelt haben. Die Schulter des Hundes reichte mir fast bis zur Taille, und der Tierarzt war davon überzeugt, dass Mouse noch nicht völlig ausgewachsen war. Übersetzt hieß das: ein ganz schöner Haufen Vieh für meine winzige Wohnung.
Oh, und auch Mouses Schüsseln waren leer. Er schnüffelte an meiner Hand mit einer Schnauze, die mit etwas verkrustet war, das verdächtig nach Spaghettisoße aussah, und scharrte mit einer Pfote an seinen Fressnäpfen, die über den Linoleumboden scheuerten.
»Verdammt, Mouse!«, knurrte ich wie Kain höchstpersönlich. »Sieht es hier immer noch so aus? Wenn er noch da ist, bring ich ihn um!«
Mouse stieß ein tiefes Schnaufen aus, der ausführlichste Kommentar, den er je von sich gibt, und folgte mir seelenruhig in ein paar Schritt Entfernung, als ich zu der geschlossenen Schlafzimmertür marschierte.
Gerade als ich dort ankam, öffnete sich die Tür, und eine Blondine mit Engelsgesicht erschien, die nichts außer einem Baumwoll-T-Shirt trug, noch dazu kein besonders langes.
»Oh«, sagte sie gedehnt und lächelte zögerlich und verschlafen. »’tschuldigung. Ich wusste nicht, dass noch jemand hier ist.« Ohne eine Spur von Sitte und Anstand scharwenzelte sie ins Wohnzimmer und durchwühlte das Durcheinander vor dem Kamin, um ein paar Kleidungsstücke herauszuzerren. An der lässigen, zufriedenen Art, wie sie sich bewegte, konnte ich nur allzu leicht ablesen, dass sie erwartete, dass ich sie anstarrte, und ihr das nicht das Geringste ausmachte.
Früher wäre mir so eine Sache höllisch peinlich gewesen, doch wahrscheinlich hätte ich dennoch ein paar verstohlene Blicke riskiert. Aber nachdem ich jetzt schon fast ein Jahr mit meinem Halbbruder, dem Inkubus, zusammenwohnte, ärgerte es mich einfach nur. Ich rollte mit den Augen und fragte: »Thomas?«
»Tommy?«, sagte das Mädchen. »In der Dusche, glaub ich.« Sie schlüpfte in Joggingkleidung – Trainingshose, eine dazu passende Jacke, teure Schuhe. »Tun Sie mir ’nen Gefallen? Sagen Sie ihm, es …«
Ich unterbrach sie ungeduldig. »Es hat zwar eine Menge Spaß gemacht, und Sie werden die Erfahrung für immer wie einen Schatz bewahren. Aber es war eine einmalige Geschichte, und Sie hoffen sehr, dass er erwachsen wird und ein nettes Mädchen kennenlernt oder Präsident wird oder weiß der Geier was.«
Sie starrte mich an, und ihre blonden Augenbrauen zogen sich ärgerlich zusammen. »Sie müssen nicht gleich so grob werden …« Dann weiteten sich ihre Augen. »Oh. Oh! Es tut mir leid. O Gott!« Sie beugte sich zu mir vor und wisperte mir in einem Unter-uns-Klosterschwestern-Flüstern zu: »Ich hätte nie gedacht, dass er mit einem Mann zusammen ist. Wie schafft ihr beiden das nur in diesem winzigen Bett?«
Ich blinzelte und sagte: »Moment mal!«
Doch sie ignorierte mich, schlenderte nach draußen und murmelte in ihren nicht vorhandenen Bart: »Er ist so ein schlimmer Junge!«
Ich bedachte ihren Rücken mit mörderischen Blicken. Dann funkelte ich Mouse an.
Seine Zunge schlabberte in einem hündischen Grinsen aus dem Maul hervor, und er wedelte sachte mit dem Schwanz.
»Ach, halt die Fresse!« Ich schloss die Tür, dann hörte ich das Rauschen von Wasser, das durch die Rohre in meiner Dusche rann. Ich stellte Futter für Mister und Mouse hin, auf das sich der Hund sofort stürzte. »Er hätte zumindest den verdammten Hund füttern können«, grummelte ich und öffnete den Kühlschrank.
Ich kramte darin herum, fand aber nicht, wonach ich suchte. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Meine Frustration entflammte zu einem Flächenbrand, und mordlüstern richtete ich mich vom Eisschrank wieder auf.
»He«, sagte Thomas hinter mir, »uns ist das Bier ausgegangen.«
Ich drehte mich um und bedachte meinen Halbbruder mit einem vernichtenden Blick.
Thomas war eine Spur über eins achtzig groß, und nachdem ich genügend Zeit gehabt hatte, mich an den Gedanken zu gewöhnen, musste ich zugeben, dass er mir ein wenig ähnlich sah: ausgeprägte Wangenknochen, ein langes Gesicht, ein markantes Kinn. Aber welcher Bildhauer auch immer Thomas’ Züge vollendet hatte, hatte die Arbeit an meiner Visage einem seiner Lehrlinge zugeschanzt. Ich bin echt nicht hässlich, aber Thomas sah aus wie das Gemälde des unbekannten griechischen Gottes der Körperpflege. Sein Haar war so dunkel, dass es den Anschein erweckte, selbst das Licht könne ihm nicht entkommen, und selbst jetzt, da er frisch aus der Dusche kam, begann es sich zu ringeln. Seine Augen hatten die Farbe von Gewitterwolken, und für die Wölbungen seiner Muskeln ließ er sich zu keinem einzigen Moment körperlicher Ertüchtigung herab, um sie sich ehrlich zu verdienen.
Er trug Jeans, mehr nicht – seine standardmäßige Haushaltsuniform. Ich war einmal Zeuge gewesen, wie er in diesem Aufzug die Tür geöffnet hatte, nachdem eine andere Art Zeuge, nämlich eine Zeugin Jehovas, geklopft hatte. Die hatte sich sogleich in einer Wolke aus vergessenen Wachtürmen auf ihn gestürzt. Die Bissspuren, die sie hinterlassen hatte, waren äußerst aufschlussreich gewesen.
Es war nicht ihre Schuld gewesen. Thomas hatte das Blut seines Vaters geerbt, eines Vampirs des Weißen Hofes. Er war ein psychisches Raubtier, das sich von der puren Lebenskraft menschlicher Wesen ernährte, und an die kam er am einfachsten durch den innigen Kontakt beim Sex heran. Dieser Teil von ihm umgab ihn wie eine Aura, und die wiederum verdrehte den Leuten den Kopf, wo immer er sich auch blicken ließ, und keine Frau konnte zu ihm Nein sagen – im wahrsten Sinne des Wortes.
Und auch er konnte dann nicht mehr Nein sagen – und tötete sie, allerdings nur ein kleines bisschen. Er musste es tun, um nicht den Verstand zu verlieren. Doch er nährte sich immer nur ein einziges Mal von einem seiner Opfer.
Alles andere wäre im Übrigen kein Problem gewesen. Diejenigen, die von einem Vampir des Weißen Hofes als Beute auserwählt wurden, gerieten derart in den Bann schierer Ekstase, dass sie ihrem übersinnlichen Liebhaber völlig verfielen. Doch so weit ließ es Thomas nicht kommen. Er hatte diesen Fehler einmal gemacht, und die Frau, die er einst geliebt hatte, war jetzt gefangen in der tödlichen Euphorie, die seine Berührungen verursacht hatten, und an einen Rollstuhl gefesselt.
Ich biss die Zähne zusammen und sagte mir, dass es für Thomas nicht leicht war, darum befahl ich mir, die Schnauze zu halten, und brummte nur: »Ich weiß, dass kein Bier mehr da ist. Oder Milch. Oder Cola.«
»Ähm«, entgegnete er.
»Wie ich sehe, hast du auch keine Zeit gehabt, Mister und Mouse zu füttern. Warst du wenigstens mit Mouse Gassi?«
»Na klar«, sagte er. »Ich meine … ähm … ich habe ihn heute Morgen mit rausgenommen, als du zur Arbeit gegangen bist, wie du dich erinnern wirst. Da traf ich auch Angie.«
»Schon wieder eine Joggerin«, sagte ich, schon wieder ganz Kain. »Du hast versprochen, nicht mehr dauernd Fremde hier anzuschleppen, Thomas! Und noch dazu in meinem verdammten Bett? Herrje, Mann, schau dir doch mal an, wie es hier aussieht!«
Das tat er, und ich sah, wie es ihm langsam dämmerte, als hätte er es zuvor wirklich nicht bemerkt. Er ächzte. »Verdammt, Harry, es tut mir leid. Es war nur … Angie ist wirklich … wirklich heftig und … äh … ein ziemlich athletisches Mädchen, und ich hab nicht gemerkt, dass …« Er hielt inne, hob ein Exemplar von Dean Koontz’ »Brandzeichen« auf und versuchte, den Knick im Einband auszubügeln. »Wow«, fügte er wenig überzeugend hinzu, »die Wohnung ist das reinste Schlachtfeld.«
»Ja«, entgegnete ich, »und du warst den ganzen Tag hier. Du hast gesagt, du würdest Mouse zum Tierarzt bringen, ein wenig aufräumen und einkaufen gehen.«
»Ach komm schon«, entgegnete er. »Was ist daran denn so tragisch?«
»Ich hab kein Bier«, zürnte ich und ließ meinen Blick über das Chaos um mich herum schweifen. »Und Murphy hat mich angerufen und angekündigt, später hier vorbeizuschauen.«
Thomas hob eine Braue. »Ach … äh … sei mir bitte nicht böse, Harry, aber ich bezweifle stark, dass sie sich mit dir zu einem Rendezvous treffen will.«
Ich funkelte ihn an. »Könntest du endlich damit aufhören?«
»Ich sag nur, du solltest sie einfach fragen, ob sie mit dir ausgehen will, um es hinter dich zu bringen. Sie würde bestimmt Ja sagen.«
Ich knallte die Tür des Eisschranks zu. »Es ist nicht, wie du denkst!«
»Ja, gut«, sagte Thomas beschwichtigend.
»Wirklich nicht. Wir arbeiten zusammen. Wir sind Freunde. Das ist alles.«
»Klar«, stimmte er zu.
»Ich bin nicht daran interessiert, mit Murphy auszugehen«, behauptete ich, »und sie hat nicht das geringste Interesse an mir.«
»Sicher. Ich hab’s verstanden.« Er rollte mit den Augen und begann, auf den Boden gepurzelte Bücher aufzuheben. »Deshalb willst du ja auch, dass die Wohnung ordentlich aussieht. Damit deine Geschäftspartnerin nichts dagegen hat, etwas länger zu bleiben.«
Ich fletschte die Zähne und zischte: »Bei allen Sternen des Himmels! Thomas, ich bitte dich ja nicht gerade darum, mir den verdammten Mond vom Himmel zu holen! Ich verlange auch keine Miete von dir. Nur würde es dich bestimmt nicht umbringen, ein wenig im Haushalt mitzuhelfen, bevor du zur Arbeit gehst.«
»Ja«, erwiderte Thomas, während er sich mit den Fingern durchs Haar fuhr. »Ähm … apropos …«
»Apropos?«, wollte ich wissen. Er hätte eigentlich am Nachmittag verschwinden sollen, damit der Reinigungsdienst in meine Wohnung konnte. Die Feen aber tauchten nicht auf und räumten auf, solange sie jemand dabei beobachten konnte, und sie würden überhaupt nicht wiederkommen, wenn ich jemandem von ihnen erzählte. Fragen Sie mich nicht, warum, sie sind einfach so. Vielleicht haben sie eine echt fiese Gewerkschaft oder so.
Thomas zuckte mit den Schultern und setzte sich auf die Armlehne der Couch, ohne mich anzusehen. »Ich hatte nicht das Geld für den Tierarzt oder die Einkäufe«, sagte er. »Ich bin schon wieder rausgeflogen.«
Ich starrte ihn an und versuchte verzweifelt, die Wut in meinem Bauch am Köcheln zu halten, doch sie verpuffte nach und nach, denn die Enttäuschung und die Schmach in seinem Tonfall waren mir nicht entgangen, und er spielte mir bestimmt nichts vor.
»Verdammt«, murmelte ich nur zum Teil an Thomas gerichtet. »Was ist passiert?«
»Das Übliche«, antwortete er. »Die Managerin im Drive-Through ist mir ins Kühlhaus gefolgt und hat sich die Kleider vom Leib gerissen. Genau in diesem Augenblick ist der Besitzer zu einer Inspektion reingekommen und hat mich auf der Stelle gefeuert. Wie er sie angesehen hat, glaub ich fast, sie bekommt eine Beförderung. Ich hasse Geschlechterdiskriminierung.«
»Wenigstens war’s diesmal eine Frau«, sagte ich. »Wir müssen an deiner Selbstkontrolle arbeiten.«
Sein Tonfall wurde bitter. »Eine Hälfte meiner Seele ist ein Dämon, die kann ich nicht kontrollieren, das ist unmöglich.«
»Das kauf ich dir nicht ab«, entgegnete ich.
»Nur weil du Magier bist, heißt das noch lange nicht, dass du auch nur das Geringste davon verstehst«, behauptete er. »Ich kann kein Leben führen wie ein Sterblicher. Ich bin dafür einfach nicht geschaffen.«
»Du machst das gut.«
»Gut?«, fragte er, und seine Stimme wurde lauter. »Ich kann jegliche Hemmungen einer Jungfrau auf fünfzig Schritt zerfetzen, aber ich kann nicht einmal für zwei Wochen einen Job behalten, bei dem ich ein dämliches Haarnetz und ein idiotisches Papierhütchen tragen muss. Was daran ist bitte schön gut?«
Er riss die kleine Truhe auf, in der er seine Kleidung aufbewahrte, schnappte sich ein Paar Schuhe und seine Lederjacke, zog beides mit wütender Präzision an und stakste ohne einen Blick zurück in die langsam hereinbrechende Abenddämmerung hinaus.
Und ohne das Durcheinander aufzuräumen, das er angerichtet hatte, dachte ich freudlos. Dann linste ich zu Mouse hinüber, der sich mit seinem Kinn auf den Pfoten mit traurigen Hundeaugen auf den Boden gelegt hatte.
Thomas war der einzige Verwandte, den ich je gehabt hatte. Aber das änderte nichts an der Wahrheit: Das Leben eines normalen Sterblichen fiel ihm schwer. Er war gut darin, Vampir zu sein, das lag in seiner Natur. Und egal, wie sehr er sich bemühte, in der Rolle des Sterblichen stolperte er von einem Problem ins nächste. Er erwähnte es nie, aber ich spürte, wie Schmerz und Verzweiflung mit jeder verstrichenen Woche in ihm wuchsen.
Mouse atmete schwer aus. Es war gerade noch kein Jaulen.
»Ich weiß«, sagte ich zu dem Hund. »Ich mach mir auch Sorgen.«
Ich nahm Mouse auf einen langen Spaziergang mit und kam erst wieder heim, als sich der Himmel über Chicago in der Dämmerung eines späten Oktobertages zunehmend verdunkelte. Ich fischte die Post aus dem Briefkasten und war gerade dabei, die Stufen zu meiner Wohnung hinunterzusteigen, als ein Auto auf den kleinen Schotterparkplatz des Pensionsgebäudes einbog und wenige Schritte von mir entfernt knirschend anhielt.
Eine zierliche Blondine in Jeans und Windjacke der White Sox aus Satin parkte das Auto, wobei sie jedoch den Motor laufen ließ.
Karrin Murphy sieht überhaupt nicht aus wie die Leiterin einer Ermittlungsbehörde, die sich mit allem befasst, was im gesamten Einzugsgebiet von Chicago so durch die Nacht geistert. Wenn Trolle wieder einmal Passanten ausrauben, Vampire ihre Opfer einfach tot oder sterbend auf der Straße liegen lassen oder jemand mit mehr magischer Feuerkraft als gesundem Menschenverstand Amok läuft, ist es an der Sondereinheit für Spezialermittlungen der Polizei von Chicago, dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
Selbstverständlich glaubt niemand ernsthaft an Trolle, Vampire oder böse Hexer, doch wenn etwas Bizarres passiert, ist es Aufgabe der Sondereinheit, jedermann zu erklären, es habe sich nur um einen Irren mit Gummimaske gehandelt und es bestehe kein Grund zur Sorge.
Die Sondereinheit hat einen Scheißjob, aber die Leute, die für diese Abteilung arbeiten, sind alles andere als dämlich. Ihnen ist nur allzu bewusst, dass es da draußen in der Finsternis Dinge gibt, die man mit unserer Schulweisheit nicht erklären kann, und für Murphy bin ich eine ihrer besten Waffen. Sie heuert mich immer dann als Berater an, wenn es die Sondereinheit mit etwas wirklich Gefährlichem und Fremdartigem zu tun bekommt, und mit den Honoraren, die ich dafür einstreiche, bestreite ich den Löwenanteil meiner Ausgaben.
Als er Murphy sah, begrüßte Mouse sie mit einem leisen Bellen und trottete mit wedelndem Schwanz zu ihr hinüber. Hätte ich mich zurückgelehnt und die Beine ausgestreckt, hätte ich über den Schotter Ski fahren können, aber so oder so ließ mir der große Hund keine andere Wahl als mitzukommen.
Murphy kniete sich hin, um ihre Hände im Fell hinter Mouses Hängeohren zu vergraben und ihn herzhaft zu kraulen. »He, hallo, Junge«, sagte sie lächelnd. »Na, wie geht’s dir?«
Mouse schlabberte mehrere Hundeküsse auf ihre Hände.
»Igitt!«, schrie Murphy, aber zugleich lachte sie. Sie schob Mouses Schnauze sachte von sich und stand auf. »’n Abend, Harry. Freut mich, dass ich Sie noch erwischt habe.«
»Ich komme gerade von meinem Abendspaziergang zurück«, sagte ich. »Wollen Sie reinkommen?«
Murphy hat ein niedliches Gesicht und sehr blaue Augen. Ihr blondes Haar hatte sie an diesem Abend zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst, und so sah sie um einiges jünger aus als gewöhnlich. Ihr Ausdruck aber war reserviert, ja, vielleicht fühlte sie sich sogar ein wenig unbehaglich. »Tut mir leid, aber ich kann nicht«, antwortete sie. »Ich muss ein Flugzeug kriegen. Ich hab wirklich keine Zeit.«
»Ah«, sagte ich, »um was geht es denn?«
»Ich verlasse die Stadt für ein paar Tage. Ich sollte aber am Montagnachmittag wieder da sein. Ich hatte eigentlich gehofft, Sie überreden zu können, meine Blumen zu gießen.«
»Oh«, sagte ich. Sie wollte, dass ich ihre Blumen goss. Wie neckisch. »Ja, klar. Kann ich machen.«
»Danke«, sagte sie und gab mir einen Schlüssel an einem einfachen Stahlring. »Das ist der Schlüssel für die Hintertür.«
Ich nahm ihn. »Wo fliegen Sie hin?«
Das Unbehagen in ihrem Gesichtsausdruck vertiefte sich noch. »Einfach aus der Stadt raus, ein kleiner Urlaub.«
Ich blinzelte.
»Ich habe seit Jahren keinen Urlaub mehr gehabt«, sagte sie wie entschuldigend. »Es ist mal wieder Zeit.«
»Nun ja. Klar«, sagte ich. »Ähm … Urlaub. Ganz allein?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Nun, das ist irgendwie die andere Sache, über die ich mit Ihnen reden wollte. Eigentlich erwarte ich keine Schwierigkeiten, aber ich wollte einfach, dass Sie wissen, wo ich mich aufhalte, nur für den Fall, dass ich nicht rechtzeitig zurück bin.«
»Klar, klar«, stimmte ich zu. »Kann nicht schaden, vorsichtig zu sein.«
Sie nickte. »Ich fahre mit Kincaid nach Hawaii.«
»Ähm … Sicher rein beruflich, nicht wahr?«
Sie verlagerte ihr Gewicht von einem Bein aufs andere. »Nein. Wir sind jetzt ein paar Mal ausgegangen. Ich meine, es ist nichts Ernsthaftes, aber …«
»Murphy«, protestierte ich. »Sind Sie irre? Der Kerl bedeutet Ärger im ganz großen Stil!«
Sie funkelte mich an. »Ich bin erwachsen, Dresden!«
»Ich weiß«, sagte ich. »Aber der Typ ist ein Söldner. Ein Killer. Er ist nicht mal vollständig menschlich. Sie können ihm nicht trauen!«
»Sie haben ihm vertraut«, erinnerte sie mich. »Im letzten Jahr im Kampf gegen Mavra.«
Ich schaute düster drein. »Das war etwas anderes.«
»Oh?«, fragte sie.
»Ja. Ich hab ihn damals dafür bezahlt, Dinge umzulegen. Ich wollte mit ihm nicht ins Be… , äh, ins Bad, ins Strandbad!«
Murphy zog eine Braue hoch.
»Sie sind in seiner Gegenwart nicht sicher«, sagte ich eindringlich.
»Ich fahre mit ihm nicht weg, um in Sicherheit zu sein«, erwiderte sie. Ihre Wangen röteten sich leicht. »Genau darum geht es doch.«
»Sie sollten das nicht tun«, beschwor ich sie.
Sie sah zu mir hoch und runzelte die Stirn.
Dann fragte sie: »Warum?«
»Weil ich einfach nicht mitansehen möchte, wie Ihnen wehgetan wird«, antwortete ich freimütig, »und weil Sie jemand Besseren als ihn verdienen.«
Sie musterte mich einen Augenblick lang und atmete dann schnaufend durch die Nase aus. »Ich brenne jetzt nicht nach Las Vegas durch, um zu heiraten, Dresden. In den letzten Jahren habe ich wie ein Tier gearbeitet und das Leben an mir vorbeirauschen lassen. Ich möchte mir nur etwas Zeit nehmen, um zu leben, ehe es zu spät ist.« Sie zog einen gefalteten Notizzettel aus der Tasche. »Das ist das Hotel, wo ich wohnen werde. Falls Sie mich erreichen müssen.«
Ich sah mit einem finsteren Blick auf den gefalteten Notizzettel, denn irgendwie wurde ich das Gefühl nicht los, dass mir irgendetwas entgangen war. Ihre Finger strichen über die meinen, aber durch den Handschuh und die Narben konnte ich nichts spüren. »Sind Sie sicher, dass Ihnen nichts passieren wird?«
Sie nickte. »Ich bin ein großes Mädchen. Und ich bin die, die aussucht, wohin wir fahren. Er weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Ich hab gedacht, so kann er im Vorhinein nichts aushecken, falls er irgendwelche komischen Hintergedanken hat.« Sie deutete mit einer vagen Geste auf die Handfeuerwaffe, die sie unter der Jacke trug. »Ich werde vorsichtig sein. Ich verspreche es.«
»Ja«, sagte ich. Ich versuchte nicht einmal, sie anzulächeln. »Nur für die Akten: Das ist dumm, Murph. Ich hoffe, Sie überleben das.«
Ihre blauen Augen blitzen unter ihrer gerunzelten Stirn. »Ich hatte gehofft, Sie würden irgendetwas wie ›haben Sie eine schöne Zeit‹ sagen.«
»Ja«, sagte ich, »was auch immer, haben Sie Spaß. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie sicher angekommen sind?«
»Ja«, versprach sie. »Danke, dass Sie sich um meine Pflanzen kümmern.«
»Kein Problem«, antwortete ich.
Sie nickte mir zu, hielt dann aber noch einen Augenblick inne. Schließlich kraulte sie noch einmal Mouse hinter den Ohren, stieg in ihren Wagen und fuhr auf und davon.
Ich blickte ihr nach. Und ich machte mir Sorgen. Und war eifersüchtig.
Richtig, richtig eifersüchtig.
Heilige Scheiße! Hatte Thomas etwa doch recht?
Mouse winselte und scharrte mit der Pfote an meinem Bein. Ich seufzte, steckte den Notizzettel ein und führte meinen Hund in die Wohnung hinunter.
Als ich die Tür öffnete, stieg mir der Geruch frischer Fichtennadeln in die Nase – und nicht nur Fichtenaroma, um das klarzustellen, sondern der Geruch von echten frischen Fichten. Aber es waren weit und breit keine Nadeln zu sehen.
Die Feen waren da gewesen, aber schon wieder verschwunden. Die Bücher standen geordnet in Reih und Glied in den Regalen, der Boden war geschrubbt, die Vorhänge repariert, das Geschirr gewaschen. Sie verstehen, worauf ich hinauswill. Feen mögen bizarre Gesetze haben, aber als Putzdienst führen sie ein ziemlich straffes Regiment.
Ich zündete Kerzen mit Zündhölzern aus einer Schachtel an, die auf dem Couchtisch lag. Als Magier komme ich nicht gut mit Elektrizität und also auch nicht mit Computern klar, also mache ich mir nicht einmal die Mühe, meine Wohnung mit Strom zu versorgen. Mein Eisfach ist ein uraltes Modell, das mit echtem Eis betrieben wird, und ich koche auf einem kleinen Holzofen.
Auf dem wärmte ich etwas Suppe auf, die das Einzige war, was ich noch hatte, setzte mich hin und begann, meine Post durchzusehen.
Das Übliche. Die Marketingweisen eines Computerversands hielten unvermindert an ihren Anstrengungen fest, mir den neuesten Laptop, ein Handy oder einen Plasmafernseher anzudrehen, obwohl ich ihnen bereits telefonisch und auch schriftlich versichert hatte, dass ich über keine Elektrizität verfügte und es die Mühe einfach nicht wert war. Die Rechnung für meine Autoversicherung war ebenfalls eingetrudelt. Und zwei Schecks, der erste ein minimales Honorar, ausgestellt von der Polizei von Chicago dafür, dass ich Murphy im letzten Monat bei einem Schmuggelfall für eine Stunde unter die Arme gegriffen hatte, der zweite um einiges saftiger, von einem Münzsammler, der einen Koffer voller antiker Zahlungsmittel untergegangener Nationen über die Reling seiner Jacht in den Lake Michigan hatte purzeln lassen. Als letzten Ausweg, um ihn ausfindig zu machen, hatte er sich des einzigen Magiers besonnen, der im Telefonbuch von Chicago zu finden ist.
Das letzte Kuvert war eines dieser großen braunen Ungetüme, und mir zuckte ein kurzes Aufflackern von ekelhafter Kälte durch die Magengrube, als mir die Handschrift darauf ins Auge stach. Sie war in anonymen Buchstaben verfasst, so tadellos geschrieben wie auf einem Kindergartenposter und so eintönig wie das Vorlesungsskript eines Englischprofessors.
Mein Name.
Meine Adresse.
Sonst nichts.
Es gab zwar keinen vernünftigen Grund dafür, aber die Handschrift jagte mir einen Schauer über den Rücken. Ich war nicht sicher, was meine Instinkte weckte, außer dass diese Schrift zu vollkommen wirkte, zu makellos. Einen Augenblick lang dachte ich, ich hätte mich völlig grundlos aufgeregt und es handle sich einfach um irgendeine gedruckte Schrift, aber im letzten Buchstaben des Namens »Dresden« war ein Schwung zu finden, der bei allen anderen Namen fehlte. Auch dieser Schwung sah vollkommen aus – und mit voller Absicht ausgeführt. Er war einzig und allein dazu da, mich wissen zu lassen, dass es sich um eine nicht menschliche Handschrift handelte und nicht um einen Laserdruck.
Ich legte den Umschlag flach auf den Couchtisch und starrte ihn an. Er war dünn und nicht von irgendeinem Inhalt verformt, was bedeutete, dass er nur einige wenige Bögen Papier enthielt, wenn überhaupt. Was wiederum bedeutete, dass es sich nicht um eine Bombe handelte. Oder genauer gesagt, nicht um eine Hightech-Bombe, die ohnehin eine ziemlich nutzlose Waffe gegen einen Magier war. Ein technisch primitiver Zündmechanismus hätte wahrscheinlich prima funktioniert, doch der wäre nicht so klein gewesen.
Natürlich konnte ich mystische Angriffsmöglichkeiten nicht ausschließen. Darum hielt ich meine linke Hand über den Umschlag und tastete ihn magisch ab, doch irgendwie konnte ich mich nicht richtig konzentrieren.
Mit einer Grimasse schälte ich den Lederhandschuh von meiner Hand und meinen narbenbedeckten, verkrüppelten Fingern. Im vorigen Jahr hatte ich an der Hand so schwere Verbrennungen erlitten, dass mir die meisten Ärzte sofort eine Amputation empfohlen hatten. Ich hatte nicht zugelassen, dass sie mir die Hand nahmen. Hauptsächlich aus dem Grund, warum ich noch immer den gleichen, zerbeulten VW Käfer fuhr – weil sie zu mir gehörte, zum Donnerwetter!
Aber meine Finger waren ziemlich schlimm anzusehen, genau wie der Rest meiner linken Hand. Ich konnte sie kaum bewegen, spreizte sie jedoch, so gut ich konnte, und ließ einmal mehr meine Sinne schweifen, um magische Energien ausfindig zu machen, die unter Umständen um den Umschlag kreisten.
Ich hätte den Handschuh genauso gut anlassen können. Nichts Seltsames umgab den Umschlag. Also keine arkane Tretmine.
Na gut. Keine weiteren Verzögerungen. Ich hob den Umschlag mit meiner schwachen linken Hand auf und riss ihn auf, dann kippte ich den Inhalt auf den Couchtisch.
Drei Dinge waren in dem Umschlag.
Das erste war ein Foto, 20 x 25 cm. Es zeigte Karrin Murphy, Leiterin der Sonderermittlungsabteilung der Polizei von Chicago. Sie trug keine Uniform, noch nicht mal ein geschäftliches Outfit. Stattdessen hatte sie eine Rotkreuzjacke und eine Baseballkappe an und hielt eine abgesägte Schrotflinte in Händen, ein streng verbotenes Modell. Die Schrotflinte spie Flammen.
Auf dem Bild sah man auch einen Mann, der wenige Meter entfernt stand und von der Taille abwärts mit Blut bedeckt war. Eine lange schwarze Stahlstange ragte aus seiner Brust, als sei er damit aufgespießt worden. Sein Oberkörper und sein Schädel waren ein verschwommenes Durcheinander aus dunklen Linien und roten Flecken. Die Schrotflinte wies genau in Richtung dieses Durcheinanders.
Das zweite war ein weiteres Foto. Es zeigte Murphy, die die Kappe abgenommen hatte und über der Leiche des Mannes stand. Ich war auf dem Bild ebenfalls zu sehen, im Profil. Der Mann war ein Renfield gewesen, eine dämonische, psychotische Kreatur, die man nur im weitesten Sinne als Menschen bezeichnen kann – doch die Kamera war eine unbestechliche Zeugin eines Mordes gewesen.
Murphy, ein Söldner namens Kincaid und ich hatten damals ein Vampirnest des Schwarzen Hofes ausgehoben, das die mörderische Vampirin Mavra angeführt hatte. Ich hatte mir die Hand schrecklich verbrannt, als Mavra höchstselbst das Schlachtfeld betreten hatte, um gegen uns vorzugehen, und konnte mich noch glücklich schätzen, vergleichsweise glimpflich davongekommen zu sein. Am Ende hatten wir ein paar menschliche Geiseln gerettet, ein Haufen Vampire in ihre Einzelteile zerlegt und sogar Mavra erledigt.
Zumindest hatten wir jemanden vernichtet, von dem wir denken sollten, es wäre Mavra gewesen. Im Nachhinein war es schon etwas seltsam, dass uns eine Vampirin, die dafür bekannt war, sich fast völlig unauffindbar zu halten, aus dem Rauch heraus angesprungen hatte, nur um sich von uns enthaupten zu lassen. Aber es war ein ziemlich anstrengender Tag gewesen, und so hatte ich in gutem Glauben darauf vertraut.
Wir hatten versucht, den Angriff so vorsichtig wie möglich durchzuführen. So hatten wir einige Leben mehr retten können, als wenn wir Hals über Kopf hineingestürmt wären. Doch dieser Renfield war knapp davor gewesen, mir den Kopf abzureißen. Um mich zu retten, hatte Murphy ihn töten müssen, und war dabei fotografiert worden.
Ich starrte auf die Bilder.
Die Bilder waren aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen. Das bedeutete, es war noch jemand im Raum gewesen, der fotografiert hatte.
Jemand, den wir nicht gesehen hatten.
Als Drittes war im Kuvert ein Bogen Schreibmaschinenpapier, beschrieben mit derselben Handschrift, in der auch die Adresse verfasst worden war:
Dresden,
ich will ein Treffen mit Dir, biete einen Waffenstillstand für dessen Dauer und verbürge mich mit meinem Ehrenwort für seine Einhaltung. Triff mich heute Abend um 19 Uhr an Deinem Grab auf dem Graceland-Friedhof, sonst werde ich Dinge tun, die für Dich und Deine Verbündeten bei der Polizei ziemlich unerfreulich wären.
Mavra
Auf dem letzten Drittel des Briefes war mit einem Klebestreifen eine Locke goldenen Haars befestigt.
Ich hielt ein Foto neben den Brief.
Es war Murphys Haar.
Mavra hatte sie in ihrer Gewalt. Mit diesen Fotos, die Murphy beim Begehen einer mutmaßlichen Straftat (und mich bei der Beihilfe dazu) zeigten, konnte Mavra sie innerhalb weniger Stunden aus der Polizei und hinter Gittern befördern. Schlimmer noch war jedoch die Locke. Mavra war eine begabte Hexe, die vielleicht so stark war wie ein vollwertiger Magier. Mit einer Locke von Murphy konnte sie Murph fast alles antun, wonach ihr gerade der Sinn stand, und niemand konnte auch nur das Geringste dagegen unternehmen. Mavra konnte sie töten. Mavra konnte ihr aber noch viel Schlimmeres antun.
Ich brauchte nicht lange, um mich zu entscheiden. In übernatürlichen Kreisen ist ein Waffenstillstand, für den man mit seinem Ehrenwort bürgt, eine Institution – besonders bei Typen aus der Alten Welt, zu denen auch Mavra gehörte. Wenn sie mir einen Waffenstillstand anbot, um zu reden, meinte sie es auch so. Sie wollte verhandeln.
Ich starrte auf die Fotos.
Sie wollte verhandeln und würde das aus der Position der Stärke heraus tun. Was in diesem Fall Erpressung bedeutete, und falls ich nicht spurte, war Murphy tot.
2. Kapitel
Der Hund und ich gingen zu meinem Grab.
Der Graceland-Friedhof ist berühmt. Man kann ihn in nahezu jedem Touristenführer über Chicago nachschlagen. Er ist der größte Friedhof der Stadt und einer der ältesten, und zudem ranken sich um ihn unzählige Geistergeschichten mitsamt den dazugehörigen Gespenstern. Die Gräber reichen von einfachen Parzellen mit schlichten Grabsteinen bis zu lebensgroßen Repliken griechischer Tempel, ägyptischer Obelisken und gewaltiger Monumente – ja, selbst eine Pyramide war darunter. Er ist das Las Vegas der Begräbnisstätten, und auch mein Grab befindet sich dort.
Nach Einbruch der Dunkelheit ist der Friedhof geschlossen wie die meisten anderen auch, und das aus gutem Grund. Jeder kennt diesen Grund, aber niemand redet darüber. Es geht dabei nicht um die Toten, sondern vielmehr um die nicht so ganz Toten dort. Geister und Schatten verweilen auf Friedhöfen viel eher als an anderen Orten, vor allem in den älteren Städten des Landes, in denen sich die größten und ältesten Friedhöfe mitten im Stadtzentrum befinden. Das ist auch der Grund, warum man Mauern um die letzten Ruhestätten der Toten baut, und seien sie nur einen Meter hoch. Nicht um Menschen draußen, sondern um etwas drinnen zu halten. In der Welt der Gespenster wohnt Mauern eine gewisse Macht inne, und Friedhofsmauern halten die Lebenden und die Toten auf zwei verschiedenen Seiten der gemeinschaftlichen Festtafel.
Das Tor war verschlossen. Es gab jedoch einen Abschnitt weiter nordöstlich, wo ein Trupp Straßenarbeiter einen riesigen Haufen Schotter an der Mauer deponiert hatte, gerade hoch genug, dass ein Mann mit nur einer gesunden Hand und ein großer, unbeholfener Hund die Mauerkrone erreichen konnten.
So gelangten wir auf den Friedhof, Mouse und ich. Mouse war wenig mehr als ein Welpe und hatte immer noch Pfoten, die viel zu groß für seinen hageren Körper waren. Dennoch war er ansonsten von der Größe jener Statuen vor chinesischen Restaurants und wies auch deren Körperbau auf, mit breitem Brustkorb und kräftigem Kiefer. Sein Fell war fast einheitlich grau, mit pechschwarzen Flecken an den Ohrspitzen, am Schwanz und in dem Bereich der Beine um die Pfoten herum. Im Moment wirkte er noch ein wenig tollpatschig und schlaksig, aber wenn er über die kommenden Monate noch weiter an Muskeln zulegte, würde er zu einem wahrhaftigen Ungeheuer heranwachsen.
Jedenfalls hatte ich gegen die Begleitung meines persönlichen Monsters nichts auszusetzen, da ich drauf und dran war, mich mit einer Vampirin an meinem eigenen Grab zu treffen.
Es befand sich nicht weit entfernt vom recht berühmten Grabmal eines kleinen Mädchens namens Inez, das seit über hundert Jahren tot war. Auf dem Grab des Mädchens prangte eine Statue, die der ursprünglichen Alice von Lewis Carroll sehr ähnlich sah – ein Engelchen in einem pedantisch schicklichen viktorianischen Kleidchen. Angeblich belebte der Geist des Kindes hie und da die Statue, um zwischen den Gräbern und den Stadtvierteln in der Nähe des Friedhofs herumzutollen und zu spielen. Ich hatte das noch nie mit eigenen Augen gesehen.
Aber – he, die Statue war nicht da!
Mein Grab ist eines der bescheideneren vor Ort, und es ist nach wie vor offen. Die adlige Vampirin, die es für mich gekauft hatte, wollte es so. Sie hatte mir auch einen Sarg besorgt, der rund um die Uhr auf mich wartete. Irgendwie wie die Air Force One für den Präsidenten. Für mich war es Dead Force One.
Der Grabstein war aus einfachem weißem Marmor, eine senkrechte Steinplatte, auf der fett eingravierte Buchstaben prangten, mit Gold ausgelegt: HARRYDRESDEN. Dann die Einlegearbeit eines goldenen Pentagramms, ein fünfzackiger Stern in einem Kreis, das Symbol der Kräfte der Magie, umfasst vom menschlichen Geist. Darunter befanden sich weitere Buchstaben: ERSTARB, ALSERDASRICHTIGETAT.
Irgendwie war es immer wieder ziemlich desillusionierend, diesen Ort aufzusuchen. Ich meine, wir werden alle sterben. Auf intellektueller Ebene ist uns das bewusst. Es wird uns klar, wenn wir noch ziemlich jung sind, und es jagt uns einen Höllenschrecken ein, also reden wir uns danach mehr als zehn Jahre lang ein, eigentlich unsterblich zu sein.
Der Tod ist nicht das, worüber man gerne nachdenkt, aber wie man es auch dreht und wendet, man entkommt ihm nicht. Egal, was auch immer man anstellt, wie verbissen man sich in Form hält, wie fanatisch man Diät hält, wie sehr man meditiert, betet oder wie viel Geld auch immer man der Kirche spendet. Am Ende bleibt dennoch nur diese einzige, kalte Gewissheit, der sich jeder auf Erden stellen muss: Eines Tages ist alles aus. Eines Tages wird die Sonne aufgehen, die Welt wird sich weiterdrehen, die Leute werden ihrem täglichen Trott nachgehen – aber man selbst wird nicht mehr dabei sein. Man wird ganz still und leise und kalt sein.
Trotz aller möglichen Religionen, trotz aller Berichte von Leuten, die Nahtoderfahrungen hatten, und der Vorstellungskraft von Geschichtenerzählern im gesamten Verlauf der Geschichte bleibt der Tod das letzte Mysterium. Niemand weiß mit unerschütterlicher Sicherheit, was danach passiert, und wir taumeln alle blind auf das zu, was im Dunkel jenseits der Schwelle auf uns wartet.
Der Tod.
Man kann ihm nicht entkommen.
Man.
Wird.
Sterben.
Das ist eine verdammt bittere, grässlich greifbare Tatsache, die man erst einmal ertragen muss – und glauben Sie mir, sie bekommt eine ganz neue Palette an Farben und Texturen, wenn Sie an Ihrem eigenen offenen Grab stehen.
Ich hielt inne zwischen all den stillen Grabsteinen und Gedenkstätten, die von nüchtern bis bizarr reichten, und der Mond schien auf mich herab. Es war Ende Oktober und zu kalt für Grillen, aber der Verkehrslärm, Sirenen, Alarmanlagen, Flugzeuge hoch über mir, weit entfernte laute Musik, kurz, der Puls Chicagos leistete mir Gesellschaft. Nebel war wie in so vielen Nächten aus dem Lake Michigan hervorgekrochen, Schwaden waberten zwischen den Gräbern und um die Gedenksteine. In der Luft lag eine stille, fast elektrische Spannung, eine Art gedämpfte Energie, wie man sie im Spätherbst so oft spürte. Halloween war fast da, und die Grenzen zwischen Chicago und der Geisterwelt, dem Niemalsland, waren so schwach wie zu keiner anderen Zeit.
Ich spürte die ruhelosen Gespenster des Friedhofs, die sich im wallenden Nebel regten und die energiegeladene Luft kosteten, die meisten viel zu schwach, um sich vor den Augen Sterblicher zu manifestieren.
Mouse saß neben mir, die Ohren aufmerksam nach vorn gerichtet, und ließ den Blick in regelmäßigen Abständen schweifen, und das so konzentriert, als könne er die Dinge, die ich nur ganz vage fühlte, tatsächlich sehen. Aber was auch immer sich da draußen befand, schien ihm keine Sorgen zu bereiten. Er saß ganz ruhig neben mir, meine behandschuhte Hand auf seinem Kopf.
Ich trug meinen langen Staubmantel aus Leder, dessen Pelerine mir fast bis zu den Ellbogen fiel, und darunter einen Pulli, eine schwarze Arbeitshose und alte Springerstiefel. Ich hielt meinen Magierstab in der rechten Hand. Er bestand aus solidem Eichenholz, in das ich eigenhändig von einem Ende zum anderen fließende Runen und Sigille geschnitzt hatte. Der silberne Drudenfuß meiner Mutter hing an einer Kette um meinen Hals. Aufgrund der Narben auf meiner Haut spürte ich das ebenfalls silberne, mit winzigen Schilden behangene Armband kaum, das an meinem linken Handgelenk baumelte, aber es war da. Einige Knoblauchzehen, die ich zusammengebunden hatte, ruhten in einer Tasche meines Staubmantels. Die Ansammlung seltsamer Gegenstände stellte ein ziemlich magisches Arsenal dar, das mich schon aus so manchen haarigen Situationen gerettet hatte.
Mavra hatte mir ihr Ehrenwort gegeben, doch ich hatte genug andere Feinde, die mir nur zu gern eins auswischen wollten. Also gab ich kein leichtes Ziel ab, aber im Dunkeln auf einem Friedhof herumzustehen, auf dem es spukte, war selbst mir nach einer Weile unangenehm.
»Komm schon«, brummte ich nach ein paar Minuten. »Was braucht sie denn so lange?«
Mouse stieß ein Knurren aus, das so tief und leise war, dass ich es kaum hörte – aber ich spürte die plötzliche Anspannung und Wachsamkeit meines Hundes, die meinen Arm von meiner verstümmelten Hand bis zum Ellbogen hinauf zum Erbeben brachte.
Ich umfasste meinen Stab fester und sah mich um. Mouse folgte meinem Beispiel, bis der Blick seiner dunklen Augen etwas folgte, das ich nicht sah. Was auch immer es war, es kam offenbar näher. Dann hörte ich ein leises Rascheln, und Mouse kauerte sich mit gefletschten Zähnen hin, wobei seine Schnauze auf mein offenes Grab gerichtet war.
Ich trat näher daran heran. Nebelschwaden waberten vom grünen Rasen hinein. Ich murmelte halblaut ein paar Worte, nahm mein Amulett ab und ließ einen Teil meines Willens in den fünfzackigen Stern fließen, wodurch er in einem gedämpften blauen Licht aufstrahlte. Ich legte das Amulett über die Finger meiner linken Hand, während ich mit meiner rechten den Stock umklammerte und ins Grab hinuntersah.
Der Nebel darin sammelte sich plötzlich, verdichtete sich und bildete die Gestalt einer dürren Leiche, die einer Frau, ausgemergelt und ausgetrocknet, als hätte sie Jahre in der Erde gelegen. Die Leiche hatte ein grünes Kleid an und darüber eine schwarze Tunika, wie man sie wohl im Mittelalter getragen hatte. Der Stoff war aus einfacher Baumwolle – also moderne Fabrikate und kein tatsächlich historisches Gewand.
Das Knurren von Mouse schwoll zu einem deutlich hörbaren Grollen an.
Die Leiche setzte sich auf, öffnete milchig weiße Augen und musterte mich unverwandt. Sie hob eine Hand, in der sie eine weiße Lilie hielt, die sie mir hinhielt. Dann sprach die Leiche mit einer Stimme, die kaum mehr war als ein kratziges Flüstern: »Magier Dresden. Eine Blume für dein Grab.«
»Mavra«, sagte ich, »du kommst spät.«
»Es gab Gegenwind«, entgegnete die Vampirin. Sie zuckte mit dem Handgelenk, und die Lilie segelte im hohen Bogen auf meinen Grabstein. Sie folgte der Blume mit einer ähnlichen, grauenhaft grazilen Bewegung. Ich bemerkte, dass sie einen Waffengurt mit Schwert und Dolch um die Hüfte trug. Beide sahen alt und gebraucht aus, und ich hätte einen Batzen Geld darauf verwettet, dass sie uralt waren.
Sie hielt inne und musterte mich von der anderen Seite meines Grabes aus. Ihr Gesicht hatte sie ganz leicht von dem blauen Licht meines Amuletts abgewandt, wobei sie den Blick ihrer milchigen Augen jedoch die ganze Zeit auf Mouse gerichtet hatte. »Du hast deine Hand behalten? Nach den Verbrennungen hätte ich angenommen, man hätte sie dir amputiert.«
»Sie gehört mir«, sagte ich, »und geht dich nicht das Geringste an. Du verschwendest meine Zeit.«
Die toten Lippen der Vampirleiche verzogen sich zu einem Lächeln. Hautschuppen rieselten aus ihren Mundwinkeln. Ihr sprödes Haar war zum Großteil wie trockenes Stroh in Fingerlänge abgebrochen, doch hie und da strich noch eine Strähne von der Farbe schimmligen Brotes über die Schultern ihres Kleides. »Es ist deine Sterblichkeit, die dich ungeduldig macht.«
Ich legte mein Amulett wieder an. »Ich bin nicht hier, um zu plaudern. Du hast Dreck über Murphy ausgegraben und willst etwas von mir. Also raus damit.«
Ihr Gekicher war voll Spinnweben und Sandpapier. »Ich vergesse immer wieder, wie jung du bist, bis du dann wieder vor mir stehst. Doch das Leben verrinnt schnell. Du solltest die wenige Zeit, die dir noch bleibt, genießen.«
»Tja, irgendwie habe ich nicht gerade viel Spaß dabei, wenn ein egomanischer Superzombie und ich einander Beleidigungen an den Kopf werfen«, murrte ich. Mouse unterstrich den Satz noch mit einem weiteren, dumpfen Grollen. Ich wandte mich ab. »Wenn das alles ist, was du zu bieten hast, verschwinde ich.«
Ihr Lachen wurde lauter, und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Es war wirklich teuflisch unheimlich. Vielleicht war es die Atmosphäre, aber irgendetwas lag in dem Geräusch. Vielleicht war es aber die vollkommene Abwesenheit von Wärme, von Menschlichkeit, von Freundlichkeit und Freude. Dieses Lachen war wie Mavra selbst – äußerlich in eine vertrocknete menschliche Hülle gekleidet, unter der etwas lauerte, das den schlimmsten Angstträumen entsprungen war.
»Nun gut«, zischelte Mavra. »Dann werden wir uns wohl kurzfassen.«
Ich sah sie misstrauisch an. Irgendetwas an ihrem Verhalten hatte sich geändert, und in meinem Kopf schrillten alle Alarmglocken.
»Finde Kemmlers Wort«, sagte sie, dann wandte sie sich mit rauschenden dunklen Röcken ab, eine Hand entspannt auf dem Heft ihres Schwertes, als sie Anstalten machte, sich zu entfernen.
»He!«, würgte ich hervor. »Das ist alles?«
»Das ist alles«, antwortete sie, ohne sich umzudrehen.
»Warte mal!«, rief ich.
Sie blieb stehen.
»Was zum Teufel ist Kemmlers Wort?«
»Eine Spur.«
»Die wo hinführt?«, fragte ich.
»Zur Macht.«
»Ach, und du willst dieses Wort haben.«
»Ja.«
»Deshalb soll ich es finden.«
»Ja. Allein. Erzähl niemandem von unserer Vereinbarung.«
Ich atmete langsam ein. »Was, wenn ich dir stattdessen rate, zur Hölle zu fahren?«
Mavra hob den Arm, ein Foto zwischen zwei ihrer welken Finger, und selbst im Mondlicht konnte ich erkennen, dass Murphy darauf zu sehen war.
»Ich werde dich aufhalten«, stieß ich hervor, »und selbst wenn mir das nicht gelingt, werde ich hinter dir her sein. Wenn du ihr nur ein Haar krümmst, werde ich dich so heftig beseitigen, dass deine zehn letzten Opfer auf wundersame Weise wieder auferstehen!«
»Ich muss nicht einmal Hand an sie legen«, sagte sie. »Ich werde der Polizei die Beweise zukommen lassen. Die Behörden der Sterblichen werden sie bestrafen.«
»Das darfst du nicht«, sagte ich. »Auch wenn Magier und Vampire im Krieg liegen, lassen wir die Sterblichen außen vor. Wenn du die Behörden der Sterblichen in die Angelegenheit reinziehst, wird das der Rat ebenfalls tun, und dann werden die Roten dem Beispiel folgen. Die ganze Angelegenheit könnte zu einem kompletten, weltweiten Chaos eskalieren.«
»Wenn ich vorhätte, die Behörden der Sterblichen gegen dich einzusetzen, möglicherweise«, gab Mavra zu. »Du gehörst immerhin dem Weißen Rat an.«
Mein Magen verkrampfte sich, als es mir dämmerte. Ich war Mitglied des Weißen Rates und gehörte damit zur übernatürlichen Welt.
Murphy nicht.
»Die Beschützerin des Volkes«, brummte Mavra. »Die Gesetzeshüterin wird als Mörderin überführt, und ihre einzige Rechtfertigung wird klingen wie das Gestammel einer Wahnsinnigen. Sie war stets bereit, für ihre Pflicht zu sterben, Magier. Aber ich werde sie nicht bloß töten. Ich werde sie komplett vernichten. Ich werde ihr Leben und ihr ganzes Dasein auslöschen.«
»Du Schlampe!« Zorn explodierte irgendwo in meiner Brust und wogte wie rotes Feuer durch meinen Körper und meine Gedanken. »Falls ich mich nicht auf einen Waffenstillstand mit dir eingelassen hätte, würde ich …«
Mavras leichengelbe Zähne blitzten in einem gespenstischen Lächeln auf. »Mich an Ort und Stelle vernichten, Magier. Aber das würde dir nichts nützen. Wenn ich es nicht verhindere, werden die Fotos und andere Beweisstücke an die Polizei gesandt, und ich werde es nur verhindern, wenn du mir Kemmlers Wort beschaffst. Finde es. Bring es mir bis zur Mitternacht in drei Tagen, und ich werde dir die Beweise aushändigen. Du hast mein Wort.«
Sie ließ das Foto fallen, und ein ekelerregendes violettes Licht umspielte es, während es zu Boden glitt. Der durchdringende Geruch verbrannter Chemikalien stieg mir in die Nase.
Als ich meinen Blick wieder auf Mavra richten wollte, war sie fort.
Ich stapfte langsam zu dem heruntergefallenen Foto, wobei ich mich anstrengte, meinen Zorn niederzukämpfen und meine übernatürlichen Sinne schweifen zu lassen. Ich fühlte nicht die geringste Spur von Mavras Präsenz in meiner Nähe, und in den nächsten Sekunden verebbte auch das Knurren meines Hundes zu einem leisen, argwöhnischen Laut der Unsicherheit, der schließlich ganz verstummte. Auch wenn mir nicht alle Einzelheiten bekannt waren, war Mouse kein gewöhnlicher Hund, und wenn Mouse nichts Böses mehr witterte, das sich im Schatten herumdrückte, dann weil sich eben nichts Böses im Schatten herumdrückte.
Die Vampirin war nicht mehr da.
Ich hob das Bild auf. Murphys Gesicht darauf war verunstaltet. Die dunkle Energie hatte Spuren in Form von Zahlen darauf hinterlassen. Eine Telefonnummer.
Mein gerechter Zorn verpuffte langsam, und wenn er gänzlich verschwunden war, würden an seiner Stelle nur krankhafte Sorge und Furcht auf mich warten.
Falls ich nicht für eine der schlimmsten Kreaturen, mit der ich es jemals zu tun gehabt hatte, arbeitete, würde sie Murphy in der Kälte zum Trocknen aufhängen lassen.
Besagte Kreatur war hinter Macht her – und ihr blieb dazu nur eine bestimmte Frist. Falls Mavra etwas so eilig benötigte, bedeutete das, dass irgendwo ein Machtkampf schwelte, und Mitternacht in drei Tagen hieß Halloween. Außer dass es mir den Geburtstag gründlich versauen würde, bedeutete das auch, dass früher oder später Schwarze Magie ins Spiel kommen würde, und zu dieser Jahreszeit konnte das nur eines bedeuten.
Nekromantie.
Da stand ich nun auf dem Friedhof, starrte in mein eigenes Grab und begann zu zittern, und das nicht nur, weil mir kalt war.
Ich fühlte mich allein.
Mouse stieß einen Ton aus, der gerade noch kein besorgtes Winseln war, und lehnte sich an mich.
»Komm schon, alter Knabe«, sagte ich zu ihm. »Lass uns heimgehen. Es hat keinen Sinn, wenn mehr als einer von uns in diese verzwickte Angelegenheit hineingerät.«
3. Kapitel
Ich brauchte Antworten.
Höchste Zeit, das Labor aufzusuchen.
Mouse und ich kehrten in meinem zerbeulten Volkswagen wieder zu meinem Appartement zurück. Ursprünglich war der Käfer mal blau, doch inzwischen sind verschiedene Türen und Karosserieteile roten, weißen und grünen Ersatzteilen gewichen. Mein Mechaniker Mike hatte es sogar geschafft, die Kühlerhaube zumindest ansatzweise in ihren Urzustand zurückzuhämmern, die ein Amok laufender böser Bube ziemlich außer Form geprügelt hatte. Ich hatte kein Geld für eine Lackierung, also hatte sich Grundierungsgrau zum Gesamtensemble hinzugesellt.
Mouse war zu schnell gewachsen, als dass er es einigermaßen elegant aus dem Auto geschafft hätte. Er nahm einen Großteil des Rücksitzes in Beschlag, und wenn er von dort aus nach vorn und aus der Fahrertür kraxelte, erinnerte er mich an eine Doku, die ich gesehen hatte, in der ein neuseeländischer Seeelefant über einen Parkplatz gewatschelt war. Er hüpfte nichtsdestotrotz fröhlich aus dem Auto, hechelte und wedelte zufrieden mit dem Schwanz. Mouse liebt es, Auto zu fahren. Dass das Fahrziel ein geheimes Treffen auf einem Friedhof gewesen war, schien ihm den Spaß nicht im Mindesten verdorben zu haben. Der Weg war das Ziel. Mouse war schon eine ganz schöne Zen-Seele.
Mister war noch nicht wieder zurück und Thomas ebenso wenig. Ich bemühte mich, mir darüber nicht zu sehr den Kopf zu zerbrechen. Mister hat sich allein ganz gut durchgeschlagen, ehe ich ihn gefunden habe, und begibt sich gerne mal auf ausgedehnte Streifzüge. Er kann auf sich selbst aufpassen. Und bis auf die letzten Monate hatte auch Thomas es passabel geschafft, ohne mich zu existieren.
Ich musste mir um beide keine Sorgen machen, oder?
Ja, klar.
Ich entschärfte die Zeichen und Sprüche, die mein Heim vor allen möglichen übernatürlichen Eindringlingen schützten, und schlüpfte mit Mouse in meine Wohnung. Dort schürte ich das Feuer, und der Hund ließ sich mit einem erfreuten Seufzer davor zu Boden sinken. Erst dann hängte ich meinen Mantel auf, schnappte mir meinen dicken, alten Flanellbademantel und eine Cola und ging nach unten.
Ich wohne zwar in einer Kellerwohnung, doch eine Falltür unter einem meiner Teppiche gibt den Weg zu einer hölzernen Klappleiter frei, die in einen weiteren Keller darunter und in mein Laboratorium führt. Da unten ist es zu jeder Jahreszeit ziemlich frisch, weshalb ich dort oft den schweren Bademantel trage. Da geht zwar ein weiteres Quäntchen an Romantik des Magier-Daseins dahin, aber dafür habe ich es bequem.
»Bob!«, rief ich, als ich in die undurchdringliche Schwärze des Laboratoriums hinunterkletterte. »Wirf die Datenbanken an! Wir haben zu tun!«
Die ersten Lichter, die im Raum aufflackerten, hatten die Größe und die Farbe von Kerzenflammen. Sie schienen aus den Augenhöhlen eines Totenschädels und wurden langsam heller und heller, bis ich auch das Regal ausmachen konnte, auf dem der Schädel ruhte – ein einfaches Holzbrett an der Wand mit Kerzen, Liebesromanen, einem ganzen Haufen kleinerem Krimskrams und eben dem bleichen Menschenschädel.
»Wurde aber auch langsam Zeit«, grummelte der Schädel. »Es ist Wochen her, seit du mich das letzte Mal gebraucht hast.«
»Liegt an der Jahreszeit«, erwiderte ich. »Nach ein paar Jahren im Geschäft sind die meisten Jobs um Halloween alle irgendwie gleich, und ich muss dich nicht um Rat fragen, wenn ich die Antwort auf meine Fragen schon kenne.«
»Wenn du echt so schlau wärst«, moserte Bob, »bräuchtest du mich auch jetzt nicht.«
»Stimmt«, sagte ich, zog eine Schachtel mit Küchenstreichhölzern aus der Tasche des Bademantels und begann, Kerzen anzustecken. Ich fing mit einer ganzen Menge an, die auf einem Metalltisch standen, der die Mitte des kleinen Raumes einnahm. »Du bist ein Geist des Wissens, wohingegen ich nur ein armer Sterblicher bin.«
»Klar«, sagte Bob, wobei er das Wort dehnte. »Geht’s dir gut, Harry?«
Ich entzündete auch die Kerzen auf den weißen Drahtregalen und Werkbänken an den drei Wänden, die um den Tisch ein C bildeten. Meine Regale waren mit Plastikbehältern, Kaffeedosen, Schachteln, Büchsen, Phiolen, Fläschchen und allen anderen möglichen Behältnissen vollgestellt. Sie enthielten die verschiedensten Dinge, von hundsgewöhnlich wie einfache Fusseln bis exotisch wie Sepiatinte. Auch waren mehrere hundert Kilo Bücher und Notizblöcke in den Regalen zu finden. Einige waren sorgsam eingereiht, andere achtlos aufgetürmt. Ich hatte den Feen keinen Zugang gestattet, darum lag über allem ein feiner Staubfilm.
»Warum fragst du, ob’s mir gut geht?«, erkundigte ich mich.
»Nun«, sagte Bob vorsichtig, »du machst mir Komplimente, was nie ein gutes Zeichen ist, und du zündest alle Kerzen mit Streichhölzern an.«
»Na und?«
»Nun, du kannst die Kerzen mit diesem bescheuerten Spruch anmachen, den du ausgetüftelt hast. Außerdem lässt du wegen deiner verbrannten Hand dauernd die Schachtel fallen. Du hast bis jetzt sieben Zündhölzer gebraucht, um die paar Kerzen anzuzünden.«
Ich fingerte ungeschickt herum, und zum wiederholten Mal fiel mir ein Streichholz aus der verkrampften behandschuhten Hand.
»Acht«, sagte Bob.
Ich unterdrückte ein Knurren und entzündete ein neues Streichholz, was ich jedoch mit zu viel Gewalt tat, sodass das Hölzchen zerbrach.
»Neun.«
»Ach, sei doch still«, murrte ich.
»Zu Befehl. Ich bin der Beste, wenn’s darum geht, still zu sein.«
Ich steckte noch einige Kerzen an, bis sich Bob schließlich wieder meldete.
»Also bist du hier heruntergekommen, um mit meiner Hilfe die Arbeit an einem neuen Sprengstock zu beginnen?«
»Nein«, sagte ich. »Bob, ich habe nur eine Hand, ich kann mit einer Hand nichts schnitzen.«
»Du könntest einen Schraubstock verwenden«, schlug der Schädel vor.
»Ich bin noch nicht bereit«, antwortete ich. Meine verletzten Finger brannten und pochten. »Ich bin’s … einfach noch nicht.«
»Dann sieh besser zu, dass du bereit wirst«, mahnte Bob. »Es ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendetwas Fieses sein freches Haupt erhebt und …«
Ich warf dem Schädel einen bösen Blick zu.
»Schon gut, schon gut.« Hätte Bob Hände gehabt, er hätte sie als Zeichen, dass er sich ergab, erhoben. »Was du mir also sagen willst, ist, dass du noch immer keine Feuermagie einsetzt.«
»Sterne und Steine!« Ich seufzte. »Ja, und ich benutze Streichhölzer statt eines Kerzenzaubers. Ist das so schlimm? Und ich hab viel zu viel um die Ohren, um einen neuen Sprengstock herzustellen. Ist doch wirklich keine große Sache. An meinen typischen Arbeitstagen muss ich nicht allzu viel in die Luft jagen oder niederbrennen.«
»Harry?«, fragte Bob. »Siehst du ein Kreuz und hörst du einen Hahn?«
Ich blinzelte. »Was?«
»Erde an Dresden«, sagte Bob. »Dreimal wirst du mich verleugnen.«
Ich warf die Zündholzschachtel nach dem Schädel. Sie prallte ab, und ein paar Streichhölzer spritzten in verschiedene Richtungen davon. »Behalt deine verdammten psychoanalytischen Expertisen gefälligst bei dir«, knurrte ich. »Es wartet Arbeit auf uns.«
»Ja«, sagte Bob, »du hast recht, Harry. Was weiß ich denn schon von solchen Sachen?«
Ich funkelte Bob an und zog einen Sessel näher an den Arbeitstisch heran. »Die Frage der Stunde ist folgende: Was weißt du über Kemmlers Wort?«
Bob sog die Luft durch die Zähne ein. »Kannst du mir einen Referenzpunkt oder etwas Ähnliches geben?«
»Ich bin mir nicht sicher«, antwortete ich. »Aber ich habe so ein Bauchgefühl, das mir sagt, das Ganze hat mit Nekromantie zu tun.«
Bob pfiff leise, obwohl er keine Lippen hatte. »Ich hoffe nicht.«
»Inwiefern?«
»Weil dieser Kemmler ein echter Albtraum war. Ich meine … Wow, der war krank, Harry. Böse.«
Das erregte meine Aufmerksamkeit. Bob der Schädel war ein Luftgeist, ein Wesen, das in einer Welt aus Wissen, aber ohne jegliche Moral existierte. Er war ziemlich ambivalent, was den Kampf des Guten gegen das Böse anging, und daraus ergab sich, dass ihm nur äußerst vage bewusst war, wo man Grenzen ziehen musste. Wenn Bob jemand als böse bezeichnete … dann musste Kemmler wirklich bis zum Äußersten gegangen sein.
»Was hat er denn so angestellt?«, wollte ich wissen. »Wie hat sich seine Bösartigkeit gezeigt?«
»Nun ja, am bekanntesten ist er für den Ersten Weltkrieg.«
»Was, die ganze Chose?«
»Im Großen und Ganzen ja. Da steckten gut hundertfünfzig Jahre Planung darin, und er hatte die Finger so gut wie überall mit drin. Am Ende der Kampfhandlungen verschwand er einfach und ist erst wiederaufgetaucht, als er im Zweiten Weltkrieg die Insassen der Massengräber wiedererweckte. In Osteuropa ist er regelrecht durchgedreht. Niemand ist sicher, wie viele Menschen er umgebracht hat.«
»Sterne und Steine!«, sagte ich. »Und warum tut so einer so was?«
»Soll ich einfach mal raten? Er war absolut durchgeknallt und böse!«
»Du sagst immer ›war‹«, sagte ich. »Vergangenheit?«
»Absolut. Nach allem, was der Bursche verbrochen hatte, brachte ihn der Weiße Rat zur Strecke und hat seinen dreckigen Arsch 1961 von der Erdoberfläche getilgt.«
»Du meinst die Hüter?«
»Ich meine den Weißen Rat«, sagte Bob. »Den Merlin, den Ältestenrat, die Eingreiftruppe der Erzengel, die Hüter und jeden Magier und verbündeten Zauberer, dessen sie habhaft werden konnten.«
»Wegen eines Mannes?«
»Siehe oben, Stichwort echter Albtraum«, sagte Bob. »Kemmler war Nekromant, Harry. Macht über die Toten. Er hatte beste Beziehungen zu diversen Dämonen, war gut Freund mit Persönlichkeiten an den meisten Vampirhöfen, bester Kumpel von so ziemlich jeder Abscheulichkeit in Europa und einigen der garstigeren Feen. Außerdem besaß er einen Kader von Babykemmlers, die die Drecksarbeit für ihn erledigten. Zauberlehrlinge und Schläger und Schergen jeder Couleur.«
»Verdammt«, murmelte ich.
»Das war er zweifellos. Sie haben ihn damals ziemlich gründlich getötet. Sogar ein paar Mal. Er ist einfach wiederaufgetaucht, nachdem ihn die Hüter Anfang des neunzehnten Jahrhunderts erledigt haben, also waren sie beim zweiten Mal besonders sorgfältig. Auf Nimmerwiedersehen, Herr psychotisches Dreckschwein.«
»Du hast ihn gekannt?«
»Habe ich dir das nie erzählt?«, fragte Bob. »Er war gut vierzig Jahre lang mein Besitzer.«
Ich starrte ihn an. »Du hast für dieses Monster gearbeitet?«
»Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss«, sagte Bob stolz.
»Wie hat Justin dich dann bekommen?«
»Justin DuMorne war ein Hüter, Harry, und er war bei Kemmlers letztem Gefecht dabei. Er zog mich aus den kokelnden Ruinen von Kemmlers Labor. Irgendwie genau so, wie du mich damals aus den kokelnden Ruinen von Justins Labor gezogen hast, nachdem du ihn erledigt hattest. So spielt das Leben, eine Wiederholung nach der anderen, fast wie im Fernsehen.«
Ich kaute an meiner Unterlippe. »Was ist Kemmlers Wort, Bob?«
»Nicht die geringste Ahnung.«
Ich funkelte ihn an. »Was soll das heißen? Ich dachte, du wärst sein Freitag in Schädelform gewesen?«
»Na ja …« Auf einmal flackerte es ängstlich in seinen Augenhöhlen. »Ich kann mich aber an fast nichts erinnern.«
Ich schnaubte spöttisch. »Bob, du vergisst nie etwas.«
»Nein …« Seine Stimme ebbte zu einem kaum verständlichen Flüstern ab. »Außer wenn ich es will, Harry.«
Ich runzelte die Stirn und atmete tief ein. »Du willst mir also sagen, du hast willentlich gewisse Dinge über Kemmler vergessen?«
»Oder man zwang mich dazu«, meinte der Schädel. »Ähm … Harry, kann ich herauskommen? Ich bleib auch im Labor. Du weißt schon, nur solange wir uns unterhalten.«
Selbst an guten Tagen hatte Bob nur Unfug im Sinn. Ich ließ ihn eigentlich überhaupt nicht mehr heraus, außer um ihn auf die Suche nach Informationen zu schicken, und wenn er mich auch des Öfteren nervte, ihn doch zu einem seiner Vandalen-Raubzüge rauszulassen, hatte er mich jedoch noch nie um Erlaubnis gebeten, den Schädel für die Dauer eines Gespräches zu verlassen.