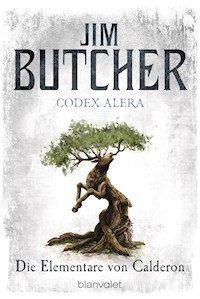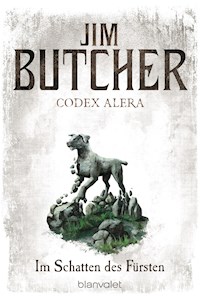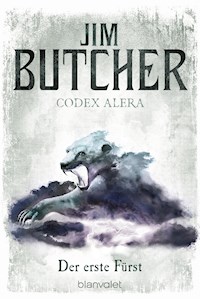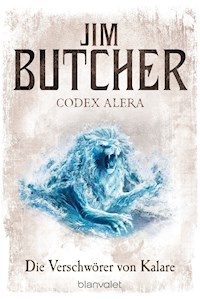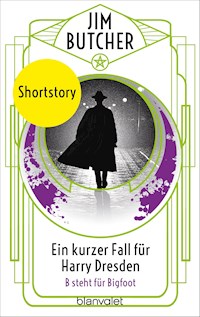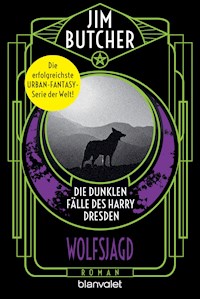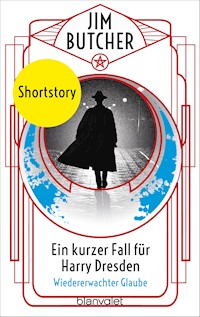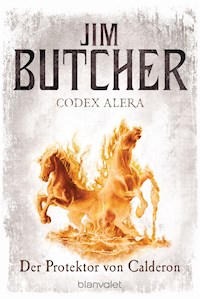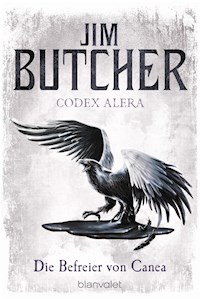9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Harry-Dresden-Serie
- Sprache: Deutsch
Wie erschreckend Filmmonster sind, wird einem erst klar, wenn sie nicht in ihren Filmen bleiben. Der achte dunkle Fall des Harry Dresden.
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich bin jetzt ein Hüter des weißen Rates der Magier. Das macht mich zum wichtigsten Beschützer Chicagos gegen schwarze Magie. Und das Unheil brach auch gleich aus, kaum dass ich das Amt übernommen hatte. Ausgerechnet bei einem Horrorfilm-Festival stiegen die Monster aus der Leinwand. Schnell wurde mir klar, dass ein Schwarzmagier am Werk sein musste. Und langsam dämmerte mir, dass ich als Wächter nicht nur Beschützer war, sondern auch Richter – und Henker …
Die dunklen Fälle des Harry Dresden: spannend, überraschend, mitreißend. Lassen Sie sich kein Abenteuer des besten Magiers von Chicago entgehen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Mein Name ist Harry Blackstone Copperfield Dresden, und ich bin jetzt ein Hüter des Weißen Rates der Magier. Das macht mich zum wichtigsten Beschützer Chicagos gegen Schwarze Magie. Und das Unheil brach auch gleich aus, kaum dass ich das Amt übernommen hatte. Ausgerechnet bei einem Horrorfilm-Festival stiegen die Monster aus der Leinwand. Schnell wurde mir klar, dass ein Schwarzmagier am Werk sein musste. Und langsam dämmerte mir, dass ich als Hüter nicht nur Beschützer war, sondern auch Richter – und Henker …
Autor
Jim Butcher ist der Autor der Dresden Files, des Codex Alera und der Cinder-Spires-Serie. Sein Lebenslauf enthält eine lange Liste von Fähigkeiten, die vor ein paar Jahrhunderten nützlich waren – wie zum Beispiel Kampfsport –, und er spielt ziemlich schlecht Gitarre. Als begeisterter Gamer beschäftigt er sich mit Tabletop-Spielen in verschiedenen Systemen, einer Vielzahl von Videospielen auf PC und Konsole und LARPs, wann immer er Zeit dafür findet. Zurzeit lebt Jim in den Bergen außerhalb von Denver, Colorado.
Jim Butcher
SCHULDIG
DIE DUNKLEN FÄLLE DES HARRY DRESDEN
Roman
Deutsch von Dominik Heinrici
Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Proven Guilty (The Dresden Files 8)« bei Penguin RoC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2006 by Jim ButcherPublished by Arrangement with IMAGINARY EMPIRE LLC
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Peter Thannisch
Covergestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Illustrationen: © www.buerosued.de
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30439-3V002
www.blanvalet.de
1. Kapitel
Blut hinterlässt keine Flecken auf dem grauen Umhang eines Hüters.
Mir war das bis zu dem Tag nicht bewusst gewesen, an dem Morgan, der zweitranghöchste Hüter des Weißen Rates, sein Schwert über der knienden Gestalt eines jungen Mannes erhob, den er für schuldig befunden hatte, Schwarze Magie ausgeübt zu haben. Der Junge, höchstens sechzehn Jahre alt, schrie unter seiner schwarzen Kapuze auf Koreanisch, doch er flehte nicht um sein Leben, denn aufgrund seiner Jugend hielt er sich offenbar nach wie vor für unsterblich. Er schrie vor Hass und Wut und schien nicht einmal zu begreifen, als das Schwert auf ihn herabsauste.
Das war eine geringe Gnade. Eine mikroskopisch geringe, wenn man es so betrachtet.
Sein Blut spritzte in purpurnem Bogen durch die Luft, und ich stand nicht mal drei Meter entfernt. Ich fühlte, wie warme Tropfen auf meine Wange klatschten, und weiteres Blut färbte die eine Seite meines Umhanges zornig rot. Der Kopf fiel zu Boden, und ich sah, wie sich das Tuch darüber bewegte, als stoße der Mund des Knaben immer noch Verwünschungen aus.
Der Körper fiel zur Seite. Die Muskeln einer Wade zuckten zunächst noch, doch das nur für wenige Sekunden.
Morgan blieb einen Augenblick über der unbeweglichen Gestalt stehen, das silberne Schwert in Händen. Außer ihm und mir war noch ein Duzend weiterer Hüter anwesend – und zwei Mitglieder des Ältestenrates, der Merlin und mein ehemaliger Mentor Ebenezar McCoy.
Auch die schwachen Bewegungen des stoffbedeckten Kopfes erstarben. Morgan sah zum Merlin auf und nickte. Der erwiderte das Nicken. »Möge er Frieden finden.«
»Frieden«, antworteten alle Hüter gemeinsam.
Außer mir. Ich wandte ihnen den Rücken zu und schaffte es, noch zwei Schritte zu taumeln, bevor ich mich auf den Boden des Lagerhauses übergab.
Zitternd stand ich einen Augenblick da, bis ich sicher war, dass ich nichts mehr hochwürgen konnte, bevor ich mich langsam aufrichtete. Ich spürte, wie jemand näher kam, und als ich aufblickte, sah ich Ebenezar dort stehen.
Er war ein alter Mann, der Kopf fast kahl bis auf ein paar letzte Büschel weißen Haars. Er war nicht sehr groß, aber stämmig, und sein Gesicht war halb unter einem draufgängerisch aussehenden Bart verborgen. Nase, Wangen und die blanke Kopfhaut waren braun gebrannt bis auf eine frische, gerötete Narbe oberhalb seiner Stirn. Auch wenn er jahrhundertealt war, bewegte er sich mit einer energischen Lebhaftigkeit, und seine Augen hinter der goldrandigen Brille wirkten wachsam und nachdenklich. Er trug die formelle schwarze Robe des Rates, und die purpurrote Stola darüber zeigte, dass es sich bei ihm um ein Mitglied des Ältestenrates handelte.
»Harry«, fragte er leise, »alles klar?«
»Nach dem Ganzen hier?«, brummte ich laut genug, dass mich jeder hörte. »Bei niemandem in diesem verdammten Gebäude sollte alles klar sein.«
Ich fühlte plötzliche Spannung in der Luft hinter mir.
»Nein«, stimmte Ebenezar zu, und ich sah, wie er sich zu den anderen Magiern umblickte. Sein Kiefer war grimmig nach vorn geschoben.
Der Merlin kam zu uns herüber. Auch er trug seine formelle Robe und seine Stola. Er sah genau so aus, wie man sich einen Magier schon immer vorgestellt hat – groß, mit langem weißem Haar, einem langem weißem Bart, durchdringenden blauen Augen und von Alter und Weisheit zerfurchtem Gesicht.
»Hüter Dresden«, hob er an. Er hatte die klangvolle Stimme eines ausgebildeten Redners, und in seinem Englisch schwang ein britischer Oberklassenakzent mit. »Falls Sie einen Hinweis darauf hatten, dass der Knabe unschuldig war, hätten Sie diesen während der Gerichtsverhandlung vorbringen sollen.«
»Sie wissen genau, dass ich nichts dergleichen in der Hand hatte«, antwortete ich.
»Wir haben ihn für schuldig befunden«, sagte der Merlin. »Ich habe den Seelenblick vollzogen. Ich habe mehr als zwei Duzend Sterbliche untersucht, deren Gedanken er verändert hatte. Bei dreien von ihnen besteht zumindest die Möglichkeit, dass sie ihre geistige Gesundheit wiedererlangen. Vier weitere hat er jedoch gezwungen, Selbstmord zu begehen. Darüber hinaus hatte er neun Leichen vor den örtlichen Polizisten versteckt, und jedes einzelne seiner Opfer war ein Blutsverwandter.« Der Merlin machte einen Schritt in meine Richtung, und die Luft in der Halle fühlte sich plötzlich sengend heiß an. Seine azurblauen Augen blitzten vor Zorn, und in seiner Stimme grollte tiefe, unbeirrbare Autorität. »Die Macht, die er einsetzte, hatte seine Gedanken zerfressen. Was wir taten, war notwendig.«
Ich blickte dem Merlin direkt ins Gesicht, doch meine Körperhaltung war weder streitlustig noch provokativ, und in meiner Stimme lag nichts Respektloses, als ich sprach. Die letzten Monate hatten mich gelehrt, dass der Merlin nicht durch eine Werbeanzeige auf einer Zündholzschachtel an seinen Job gekommen war. Er war schlicht und einfach der mächtigste Magier auf Erden. Mit seiner reinen Stärke gingen Talent, Können und Erfahrung einher. Wenn es je so weit kam, dass wir uns magisch in die Haare kriegten, würde von mir nicht einmal genug übrig bleiben, um es in einen Papiertüte zu kehren. Ich wollte auf keinen Fall eine Auseinandersetzung riskieren.
Aber ich wollte auch auf keinen Fall klein beigeben.
»Er war ein Kind«, sagte ich. »Wir alle waren das mal. Er hatte einen Fehler gemacht. Wie wir alle allzu oft einen machen.«
Der Merlin betrachtete mich mit einem Ausdruck, der irgendwo zwischen Verärgerung und Verachtung lag. »Sie sind sich darüber bewusst, was das Wirken von Schwarzer Magie mit einem Menschen anstellen kann«, entgegnete er. Unglaublich subtile Schattierungen und Betonungen in seinen Worten fügten ohne jeden Zweifel einen unausgesprochenen Gedanken hinzu: Sie wissen das so genau, weil Sie ebenfalls Schwarze Magie ausgeübt haben. Früher oder später werden Sie sich einen Schnitzer leisten, und dann sind Sie an der Reihe.
Laut sagte er: »Wer einmal Schwarze Magie wirkt, wird das erneut tun. Immer wieder.«
»Das höre ich auch dauernd«, antwortete ich. »Sag Nein zu Schwarzer Magie. Aber dieser Junge hatte niemanden, der ihm die Regeln beigebracht hat, niemanden, der ihn unterwiesen hat. Wenn irgendjemand von seiner Gabe gewusst und rechtzeitig etwas unternommen hätte …«
Der Merlin hob die Hand, und diese einfache Geste trug eine derart endgültige Autorität in sich, dass ich verstummte, um ihn sprechen zu lassen. »Der Punkt, der Ihnen entgeht, Hüter Dresden, ist folgender: Der Knabe, der einen törichten Fehler beging, starb lange vor dem Zeitpunkt, als wir herausfanden, was er trieb. Das, was von ihm noch übrig war, war im Großen und Ganzen nur noch ein Ungeheuer, das in seinem Leben nichts anderes mehr getan hätte, als seinen Mitmenschen Schrecken und Tod zu bringen.«
»Ja, ich weiß«, erwiderte ich, und diesmal gelang es mir nicht, Wut und Frustration aus meiner Stimme zu verbannen. »Und ich weiß, was getan werden musste. Ich weiß, dass das der einzige Weg war, ihn noch aufzuhalten.«
Kurz fürchtete ich, mich erneut übergeben zu müssen, also schloss ich die Augen und stützte mich auf das massive Eichenholz meines beschnitzten Stabes. Ich bekam meinen Magen unter Kontrolle und öffnete wieder die Augen, um dem Merlin erneut direkt ins Gesicht zu sehen. »Aber das ändert nichts daran, dass wir gerade einen Jungen umgebracht haben, dem wahrscheinlich nicht wirklich bewusst war, was da genau mit ihm geschah.«
»Sie sind wahrhaft nicht in der Position, jemandem einen Mord zu unterstellen, Hüter Dresden.« Der Merlin zog eine silberne Augenbraue hoch. »Haben Sie nicht selbst aus kürzester Entfernung eine Schusswaffe auf den Hinterkopf einer Frau abgefeuert, von der Sie nur glaubten, es könne sich um Capiorcorpus handeln?«
Ich schluckte. Zur Hölle, genau das hatte ich ein Jahr zuvor getan. Das war wohl einer der riskantesten Münzwürfe meines Lebens gewesen. Wenn ich damals falschgelegen hätte, wenn der körpertauschende Magier, den ich Totengreifer nannte, nicht in den Körper von Hüterin Luccio gefahren gewesen wäre, hätte ich nicht nur eine unschuldige Frau ermordet, sondern außerdem noch eine Gesetzeshüterin des Weißen Rates.
Ich hatte mich nicht geirrt, aber bis zu diesem Zeitpunkt … hatte ich noch nie jemanden einfach getötet. Zugegeben, in der Hitze des Gefechts hatte ich sehr wohl Leben genommen, und indirekt war ich ebenfalls für weitere Todesfälle verantwortlich. Aber den Tod von Totengreifer hatte ich aus nächster Nähe, kalt berechnend und in keinster Weise indirekt herbeigeführt. Einfach nur ich, eine Knarre und eine in sich zusammengesunkene Leiche. Ich konnte mich noch lebhaft daran erinnern, wie ich mich entschieden hatte zu schießen, an das Gefühl des kalten Metalls in meiner Hand, den widerspenstigen Abzug meines Revolvers, an das Donnern des Schusses, die Art, wie der Körper als Haufen erschlaffter Gliedmaßen zu Boden gesunken war und dass das tatsächliche Ausführen dieser Tat irgendwie viel zu einfach für die schreckliche Tragweite schien.
Ich hatte gemordet. Ich hatte absichtlich das Leben eines Menschen ausgelöscht, und das verfolgte mich nach wie vor in meinen Träumen.
Ich hatte keine andere Wahl gehabt. Totengreifer hätte tödliche Magie heraufbeschwören können, und das Beste, worauf ich hätte hoffen können, wäre ein Todesfluch gewesen, der mich in dem Moment umgebracht hätte, in dem ich ihn niederstreckte. Selbst wenn dem nicht so gewesen wäre, hätte Totengreifer in einem fairen Kampf mit mir den Boden aufgewischt. Also hatte ich ihm einfach keinen fairen Kampf geliefert. Ich hatte ihm in den Hinterkopf geschossen, denn ich hatte Totengreifer aufhalten müssen.
Ich hatte die Frau, die ich vor mir gesehen hatte, auf Verdacht hingerichtet.
Kein gerichtliches Verfahren. Kein Seelenblick. Kein Urteil eines unparteiischen Schlichters. Peng. Aus. Ein lebender Magier, ein toter Bösewicht.
Ich hatte es getan, um mich und andere vor Schaden zu bewahren. Keine Frage, ich hatte es getan und keine Sekunde gezögert, da ich mich in dieser Nacht noch weiteren Gefahren zu stellen hatte.
Wie man es als Hüter tut. Irgendwie machte das meine moralische Überlegenheit ziemlich zunichte.
Geheimnisvolle blaue Augen musterten mein Gesicht, und der Merlin nickte langsam. »Sie haben sie gerichtet«, stellte er mit ruhiger Stimme fest. »Weil es erforderlich war.«
»Das war etwas anderes«, behauptete ich.
»Das ist wahr. Ihre Tat bedurfte einer weit größeren persönlichen Überzeugung. Es war dunkel, kalt, und Sie waren allein. Die Verdächtige war stärker als Sie. Hätten Sie zugeschlagen, aber keinen Erfolg gehabt, wären Sie ums Leben gekommen. Dessen ungeachtet mussten Sie tun, was Sie damals taten, denn es war notwendig.«
»Notwendig ist nicht dasselbe wie richtig«, sagte ich.
»Möglicherweise nicht«, meinte er. »Aber die Gesetze der Magie sind das Einzige, was Magier davon abhält, ihre Macht über Sterbliche zu missbrauchen. Das lässt keinen Spielraum für Kompromisse. Sie sind jetzt ein Hüter. Sie müssen Ihre Pflichten den Sterblichen und dem Rat gegenüber erfüllen.«
»Was mitunter bedeutet, Kinder umzubringen?« Diesmal verbarg ich meine Abscheu nicht, auch wenn ich nicht besonders überzeugend klang.
»Was bedeutet, zu jeder Zeit den Gesetzen der Magie Gültigkeit zu verschaffen«, erwiderte der Merlin, und sein Blick bohrte sich in meinen. »Es ist Ihre Pflicht, mehr als je zuvor.«
Ich brach den Blickkontakt als Erster, ehe etwas Schlimmes passieren konnte. Ebenezar stand ein paar Schritte von mir entfernt und beobachtete mich genau.
»Zugegeben, Sie haben für einen Mann Ihres Alters schon sehr viel mit angesehen«, fuhr der Merlin fort, und sein Tonfall wurde ein wenig sanfter. »Aber Sie haben noch nicht gesehen, wie schlimm die Dinge wirklich werden können. Nicht mal ansatzweise. Die Gesetze gibt es aus einem guten Grund, und sie müssen eingehalten werden, wie sie geschrieben stehen.«
Ich wandte das Gesicht ab und starrte auf die rote Lache auf dem Boden des Lagerhauses neben der Leiche des Jugendlichen. Man hatte mir seinen Namen nicht genannt, bevor sie ihn getötet hatten.
»Genau«, seufzte ich müde und wischte mit einem sauberen Teil meines Hütermantels über mein blutbeflecktes Gesicht. »Ich sehe auch, womit sie geschrieben sind.«
2. Kapitel
Ich verließ das Lagerhaus. Chicago gab sich alle Mühe, zu tun, als sei es Miami. Der Sommer im Mittleren Westen fällt meist zumindest schwül aus, doch in diesem Jahr war die Sommerhitze besonders drückend, und es hatte auch häufig geregnet. Das Lagerhaus gehörte zu den Werften am Seeufer, und selbst das kühle Wasser des Lake Michigan war wärmer als gewöhnlich. Die Luft war in einem stärkeren Maß als sonst vom üblichen Geruch des Sees nach Schlamm, Moder und Eau de Totfisch durchdrungen.
Ich passierte die beiden Hüter die in ihren grauen Umhängen am Ausgang Wache schoben, und wir nickten einander zu. Beide waren jünger als ich, offensichtlich einige der letzten Neuerwerbungen der Militär-/Polizeiorganistion des Weißen Rates. Als ich an ihnen vorüberschritt, spürte ich kurz das Prickeln eines magischen Schleiers auf meiner Haut, eines Spruchs, der gewirkt worden war, um das Warenhaus vor allen spähenden Augen zu verbergen. Für die Standards, die die Hüter normalerweise setzten, war es kein besonders beeindruckender Schleier, doch er war um einiges besser gewirkt, als ich ihn höchstwahrscheinlich zustande gebracht hätte. Außerdem gab es nach der erfolgreichen Offensive des Roten Hofes der Vampire im Herbst zuvor nicht gerade einen Riesenhaufen Hüter, aus dem man sich die besten aussuchen konnte. In der Not frisst der Teufel Fliegen.
Ich schlüpfte aus Robe und Umhang. Ich trug Sportschuhe, eine kurze Kakihose und ein rotes Tanktop darunter. Die schwere Kleidung abzustreifen, verschaffte mir auch keine Kühlung, doch irgendwie fühlte ich mich eine Spur weniger elend. Ich eilte zu meinem Auto, einem zerbeulten alten VW Käfer, dessen Fenster heruntergekurbelt waren, um zu verhindern, dass die Sonne das Wageninnere in einen Backofen verwandelte. Irgendwann einmal war das Vehikel dunkelblau gewesen, doch nun war es in den wildesten Farben zusammengewürfelt, da mein Mechaniker beschädigte Teile des Wagens mit Versatzstücken verschrotteter Käfer ersetzt hat.
Ich hörte hinter mir schwere Schritte. »Harry!«, rief mir Ebenezar nach.
Ich warf Robe und Umhang auf die Rückbank des Käfers und antwortete nicht.
»Harry!«, rief Ebenezar erneut. »Verdammt, Junge, bleib stehen!«
Kurz überlegte ich mir, einfach einzusteigen und davonzufahren, doch stattdessen hielt ich inne, bis der alte Magier bei mir angelangt war und sich ebenfalls aus seiner formellen Robe und seiner Stola schälte. Darunter trug er ein weißes T-Shirt und eine Jeanslatzhose sowie schwere Wanderstiefel aus Leder. »Ich muss mit dir sprechen.«
Ich atmete tief durch und nahm mir einen Moment Zeit, um meine Gefühle unter Kontrolle zu bekommen – und meinen Magen. Ich wollte mich nicht erneut blamieren, indem ich meine Vorstellung im Lagerhaus wiederholte. »Was ist?«
Er blieb ein paar Schritte hinter mir stehen. »Der Krieg läuft schlecht.«
Damit meinte er den Krieg des Weißen Rates gegen den Roten Hof der Vampire. Anfänglich hatte der Krieg hauptsächlich darin bestanden, auf Samtpfoten herumzuschleichen, sich gegenseitig zu belauern und sich in Seitengassen zu prügeln, doch im vergangenen Jahr hatten die Vampire den Einsatz erhöht. Ihr Angriff war zeitgleich mit den heimtückischen Machenschaften eines Verräters innerhalb der Reihen des Weißen Rates und den Übergriffen mehrerer Nekromanten erfolgt, gesetzlose Magier, die Tote erweckten und als wütende Gespenster oder Zombies auferstehen ließen.
Die Vampire hatten den Rat hart getroffen und beinahe zweihundert Magier umgebracht, vor allem Hüter. Darum hatten mir die Hüter auch den grauen Umhang angedeihen lassen. Sie benötigten Hilfe.
Insgesamt hatten die Vampire fast fünfundvierzigtausend Männer, Frauen und Kinder umgebracht. Deshalb hatte ich den Umhang angenommen – das war eine Angelegenheit, die ich nicht einfach ignorieren konnte.
»Ich habe die Berichte gelesen«, sagte ich. »Es heißt, die Venatori Umbrorum und die Bruderschaft von Saint Giles hätten sich mächtig ins Zeug gelegt.«
»Mehr als das. Wenn sie nicht ihrerseits einen Angriff gestartet hätten, um die Vampire aufzuhalten, hätte der Rote Hof den Weißen Rat vor Monaten vernichtet.«
Ich blinzelte. »Die leisten so viel?«
Die Venatori Umbrorum und die Bruderschaft von Saint Giles waren die Hauptverbündeten des Weißen Rates im Krieg gegen den Roten Hof. Die Venatori waren ein alter Geheimbund, der sich zusammengeschlossen hatte, um die Dunkelheit zu bekämpfen, wo auch immer er dazu imstande war. Wie die Freimaurer, nur mit Flammenwerfern. Im Großen und Ganzen war es eher ein Haufen Akademiker, und auch wenn viele Venatori den ein oder anderen militärischen Hintergrund hatten, lag ihre wahre Stärke darin, das menschliche Rechtssystem zu nutzen und die Informationen auszuwerten, die ihnen ihre weit gestreuten Quellen zutrugen.
Die Bruderschaft von Saint Giles hingegen war eine etwas andere Sache. Sie hatte bei Weitem nicht so viele Mitglieder wie die Venatori, aber wie ich es verstanden hatte, waren die meisten von ihnen zur Hälfte Vampire. Sie waren mit der finsteren Macht verseucht, die den Roten Hof zu einer solchen Bedrohung machte, doch solange sie nicht willentlich das Blut eines Sterblichen tranken, waren sie weiterhin auch Menschen. Das machte sie stärker und schneller, und sie konnten Verletzungen besser wegstecken als Normalsterbliche, was auch ihre Lebensspanne deutlich verlängerte. Vorausgesetzt, sie fielen nicht ihrem permanenten Blutdurst zum Opfer oder kamen im Lauf einer Operation gegen ihre Feinde am Roten Hof ums Leben.
Wenn ich ehrlich war, hatte ich den Krieg zwischen dem Weißen Rat und dem Roten Hof sogar ausgelöst. Eine Vampirin des Roten Hofes hatte eine Frau entführt, die mir sehr viel bedeutet hatte, und ich hatte zu den brutalsten mir zur Verfügung stehenden Mitteln gegriffen, um sie zu retten. Ich hatte sie zwar zurückgeholt, doch sie war von der Finsternis berührt, und nun war ihr ganzes Leben ein Kampf – einerseits gegen die Vampire, die ihr das angetan hatten, andererseits gegen den Blutdurst, der ihr aufgezwungen worden war. Nun war sie Teil der Bruderschaft, zu der auch andere wie sie und viele Menschen und, wie mir zu Ohren gekommen war, Nicht-ganz-Menschen gehörten, die sonst nirgendwo ein Zuhause fanden. Saint Giles war der Schutzpatron der Aussätzigen und Ausgestoßenen, und seine Bruderschaft hatte sich als überraschend starker Verbündeter erwiesen, auch wenn sie bei Weitem kein Machtfaktor war wie der Rat oder einer der Vampirhöfe.
»Unsere Verbündeten können sich den Vampiren nicht von Angesicht zu Angesicht stellen«, sagte Ebenezar und nickte. »Aber sie richten ziemliche Verwüstung unter den Nachschublinien des Roten Hofes an und stören auch deren Aufklärung und Unterstützung, indem sie den Hof aus der Welt der Sterblichen heraus angreifen. Sie entlarven seine Agenten, mit denen der Rote Hof die Gesellschaft der Sterblichen infiltriert. Sie sorgen dafür, dass Menschen, die der Rote Hof kontrolliert, wegen irgendwelcher Verbrechen verhaftet, in Intrigen verwickelt oder umgebracht werden – oder entführt, um sie von ihrer Sucht zu befreien. Die Bruderschaft und die Venatori tun alles in ihrer Macht Stehende, um dem Rat Informationen zukommen zu lassen, was uns ermöglicht hat, erfolgreich Angriffe gegen die Vampire zu führen. Die Venatori und die Bruderschaft können zwar keinen kriegsentscheidenden Schlag gegen die Vampire führen, aber sie haben den Roten Hof zumindest ausgebremst. Möglicherweise genug, damit wir uns ausreichend erholen können.«
»Wie steht es um das Ausbildungslager?«, fragte ich.
»Luccio ist zuversichtlich, dass sie mit der Zeit unsere Verluste ersetzen kann«, entgegnete Ebenezar.
»Ich sehe nicht, wie ich da helfen könnte«, meinte ich. »Außer ihr sucht jemanden, der auszieht, um neue Generationen von Magiern zu zeugen.«
Er trat näher und blickte sich um. Er wirkte nicht angespannt, doch es war offensichtlich, dass er sicherstellte, dass niemand nahe genug war, um uns zu belauschen. »Es gibt etwas, was du nicht weißt. Der Merlin will auch nicht, dass es allgemein bekannt wird. Du erinnerst dich an den Angriff des Roten Hofes im letzten Jahr und dass sie Fremdwandler beschworen und uns innerhalb der Feenlande angriffen.«
»Blöde Idee. Die Feen werden es ihnen ganz schön heimzahlen.«
»Der Meinung waren wir alle«, antwortete der alte Mann. »Und tatsächlich hat der Sommerhof den Roten den Krieg erklärt und auch die ersten Angriffe eingeleitet. Aber der Winter hat nicht reagiert – und auch der Sommerhof tut wenig mehr, als die Grenzen seines eigenen Reichs zu sichern.«
»Königin Mab hat keine Kriegserklärung ausgesprochen?«
»Nein.«
Ich runzelte die Stirn. »Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sie sich diese Chance entgehen lässt. Sie fährt doch total auf Gewaltorgien und Gemetzel ab.«
»Es hat uns auch überrascht. Deshalb möchte ich dich um einen Gefallen bitten.«
Ich musterte Ebenezar McCoy, ohne etwas zu erwidern.
»Finde heraus, wieso«, fuhr er fort. »Du hast Kontakte zu den Feenhöfen. Finde heraus, was vor sich geht. Finde heraus, warum die Sidhe nicht in den Krieg ziehen.«
»Was?« Ich war verblüfft. »Der Ältestenrat weiß das nicht? Habt ihr keine Botschafter und Kontakte auf höchster Ebene und offizielle Kanäle und so? Ein rotes Telefon zum Beispiel?«
Ebenezar lächelte ohne allzu viel Heiterkeit. »Die Turbulenzen, die der Krieg nach sich zog, beanspruchen die Geheimdienstaktivitäten aller Seiten bis ans Limit, selbst in den Sphären des Übernatürlichen. Es gibt noch eine andere Ebene des Krieges, nämlich die Auseinandersetzungen zwischen übersinnlichen Spionen und den Abgesandten aller involvierten Parteien, und was die Botschafter der Sidhe betrifft …« Er hob seine breiten Schultern zu einem Achselzucken. »Na ja, du kennst die Sidhe so gut wie sonst kaum jemand.«
»Sie waren freundlich, zugänglich, haben sich absolut ehrlich geäußert«, schlussfolgerte ich, »und am Ende hattet ihr nicht die geringste Ahnung, was vor sich geht.«
»Genau.«
»Also bittet der Ältestenrat mich, Licht in diese Angelegenheit zu bringen?«
Ebenezar sah sich erneut um. »Nicht der Ältestenrat. Ich und ein paar andere.«
»Welche anderen?«, wollte ich wissen.
»Leute, denen ich vertraue«, sagte er und sah mich über den Rand seiner Brille direkt an.
Ich starrte einen Atemzug lang zurück und flüsterte dann: »Es geht um den Verräter.«
Die Vampire waren in der ganzen Angelegenheit immer etwas zu weit obenauf gewesen, als dass es sich um reines Glück hatte handeln können. Jemand musste sie über die geheime Aufstellung der Streitkräfte des Weißen Rates und seine Pläne informieren, und das hatte viele Magier das Leben gekostet – vor allem während des schwersten Angriffs des Vorjahrs, bei dem die Vampire die Grenzen der Feenreiche verletzt hatten, um den fliehenden Rat zu verfolgen. »Du bist der Meinung, der Verräter gehört dem Ältestenrat an.«
»Ich denke, wir können kein Risiko eingehen«, entgegnete Ebenezar leise. »Das ist eine inoffizielle Angelegenheit. Ich kann dir nicht befehlen, es zu tun. Und ich würde verstehen, wenn du es nicht tun willst. Aber es gibt niemand Besseren für diese Aufgabe. Unsere Verbündeten können den Druck ihrer jetzigen Operationen nicht lange aufrechterhalten, und sie haben jetzt schon einen gewaltigen Blutzoll entrichtet, um uns zu helfen, so gut sie konnten.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust und sagte: »Wir müssen ihnen helfen, keine Frage. Aber jedes Mal, wenn ich auch nur schief in die Feenlande schiele, gerate ich in noch üblere Schwierigkeiten. Das ist das Letzte, was ich brauche. Wenn ich es tun soll, wie …«
Ebenezar verlagerte sein Gewicht, und Kies knirschte. Ich blickte auf und sah, wie der Merlin und Morgan aus dem Gebäude kamen, wobei sie flüsternd in ein intensives Gespräch vertieft waren.
»Ich wollte mit dir reden«, sagte Ebenezar, und mir war klar, dass es für die Ohren der anderen bestimmt war, »um sicherzugehen, dass Morgan und die restlichen Hüter dich auch anständig behandeln.«
Ich spielte mit. »Die sprechen kaum mit mir. So ziemlich der einzige weitere Hüter, den ich je zu Gesicht bekomme, ist Ramirez. Korrekter Typ. Ich mag ihn.«
»Das spricht für ihn.«
»Dass ich als die tickende Zeitbombe des Rates etwas Gutes über ihn zu sagen habe?« Ich wollte abwarten, bis der Merlin und Morgan wieder verschwunden waren, aber sie blieben in einiger Entfernung stehen, immer noch in ihr Gespräch vertieft. Ich starrte eine Weile auf den Schotter hinab, ehe ich um einiges leiser sagte: »Das heute hätte ich sein können. Ich hätte dieser Junge sein können.«
»Das ist schon lange her«, antwortete Ebenezar. »Du warst kaum mehr als ein Kind.«
»Er auch nicht.«
Ebenezars Miene wurde wachsam. »Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest.«
»War das der Grund, warum es hier geschah?«, wollte ich wissen. »Warum sie wegen einer Enthauptung extra nach Chicago gekommen sind?«
Er atmete langsam aus. »Hier ist einer der größten Verkehrsknotenpunkte der Welt. Hier kommt mehr Flugverkehr durch als irgendwo sonst. Chicago ist eine riesengroße Hafenstadt, wo alles Mögliche für den Weitertransport verladen wird – per Schiff, Eisenbahn oder LKW. Das bedeutet, dass es viele Wege in und aus der Stadt gibt und dass hier viele Reisende durchkommen. Das macht es schwieriger für Spione des Roten Hofes, uns zu entdecken.« Er lächelte mich finster an. »Irgendwie macht es den Anschein, als sei Chicago der Gesundheit aller Vampire äußerst abträglich, die sich in die Stadt wagen.«
»Das ist eine ziemlich gute Vertuschungsgeschichte«, grummelte ich. »Was steckt wirklich dahinter?«
Ebenezar seufzte und hob beschwichtigend die Hand. »Es war nicht meine Idee.«
Ich betrachtete ihn eine Weile und sagte dann: »Der Merlin hat das Treffen hier einberufen.«
Ebenezar nickte und zog eine struppige graue Augenbraue hoch.
»Er wollte auf diese Weise zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und mir eine Nachricht zukommen lassen.«
Ebenezar nickte erneut. »Er wollte dich eigentlich deines Amtes entheben, doch Luccio ist wieder die Kommandantin der Hüter, auch wenn Morgan jetzt im Feld die Befehlsgewalt hat. Sie hat sich schützend vor dich gestellt, und der Rest des Ältestenrates hat ihn überstimmt.«
»Wette, das ging ihm runter wie Öl«, ätzte ich.
Ebenezar lachte leise. »Ich hatte schon Angst, er würde einen Schlaganfall erleiden.«
»O Freude«, seufzte ich. »Eigentlich wollte ich dieses Amt überhaupt nicht.«
»Ich weiß, oft hat das Leben nur Mühsal zu bieten, Junge.«
»Also glaubt der Merlin, er zeigt mir eine Enthauptung und jagt mir damit eine solche Angst ein, dass ich daraufhin irgendeinen Blödsinn veranstalte.« Ich überlegte mit gerunzelter Stirn. »Ich nehme mal an, dass es in Hinsicht auf den Angriff letztes Jahr auch nichts wirklich Neues gibt. Ihr habt niemanden gefunden, der plötzlich eine unerklärliche Summe auf dem Konto hatte?«
»Noch nicht«, gab Ebenezar zu.
»Also haben wir einen Verräter, und das Einzige, was der Merlin tun muss, ist abwarten, bis ich Mist baue. Dann bin ich plötzlich der Verräter, und er kann mich zerquetschen.«
Ich sah die Warnung in Ebenezars Augen. »Er ist felsenfest davon überzeugt, dass du für den Rat eine Bedrohung darstellst. Wenn dein Verhalten ihn in diesem Glauben bestärkt, wird er tun, was er für nötig hält, um dich aufzuhalten.«
Ich schnaubte. »Da gab es doch schon einmal so einen Typen. McCarthy. Wenn der Merlin tatsächlich so versessen darauf ist, einen Verräter zu finden, wird er einen finden, egal, ob der nun existiert oder nicht.«
Ebenezar funkelte zum Merlin hinüber, und ein kehliger schottischer Akzent kroch in seine Stimme wie immer, wenn er wütend war. »Aye, und ich war der Meinung, du solltest das wissen.«
Ich nickte, doch ich sah nicht zu ihm auf. Ich hasse es, wenn man mich zu etwas zwingt, doch es machte nicht den Anschein, als wolle Ebenezar mich in eine Ecke drängen. Er bat mich um einen Gefallen. Ich mochte mir selbst durchaus ebenso helfen wie ihm, wenn ich ihm diesen Gefallen tat, aber er würde es mir nicht heimzahlen, wenn ich die Bitte ausschlug. Das war nicht sein Stil.
Ich sah ihm in die Augen und nickte. »Gut.«
Er atmete langsam aus und erwiderte mein Nicken. In seinem Gesichtsausdruck konnte ich stillen Dank lesen. »Oh, noch was«, sagte er und gab mir einen Umschlag.
»Was ist das?«
»Das weiß ich nicht, aber der Türhüter bat mich, es dir zu geben.«
Der Türhüter. Er ist der stillste Magier des Ältestenrates, doch selbst der Merlin bringt ihm großen Respekt entgegen. Er hält sich aus den meisten politischen Grabenkämpfen im Ältestenrat heraus, aber er weiß Dinge, die er nicht wissen dürfte – mehr als die meisten Magier, will ich damit sagen –, und soweit ich es beurteilen konnte, hatte er mir nie etwas anderes aufgetischt als die Wahrheit.
Ich öffnete den Umschlag. Darin war ein einzelnes Blatt Papier, und darauf stand in präziser, flüssiger Handschrift:
Dresden,
in den letzen zehn Tagen kam es wiederholt zu Akten Schwarzer Magie in Chicago. Als ranghöchster Hüter dieser Region fällt es Ihnen zu, dies zu untersuchen und die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Meiner Meinung nach ist es vonnöten, dass Sie sich dessen umgehend annehmen. Meines Wissens ist sich sonst niemand dieser Situation bewusst.
Rashid
Na toll! Noch mehr Schwarze Magie in Chicago. Wenn es nicht irgendein sabbernder psychotischer Bösewicht mit einem schwarzen Hut war, handelte es sich wahrscheinlich um ein weiteres Kind wie den Jungen, der ein paar Minuten zuvor gestorben war. Dazwischen gab es nicht viel. Ich hoffte sehr auf einen mordlüsternen Irren, denn mit denen kannte ich mich aus. Was die andere Möglichkeit betraf … Ich fürchtete, damit würde ich nicht fertigwerden.
Ich schob den Brief in den Umschlag zurück und dachte nach. Die Sache war also eine Angelegenheit zwischen dem Türhüter und mir. Er hatte mich nicht in aller Öffentlichkeit angesprochen oder Ebenezar eingeweiht, was bedeutete, es stand mir frei, wie ich vorging. Hätte der Merlin davon gewusst und mir den Auftrag offiziell erteilt, hätte ich wenig freie Hand gehabt, und er hätte jeden Schritt, den ich unternahm, argwöhnisch beobachten lassen.
Der Türhüter aber traute mir zu, dass ich die Sache allein und auf meine Weise regeln würde. Das war fast noch schlimmer.
Mann!
Manchmal war ich es ganz schön leid, der Typ zu sein, von dem man erwartet, dass er mit allen Situationen klarkommt, an die sich sonst niemand heranwagt.
Ich sah auf und bemerkte, dass mich Ebenezar mit zusammengekniffenen Augen musterte, was sein Gesicht in ein Wirrwarr aus Runzeln und Falten verwandelte.
»Was?«, fragte ich.
»Hast du einen neuen Haarschnitt?«
»Äh, nein, das nicht. Warum?«
»Du siehst …«, die Stimme des alten Magiers klang nachdenklich, »… anders aus.«
Mein Herz raste. Ich hatte bisher gedacht, dass Ebenezar nichts von der Entität ahnte, die sich in den unbenutzten Regionen meines Gehirns eingenistet hatte. Doch Ebenezar McCoy hatte weit mehr drauf, als ihm selbst der Rat zugestehen wollte. Es war also möglich, dass er etwas von der Präsenz des gefallenen Engels in mir spürte.
»Na ja, ich trage schon einige Zeit den Umhang jener Leute, die ich einen Großteil meines erwachsenen Lebens verachtet habe«, meinte ich. »Einmal abgesehen davon und dass ich ein Krüppel bin, habe ich fast ein ganzes Jahr kaum Schlaf bekommen.«
»Das kann natürlich der Grund sein«, meinte Ebenezar. »Wie geht’s deiner Hand?«
Ich verkniff mir die unwirsche Antwort, dass sie immer noch verstümmelt und vernarbt war und aussah wie ein übel zerschmolzener Teil einer Wachsfigur. Ein paar Jahre zuvor hatte ich mich mit einem bösen Miststück mit verdammt viel Grips angelegt, der herausbekommen hatte, wie man meine defensiven Zauber umgehen kann, die eigentlich kinetische Energie von mir abhalten, nur leider keine Hitze. So hatten einige seiner psychotischen Schergen improvisiertes Napalm nach mir geworfen. Mein Schild hatte zwar das brennende Gel abgefangen, aber die Hitze war dennoch hindurchgesickert und hatte mir die Hand gegrillt, die ich ausgestreckt hatte, um die Energie für den Schild zu bündeln.
Ich hob die behandschuhte Linke und wackelte mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Die anderen Finger zuckten nur, weil ihre Nachbarn sie mitzogen. »Nicht viel Gefühl darin, aber ich kann ein Bier halten. Oder ein Lenkrad. Ein Arzt zwingt mich, Gitarre zu spielen, um sie mehr zu bewegen.«
»Gut«, sagte Ebenezar. »Übung ist gut für den Körper, und Musik ist gut für die Seele.«
»Nicht so, wie ich spiele.«
Ebenezar grinste, dann zog er eine Taschenuhr aus der Vordertasche seiner Latzhose und warf einen Blick darauf. »Mittag«, stellte er fest. »Hast du Hunger?«
Auch wenn ich es aus seinem Tonfall nicht heraushörte, ich konnte bei Ebenezar McCoy zwischen den Zeilen lesen.
Er war in einer Zeit, in der ich dringend Unterweisung brauchte, mein Lehrer gewesen. Er hatte mir alles beigebracht, was ich für wichtig genug gehalten hatte, es mir zu merken. Er war immer zuverlässig, großzügig, geduldig, loyal und freundlich zu mir gewesen.
Aber er hatte mich auch die gesamte Zeit über belogen und selbst die Prinzipien missachtet, die er mich gelehrt hatte. Einerseits hatte er mir beigebracht, was es bedeutete, Magier zu sein, dass die Zauberkraft eines Magiers seinen tiefsten Glaubensgrundsätzen entsprang und dass es weit mehr als ein Verbrechen war, damit Böses zu bewirken. Es war eine Verhöhnung des Wesens der Magie. Es war ein Frevel.
Andererseits war er aber auch im Geheimen der Auftragskiller des Weißen Rates gewesen und war es noch, ein Magier mit der Lizenz, zu töten, der die Gesetze der Magie brechen durfte. Im Namen der politischen Notwendigkeit hatte er all das in den Schmutz gezogen, was an seiner Macht gut und ehrenwert war, und das ziemlich oft.
Ich hatte Ebenezar vertraut, wie ich noch nie jemandem vertraut hatte. Ich hatte mein Leben auf dem Fundament dessen aufgebaut, was er mich über Magie und über Richtig und Falsch gelehrt hatte. Doch wie sehr hatte er mich enttäuscht! Er hatte eine Lüge gelebt, und es war äußerst schmerzhaft für mich gewesen, ebendies herauszufinden. Selbst zwei Jahre später fühlte ich mich bei dem Gedanken daran auf ekelerregende Art unwohl.
Mein Mentor bot mir die Friedenspfeife und versuchte, die Dinge, die zwischen uns standen, auszuräumen. Mir war durchaus bewusst, dass auch er nur ein Mensch war, fehlbar wie alle anderen, und ich wusste ebenso, dass ich über diesen Dingen hätte stehen und neue Brücken hätte schlagen sollen. Das hätte Mitgefühl und Verantwortung gezeigt. Es wäre das Richtige gewesen.
Aber ich konnte es nicht. Es schmerzte immer noch zu sehr, als dass ich klar darüber hätte nachdenken können.
Ich sah zu ihm auf. »Wenn mir jemand durch eine formelle Enthauptung eine Todesdrohung zukommen lässt, verdirbt mir das immer irgendwie den Appetit.«
Er nickte, nahm die Ausrede mit einem geduldigen, gelassenen Ausdruck zur Kenntnis, auch wenn ich Bedauern in seinen Augen erkennen konnte. Er hob seine Hand zu einem stummen Winken, wandte sich ab und ging zu seinem zerbeulten alten Ford Pick-up.
Gedanken brandeten in mir hoch. Vielleicht sollte ich etwas sagen. Vielleicht sollte ich mit dem Alten doch einen Happen essen gehen.
Andererseits entsprach meine Ausrede durchaus der Wahrheit. Ich würde kaum etwas hinunterbekommen. Ich spürte immer noch, wie die heißen Blutstropfen auf mein Gesicht gespritzt waren, sah, wie unnatürlich verdreht der Körper in der Blutlache lag. Ich schloss die Augen, um diese bluttriefenden Erinnerungen aus dem Rampenlicht meiner Gedanken zu zwingen. Dann stieg ich in mein Auto und versuchte, sie ganz hinter mir zu lassen.
Der Käfer hat nicht besonders viele PS, doch er schleuderte eine ganz schön ansehnliche Menge Kies in die Luft, als ich losbrauste.
Ermittlungen bei den Feen. Na toll, das würde unter Garantie verdammt kompliziert werden. Wenn es etwas gab, das Feen wie die Pest hassten, dann klare Ansagen, egal, worum es ging. Zu versuchen, von ihnen eine eindeutige, verständliche Antwort zu erhalten, ist wie Zähne ziehen. Und zwar die eigenen. Durch ein Nasenloch.
Aber Ebenezar hatte recht. Ich war höchstwahrscheinlich das einzige Ratsmitglied, das Sidhe sowohl am Sommer- als auch am Winterhof kannte. Wenn jemand im Rat etwas herausfinden konnte, dann ich.
Um die ganze Chose noch spannender zu machen, musste ich die Quelle nicht näher definierter Schwarzer Magie in Chicago aufspüren und diesem Treiben ein Ende setzen. Genau das taten Hüter, wenn sie nicht gerade in einem Krieg verwickelt waren, und ich selbst hatte es auch schon das eine oder andere Mal getan, auch wenn es nie eine erfreuliche Angelegenheit gewesen war. Schwarze Magie bedeutete Schwarzmagier der einen oder anderen Sorte, und die tendierten dazu, einen anderen Magier, der sie bei der Ausübung ihrer Schandtaten störte, um die Ecke zu bringen.
Feen.
Schwarze Magie.
Ein Unglück kommt selten allein.
3. Kapitel
Von einem Herzschlag auf den anderen war der vorher leere Beifahrersitz meines Käfers plötzlich besetzt. Ich schrie erschrocken auf und hätte fast einen Lieferwagen touchiert. Die Reifen quietschten protestierend, und ich kam ins Schleudern, stemmte mich dagegen und bekam den Wagen wieder unter Kontrolle. Mein Herz raste, doch ich schaffte es, die Fahrt einigermaßen zivilisiert fortzusetzen, und wandte mich zur Seite, um meine neue Beifahrerin wütend anzufunkeln.
Lasciel alias die Verführerin alias die Netzweberin, anscheinend eine Art Fotokopie der Persönlichkeit eines gefallenen Engels, saß auf dem Beifahrersitz. Sie konnte jede Gestalt annehmen, die ihr in den Sinn kam, aber normalerweise erschien sie als hochgewachsene flotte Blondine in einer griechischen Tunika, die ihr bis zu den Knien reichte.
Sie saß mit den Händen im Schoß da und starrte mit der Andeutung eines Lächelns durch die Windschutzscheibe des Wagens nach vorn.
»Was, zur Hölle, glaubst du eigentlich, tust du hier?«, fauchte ich sie an. »Versuchst du, mich umzubringen?«
»Jetzt benimm dich nicht wie ein Baby«, antwortete sie mit einem amüsierten Unterton in der Stimme. »Niemandem ist etwas passiert.«
»Das verdanken wir sicher nicht dir«, knurrte ich. »Schnall dich an!«
Sie sah mich diskret gelangweilt an. »Sterblicher, ich besitze keine körperliche Gestalt. Ich existiere nur in deinen Gedanken. Ich bin ein geistiges Abbild. Eine Illusion. Ein Hologramm, das nur du sehen kannst. Es besteht nicht der geringste Grund, einen Sicherheitsgurt anzulegen.«
»Es geht ums Prinzip«, behauptete ich. »Mein Auto, mein Gehirn, meine Regeln. Schnall dich verdammt noch mal an oder verschwinde!«
Sie seufzte tief. »Na gut.« Sie zog den Gurt nach vorn um die Taille und ließ den Verschluss einrasten. Ich wusste, dass sie nie nach dem wirklichen stofflichen Gurt hätte greifen können, um das zu tun, also war auch das eine Illusion, aber eine ganz schön überzeugende. Ich würde mich ziemlich anstrengen müssen, um zu bemerken, dass sich der tatsächliche Sicherheitsgurt keinen Millimeter bewegt hatte.
Lasciel sah mich an. »Zufrieden?«
»Geht so«, sagte ich. Lasciel, wie sie mir soeben erschienen war, war Teil eines tatsächlichen gefallenen Engels. Der wahrhaftige Engel war innerhalb eines Denars gefangen, einer römischen Silbermünze, die ich unter einem guten Meter Beton in meinem Keller vergraben hatte. Als ich die Münze berührt hatte, hatte ich der Persönlichkeit des Dämons einen gewissen Ausweg geschaffen – verkörpert durch das eigenständige Gedankenkonstrukt, das nun in meinem Kopf hauste, wahrscheinlich in den neunzig Prozent des Gehirns, die wir Menschen angeblich nicht nutzen. Na ja, in meinem Fall wohl eher fünfundneunzig. Lasciel konnte mir erscheinen, konnte sehen, was ich sah, fühlen, was ich fühlte, zu einem gewissen Grad meine Erinnerungen durchstöbern, und – was am verstörendsten war – sie konnte Illusionen erschaffen, die ich nur mit größter Mühe zu durchschauen vermochte. Genau wie sie gerade die Illusion ihrer körperlichen Präsenz in meinem Auto erschuf. Eine äußerst anziehende, attraktive und absolut reizende Präsenz.
Das Miststück.
»Ich war eigentlich der Meinung, wir hätten uns geeinigt«, fauchte ich. »Ich will nicht, dass du einfach angetrabt kommst, außer wenn ich dich rufe.«
»Ich habe dieses Übereinkommen auch bisher brav respektiert«, antwortete sie. »Ich bin nur gekommen, um dich daran zu erinnern, dass dir meine Dienste und Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn du sie brauchst, und dass mein vollständiges Ich, das im Moment unter dem Boden deines Labors ruht, genauso bereit ist, dir zu helfen.«
»Du tust gerade so, als hätte ich mir gewünscht, dass du da bist. Wenn ich wüsste, wie ich dich aus meinen Gedanken löschen kann, ohne mich dabei umzubringen, würde ich das tun – und zwar ohne mit der Wimper zu zucken.«
»Der Teil von mir, der sich mit dir deine Gedanken teilt, ist nur ein Schatten meines wahren Ichs«, erklärte Lasciel. »Aber, Sterblicher, ich bin, ich existiere, und mir ist sehr daran gelegen, dass das so bleibt.«
»Wie gesagt, wenn ich es könnte, ohne dabei selbst ins Gras zu beißen …«, knurrte ich. »Bis dahin geh mir aus den Augen, außer du bestehst darauf, dass ich dich in einem Abstellkämmerchen in meinem Gehirn ankette.«
Ihre Mundwinkel zuckten, vielleicht war es Ärger, doch ich konnte in ihrem Gesicht nichts lesen. »Wie du willst«, meinte sie und legte den Kopf schief. »Aber wenn Schwarze Magie in Chicago tatsächlich einmal mehr im Kommen ist, kann es sein, dass du jedes Werkzeug brauchen wirst. Und da du überleben musst, damit auch ich am Leben bleibe, habe ich allen Grund, dir zu helfen.«
»Ein schwarzes Schächtelchen«, sagte ich. »Ohne Löcher im Deckel. Die riecht wie ein Umkleideraum in einer Highschool.«
Sie schürzte die Lippen, ein Ausdruck wachsamer Belustigung. »Wie du willst, mein Gastgeber.«
Damit war sie verschwunden, hatte sich in die finstersten Gewölbe meines Gedankengebäudes oder wohin auch immer zurückgezogen.
Ich stellte sicher, dass meine Gedanken so gut wie möglich abgeschirmt und vor ihrer Neugierde geschützt waren. Es lag nicht in meiner Macht, zu verhindern, dass Lasciel mitbekam, was ich hörte oder sah, oder dass sie wild in meinen Erinnerungen herumstöberte, doch ich hatte gelernt, wenigstens meine augenblicklichen Gedanken vor ihr zu verbergen. Das tat ich ständig, um zu verhindern, dass sie zu schnell zu viel über mich erfuhr, denn das hätte ihr geholfen, ihr Ziel zu erreichen – mich zu überzeugen, die antike Silbermünze auszugraben, die, geschützt durch Sprüche und Beton, unter meinem Labor in der Erde schlummerte.
In dieser Münze, einem römischen Denar – einem aus einer Sammlung von insgesamt dreißig – hauste das gesamte Wesen des gefallenen Engels Lasciel. Wenn ich mich entschloss, mich mit ihr zu verbünden, stünde mir beträchtliche Macht zur Verfügung. Die Macht und das Wissen eines gefallenen Engels konnte einen Menschen in eine tödliche und so gut wie unüberwindliche Bedrohung verwandeln – zum Diskontpreis der eigenen Seele. Wenn man einmal bei einem der Engel der Hölle unterschrieben hatte, war man nicht mehr der Kapitän am eigenen Steuerrad. Je mehr man zuließ, dass sie einem halfen, desto mehr gab man ihnen gegenüber den eigenen Willen auf, und schon traf der gefallene Engel die Entscheidungen.
Ich hatte mir die Münze, einen Herzschlag bevor das Kind eines Freundes danach hatte greifen können, geschnappt, und schon diese Berührung hatte gereicht, einen Teil von Lasciels Persönlichkeit in meinen Kopf zu pflanzen. Sie hatte mir im vergangenen Herbst geholfen, ein paar echt miese Tage zu überstehen, und ihre Unterstützung war wirklich unschätzbar gewesen. Aber genau da lag das Problem. Ich durfte ihre Hilfe nicht noch einmal annehmen, denn früher oder später würde ich mich daran gewöhnen, und irgendwann würde es mir gar nicht mehr wie eine blöde Idee vorkommen, die Münze in meinem Keller auszubuddeln.
Das wiederum bedeutete, dass ich den Vorschlägen des gefallenen Engels gegenüber ständig auf der Hut sein musste. Auch wenn der Preis nicht genannt wurde, er war einfach zu hoch.
Lasciel hatte aber in einem recht: Wenn tatsächlich Schwarze Magie im Spiel war, begab ich mich in größte Gefahr. Es war gut möglich, dass ich tatsächlich Hilfe benötigen würde.
Ich dachte an die, die in der Vergangenheit an meiner Seite gekämpft hatten. Ich dachte an meinen Freund Michael, dessen Kind nach der Münze gegriffen hatte. Ich hatte ihn seither nicht mehr gesehen. Er hatte sich ein paar Mal bei mir gemeldet, hatte mich zum Thanksgiving einladen wollen und gefragt, ob es mir gut ginge. Doch ich hatte jede Einladung ausgeschlagen und alle Telefongespräche so kurz wie möglich gehalten.
Michael wusste nicht, dass ich den Denar in meinen Besitz hatte, die unter Umständen einen Ritter des Schwarzen Denarius aus mir machen konnte. Ich hatte bereits mit mehreren dieser Denarier die Klingen gekreuzt und sogar einen von ihnen getötet. Sie waren Ungeheuer der übelsten Sorte, und Michael wiederum war ein Ritter des Kreuzes und einer von drei Menschen auf der Welt, die auserwählt waren, ein heiliges Schwert zu führen. Und damit meine ich ein waschechtes heiliges Schwert. In jeder dieser Waffen war der Legende nach ein Nagel des Kreuzes Christi in die Klinge eingearbeitet. Michael bekämpfte die Dunkelheit, rettete Unschuldige vor den Klauen der Hölle und stellte sich den düstersten Kreaturen entgegen, ohne mit der Wimper zu zucken, so stark war sein Glaube, dass Gott ihm die Kraft verlieh, die Finsternis zu überwinden.
Im Gegensatz zu ihm waren seine Feinde, die Denarier, machthungrige Psychopathen, die ebenso entschlossen waren, Leid und Trauer zu verbreiten, wie Michael sich bemühte, ebendiese einzudämmen.
Ich hatte ihm nie von der Münze erzählt, denn ich wollte nicht, dass er erfuhr, dass ich mein Hirn mit einem Dämon teilte. Ich wollte nicht, dass er schlecht von mir dachte. Einen Großteil meines Erwachsenendaseins war der Weiße Rat überzeugt davon gewesen, ich wäre eine Art Monster, das nur auf die Gelegenheit wartete, sich in seine wahre Gestalt zu verwandeln und alles um es herum in Schutt und Asche zu legen. Aber Michael hatte von dem Zeitpunkt an, an dem wir uns zum ersten Mal getroffen hatten, immer unerschütterlich auf meiner Seite gestanden. Seine bedingungslose Unterstützung hatte mir mehr als einmal den Hintern gerettet. Ich wollte nicht in seinen Augen auf eine Stufe mit den Denariern herabsinken. Also würde ich ihn auch nicht um Hilfe bitten, bis ich Lasciels blöde geistige Sockenpuppe wieder los war.
Ich würde mich alleine darum kümmern.
Ich war ziemlich sicher, dass der Tag nicht viel schlimmer werden konnte.
Doch kaum war mir dieser Gedanke durch den Kopf geschossen, erklang ein lautes Knirschen, und mein Schädel knallte gegen die Kopfstütze des Fahrersitzes. Der Käfer erzitterte, schlingerte wild.
Man sollte wirklich meinen, dass ich es allmählich besser wüsste.
4. Kapitel
Ich schaffte es, einen hektischen Blick über die Schulter zu werfen, und konnte ein wahres Schlachtschiff von Chrysler erspähen, dunkelgrau und mit getönten Scheiben, bevor das Auto erneut in den Käfer krachte und ihm einen geradezu mörderischen Drall verpasste. Mein Kopf flog zur Seite, knallte gegen das Fenster, und ich konnte die qualmenden Reifen fast riechen, als diese gleichzeitig nach vorn und zur Seite schlitterten. Ich spürte, wie der VW gegen den Randstein prallte und dann leicht nach oben ruckte. Ich riss das Lenkrad herum und trat auf die Bremse, als mein Körper auf Dinge reagierte, denen mein betäubtes Gehirn immer noch hinterherhechelte. Ich glaube, mir gelang es, zu verhindern, dass die Angelegenheit ein totales Fiasko wurde, da ich in einem spitzen Winkel gegen eine Mauer donnerte, statt in den entgegenkommenden Verkehr zu knallen. Jedenfalls schaffte ich es, die Beifahrerseite des Käfers gegen das Gebäude an der Straße zu rammen. Backsteine schmirgelten über Blech, bis ich etwa zwanzig Meter weiter zum Stehen kam.
Vor meinen Augen flirrten Sternchen, die ich beiseitezuwedeln versuchte, um einen Blick auf das Nummernschild des Chryslers zu erhaschen – doch der war bereits verschwunden. Zumindest glaubte ich das.
Wenn ich ehrlich bin, brummte mir so der Schädel, dass mir einfach nur dazusitzen wie eine echt gute Idee erschien, also saß ich einfach nur da. Nach einiger Zeit beschlich mich der vage Verdacht, ich sollte eventuell doch sicherstellen, dass niemandem etwas passiert war. Ich sah mich um. Kein Blut, was immer positiv ist. Ich blickte benommen rund um das Auto. Keine Leichen im Rückspiegel, nichts brannte. Auf der Beifahrerseite war überall zerborstenes Sicherheitsglas, doch die Rückscheibe hatte ich schon vor einiger Zeit durch eine durchsichtige Plastikplane ersetzt.
Der Käfer, wackerer Streiter gegen die Mächte des Bösen, tuckerte weiter vor sich hin, auch wenn sich in das Motorengeräusch im Gegensatz zu seinem üblichen griesgrämigen Pfeifen ein stöhnendes Pfeifen gemischt hatte. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Sie ging nicht auf. Ich kurbelte das Fenster herunter und hievte mich hindurch. Wenn ich jetzt noch die Energie aufbringen konnte, cool über die Motorhaube zu rutschen, ehe ich wieder einstieg, stand einer Bewerbung für »Ein Duke kommt selten allein« nichts mehr im Wege.
»Hier im Hazzard Country«, nuschelte ich in meinen nicht vorhandenen Bart, »mögen wir keine vorsätzlichen Unfälle mit Fahrerflucht!«
Es dauerte keine Ahnung wie viele Minuten, bis sich der erste Cop blicken ließ, ein Streifenpolizist namens Grayson, den ich kannte. Grayson war ein älterer Polizist, ein Hüne mit einer großen roten Nase und einem gemütlichen Bierbauch, der aussah, als könnte er randalierende Besoffene nach Belieben vermöbeln oder unter den Tisch saufen, je nachdem, wonach ihm gerade der Sinn stand. Er stieg aus seinem Wagen und begann mir besorgt Fragen zu stellen. Ich antwortete, so gut ich dazu in der Lage war, aber irgendein Kabel zwischen meinem Gehirn und meinem Mund war wohl beim Autocrash durchtrennt worden, und ich bemerkte, wie er mich genau musterte und dann das Innere des Käfers nach offenen Dosen oder Flaschen absuchte, bevor er mich anwies, mich hinzusetzen, während er den Verkehr regelte. Ich setzte mich auf den Randstein, was mir ganz recht war, und sah zu, wie sich der Gehsteig fröhlich drehte, bis mich jemand an der Schulter berührte.
Karrin Murphy war die Leiterin der Sondereinheit der Polizei von Chicago. Sie sieht aus wie die typische süße Teenagerschwester aus dem Fernsehen, ist eine Haaresbreite größer als eins fünfzig, hat hellblondes Haar, blaue Augen, ein Stupsnäschen und beinahe unsichtbare Sommersprossen. Sie besteht fast ganz aus drahtigen Muskeln und hat den Körper einer Leichtathletin. An diesem Tag trug sie ein weißes Baumwollhemd und Jeans sowie eine verspiegelte Sonnenbrille im Gesicht.
»Harry?«, fragte sie. »Sind Sie in Ordnung?«
»Onkel Jesse wird furchtbar enttäuscht sein, dass Boss Hoggs Gauner den General Lee so zerbeult haben«, schniefte ich und zeigte auf mein Auto.
Sie starrte mich einen Augenblick lang an und sagte dann: »Wissen Sie, dass Sie eine ganz schöne Beule auf der einen Seite Ihres Kopfes haben?«
Ich tastete mit einem Finger danach. »Hab ich?«
Murphy seufzte und schob sanft meinen Finger weg. »Jetzt mal im Ernst. Wenn Sie dermaßen durcheinander sind, dass Sie nicht mal mit mir reden können, muss ich Sie in ein Krankenhaus bringen.«
»Tut mir leid«, seufzte ich. »War ein langer Tag, und ich hab mir ziemlich den Schädel angedonnert. In einer Minute bin ich wieder klar.«
Sie atmete aus, nickte und ließ sich neben mir auf dem Randstein nieder. »Macht es Ihnen was aus, wenn ich einen der Rettungssanis bitte, sich Sie mal anzusehen? Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen?«
»Zu gefährlich«, widersprach ich. »Die wollen mich sicher ins Krankenhaus schleifen, und dort könnte ich das Lebenserhaltungssystem eines armen Teufels aus Versehen kurzschließen.«
»Na gut«, sagte sie ruhig, »raus mit der Sprache. Was ist passiert?«
»Jemand in einem dunkelgrauen Chrysler hat versucht, auf meiner Rückbank einzuparken.« Ärgerlich wedelte ich mit der Hand, als sie den Mund öffnete. »Nein, ich habe das Nummernschild nicht sehen können. Ich war zu beschäftigt damit, mir die Karriereoptionen als Crashtest-Dummy durch den Kopf gehen zu lassen.«
»Den Schnupperkurs haben Sie hinter sich«, meinte sie. »Stecken Sie wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten?«
»Noch nicht«, klagte ich. »Bei den Toren der Hölle, Murphy! Vor einer verdammten halben Stunde hat man mich informiert, dass irgendwo in Chicago die metaphysische Kacke am Dampfen ist. Ich hatte noch nicht mal Zeit, auch nur damit anzufangen, mir das Ganze anzusehen, und schon versucht jemand, aus mir einen Werbestar für Sicherheitsgurte und Airbags zu machen.«
»Sind Sie sicher, dass es Absicht war?«
»Uneingeschränkt. Aber wer auch dahintersteckt, es war kein Profi.«
»Warum?«
»Ich hatte nicht die geringste Ahnung, dass er da war, bis er in mich reingedonnert ist. Er hätte mich einfach in den Gegenverkehr drängen können, dann hätte ich eine Chance mehr gehabt.«
»Gelegenheitsangriff«, murmelte Murphy.
»Wasndas?«
Sie grinste flüchtig. »Wenn man die Gelegenheit nicht erwartet, sie sich einem aber trotzdem bietet und man beschließt, sie zu ergreifen und nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.«
»Oh. Ja, wahrscheinlich.«
Murphy schüttelte den Kopf. »Vielleicht ist es ja wirklich besser, wenn ich Sie zum Arzt bringe.«
»Nein«, sagte ich. »Wirklich, mir geht’s gut. Aber ich will so schnell wie möglich von hier verschwinden.«
Murphy atmete langsam ein und nickte. »Ich werde Sie nach Hause bringen.«
»Danke.«
Grayson kam zu uns herüber. »Der Abschleppwagen ist auf dem Weg«, informierte er Murphy. »Was haben wir denn?«
»Unfall mit Fahrerflucht.«
Grayson zog seine Brauen hoch und musterte mich eindringlich. »Ja? Sieht eher so aus, als hätte der ihn mehr als einmal erwischt. Wie mit Absicht.«
»Soweit ich das beurteilen kann, war’s ein Unfall«, versicherte ich.
Grayson nickte. »Da sind noch Klamotten auf Ihrem Rücksitz. Sieht aus, als wäre Blut darauf.«
»Überbleibsel vom letzten Halloween«, sagte ich. »Das ist Kostümkram. Ein Umhang, Roben und so Zeug. Vollkommen besudelt mit Kunstblut. Sah total abgeschmackt aus.«
Grayson schnaubte. »Sie sind noch schlimmer als mein Sohn. Er hat immer noch sein Football-Trikot vom letzten Herbst auf dem Rücksitz.«
»Aber er fährt höchstwahrscheinlich ein besseres Auto.« Ich blickte zum Käfer. Mein Wagen war ziemlich geschrottet, und ich zuckte bei seinem Anblick leicht zusammen. Es handelte sich bei dem Käfer nicht um eine kostbare Antiquität, aber er war mein Auto. Ich fuhr mit ihm herum. Ich mochte ihn. »Ich bin sogar sicher, dass er ein besseres Auto hat.«
Grayson kicherte verschmitzt. »Ich muss ein paar Formulare ausfüllen. Sind Sie in der Lage, mir zu helfen?«
»Aber klar.«
»Danke für den Anruf, Sergeant«, sagte Murphy.
»De nada«, antwortete Grayson und tippte sich mit einem Finger an den Schirm seiner Mütze. »Ich besorg die Formulare, sobald der Abschleppwagen hier ist, Dresden.«
»Cool«, antwortete ich.
Grayson verzog sich, und Murphy starrte mich für einen Augenblick kühl an.
»Was?«, fragte ich leise.
»Sie haben ihn angelogen«, antwortete sie. »Was die Robe und das Blut anbelangt.«
Ich zuckte mit einer Schulter.
»Sie haben verdammt geschickt gelogen. Ich meine, ich wusste überhaupt nicht …« Sie schüttelte den Kopf. »Es überrascht mich. Das ist alles. Sie waren immer ein absolut erbärmlicher Lügner.«
»Äh …«, entgegnete ich schlagfertig. Ich war nicht sicher, wie ich das auffassen sollte. »Danke?«
»Was steckt wirklich dahinter?«
»Nicht hier«, sagte ich. »Lassen Sie uns später reden.«
Murphy musterte mich für eine Weile, um mich dann noch fürsorglicher anzusehen. »Harry, was ist passiert?«
Das Bild des schlaffen, kopflosen Körpers des namenlosen jungen Mannes kam mir wieder in den Sinn. Zu viele Emotionen brandeten dabei in mir hoch, bis mein Hals so zugeschnürt war, dass ich kein Wort mehr über die Lippen hätte bringen können. Also schüttelte ich andeutungsweise den Kopf und zuckte die Achseln.
Sie nickte. »Kommen Sie klar?«
Ich bemerkte eine seltsame Sanftheit in ihrer Stimme. Wegen ihrer Arbeit bei der Sondereinheit der Polizei von Chicago umgab sich Murphy stets mit einer Aura knallharter Zähigkeit, die sie fast so beeindruckend erscheinen ließ, wie sie tatsächlich war. Diese Fassade blieb so gut wie immer gleich, zumindest in der Öffentlichkeit und wenn andere Gesetzeshüter in der Nähe waren. Aber nun machte ich eine leise, definitive Verletzlichkeit in ihrer Stimme aus, derer sie sich nicht schämte.
Wir hatten in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten gehabt, doch Murphy war eine verdammt gute Freundin. Ich bedachte sie mit meinem freundlichsten schiefen Lächeln. »Ich komme immer klar. Mehr oder weniger.«
Sie streckte die Hand aus und strich mir eine Haarsträhne aus meiner Stirn. »Sie sind voll das Mädchen, Dresden. Ein kleiner Rums mit dem Auto, und schon werden Sie ganz gefühlsduselig und pathetisch.« Ihr Blick schweifte erneut zum Käfer, und in ihren Augen brannte himmelblaues Feuer. »Wissen Sie, wer das war?«
»Noch nicht«, knurrte ich in dem Augenblick, als der Abschleppwagen eintraf. »Aber Sie können Ihren Allerwertesten darauf verwetten, dass ich das herausfinden werde.«
5. Kapitel
Als wir bei mir daheim ankamen, begann mein Kopf wieder in Normalgeschwindigkeit zu arbeiten, allerdings nur um mich wissen zu lassen, wie sehr er schmerzte. Das Licht der Nachmittagssonne stach mir mit frohgemuter Bösartigkeit in die Augen, und ich war heilfroh, während ich die Stufen zu meiner Wohnung hinunterschlurfte, meine magischen Schutzzeichen entschärfte, die Tür aufschloss und mich hart dagegenwarf.
Sie öffnete sich nicht. Im vergangenen Herbst hatten Zombies meine Sicherheitstür aus Stahl in Stücke gerissen und meine Wohnung verwüstet. Auch wenn ich für mein Hüteramt immerhin ein regelmäßiges, moderates Gehalt bekam, hatte ich leider nicht ausreichend Geld für alle Reparaturen, und so hatte ich mich heldenhaft der Herausforderung gestellt, die Tür selbst wieder instand zu setzen. Ich hatte den Rahmen nicht gut hinbekommen, doch ich versuchte, die positive Seite daran zu sehen: Man konnte darüber diskutieren, ob die neue Tür nicht noch sicherer war als die alte, da sich das verdammte Ding nicht einmal dann öffnen ließ, wenn es nicht abgeschlossen war.
Während ich auf Hochtouren im Renoviermodus gelaufen war, hatte ich auch Linoleum in der Küche, Teppich in Wohnzimmer und Schlafzimmer und Fliesen im Bad verlegt, und soll ich Ihnen was verraten? Es ist nicht so einfach, wie es diese ganzen Heimwerkerbücher darstellen.
Ich musste mich mit der Schulter drei- oder viermal gegen die Tür werfen, bis sie schließlich quietschend und knarzend aufsprang.
»Ich dachte, Sie wollten das von einem Fachmann in Ordnung bringen lassen«, sagte Murphy.
»Sobald ich das Geld dafür habe.«
»Sie bekommen doch jetzt ein geregeltes Gehalt, oder nicht?«
Ich seufzte. »Ja. Aber dessen Höhe ist 1959 festgelegt worden, und seit damals hat der Rat nichts getan, um die Inflation auszugleichen. Wenn ich mich recht erinnere, wollen sie sich das in ein paar Jahren noch mal ansehen.«
»Wow, die sind ja noch lahmer als die Stadtverwaltung.«
»Schön, dass Sie alles immer positiv sehen.« Ich ging in die Wohnung und trat auf die enorme Falte, die der Teppich aus unerfindlichen Gründen vor der Eingangstür warf.
Meine Wohnung ist nicht gerade riesig. Ich verfüge zumindest über ein ziemlich geräumiges Wohnzimmer mit einer Küchenecke in einer Nische gegenüber der Eingangstür. Die Tür zu meinem Schlafzimmer und dem winzigen Badezimmer befindet sich gleich rechts, wenn man hereinkommt, und daneben ist ein Kamin aus roten Ziegeln in der Wand eingelassen. Regale, Wandteppiche und Filmposter hängen an den kalten Steinmauern. Mein Original-Krieg-der-Sterne-Poster hatte den Angriff unbeschadet überstanden, doch meine Taschenbuch-Bibliothek hatte ganz schön gelitten. Diese abscheulichen Zombies! Sobald sie fertig damit gewesen waren, miefigen Schleim zu sabbern und die Inneneinrichtung zu demolieren, hatten sie überall Eselsohren reingemacht und die Buchrücken geknickt.
Ich hatte außerdem ein Paar Second-Hand-Sofas gehabt, an die man nicht allzu schwer herankam, also war es kein großes Drama gewesen, sie zu ersetzen. Zudem standen zwei bequeme alte, angenehm speckige Sessel vor dem Kamin, und ein Couchtischchen und ein riesiger Haufen grauschwarzen Fells rundeten das Interieur ab.
Strom habe ich nicht, daher ist die Wohnung eher ein schummriges Loch, aber ein angenehm kühles schummriges Loch, und es war eine Erleichterung, endlich aus der sengenden Sonne zu kommen.
Der kleine Pelzberg schüttelte sich, und irgendetwas donnerte wiederholt gegen die Mauer neben ihm, als er sich erhob und die Umrisse eines riesigen, bulligen Hundes annahm. Er hatte graues Fell, und eine fast löwenhafte Mähne bedeckte seinen Hals, den Nacken, die Brust und die Oberseite der Schultern.
Er stapfte schnurstracks auf Murphy zu, setzte sich und bot ihr die rechte Vorderpfote an.
Murphy lachte und schüttelte kurz die Pfote – wobei ihre Finger bei Weitem nicht um die dargebotene Pranke reichten. »Hallo, Mouse.« Sie kraulte den Hund hinter den Ohren. »Wann haben Sie ihm denn das beigebracht?«
»Hab ich nicht«, sagte ich und bückte mich, um Mouse ebenfalls hinter den Ohren zu kraulen. »Wo ist Thomas?«, fragte ich den Hund.
Mouse stieß ein Niesen aus und blickte zu der geschlossenen Tür zu meinem Schlafzimmer. Ich blieb kurz stehen, um zu lauschen, und hörte das gedämpfte Gurgeln von Wasser in den Leitungen. Thomas war also unter der Dusche.