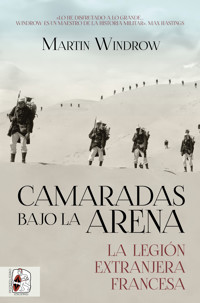Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Mumble ist noch ein flauschiges Eulenküken, als Martin Windrow sie bei sich aufnimmt. 15 Jahre lang sollten die beiden unzertrennlich bleiben. Anrührend, charmant und mit unnachahmlich britischem Humor erzählt Windrow, wie die kleine Eule seinen Alltag auf den Kopf stellt. Er berichtet von Mumbles Leidenschaft, Schnürsenkel zu jagen, von ihren lausigen Landungen nach waghalsigen Flugmanövern und ihrem großen Bedürfnis nach Streicheleinheiten. Amüsiert lässt er die Reaktionen seiner irritierten Mitmenschen Revue passieren, die aber irgendwann akzeptieren: Windrow und Mumble sind Freunde geworden. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Beziehung – die uns en passant alles über die Biologie und Mythologie der Eulen lehrt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Windrow
Die Eule, die gern aus dem Wasserhahn trank
Mein Leben mit Mumble
Aus dem Englischen von Sabine Hübner
Titel der Originalausgabe:
The Owl Who Liked Sitting on Caesar. Life With A Lovable Tawny Owl
London, Bantam Press (an imprint of Transworld Publishers) 2014
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches oder von Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren), auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – mit Ausnahme der in den §§ 53, 54 URG genannten Sonderfälle –, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Copyright © Martin Windrow 2014
Alle Rechte der deutschen Ausgabe:
© 2015 Carl Hanser Verlag München
Internet: http://www.hanser-literaturverlage.de
Herstellung: Thomas Gerhardy
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
unter Verwendung einer Fotografie von © plainpicture/Narratives
Illustrationen: Christa Hook
Datenkonvertierung E-Book: Kösel Media, Krugzell
Printed in Germany
ISBN 978-3-446-44328-0
E-Book-ISBN 978-3-446-44327-3
Inhalt
Anmerkung des Autors
Einleitung
1. Mann begegnet Eule – Mann verliert Eule – Mann begegnet der Eule seines Lebens
2. Eulen – wissenschaftliche Fakten und Volksglaube
3. Der blinde Passagier im siebten Stock
4. Das Privatleben der Waldkäuze
5. Wunderbare Mumble
6. Bedienungsanleitung für eine Eule
7. Mumbles Tag
8. Mumbles Jahr
9. Echte Bäume und Mäuse in freier Natur
10. Abschied
Danksagung
Auswahlbibliographie
Anmerkung des Autors
Den Lesern ist hoffentlich bewusst, dass im Vereinigten Königreich wie in Deutschland sämtliche Raubvogelarten sowie deren Eier und Küken strikt unter Naturschutz stehen. Sollten Sie zufällig auf ein vermeintlich „verlassenes“ Eulenjunges stoßen, geben Sie keinesfalls dem Impuls nach, es zu „retten“ und mit nach Hause zu nehmen. Greifen Sie bitte nur ein, wenn sich das Eulenjunge offensichtlich in Gefahr befindet – etwa wenn es, in Reichweite von Hunden und anderen Fressfeinden, auf dem Boden hockt. In diesem Fall sollten Sie es sanft in beide Hände nehmen und auf einen sicheren Ast setzen; dort werden es dann seine Eltern finden (sie sind meist nicht weit entfernt) – oder es klettert selbst ins Nest zurück, was ihm normalerweise keine Probleme bereiten dürfte. Dass Eulen ihre Jungen angeblich verstoßen, wenn diese „den menschlichen Geruch angenommen haben“, ist ein Mythos. Traditionell wird vermutet, dass Eulen über fast keinen Geruchssinn verfügen; doch ob dies nun zutrifft oder nicht – wenn Euleneltern ihr verirrtes Küken innerhalb von 24 Stunden wiederfinden, werden sie es weiter füttern.
Nur falls das Eulenjunge offensichtlich verletzt ist, sollten Sie es mit nach Hause nehmen. In solchen Fällen ist es wichtig, sich an eine sachkundige Person zu wenden – eine Tierärztin, einen Mitarbeiter des NABU, des Deutschen Tierschutzbundes e.V. oder noch besser an ein Vogelrettungszentrum – und zwar unverzüglich. Setzen Sie das Eulenjunge in einen Karton, der ihm genügend Platz bietet und oben offen ist.
Falls es doch nötig werden sollte, das Küken zu füttern, bevor es in qualifiziertere Hände gelangt, füttern Sie es auf keinen Fall mit Brot und Milch, denn das wäre sein sicherer Tod; Eulen sind reine Fleischfresser, deren Verdauungssystem darauf basiert, dass alle Bestandteile ihrer tierischen Beute verwertet werden. Wenn Sie ein Eulenküken füttern müssen, bieten Sie ihm kleine Klümpchen Rinderhack an (ich wiederhole: Rinderhack – es verträgt nicht alle Fleischsorten), vielleicht in Eigelb getunkt; schieben Sie ihm das Futter in den Schlund, etwa mithilfe eines abgerundeten Streichholzes. Das Küken benötigt unbedingt Raufutter, weshalb sich als Zwischenlösung anbietet, dem Hackfleisch winzige Stückchen einer weichen Feder beizumischen (selbstverständlich nur natürliche Materialien – keine Federn, die womöglich gefärbt oder sonstwie chemisch behandelt sind). Die Ernährungsvorschriften für Eulen sind jedoch komplizierter; machen Sie jemanden ausfindig, der mit der Aufzucht und Pflege von Raubvögeln Erfahrung hat, und holen Sie sich Rat – so schnell wie möglich.
Einleitung
APRIL 1981
Eine Rasur wird zur Herausforderung mit einer Eule auf der rechten Schulter. Widme ich mich der rechten Halsseite und führe das Rasiermesser nach oben, stößt Mumble mit dem Schnabel nach dem Griff, blitzschnell wie eine Schlange. Bearbeite ich die linke Halsseite, nutzt Mumble – mit ungetrübter Neugier, trotz enttäuschender Erfahrungen – die Chance, von der rechten Seite fürsorglich Seifenschaumklümpchen wegzupicken. Der Geschmack scheint ihr nicht zu behagen; nachdem sie ein paarmal nachdenklich geschmatzt hat, niest sie ein bisschen (Tsnit!), und der Schaum bleibt größtenteils an ihren Schnabelborsten hängen. Dennoch hüpft sie manchmal auf den Waschbeckenrand und betrachtet höchst interessiert den auf dem Wasser schwimmenden Rasierschaum. Es fühlt sich herrlich an, ihr Gefieder an meinem nackten Bauch zu spüren, warm und samtweich.
Ich wollte sie dazu bringen, über meinen Nacken zur linken Schulter zu wandern, wenn ich links mit Rasieren fertig bin, aber Mumble bevorzugt nun mal die rechte Schulter und ist – genau wie ich – so früh am Tag allen Neuerungen abhold. Wir laufen morgens beide auf Autopilot, und diese eingeschränkte Fähigkeit, sich in den ersten Stunden des Tages zu orientieren, verbindet uns.
Der Rasierspiegel reflektiert zwei Augenpaare – eins davon blau und gerötet, das andere glasig schwarz – nebeneinander in einem schmuddeligen Chaos aus nassem Haar, Rasierseife und Federn. In beiden Augenpaaren meine ich die vertraute morgendliche Kombination zu erkennen – Apathie und einen gewissen Argwohn, was der Tag wohl bereithalten mag: für mich unheilvolle braune Sichtfensterkuverts; für Mumble vielleicht eine lästige zerfranste Feder unter den linken Handschwingen. Weshalb sollte ich ihre Probleme vergrößern, indem ich ihr radikale Neuerungen aufzwinge, etwa die, mir beim Rasieren von der linken Schulter aus zu assistieren? Wir kriegen das hin; wir kriegen das so gut hin, dass ich oft gar nicht mehr merke, auf welch bizarre Weise ich mich in den drei Jahren unseres Zusammenlebens angepasst habe.
OKTOBER 2013
Mumble gehörte damals so sehr zu meinem Leben, dass mir das Kuriose unserer Beziehung eigentlich nur noch zu Bewusstsein kam, wenn ich erstaunte Reaktionen erntete. Manch neue Bekanntschaft trat angesichts eines Lektors, der im siebten Stock eines Hochhauses in South London mit einem Waldkauz zusammenlebte, nachdenklich den Rückzug an. Wer Exzentriker hingegen faszinierend fand, fühlte sich angesprochen – teils so sehr, dass ich zu Weihnachten und am Geburtstag jahrelang eine wahre Flut von Eulenkarten erhielt. (Anfangs fand ich das ja rührend, auf lange Sicht war es aber doch etwas ermüdend.) Andere erkundigten sich allerdings durchaus – meiner Meinung nach zuweilen ziemlich schonungslos – nach der Praktikabilität meiner häuslichen Situation. Ich versuchte zwar geduldig zu antworten, fand es aber schwer, die direkte Frage »Ja, aber … warum?« kurz und bündig zu beantworten; meine beste Antwort lautete schlicht: »Warum nicht?«
Es ist mir peinlich, wenn ich daran zurückdenke, dass ich in einer solchen Situation einmal wie ein nerviger Klugscheißer reagiert habe: »Schauen Sie – ich lebe seit zwei Jahren mit ihr zusammen. Sie kostet mich etwa 20 £ im Jahr, alles inklusive. Sie ist außerordentlich hübsch und amüsant. Sie ist anschmiegsam, ohne zu klammern, und sie duftet so gut. Es ist ihr egal, um welche Uhrzeit ich nach Hause komme, sie plappert nicht beim Frühstück, und es passiert eher selten, dass wir uns darüber streiten, wer welchen Teil der Sonntagszeitung kriegt.« Nachdem mir klargeworden war, welche Rückschlüsse derlei Phrasen auf meine Einstellung zu menschlichen Paarbeziehungen zulassen könnten, strich ich sie schnell aus meinem Gesprächsrepertoire.
Lernten die Leute Mumble dann kennen, bedurfte es meist keiner weiteren Erklärungen mehr. Was für Vorurteile sie auch immer gehegt haben mochten – kaum standen sie zum ersten Mal diesem Käuzchen gegenüber, hellten sich ihre Züge auf und wurden weich. In Mumbles erstem Jahr, als auch Fremde sie noch ohne trennendes Glas oder Drahtgeflecht betrachten konnten, ertönte dann meist ein verwunderter Ausruf (»Oh! … wie wunderschön sie ist!«), und gleichzeitig streckten die Besucher instinktiv – es sei denn, ich hatte daran gedacht, sie zu warnen – die Hand aus, um Mumble zu streicheln.
Weniger erfreulich allerdings war die Erfahrung, dass die betreffende Person, selbst wenn man sich nach Jahren wiedersah, meist spontan sagte: »Aber ja, natürlich – der Eulenmann!« Seitdem tröste ich mich mit dem Gedanken, dass es weit negativere Gründe gibt, Menschen (egal wie vage) in Erinnerung zu bleiben.
* * *
Die Mahnung in der Anmerkung des Autors, niemals impulsiv „ein verlassenes Eulenküken zu retten“, mag in einem Buch, das vom beglückenden Zusammenleben mit einer Eule handelt, heuchlerisch erscheinen; aber meine Rechtfertigung ist, dass Mumble nie in der Natur gelebt hat. Sie ist in Gefangenschaft geschlüpft, von Hand aufgezogen worden und hat nie Artgenossen kennengelernt. Ich konnte ihr besseres Futter bieten und ein wesentlich längeres, weniger gefährliches Leben, als es ihr im Wald beschieden gewesen wäre. Anfangs hatte ich gelegentlich Gewissensbisse, weil ich ihr das „Leben unter freiem Himmel“ versagte, aber schon bald erkannte ich, dass solche Empfindungen im Fall eines Käuzchens viel mit menschlicher Sentimentalität und nicht das Geringste mit der Natur zu tun haben – ein Waldkauz ist keine Feldlerche und kein Wanderfalke, er ist eine geflügelte Katze, die ein gemütliches Zuhause liebt. Die wenigen Male, wo Mumble Gelegenheit gehabt hätte, die freie Natur zu genießen, zeigte sie nicht das geringste Interesse (auch die Person, die Mumbles frühzeitigen Tod verursacht hat, mag von jenem sentimentalen Irrglauben besessen gewesen sein).
Unter anderem lag es an meiner inneren Verfassung nach jenem Ereignis, dass ich, trotz wiederholten Drängens meiner Familie, erst nach vielen Jahren dazu fähig war, all die Notizen und Fotografien auszugraben, die ich während unserer fünfzehn gemeinsamen Jahre gemacht hatte – und mich an den Versuch wagen konnte, sie in dieses Buch zu verwandeln. Seit ich die Mitte der 1990er Jahre weggelegten Notizbücher nun wiederlese, durchlebe ich von Neuem Emotionen, die ich lange Zeit verdrängt hatte – und ich bin froh, dass ich wieder Zugang zu diesen Empfindungen habe.
Vielleicht noch ein Hinweis zu dem Text, der aus diesem Prozess hervorging. Ich behaupte nicht, dass alle „Tagebuch“-Einträge in diesem Buch wortwörtlich Notizen entstammen, die zu jener Zeit entstanden sind, obwohl ich damals viele davon recht detailliert ausgearbeitet habe. Natürlich wurden einige überarbeitet oder weggelassen; alle jedoch zitieren gewissenhaft die kurz nach den Ereignissen entstandenen Aufzeichnungen oder die Gedanken, die sie enthalten.
* * *
Warum ich mich mit Mitte dreißig entschloss, mir zum ersten Mal ein Haustier anzuschaffen – dazu noch eine Eule, obwohl ich bis dahin nicht das geringste Interesse an Ornithologie verspürt hatte –, bleibt eine berechtigte Frage. Und war schon das „Warum“ verwirrend, schien auch das „Wie“ nicht gerade unkompliziert.
In Wirklichkeit war Mumble gar nicht meine erste Eule; und obwohl sie für mich zum Inbegriff und zur Ikone des „Eulenhaften“ wurde, wäre es unaufrichtig, meine erste gescheiterte Beziehung aus den Annalen zu tilgen. Wie die meisten solchen Irrtümer lehrte mich auch jenes Scheitern eine ganze Menge.
1
Mann begegnet Eule – Mann verliert Eule – Mann begegnet der Eule seines Lebens
ALLES BEGANN, wie so viele Dinge in den letzten fünfzig Jahren, mit meinem älteren Bruder Dick.
Mitte der 1970er Jahre hatte er sich seinen langgehegten Traum erfüllt, aufs Land nach Kent zu ziehen und ein möglichst altes Anwesen zu erwerben, das ihm genügend Platz bot, am Wochenende seinen diversen Hobbys nachzugehen. (Dazu zählten im Lauf der Zeit: Rallyefahren, die Reparatur von Militärfahrzeugen, Luftbildarchäologie, Schrotschießen und Falkenjagd, nicht zu vergessen Bluesgitarre und allerlei andere Freizeitbeschäftigungen, die diesem Mann mit seinen Riesenpranken präzise Fingerfertigkeit abverlangten.) Da seine Ehefrau Avril nicht nur Geduld besitzt, sondern auch ausgezeichnete praktische Fähigkeiten (vom Anfertigen feiner Handarbeiten und silbernen Schmucks über Gartenarbeit und Tierhaltung bis hin zum Betonmischen, Renovieren und Dekorieren), verwandelte sich die Water Farm schon bald in einen sehr attraktiven Aufenthaltsort, obwohl die vorherigen Bewohner Schafe gewesen waren. Zudem konnte man Dick gegenüber kaum einen Gebrauchsartikel oder eine Dienstleistung erwähnen, ohne dass sein freundliches, etwas zerbeultes Gesicht diesen nachdenklichen Ausdruck angenommen hätte: »Ah, interessant – ich kenne da zufällig jemanden, der … (… einen Panzermotor verkauft, Schaffelle trocknet, als Stuntman beim Film arbeitet, genau weiß, zu welchen Zeiten die Kaninchengehege seiner Lordschaft am Wochenende unbewacht sind, sich mit Sprengstoff auskennt, Wildschweine züchtet, Holländisch spricht, Objekte in Kunstharz gießt, einem ohne lästigen Papierkram x-beliebige Dinge besorgen kann, etc. etc.).
Damals wohnte ich in einem Hochhaus in Croydon, South London, und pendelte täglich zwischen meinem Wohnort und Covent Garden hin und her, wo ich in einem Verlag als Lektor mit militärhistorischen Werken befasst war. Unsere Großfamilie verbrachte Weihnachten meist auf der Water Farm, und da sich sowohl mein Privatleben als auch mein Berufsalltag zwischen schmutzigem Beton und Dieselabgasen abspielte, nahm ich Dicks und Avrils grenzenlose Gastfreundschaft oft auch im Sommer in Anspruch und verbrachte die Wochenenden in Kent. Die beiden unterhielten eine ganze Menagerie, im Lauf der Jahre immer wieder andere Tiere: zahllose Katzen (einschließlich einer, die mir bei der Kaninchenjagd beschämend deutlich den Rang ablief), Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Truthähne, ein paar Schafe, eine Ziege, einen Esel, eine Dexter-Aberdeen-Angus-Kuh, Shreds, die wunderbare Waldiltis-Frettchen-Kreuzung meines Neffen Stephen, und eine Zeitlang sogar einen Waschbären (voll ausgewachsen sind Waschbären wesentlich größer und kräftiger, als man gemeinhin glaubt). Ich „hatte“ es eigentlich gar nicht so mit Tieren, aber sicherlich trug dieser kleine Zoo zur Attraktivität der Water Farm bei, neben all den anderen Verlockungen – Friede, Weiträumigkeit, reine Luft und Avrils überragende Kochkünste.
Noch vor dem Umzug auf die Water Farm hatte Dick sich für Bücher über die Falkenjagd interessiert. Selbstverständlich fand er auch in diesem Bereich bald Freunde und erwarb seinen ersten Vogel – einen wunderbar glänzenden Falken namens Temudjin, nach dem jungen Dschingis Khan. Nachdem Dick die Farm gekauft hatte, baute er Käfige und Volieren, die den Vögeln genügend Bewegungsspielraum boten, und da sich sein Wissen, sein Können und sein Bekanntenkreis immer mehr vergrößerten, waren diese Unterkünfte ständig belegt. Zu den Insassen zählten Turmfalken, Bussarde, Habichte und sogar ein etwas lädierter Steppenadler, der an „Pododermatitis“ litt (nein, sagt mir auch nichts).
Ich beobachtete, wie Dick mit den Raubvögeln umging und sie ausbildete, und wurde von seiner Faszination unweigerlich angesteckt. Als ich eines Tages auch einmal einen Falken auf die behandschuhte Faust nehmen durfte, um gemeinsam mit Dick durch die Felder zu streifen, wehte mich sofort der Zauber des Mittelalters an. Ein unbeschreibliches Gefühl. Natürlich war auch Eitelkeit im Spiel: Der Mann muss erst noch geboren werden, der nicht die Pose eines Plantagenet einnimmt und lässig das Brustgefieder seines Falken streichelt, wenn hinter einer Wegbiegung eine Schar gebührend beeindruckter Spaziergänger erscheint … Aber es schmeichelte nicht nur dem Ego; für mich war das eine bisher ungekannte Art von Beziehung, die mich mit ganz neuen Empfindungen erfüllte. Sie schienen sehr tief zu sitzen und weit zurückzureichen. Es war ein langsamer Prozess, den ich mir eine ganze Weile gar nicht eingestand, doch allmählich spürte ich ganz bewusst, dass ich mit diesem Neuen auf Dauer in Verbindung bleiben wollte.
Der Gedanke, in einem Hochhausapartment in South London einen Falken zu halten, war natürlich abwegig, dennoch verfolgte mich dieser Traum. Schließlich wies mir meine Schwägerin unwissentlich den Weg. Avril hatte sich schon seit einiger Zeit einen eigenen Vogel gewünscht, aber einen, der sich problemlos in ihren Alltag als unermüdlich tätige Mutter zweier Söhne fügte. Gewissenhaft hängte Dick sich ans Telefon und rief ein paar Herren mit lustigen Spitznamen an, und eines Tages ließ sich „Wol“ in Avrils Küche nieder, wo er die meiste Zeit auf einem schattigen Ausguck hoch oben auf dem großen Küchenbuffet hockte. Avrils Küche war für zufällige Besucher ohnehin ein willkommener Hafen und gewann durch die Gegenwart des Käuzchens noch größere Anziehungskraft. (Wol saß so still, dass die meisten Leute dachten, er sei ausgestopft, bis ein gelegentliches Blinzeln die Wahrheit verriet; gelegentlich kam es dann vor, dass ein Besucher Kaffee verschüttete oder sich an einem Bissen Kuchen verschluckte.)
Wol bezauberte mich vom ersten Moment an, und als ich miterlebte, wie problemlos und unaufgeregt sich eine Eule – wenn man sie jung genug bei sich aufnimmt – an menschliche Gesellschaft gewöhnen kann, setzte ich dem nagenden Wunsch, selbst einen Vogel zu besitzen, immer weniger Widerstand entgegen.
* * *
Im Sommer 1976 baten ein Freund und ich um gastliche Aufnahme in der Water Farm, während wir auf einem nahegelegenen Flugplatz einen kurzen Fallschirmspringkurs absolvierten.
Damals verfügten Anfänger noch nicht über die moderne Fallschirmausrüstung mit ihren relativ leichten Packs, matratzenförmigen Fallschirmkappen und präziser Steuerung, die einem fast immer eine aufrechte Landeposition erlaubt. Roger und ich bekamen gezeigt, wie man Landerollen macht; ohne die ging es nicht bei den alten Irvin-Fallschirmen, deren X-Type-Gurtwerk zentnerschwer an uns hing (und uns mit der Grazie eines Kartoffelsacks zu Boden brachte).
Mein erster Sprung war ebenso schrecklich wie beglückend. Zuerst kam der bodenlose, blanke Horror, als der Motor der kleinen Cessna abgeschaltet wurde und ich hinauskletterte und zwischen Tragflächenstrebe und Fahrwerk balancierte, wobei ich Mühe hatte, im brausenden Wind den Absetzer zu verstehen, der noch einmal alle wichtigen Punkte durchging. Dann – als sich der Schirm ruckartig geöffnet hatte, das enganliegende Gurtwerk mich hielt wie Gottes Hand und von unten die Landschaft Kents zu mir emporlächelte – überflutete mich ein absolutes Hochgefühl, das sich noch verstärkte, als ich mich nach erfolgreicher Landung wieder vom Boden aufrappelte.
Zur denkwürdigsten Erfahrung jedoch geriet der dritte Sprung. Aufgrund meiner äußerst mangelhaften motorischen Fähigkeiten, die schon in meiner Schulzeit den Sportlehrern auffielen, verschätzte ich mich, während der Boden in den letzten Sekunden auf mich zuraste, bei der Landerolle total. Mit dem Hintern voran schlug ich auf und zog mir eine der klassischen (und wahnsinnig schmerzhaften) Fallschirmsportverletzungen zu – eine Kompressionsfraktur der Lendenwirbel. Der arme Roger, der den langen Strohhalm gezogen hatte und sich immer noch Hunderte Fuß über dem Sprungplatz befand, musste sich auf seine eigene Landung vorbereiten, während er mitbekam, wie ich mich laut stöhnend am Boden krümmte. Meine eindrücklichste Erinnerung der nächsten halben Stunde ist die an einen jungen Offiziersanwärter, der im Kreis der anderen um mich herumstand. Während sonst alle besorgt auf mich herunterstarrten, steckte er sich eine Zigarette in den Mund, klopfte zerstreut auf seine Taschen, murmelte seinen Kameraden etwas zu – die den Kopf schüttelten, ohne ihre ernsten Blicke von mir zu wenden –, beugte sich dann zu mir herunter und bat mich um Feuer. Da ich in Gedanken gerade mit meinem Rückgrat beschäftigt war, konnte ich ihm leider nicht damit dienen.
Im Juni 1976 stöhnte Südengland unter einer Hitzewelle, wie es sie nur alle zwanzig Jahre einmal gibt, und ich lag schweißüberströmt und völlig bewegungsunfähig in einem Klinikbett; dieses Bett stand unmittelbar unter einem großen Oberlicht, das in die niedrige Decke eines einstöckigen Seitentrakts eingelassen war. In der sengenden Sonne angepflockt wie ein Apachen-Opfer, voller Ekel vor dem ungenießbaren Klinikfraß, habe ich es zwei Personen zu verdanken, dass ich durchgehalten habe – erstens einer netten erfahrenen Nachtschwester, die ein entspanntes Verhältnis zu Pethidin-Injektionen bewies, und zweitens Dick, der mich jeden Abend auf dem Heimweg von der Arbeit getreulich besuchte und mir köstliche Sandwiches mitbrachte. Nach einer Woche in verschwitzten Laken, eingezwängt in Metallschienen, schaffte ich es schließlich, schwerfällig zu Dicks Wagen hinauszuwanken, wie Boris Karloff in Frankenstein, und wurde zur Water Farm zurückgebracht, um dort wieder auf die Beine zu kommen.
* * *
Während ich in den nächsten Wochen meine Beweglichkeit wiedererlangte, musste ich tagsüber oft stundenlang mit einem Buch auf einer Decke im Schatten liegen, oder ich wankte unbeholfen durch die Gegend. Nun hatte ich mehr Zeit denn je, Dicks Vögel zu beobachten, und entwickelte immer größeres Interesse. Nicht einmal ich schaffte es, tagelang pausenlos zu lesen, und so boten mir die Vögel willkommene Abwechslung. Jetzt, wo ich Muße hatte, sie einfach still zu betrachten und mehrmals täglich zu besuchen, nahm ich nicht mehr nur Momentaufnahmen wahr, sondern entwickelte ein Gefühl für ihren Lebensrhythmus. Indem ich ihnen bei der Gefiederpflege zusah, lernte ich ihren Körperbau genauer kennen und entdeckte ihre individuellen Besonderheiten. Ich bombardierte meinen Bruder mit Fragen über ihre Unterkünfte, ihre Ernährung, ihren Tagesablauf, ihre medizinischen und emotionalen Bedürfnisse und andere Dinge, die sicher manchmal reichlich albern waren.
Diese Gespräche setzten wir lange nach der Rückkehr in meine Wohnung in unregelmäßigen Abständen am Telefon fort. Häufig äußerte ich Zweifel an meinem Vorhaben, mich selber um einen Vogel kümmern zu wollen, und hätte Dick mir recht gegeben, wäre vermutlich nie etwas daraus geworden; aber er gehört nicht zu den Leuten, die Träume, und seien sie noch so verrückt, von vornherein für unrealistisch halten. Es dauerte nicht lange, und mir gingen die Gegenargumente aus, und dann kann der Abend, als ich tief Luft holte und Dick bat, doch bitte »diesen Bekannten anzurufen«. Vielleicht aus dem vagen Gefühl heraus, dass das Halten einer Eule womöglich zum Desaster führen könnte, welches sich bei einer kleinen Eule dann zumindest auf ein kleines Desaster beschränken würde, bat ich ihn, mir einen „Wichtel“ zu besorgen (wobei sich diese mundartliche Bezeichnung für den Steinkauz nicht auf seine Größe, sondern die Ähnlichkeit mit Kobolden bezieht).
Und so zog im Herbst 1977 ein Flaumbündel – eine 15 cm große, 120 g schwere gefiederte Furie – zu mir in den siebten Stock des riesigen Betonblocks neben der A 23 in West Croydon. Wegen seines ausgesprochen raubvogelartigen Profils, den überhängenden Brauen und den gelb glühenden Augen konnte der Vogel nur „Wellington“ heißen, nach dem Sieger von Waterloo. Leider besaß er, wie sich zeigen sollte, auch die eiserne Willenskraft des Iron Duke.
* * *
Der drosselgroße Steinkauz – Athene noctua – ist die kleinste der britischen Eulen, die als letzte Eulenspezies nach Großbritannien kam. Steinkäuze wurden erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Landbesitzern aus Kontinentaleuropa eingeführt, wegen ihres Rufs, eine wahre Heimsuchung für Mäuse und Insekten zu sein; in mehreren europäischen Ländern wird ihre Ansiedlung aktiv von Bauern gefördert, und sie stehen unter Naturschutz. Es gibt eine reizvolle Geschichte, der zufolge der erste Engländer, der sie sich zunutze gemacht haben soll, Admiral Nelson war. Nachdem man ihn ins Mittelmeer beordert hatte, soll er hundert Steinkäuze aus Nordafrika erworben und jedem seiner Schiffe einen zugeteilt haben; angeblich setzte man sie bei den Mahlzeiten auf die Offizierstische, damit sie die Rüsselkäfer aus dem verdorbenen Schiffszwieback pickten. (Ich habe zwar keine Ahnung, ob diese Geschichte stimmt, würde ihr aber sehr gerne Glauben schenken. Ich höre förmlich, wie Nelsons Seebären ihre Eulen anfeuern und Wetten darauf abschließen, wie viele Käfer jede von ihnen vertilgen wird.)
Die gegenwärtige Steinkauzpopulation Großbritanniens wird – mit dem üblichen lässigen Mangel an Präzision – auf 5000 bis 12 000 Brutpaare geschätzt (in Deutschland geht man von einem noch kleineren Bestand aus). Da sich die Steinkauzbestände im Lauf der letzten Jahrzehnte verringert haben, wird dieser Vogel auf der gelben (in Deutschland roten) Liste der Naturschützer als Spezies geführt, die moderaten Anlass zur Besorgnis gibt. Sie sind diejenigen unserer Eulen, deren Aktivität sich am wenigsten auf die Nacht beschränkt, und obwohl sie nach Einbruch der Dunkelheit jagen, sind sie auch tagsüber aktiv. Steinkäuze haben ein dunkelbraunes und weißes Gefieder, das gestreift und gesprenkelt ist, sie weisen eine stromlinienförmigere Silhouette auf als die größeren Spezies, und ihr Kopf wirkt durch die niedrige Stirn abgeflacht. Sie haben die breiten gerundeten Schwingen der Waldvögel und einen sehr kurzen Schwanz. In Europa leben sie am liebsten in Wäldern und Feldgehölzen, und wenn man durchs englische Flachland fährt, erspäht man zuweilen eine kleine, auf einem Zaunpfosten hockende Gestalt, die den Blick prüfend über Felder und Hecken gleiten lässt. Wenn die Äcker gepflügt werden, kann man Steinkäuze sogar dabei beobachten, wie sie dem Pflug folgen, um Würmer zu fangen.
Der erste meiner vielen Fehler war gewesen, dass ich überhaupt nach dieser Eulenart gefragt hatte, und noch schlimmer war der Umstand, dass die betreffende Eule schon sechs Monate alt war und diese Zeit mit anderen Vögeln in einer großen Voliere verbracht hatte. Die wichtigste Grundregel für die Zähmung eines wilden Tiers lautet, dass es von seinen Artgenossen isoliert und so früh wie möglich seinem Betreuer anvertraut werden sollte – sobald man es gefahrlos von seiner Mutter trennen kann. Mit umsichtiger Güte erreicht man so vielleicht, dass das Tier potenzielle soziale Gefühle auf den Betreuer projiziert. Es ist ja allgemein bekannt, dass ein absolut soziales Tier wie etwa der Hund leicht darauf abgerichtet werden kann, sein Herrchen oder Frauchen als Alpha-Tier des Rudels zu betrachten. Ein solitärer Raubvogel – wie die Eule – empfindet keine solche instinktive Beziehung. Das Ei muss aus dem Nest genommen und in einem Inkubator ausgebrütet werden, damit das Küken schon beim Schlüpfen einen Menschen sieht und von ihm gefüttert wird.
Es heißt manchmal, der Vogel werde dann auf diese Person „geprägt“, sodass sich eine tiefe Bindung entwickle und man den Vogel nie mehr auswildern könne. Aber dies schießt weit übers Ziel hinaus. Ein Vogeljunges, das während seiner ersten Wochen von einem Menschen aufgezogen wurde, kann diese Vertrautheit ohne weiteres auf einen anderen Menschen übertragen. Von Menschen aufgezogene Findlinge wurden schon oft erfolgreich ausgewildert, indem man die Bindung ganz allmählich löste. Alternativ kann man einen Vogel vorsichtig an das Zusammenleben mit anderen Vögeln in einer Voliere gewöhnen. Verbringt der Vogel die prägenden ersten Lebenswochen nach dem Schlüpfen jedoch in der Gesellschaft anderer Vögel, ohne menschlichen Kontakt, nimmt man gemeinhin an, dass alle späteren Zähmungsversuche mehr oder weniger vergeblich sein werden (ein Wissen, über das ich im Herbst 1977 noch nicht verfügte). So stand es um Wellington; und deshalb waren meine Versuche, ihn „auf mich zu prägen“ – ihn an meine Berührung zu gewöhnen –, von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
* * *
Da Wellington ein ängstliches, wildes Tier war, nicht daran gewöhnt, berührt zu werden, musste er wie ein Falke „gefesselt“ werden, bevor ich ihn mit nach Hause nehmen konnte, anders wäre er nicht zu bändigen gewesen.
Fesseln sind schmale, dünne Lederbänder, die ein Falkner um die Füße des Vogels schlingt, damit er ihn daran festhalten kann, wenn er auf seiner Faust sitzt. Die Enden der Bänder sind mit einem kleinen Metallwirbel, der Drahle, verbunden (bei der Falkenjagd werden auch noch zwei winzige Messingglöckchen daran befestigt). Wenn der Falkner nun eine Schnur durch die Drahle zieht – etwa 1 m lang, zum Vogel hin mit einem Stoppknoten versehen –, kann er diese mit einer zweiten Drahle auf der Sitzstange verbinden oder an einem „Falkenblock“ im Freien. So hat der Vogel zwar viel Bewegungsspielraum, kann sich aber nicht in der Schnur verfangen (so zumindest lautet die Theorie; in der Praxis scheint es für manche Vögel kinderleicht zu sein, diese angeblich narrensichere Konstruktion zu überlisten).
Es leuchtet ein, dass vier Hände nötig sind, um einem ungezähmten Vogel Fesseln anzulegen – im Fall Wellingtons waren dies die Hände eines Experten und eines ängstlichen Neulings. Es galt, den Vogel aus dem Käfig zu nehmen und an jeder Bewegung zu hindern, in Rückenlage, mit den Beinen in der Luft, wobei man die Flügel sanft, aber energisch seitlich festhalten musste – falls es ihm gelang, einen seiner Flügel zu befreien und wild zu flattern, hatten wir ein Problem. Manche Leute benutzen gern ein weiches Tuch, um Vögel festzuhalten, andere wiederum trauen sich zu, den korrekten Griff mit bloßen Händen auszuführen. Unerfahren wie ich war, fand ich diese Aufgabe beängstigend: Die ersten Male hatte ich einfach kein instinktives Gespür dafür, wie und wo ich den Vogel anfassen musste. Natürlich fürchtete ich, zu fest zuzupacken – jeder Druck auf den Brustkorb eines Vogels kann diesen ersticken –, und bemerkte verblüfft, welche Kräfte so ein kleiner zappelnder Vogel entwickeln kann.
Macht man es richtig, liegt der Vogel einfach da, in sicherer, bequemer Rückenlage, bietet allerdings ein Bild verletzter Würde. Ich persönlich schämte mich jedes Mal und hätte mich am liebsten entschuldigt, doch dieses vage Gefühl moralischer Unterlegenheit kann sich sehr schnell verflüchtigen, sobald man in Kontakt mit den Füßen des Vogels kommt. Selbst die kleinsten Raubvögel haben mächtige Krallen, und jede Berührung fügt einem Verletzungen zu. Dick brachte mir unter anderem den Trick bei, dass man einem erbosten Vogel einen Bleistift zum Halten geben kann: Kaum berührt der Stift seine Füße, schließen sich die mörderischen Krallen darum und halten verbissen daran fest, während man ihm die Fesseln anlegt. (Da die Lederbänder sich durch Exkremente, Futterreste oder dadurch, dass der Vogel darauf herumkaut, abnutzen und zerfleddern, ergibt sich regelmäßig die lästige Pflicht, dem Vogel ein sauberes Geschüh anzulegen. Auch wenn man noch so sehr glaubt, der Vogel sei inzwischen zahm und träge geworden, ist man nie gegen schmerzhafte Überraschungen gefeit, falls die Aufmerksamkeit auch nur einen Moment lang nachlässt.)
* * *
Als ich an jenem Sonntagabend nach London zurückfuhr, saß Wellington in einem ziemlich großen Käfig, den Dick mir mitgegeben hatte, auf dem Beifahrersitz. Ihn aus der Tiefgarage in den Wohnblock zu tragen und dann im Lift mit ihm zu meiner Wohnung hinaufzufahren, bedeutete einige Minuten ziemlichen Stress – denn zu den Vernunftgründen, die gegen das ganze Projekt sprachen, hatte der Umstand gezählt, dass Haustiere hier eigentlich verboten waren. Der Hausmeister, der aus Yorkshire stammte, führte ein strenges Regiment, und seit es in der Vergangenheit – ich hatte die Wohnung eine Zeitlang mit einem ehemaligen Arbeitskollegen, einem Journalisten, geteilt – zu ein oder zwei kleineren Vorfällen gekommen war, hatte er die Wohnung Nr. 40 auf dem Kieker. (Zu unserer Verteidigung muss ich sagen, dass Roy und ich kaum jemals Partys veranstalteten – aber wenn, dann war es uns wichtig, unseren Gästen auch wirklich etwas zu bieten.)
Zum Glück passierte der Lift an jenem Abend die Etage des Hausmeisters, ohne dass der Halteknopf aufleuchtete. Nachdem ich sicher in der Wohnung angekommen war, stellte ich den Käfig auf einem Tisch im Wohnzimmer ab. Dort sollte Wellington fürs Erste bleiben, bis ich ihm eine geräumigere Unterkunft gezimmert hatte. Aus Hygienegründen gab ich etwas Stroh und Zeitungen in den Käfig und stellte einen Holzklotz hinein, auf dem Wellington sitzen konnte. Der Käfig bestand aus einer breiten Holzkiste, deren Vorderfront mit Maschendraht bespannt war, sodass der Vogel ein ausreichend großes Blickfeld hatte und sich dennoch vom Dach und den umgebenden Wänden geschützt fühlen konnte. Das schien vernünftig; denn in der Natur nistet Athene noctua in Baumlöchern, verwunschenen Winkeln von Bauerngehöften oder sogar unterirdisch in verlassenen Kaninchenhöhlen.
Wenn ich nun abends von der Arbeit nach Hause kam, leuchteten mir aus den Schatten hinter dem Maschendraht Wellingtons gelbe Augen entgegen, funkelnd vor Trotz. Erst einmal aß ich selbst zu Abend, dann holte ich sein Futter aus dem Kühlschrank und stellte es für die ersten Versuche bereit, ihn „auf mich zu prägen“. In der Natur hätte Wellingtons Ernährung vorwiegend aus Insekten bestanden, obwohl ihm nicht nur Schnaken, Ohrwürmer, Käfer und Falter geschmeckt hätten, sondern auch Würmer und Schnecken, ja sogar kleine Nagetiere. Da man ihn jedoch in Gefangenschaft aufgezogen hatte, war er an die übliche Verpflegung gewöhnt: tote Eintagsküken – handliche nahrhafte Happen, deren Körperhöhlen noch Eigelb enthalten: So beklagenswert das ist, fallen in Hühnerbrutanstalten doch ständig große Mengen dieser unerwünschten männlichen Küken an, und wenn man sie säckeweise einfriert und an Falkner verkauft, lassen sich wenigstens noch ein paar Pfund damit verdienen. Dick hatte mir ein paar Dutzend davon mitgegeben, um Wellington durchzufüttern, bis ich im Branchenbuch selbst einen Lieferanten entdeckt haben würde.
* * *
Der Zähmung wilder Tiere liegt selten ein anderes Geheimnis als Vernunft und Güte zugrunde. Man muss sie freundlich behandeln und sich viel mit ihnen abgeben, bis sie ihre Menschenfurcht verlieren. Dafür braucht es Ruhe und endlos viel Geduld, denn wer Emotionen wie Angst oder Wut auf das Tier projiziert, wirft den Prozess womöglich um Tage zurück. Dies gilt natürlich ganz besonders für ein solitäres Tier: Während ein junger Hund das mentale Rüstzeug hat, um zu verstehen, was Züchtigung bedeutet, und mit einer Unterwerfungsgeste reagiert, wird ein Raubvogel jede abrupte Bewegung als Aggression interpretieren.
Möchte man Raubvögel dazu bringen, dass sie einen tolerieren, muss man sich ihren Hunger zunutze machen; Hunger ist anfangs die einzige Möglichkeit, irgendeine Form von Transaktion zwischen Mensch und Vogel entstehen zu lassen. Wobei „Hunger“ heißt, dass man ihn Appetit entwickeln lässt – nicht etwa, dass man ihn aushungert. Abgesehen davon, dass dies grausam wäre, wäre es auch offensichtlich kontraproduktiv: Man versucht ja, den Vogel in eine ruhige Stimmung zu versetzen, und welche hungernde Kreatur ist ruhig? Raubvögel verbrauchen jede Menge „Brennstoff“ und müssen deshalb regelmäßig gefüttert werden, und wenn man lernt, Menge und Zeitpunkt ihrer täglichen Mahlzeit zu regulieren, erlangt man ziemlich rasch eine Art Routine. (Ich sollte vielleicht betonen, dass es hier um die Zähmung des Raubvogels als Haustier geht, nicht um den wesentlich komplexeren Prozess der Abrichtung zur Jagd in freier Natur. Zur echten Falknerei gehört es, den Vogel mit Bedacht zu füttern und regelmäßig zu wiegen und die Futterrationen exakt so zu bemessen, dass der Vogel gesund, aber stets „hungrig“ ist, damit er zwar bei Kräften bleibt, aber immer noch gerne jagt.)
* * *
Meine Hoffnungen, was Wellingtons Zähmung betraf, beschränkten sich auf elementare Dinge: Er sollte lernen, aus freiem Willen zu mir zu kommen, anfangs indem ich ihn mit Futter belohnte, später dann vielleicht einfach auf einen Ruf oder Pfiff hin. Er sollte die Vorsicht des wilden Tiers ablegen und mir erlauben, mit ihm zu spielen und mich an ihm zu erfreuen. Dies schien ein durchaus reelles Ziel zu sein. Schließlich hatte es bei Dick jedes Mal ausgesehen, als sei die Zähmung ein Kinderspiel; einmal hatte er einen Turmfalken in weniger als einer Woche dazu erzogen, zum Füttern auf seine Faust zu fliegen, also wusste ich ungefähr, wie man das anpackt.
Ich bedeckte den Boden neben meinem Sessel mit einer Zeitung und meinen Arm mit einem alten Handtuch – um mich vor „Missgeschicken“ zu schützen –, dann streifte ich mir einen alten Autofahrerhandschuh über die linke Hand (für kleine Vögel wie Wellington benötigt man eigentlich keinen Schutzhandschuh, aber der Vogel kann sich besser festhalten, wenn er auf der Faust sitzt). Eine aus Schnürsenkeln zusammengebundene Leine zwischen den Zähnen, öffnete ich dann einige Zentimeter weit die Käfigtür, tastete hoffnungsvoll im Käfig herum und versuchte, Wellingtons herabhängende Fesseln mit der Drahle zu erwischen, während er in die hinterste Käfigecke flüchtete und sich zischend aufbäumte. Kriegte ich ihn dann endlich zu fassen, zog ich ihn sanft aus dem Käfig heraus, bis er seinen Widerstand aufgab und auf meine linke Faust sprang. Mit der anderen Hand schob ich die Schnürsenkelleine durch die Drahle und wand mir das herabhängende Ende um den Finger, wobei ich die Drahle fest zwischen Daumen und Zeigefinger hielt, bis ich bequem in meinem Sessel saß und ein wenig Schnur nachlassen konnte, damit Wellington mehr Bewegungsspielraum hatte.
Der Zweck dieser Übung war, ihn so lange an meine Gesellschaft zu gewöhnen, bis er Futter von meinen Fingern nehmen und auf dem Handschuh verzehren würde. Ich hatte vor, ihn dann frei fliegen zu lassen – zumindest in jenen Teilen der Wohnung, in denen er nicht viel Schaden anrichten und sich nicht verletzen konnte – und ihn gelegentlich mit Futter auf meine Hand zurückzulocken. Immer wenn ich ihm einen Leckerbissen zeigte, wurde das von einem ganz bestimmten Pfiff begleitet – der sonst nie ertönte –, und meine Hoffnung war, dass er mit der Zeit allein auf diesen Pfiff reagieren würde, Belohnung hin oder her. Dann würde sich allmählich die Art von Beziehung entwickeln, der ich voller Zuversicht entgegenblickte.
Das Problem war, dass Wellington offenbar nicht aufgepasst hatte, als ich ihm all das erklärte. Abend für Abend, Woche für Woche hockte er (kurz) auf meiner Faust, etwa so vertrauensvoll und entspannt wie ein Schrotthändler beim Besuch eines Wirtschaftsprüfers der britischen Steuerbehörde. Für einen so kleinen Vogel wie Wellington musste ich die Küken zerschneiden – eine äußerst unangenehme Arbeit. Aber ich unterdrückte mein Schaudern, nahm einen der schleimigen Batzen von der Untertasse, hielt ihn Wellington hin und versuchte mit verführerischem Charme zu pfeifen und zu gurren. Wellington tänzelte, wich aus und presste fest den Schnabel zu, wie ein Kleinkind, das den Löffel mit Rahmspinat auf sich zukommen sieht. Ich ließ den „Leckerbissen“ vor seinen wütenden Augen baumeln; ich strich ihm damit über den Schnabel; nach etwa einer Stunde konnte ich kaum noch den Impuls unterdrücken, den störrischen Schnabel aufzustemmen und ihm den Happen mit dem stumpfen Ende eines Bleistifts in den Schlund zu schieben. Alles vergebens; anders als sein geselliger Namensvetter speiste Wellington entweder allein in seinem Käfig oder gar nicht.
* * *
Der geborgte Kistenkäfig war eindeutig nur eine temporäre Notlösung. Damit Wellington nicht die ganze Zeit eingesperrt sein musste, wenn ich ihn nicht an seiner Leine hielt, baute ich ihm als Erstes einen „Cadge“. Dies war einfach ein tragbarer Holzblock, der in einer Kiste stand, groß genug, um Ausscheidungen aufzufangen und Wellington kurze Spaziergänge an der Leine zu ermöglichen. Rasch hatte ich alles beisammen – eine Saatkiste, einen kleinen Holzklotz, an dem ich für die Leine eine Ringschraube befestigte, und den Sunday Telegraph der letzten Woche – und baute es auf dem Kistenkäfig auf. Von hier aus konnte Wellington die weiteren Vorbereitungen verfolgen.
Der Grundriss meiner Wohnung bestimmte meine Pläne für Wellingtons endgültiges Quartier. Vom fensterlosen L-förmigen Flur führten links und rechts die beiden ersten Räume ab – das Bad und das Zimmer, das ich als Büro nutzte – Letzteres mit einem Fenster auf einen kleinen Balkon. An diesen Türen vorbei führte der Flur direkt auf mein Schlafzimmer zu, links befand sich die Küche und rechts der große Wohnraum. Dieser Wohnraum war der Hauptgrund gewesen, warum Roy und ich uns damals für diese Wohnung entschieden hatten; er war geräumig, hell und luftig, und die Südseite nahezu vollständig verglast. Von hier aus hatte man einen Panoramablick auf hohe Gebäude vor einem unendlichen Himmel – eine Art Mini-Manhattan, am helllichten Tag ebenso eindrucksvoll wie nach Einbruch der Nacht, wenn alles von Lichtern funkelte. In den Raum schien den ganzen Tag über die Sonne; am anderen Ende ging ein weiteres großes Fenster nach Westen, über eine niedrige Dachlandschaft hinüber zur grünen Erhebung des alten Croydon Airport, einige Meilen entfernt. Rechts von diesem Fenster führte seitlich eine Glastür auf den Bürobalkon hinaus. Dabei handelte es sich eigentlich nur um einen besseren Betonsims, der vom darüberliegenden Nachbarbalkon schattig überdacht wurde, aber doch immerhin an sonnigen Nachmittagen Platz für zwei Liegestühle und einen Kasten Bier bot.
Mir schwebte die Konstruktion eines Käfigs vor, der genau auf diesen Balkon zugeschnitten war, ein Käfig von den Maßen eines geräumigen Kleiderschranks, groß genug, dass Wellington ein paar Flügelschläge weit hin und her fliegen konnte. Hier konnte er an der frischen Luft vor sich hin dösen, während ich tagsüber in der Arbeit war, und hatte abends einen interessanten Ausblick; gleichzeitig war er durch den darüberliegenden Balkon vor Wetterunbilden geschützt. Zwar würde die Distanz zur Nachbarwohnung nur knapp einen Meter betragen, doch war meine Nachbarin Lynne glücklicherweise eine gute Freundin, die dem Hausmeister ebenso wenig Sympathie entgegenbrachte wie ich. Ich versicherte ihr, Eulen der Spezies Athene noctua seien nicht für lauten nächtlichen Gesang bekannt. Und obwohl diese Behauptung reinem Wunschdenken entsprang, bestätigte sie sich. Wellington befand sich so weit von seinem natürlichen ländlichen Habitat entfernt – und in so luftiger Höhe –, dass er eigentlich keinen Grund hatte, mit lauten Rufen seine Reviergrenzen zu verteidigen; es wären ohnehin keine Artgenossen in der Nähe gewesen, die es gehört hätten.
* * *
Erst einmal bedeckte ich mehrere Bögen Millimeterpapier mit Kritzeleien, bevor mich mein Entwurf zufriedenstellte. Da der Balkon klein und nur von dieser einen Tür aus zugänglich war, durfte die geplante Konstruktion, wenn ich mich seitlich noch daran vorbeidrängen wollte, höchstens 60 cm breit sein; Länge und Höhe jedoch konnten jeweils 1,80 m betragen. Das hintere Ende des Käfigs wollte ich komplett mit Sperrholz verschalen, ein Bereich von der Größe einer Telefonzelle; dieser würde eine Hütte enthalten, in die Wellington sich zurückziehen konnte, wenn er keine Lust auf Gesellschaft verspürte (bei ihm offenbar eher der Normalzustand), außerdem eine Sitzstange direkt außerhalb seiner „Türschwelle“ und ein Wandbrett, auf dem er fressen konnte. Der Rest des Käfigs würde aus einem mit Drahtgeflecht bespannten Holzrahmen bestehen; mehrere aus Ästen gefertigte Sitzstangen sollten in unterschiedlicher Höhe schräg über Eck verlaufen.
Obwohl ich alles andere als ein talentierter Heimwerker bin, betrachtete ich meine Konstruktion der Käfigtür als wahren Geniestreich, beinahe patentwürdig. Die Windrow Typ 1 Doppel-Schwingtür für Eulenkäfige bestand aus mit Drahtgeflecht bespannten Holzrahmen, die den inneren Käfigmaßen entsprachen, und wurde am vorderen Ende der langen „Fassade“ angebracht. Es handelte sich um eine Doppeltür, deren zwei Türen, mit einem Scharnier verbunden, hintereinander angebracht waren, sodass eine Tür sich nach innen, die andere nach außen öffnete. Nun musste ich nur noch dafür sorgen, dass Wellington im hinteren Teil des Käfigs saß, dann konnte ich die erste Innentür schließen, indem ich an einem Draht zog. Daraufhin konnte ich die äußere Tür öffnen, den Käfig betreten und die Tür wieder hinter mir schließen, mich also in eine „Eulen-Schleuse“ begeben. In dieser Schleuse war gerade so viel Platz, dass ich die Innentür aufziehen und hinter mir zumachen konnte, sodass Wellington und ich uns nun im selben Raum befanden und ihn während des gesamten Vorgangs immer eine Tür am Davonfliegen gehindert hatte. Jetzt würde ich ihn in einen Korb locken, den Käfig auf demselben Weg verlassen und Wellington in die Wohnung tragen.
Mit stolzgeschwellter Brust begab ich mich eines Samstagmorgens in den nächsten Baumarkt. Hier bekam ich alles Nötige, hatte aber ein paar Kleinigkeiten nicht bedacht – vor allem das Problem, acht Holzlatten mit einem Querschnitt von 2,5 × 5 cm und einer Länge von 1,80 m, drei riesige Sperrholzplatten in Marinequalität (für Wellington nur das Beste) und etliche Rollen Drahtgeflecht auf einem wackligen Einkaufswagen durch den engen Kassenbereich zu manövrieren. Der zweite Akt dieser grausamen Komödie fand draußen auf dem Parkplatz statt, wo ich vor dem Problem stand, den ganzen Krempel in meinem Wagen unterzubringen, beziehungsweise oben auf dem Dach sicher zu vertäuen. (»Mami, guck mal, der komische Mann mit dem roten Gesicht und den blutigen Händen, der die ganze Zeit flucht! Warum reißt ihm denn dauernd die Schnur?«)