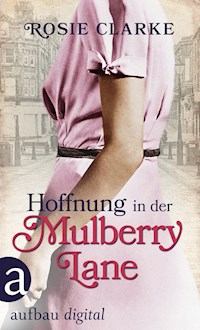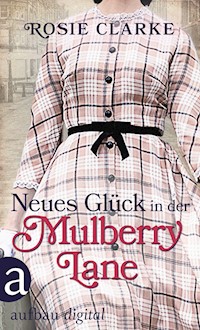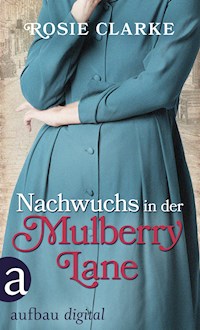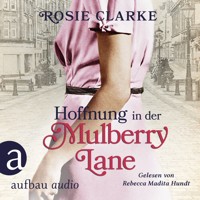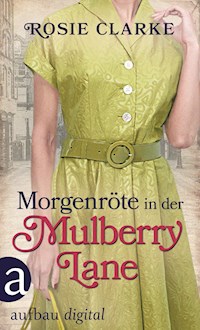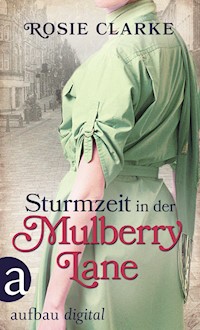12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Mulberry Lane Saga
- Sprache: Deutsch
Der drohende Krieg überschattet London, doch die Frauen aus der Mulberry Lane kämpfen mit ihren ganz eigenen Sorgen …
1938, Mulberry Lane, London. Maureen Jackson fühlt sich wie eine Gefangene. Drei Jahre zuvor war ihre Welt noch in Ordnung. Sie wollte Rory, den Mann ihrer Träume, heiraten und mit ihm eine eigene Familie gründen. Aber seit dem Tod Ihrer Mutter muss sie sich um ihren Vater kümmern, der ihr das Leben zur Hölle macht. Nun schuftet sie Tag und Nacht in seinem Lebensmittelgeschäft. Als Rory nach London zurückkehrt und mit ihm seine schwangere Frau, erinnert das Maureen an das Leben, das ihres hätte sein sollen.
Peggy und Laurence Ashley führen den Pub in der Mulberry Lane. Obwohl Laurence sich von seinem Einsatz im ersten Weltkrieg nie wieder ganz erholt hat, liebt Peggy ihren Mann sehr. Ihre Tochter Janet hofft angesichts des drohenden Krieges endlich ihre Jugendliebe Mike heiraten zu dürfen, aber Laurence ist strikt gegen diese Hochzeit. Als Janet schwanger wird und ihr Bruder sich zudem für den Kriegsdienst melden möchte, fasst Peggy den festen Entschluss, ihre Familie um jeden Preis zusammenzuhalten. Aber wird ihr das in diesen Zeiten gelingen?
Liebe, Tod und Hoffnung - Das Schicksal der Mulberry Lane in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Die große London-Saga für alle Fans von Donna Douglas, Katharina Fuchs und Ulrike Renk. Alle Titel der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 552
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Der drohende Krieg überschattet London, doch die Frauen aus der Mulberry Lane kämpfen mit ihren ganz eigenen Sorgen …
1938, Mulberry Lane, London.
Maureen Jackson fühlt sich wie eine Gefangene. Drei Jahre zuvor war ihre Welt noch in Ordnung. Sie wollte Rory, den Mann ihrer Träume, heiraten und mit ihm eine eigene Familie gründen. Aber seit dem Tod Ihrer Mutter muss sie sich um ihren Vater kümmern, der ihr das Leben zur Hölle macht. Nun schuftet sie Tag und Nacht in seinem Lebensmittelgeschäft. Als dann Rory nach London zurückkehrt und mit ihm seine schwangere Frau, erinnert das Maureen an das Leben, das ihres hätte sein sollen.
Peggy und Laurence Ashley führen den Pub in der Mulberry Lane. Obwohl Laurence sich von seinem Einsatz im ersten Weltkrieg nie wieder ganz erholt hat, liebt Peggy ihren Mann sehr. Ihre Tochter Janet hofft angesichts des drohenden Krieges endlich ihre Jugendliebe Mike heiraten zu dürfen, aber Laurence ist strikt gegen diese Hochzeit. Als Janet schwanger wird und ihr Bruder sich zudem für den Kriegsdienst melden möchte, fasst Peggy den festen Entschluss, ihre Familie um jeden Preis zusammenzuhalten. Aber wird ihr das in diesen Zeiten gelingen?
Liebe, Tod und Hoffnung – Das Schicksal der Mulberry Lane in den Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Die große London-Saga für alle Fans von Donna Douglas, Katharina Fuchs und Ulrike Renk. Alle Titel der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Über Uta Hege
Uta Hege lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Saarbrücken. Mit dem Übersetzen englischer Titel hat sie ihre Reiseleidenschaft und ihre Liebe zu Büchern perfekt miteinander verbunden und ihren Traumberuf gefunden
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Rosie Clarke
Die Frauen aus der Mulberry Lane
Aus dem Englischen übersetzt von Uta Hege
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Impressum
Wie geht es weiter in der Mulberry Lane?
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Impressum
1
»Da bist du ja, meine Liebe.« Als Jim Stillman seine Kiste voll mit Porree, Kohl und Kartoffeln auf den Küchenboden stellte, rief der durchdringende Lauchgeruch in Peggy Ashley ein Gefühl von Hunger wach. »Leider dürfte das die letzte Ernte aus dem Schrebergarten von dem alten Percy sein. Er hat mich vor seinem Tod gebeten, noch die Beete abzuernten und alles bei dir vorbeizubringen, bevor das Grundstück neu verpachtet wird.«
»Danke.« Peggy lächelte ihn an. »Percys Gemüse wird mir fehlen, denn es war immer frisch, und die Kartoffeln waren nie von Würmern angefressen.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Am meisten würde sie das gut gelaunte Lächeln ihres Stiefvaters vermissen, der im letzten Monat von ihnen gegangen war. »Ich kann einfach nicht glauben, dass er nicht mehr da sein soll.«
»Ich auch nicht, meine Liebe.« Jim nahm seine Mütze ab und kratzte sich den Kopf. »Aber Percys Grünzeug wird dir ganz bestimmt nicht fehlen. In Zukunft bringe ich dir jede Woche was von dem Gemüse, das in meinem Schrebergarten wächst. Ich habe immer jede Menge übrig, und es ist mir lieber, wenn du etwas daraus machst, als wenn ich es vergammeln lassen muss.« Er stieß ein dunkles Lachen aus. »Heute früh habe ich den jungen Tommy Barton dabei überrascht, wie er auf Percys Grundstück die Kartoffeln ausgegraben hat. Natürlich gab es dafür etwas hinter die Löffel, aber schließlich habe ich ihn mitnehmen lassen, was er ausgebuddelt hat. Der arme kleine Kerl kann einfach nicht mit ansehen, wenn seine Mutter hungern muss. Und schließlich kann er nichts dafür, dass man den alten Barton wegen Raubes eingebuchtet hat, nicht wahr?«
In der Tat hatten Tilly Barton und die beiden Jungen Sam und Tommy, die dem Pig & Whistle praktisch gegenüber wohnten, es seit der Verhaftung ihres Ehemanns und Vaters alles andere leicht. Die Bewohner der Mulberry Lane und all der anderen kleinen Gassen rund um den Spitalfields Market waren eine eingeschworene Gemeinschaft, und obwohl sie mitten im belebten East End lebten, herrschte eine Atmosphäre wie in einem Dorf. Der alte Barton war Stammgast in Peggys Pub gewesen, doch nachdem er seinen Job im Hafen verloren hatte, hatte er anscheinend nicht mehr ein und aus gewusst. Sie alle waren schockiert gewesen, als er wegen des versuchten Überfalls auf eines der kleinen Postämter der Gegend festgenommen worden war, und seine Frau ging Peggy und den anderen Leuten aus der Straße seither möglichst aus dem Weg. Wahrscheinlich schämte sie sich einfach für die Taten ihres Ehemanns.
»Natürlich nicht.« Mit einem müden Lächeln strich sich Peggy eine Strähne ihrer honigblonden Haare, die unter der kleinen weißen Haube, die sie in der Küche trug, hervorgerutscht war, aus der Stirn. »Mir war nicht klar, dass Tilly so zu kämpfen hat. Ich werde ihr nachher eine Pastete rüberbringen – oder denkst du, dass sie dann beleidigt ist?«
»Niemand, der noch halbwegs bei Verstand ist, könnte je beleidigt sein, wenn du ihm etwas Gutes tust.«
»Danke, Jim. Wie wäre es mit einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Apfelkuchen?«
»Gegen ein Stück Kuchen habe ich bestimmt nichts einzuwenden, aber wenn es für dich okay ist, nehme ich es mit, damit ich es nachher in meiner Laube essen kann.«
Natürlich war es das, versicherte sie ihm und wickelte ein großes Stück des frisch gebackenen Apfelkuchens für ihn ein. Lächelnd nahm er es ihr ab, versprach, sie nächste Woche wieder zu besuchen, und während er die Küche durch die Hintertür verließ, kam Peggys Ehemann von vorn herein.
»Wer war das?«, wollte Laurence wissen und sah dem Besucher hinterher.
»Jim Stillman. Percy wollte, dass er mir die letzten Sachen aus dem Schrebergarten bringt.«
Als Peggys Augen sich mit Tränen füllten, runzelte ihr Mann die Stirn. »Ich weiß beim besten Willen nicht, weswegen du so traurig bist. Percy war weit über achtzig, hatte ein sehr gutes Leben, und vor allem war er nur dein Stiefvater …«
»Ich weiß. Und ich weiß auch, dass er viel älter war als Mum … aber er war wirklich wunderbar zu ihr, als sie nach Walters Tod so krank geworden ist.« Peggys Stimme brach, denn die Erinnerung an ihren jüngeren Bruder, der mit gerade einmal siebzehn Jahren im Großen Krieg gefallen war, tat ihr noch immer weh. Sein Tod hatte ihre Mutter fast um den Verstand gebracht, und Peggy dachte nach wie vor mit Grauen an diese schlimme Zeit zurück. Doch Percy hatte es geschafft, sie wiederaufzurichten, wofür Peggy ihm bis an ihr Lebensende dankbar wäre, auch wenn Laurence das anscheinend nicht verstand.
»Weißt du, wo meine Zeitung ist?«, erkundigte er sich. Offensichtlich hatte er ihr gar nicht zugehört. »Ich bin mit dem Kreuzworträtsel noch nicht durch, aber ich glaube, jetzt weiß ich das letzte Wort.«
»Meinst du die Sonntagszeitung?« Peggy runzelte die Stirn und dachte nach. »Ich glaube, die ist nicht mehr da.«
»Verdammt!« Er funkelte sie zornig an. »Du weißt, dass du sie hättest aufbewahren sollen, weil ich das Rätsel noch zu Ende hätte machen wollen. Nun werde ich nie erfahren …«
»Oh, die Seite mit dem Kreuzworträtsel habe ich dir in die Anrichte gelegt. In die Schublade ganz oben. Schließlich hebe ich dir immer alle Kreuzworträtsel auf.«
Als Laurence eilig zu dem großen Schrank ging, der sich beinahe über eine ganze Küchenwand erstreckte und in dessen Aufsatz Peggys über Jahre liebevoll gesammeltes Geschirr hervorragend zur Geltung kam, wandte sie sich wieder ihrer Arbeit zu. Er stürzte sich begeistert auf das Blatt, und erneut füllten ihre Augen sich mit Tränen, da er einfach nicht verstand, wie nahe ihr der Tod ihres Stiefvaters ging. Er hatte Percy nie gemocht und sich daran gestört, dass Peggy in den letzten Monaten vor dessen Tod so oft bei ihm vorbeigegangen war. Sie hatte ihm geholfen, weil er selbst zu schwach für jede Form der Hausarbeit gewesen war. Das hatte Laurence alles andere als gern gesehen, und der Gedanke, dass er jetzt erleichtert oder vielleicht sogar froh war, da die lästigen Besuche bei dem alten Mann ein Ende hatten, tat ihr in der Seele weh.
Inzwischen hatte er das letzte Wort des Rätsels eingetragen, schnitt es aus und schob es triumphierend in ein Kuvert. »Wirf das in den Briefkasten, wenn du einkaufen gehst«, wies er sie an und legte ihr den Umschlag auf den Küchentisch. »Normalerweise gibt es keine tollen Preise, weil das Rätsel viel zu leicht ist und es praktisch jeder lösen kann, doch diesmal hat es außer mir wahrscheinlich kaum jemand geknackt.«
Als Laurence glücklich über das gelöste Rätsel aus der Küche ging, starrte ihm Peggy böse hinterher. War ihm tatsächlich nicht bewusst, wie sehr sie um Percy trauerte?
Seufzend zog sie ein paar Bleche aus dem Ofen, um sie auf den großen Tisch aus Kieferholz zu stellen, der mitten in der Küche stand. Es war ein großer Raum mit vielen Schränken, jeder Menge Platz für ihre Küchenutensilien und mit einer herrlich kühlen Speisekammer direkt nebenan. Tatsächlich war der Pub ein guter Ort zum Leben, und sie arbeitete gerne hier. Das tat sie schon seit ihrer Hochzeit, und sie hatte angenommen, dass sie dieser Tätigkeit gerne bis ins hohe Alter nachgehen würde, aber Laurence hatte sie mit seiner gleichgültigen Reaktion auf Percys Tod zutiefst verletzt.
Doch es war dumm, darüber nachzugrübeln, also zog sie ihre Schürze aus und griff nach ihrem Korb und ihrem Portemonnaie. Sie fuhr sich mit den Fingern durch den Pagenschnitt, trug etwas Lippenstift auf ihre vollen Lippen auf und blickte auf ihr Bild im Spiegel, der über dem Sideboard hing. Trotz ihres Lächelns sahen ihre blauen Augen traurig aus, vielleicht wegen des dauerhaften Schmerzes, den sie seit dem Tod ihres Stiefvaters und wegen Laurences fehlendem Mitgefühl empfand. Wahrscheinlich ginge es ihr allerdings besser, wenn sie kurz mit ihrer jungen Freundin spräche, die den Laden ihres alten Herrn am anderen Straßenende führte, denn egal, wie schwer es Peggy manchmal auch hatte, hatte es Maureen noch deutlich schwerer, aber trotzdem stets ein Lächeln im Gesicht.
*
»Wenn du welchen dahast, nehme ich zwei Büchsen von dem Kochschinken«, erklärte sie. »Er kommt aus Kanada, nicht wahr?«
Ihre Freundin nickte. »Dad nimmt immer welchen, wenn der Großhändler ihn hat, denn er ist sehr beliebt.« Auch heute hellte das gewohnte Lächeln Maureens hübsche Züge auf. Sie hatte dunkelbraunes Haar, das von der jungen Ellie aus der Nummer neun zwei Türen weiter jüngst zu einem kessen Bob geschnitten worden war. Ellies Chefin hatte erst vor Kurzem einen der leer stehenden Läden in der Straße übernommen, aber da die Preise günstig waren, lief das Geschäft bereits sehr gut. »Dad hat neulich extra zusätzliche Dosen eingekauft und unser Lager aufgefüllt, schließlich weiß man nicht, was kommt …«
»Du meinst, er sorgt schon für den Kriegsfall vor? Ich hoffe wirklich, dass das übertriebene Vorsicht ist, Maureen. Du bist zu jung, um dich noch daran zu erinnern, wie es beim letzten Mal gewesen ist, und ich erschaudere bei dem Gedanken, dass es jetzt vielleicht noch mal so kommt.«
»Ein bisschen kann ich mich erinnern.« Maureens sanfte graue Augen drückten ebenfalls Besorgnis aus. »Mum hat sich vor den Zeppelinen gefürchtet, und ich weiß, dass eins von diesen fürchterlichen Dingern ein paar ihrer Freundinnen getötet hat. Vor allem aber erinnere ich mich an das Straßenfest, das wir gefeiert haben, als der Krieg vorüber war.«
»Das stimmt, wahrscheinlich warst du damals gerade alt genug, dass du dich noch erinnern kannst«, stimmte ihr Peggy zu. »Ich weiß noch, wie all unsere tapferen Jungs lachend die Straße auf und ab marschiert sind und sich eingebildet haben, sie brächen in ein wunderbares Abenteuer auf und spätestens bis Weihnachten wäre der Krieg vorbei und sie wieder daheim. Die meisten waren bis dahin niemals über ihre Heimatdörfer oder -städte hinausgekommen und hatten keine Ahnung, was sie auf dem Kontinent erwartet.«
»Mums Bruder Tim hat Senfgas in den Gräben abbekommen … er kam zurück, war aber vollkommen verändert, meinte Mum, und nicht einmal drei Jahre später war er tot.«
»O ja, der arme Tim. Ich habe deinen Onkel gut gekannt, denn deine Mum – Gott segne sie – hat ihn ja praktisch großgezogen und ihn überallhin mitgeschleppt.« Sie schüttelte die traurigen Erinnerungen ab. »Aber wir sollten nun nicht mehr darüber jammern, schließlich ist das alles ewig her. Kommst du Freitagabend zum geselligen Beisammensein ins Gemeindehaus?«
»Ich würde liebend gern, Peggy, nur leider bin ich mir nicht sicher, dass mein Vater mich auch gehen lässt.«
»Ach, Maureen, warum lässt du dir so was von ihm bieten?« Peggy schüttelte den Kopf, als sie ihr Wechselgeld entgegennahm. »Du bist inzwischen dreiundzwanzig, und er kann dir nicht verbieten, auszugehen. Du machst dich selbst auf Dauer unglücklich, wenn du dich derart von ihm gängeln lässt.«
»Du weißt doch, dass er es an den Bronchien hat und sich immer entsetzlich aufregt, wenn er abends mal alleine bleiben soll. Seit Mum gestorben ist, hat Vater bloß noch mich, und als ich ihn das letzte Mal allein gelassen habe, ging es ihm danach so schlecht, dass ich den Doktor rufen musste.«
»Er versucht, dich zu erpressen«, klärte Peggy sie mit strenger Stimme auf. »Soll ich mal mit ihm reden, Liebes?«
»Danke, aber lieber nicht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich meine Oma darum bitte, dass sie mit ihm spricht. Sie ist die Einzige, auf die er hört. Ich werde sehen, in welcher Stimmung er am Freitag ist. Manchmal trifft er sich zum Kartenspielen mit seinen Freunden, und dann hat er nichts dagegen, wenn ich ausgehe – solange ich mit dir oder Anne zusammen bin. Wobei ihm Anne am liebsten ist, denn vor der Arbeit, die sie in der Schule leistet, hat er ehrlichen Respekt.«
»Wogegen ich als Wirtin eines Pubs für ihn wahrscheinlich ein verruchtes Frauenzimmer bin.«
Maureen errötete.
Daraufhin fragte Peggy lachend: »Damit habe ich den Nagel auf den Kopf getroffen, stimmt’s? Aber egal. Ich bin mir sicher, dass ihm deine Oma die Leviten lesen wird. Hilda Jackson wusste schließlich immer schon, wie sie die Männer der Familie unter Kontrolle halten kann.«
*
Als Peggy das Geschäft verließ, sah ihr Maureen mit einem wehmütigen Lächeln hinterher. Obwohl sie ihre engste Freundin war, versuchte nicht mal sie, sie wirklich zu verstehen. Aber tatsächlich baute Henry Jackson, seit er seine Frau verloren hatte, auf das Mitgefühl seiner Tochter und nutzte die Trauer, die sie selbst verspürte, schändlich aus.
»Wie soll ich ohne dich zurechtkommen, Maureen-Schatz?«, hatte er sie damals gefragt, wobei ihm Tränen über die Wangen gelaufen waren. »Wenn du mich jetzt verlässt, um diesen Kerl zu heiraten, lege ich mich ins Bett und stehe niemals wieder auf. Dann bist du schuld an meinem Tod. Ich brauche dich, und deine Ma würde erwarten, dass du dich auch weiter um mich kümmerst … du weißt schließlich selbst, wie krank ich bin.«
»Oh, Dad, das darfst du mir nicht antun«, hatte sie gefleht. Sie war mit Rory Mackness, einem jungen Mann, dem sie noch vor dem Tod ihrer Mum in Peggys Pub begegnet war, verlobt gewesen, doch ihr Vater hatte ihr erklärt, sie müsse sich von ihm trennen, um auch weiter für ihn da zu sein. »Das ist nicht fair … das ist nicht fair …«
»Willst du meinen Tod auf dem Gewissen haben, Mädchen? Vielleicht hätte deine Ma uns nicht verlassen, wenn du öfter hiergeblieben wärst, statt jeden Abend auszugehen.«
Bei dieser Erinnerung schnürte es ihr die Kehle zu. Es war so ungerecht von ihrem Vater, ihr die Schuld daran zu geben, dass ihre Mutter plötzlich eines Abends krank geworden und gestorben war. Womöglich wäre sie tatsächlich noch am Leben, wenn sie da gewesen wäre, um den Arzt zu rufen, aber auch ihr Vater hatte sich an jenem Abend außer Haus vergnügt. Trotzdem gab er immer nur Maureen die Schuld am Tod seiner Ehefrau, als hätte nicht er selbst sie über Jahre hinweg drangsaliert und derart schlecht behandelt, dass ihr Leben eine einzige Qual gewesen war.
Manchmal raunte eine leise Stimme Maureen zu, dass es ihrer Mutter ohne einen Ehemann, der sich den ganzen Tag beschwerte und sie manchmal sogar schlug, wahrscheinlich besser ging. Als Maureen klein gewesen war, hatte ihre Mum stets behauptet, dass die blauen Flecken an den Armen und einmal im Gesicht von unglücklichen Stürzen kämen, aber später war Maureen bewusst geworden, dass die Schwellungen und Hämatome Folgen der Misshandlungen durch ihren Ehemann gewesen waren. Ach, hätte sie vor drei Jahren doch die Kraft gehabt, sich ihrem alten Herrn zu widersetzen, oder besser noch, nicht extra für ein schönes Hochzeitskleid und ein paar Gegenstände für den neuen Haushalt, den sie hatten gründen wollen, gespart und eher geheiratet. Denn wenn sie Rorys Frau gewesen wäre, hätte sie ihr Vater nicht mehr zwingen können, heimzukehren, um sich um ihn zu kümmern und dazu noch das Geschäft für ihn zu führen.
Da Rory sie nicht hätte gehen lassen, wenn sie ihm den wahren Grund für ihren Rückzieher gebeichtet hätte, hatte sie behauptet, dass sie sich ihrer Gefühle nicht mehr sicher wäre, und als er sie hatte küssen wollen, um sie umzustimmen, hatte sie, um nicht noch einmal schwach zu werden, noch hinzugefügt, sie würde die Verlobung in der Zwischenzeit bereuen. Daraufhin hatte er sie wütend stehen lassen, war davongestapft, und seither hatten sie sich nicht noch mal gesehen.
»Träum nicht«, unterbrach die Stimme ihres Vaters ihren Gedankengang. Er kam aus dem Hinterzimmer und wies sie mit rüder Stimme an: »Na los, Maureen. Wenn keine Kundschaft da ist, geh ins Lager, und mach eine Liste von den Dingen, die wir brauchen. Ich will morgen früh zum Großhändler und muss dann wissen, was uns alles fehlt.«
»Wo gehst du hin?«, erkundigte sie sich, denn er war bereits auf dem Weg zur Tür.
»Ich wüsste nicht, was dich das angeht, Fräulein. Wenn du weißt, was für dich gut ist, tust du das, was ich dir sage, oder …«
»Oder was?«, hätte sie fragen wollen. Sie war sich ziemlich sicher, dass ihr Vater sie nicht schlagen würde, denn dann würde sie verschwinden, und er säße ganz alleine da. Sie war nicht ihre Mutter und war außer durch ihr Pflicht- und Mitgefühl auf keine Art an ihn gebunden. Aber auch wenn das anscheinend niemand nachvollziehen konnte, tat der Mann ihr wirklich leid. Obwohl sie wusste, dass er seinen schlechten Gesundheitszustand vorschob, wenn sie sich ihm widersetzte, war er in der Tat lungenkrank und hatte sicherlich ebenfalls Schuldgefühle gegenüber seiner toten Frau.
»Am Freitag gehe ich mit Anne und Peggy ins Gemeindehaus«, rief sie ihm hinterher. »Und wenn du nicht allein sein willst, frage ich Gran, ob sie vorbeikommen und dir Gesellschaft leisten kann.«
Sie atmete tief durch, als er sie durchbohrend ansah. Wenn Blicke töten könnten, wäre sie wahrscheinlich auf der Stelle umgefallen, zu ihrem Glück jedoch betrat in diesem Moment ein Kunde das Geschäft, deshalb ließ er sie wortlos stehen. Er würde ihr auf jeden Fall nach seiner Heimkehr die Leviten lesen, aber diesmal würde sie nicht nachgeben. Denn Peggy hatte recht: Es war inzwischen allerhöchste Zeit, dass sie ihr Leben selbst in die Hände nahm.
Da sie es sich laut ihrem Vater nicht leisten konnten, irgendwelche Kunden zu verpassen, machte sie den Laden mittags nur ein paar Minuten zu und aß dann schnell das Sandwich, das sie sich am Morgen zubereitete, während sie beim Frühstück saß. Im Hinterzimmer stand ein Wasserkessel, doch die Zeit, sich eine Tasse Tee zu machen und sich damit hinzusetzen, hatte sie fast nie.
Momentan bediente sie den letzten Kunden dieses Tages, der fast täglich nach der Arbeit für die Abendzeitung und ein Päckchen Woodbine-Zigaretten kam. Er war ein angenehmer, auf zurückhaltende Weise attraktiver Mann von vielleicht dreißig Jahren.
»Bitte, Mr. Hart. Das wären ein Pfund und sieben Pence«, erklärte sie und packte ihm auch noch die Malzstange, um die er sie im letzten Augenblick gebeten hatte, ein. »Und wie geht es Ihrer kleinen Shirley?«
»Sie war wieder krank, Miss Jackson«, klärte er sie traurig auf. »Ich schätze, dass ihr ihre liebe Mama fehlt, obwohl sich ihre Oma alle Mühe mit ihr gibt. Nur leider ist es eben so, dass meine Mutter auch nicht jünger wird.«
»Es ist bestimmt nicht leicht für sie, sich um ein kleines Kind zu kümmern, aber ich bin überzeugt davon, dass sie sich alle Mühe gibt«, stellte Maureen mit mitfühlender Stimme fest. »Wir alle brauchen unsere Mütter, Mr. Hart, egal, wie alt wir sind.«
»Da haben Sie recht«, pflichtete er ihr bei und nickte ihr, bevor er ging, ein wenig aufgemuntert zu.
*
Ihr Vater zündete sich gerade seine Pfeife an, als sie nach oben in die Wohnung kam. Er saß in seinem Sessel und sah auf, blieb aber stumm. Das machte ihr nichts weiter aus, denn sie war seine Stimmungsschwankungen gewöhnt. Später schaufelte er wortlos das von ihr gekochte Essen in sich rein, überließ ihr wie gewohnt den Abwasch, ging nach unten und verschwand dann durch die Hintertür. Maureen wusste, dass er seinen Schlüssel mitgenommen hatte, so wie er es immer machte, wenn er zweimal in der Woche in den Pub ging, wo er sich mit Freunden traf. Normalerweise trank er nicht im Übermaß, weil er zu geizig war, um Geld für alkoholische Getränke rauszuwerfen, aber wenn ihm jemand einen Whiskey ausgab, ohne zu erwarten, dass auch er dann eine Runde zahlte, sagte er nicht Nein.
Als endlich Ordnung in der Küche herrschte, setzte sich Maureen in den bequemen Schaukelstuhl ihrer Mutter und griff nach dem Strickzeug, das in einem Korb daneben lag. Sie kaufte ihre Wolle stets bei Mrs. Tandy, die ihren Laden in der Straße hatte. Sie war verwitwet, sehr gesprächig, ließ Maureen die Wolle unzenweise kaufen und legte den Rest für sie zurück. Maureen hatte schon immer gern gestrickt und fertigte im Augenblick ein Mützchen, Schühchen und ein Jäckchen für das Baby einer Mutter, die sich keine Wolle leisten konnte, an. Anne Riley hatte ihr von der Familie erzählt. Anne war zwar ein paar Jahre älter. Doch sie kannten sich bereits seit der Schulzeit und waren gute Freundinnen. Die junge Witwe Sally Jones stand ganz alleine mit drei Kindern da. Die fünfjährige Tochter war die älteste der drei, und eines Tages hatte Anne bemerkt, dass sie in Tränen ausgebrochen war, weil sie kein Pausenbrot mitbekommen hatte und an Geld für Essen in der Schulkantine nicht zu denken war.
»Ich habe ihr die Hälfte meines Sandwichs und meinen Apfel überlassen«, hatte Anne Maureen erzählt, als sie auf einen kurzen Schwatz vorbeigekommen war. »Später habe ich sie heimgebracht und dort gesehen, wie schwer es für die arme Sally ist. Sie gibt sich alle Mühe, aber woher sollte sie das Geld für Millys Essen in der Schule nehmen, wenn sie nichts verdient?«
»So wie ihr geht es allzu vielen Leuten in der Gegend, Anne – können wir nicht irgendetwas für sie tun?«
»Ich für meinen Teil werde versuchen, freie Krippenplätze für die beiden Jüngeren zu finden, damit sie zumindest ein paar Stunden arbeiten gehen kann – und dann will ich noch Peggy fragen, ob sie nicht bei ihren Gästen ein paar Spenden sammeln kann, weil Sally nicht einmal genügend Babykleider für den Jüngsten hat.«
»Weißt du, wie alt er ist? Ich habe ein paar hübsche Muster und kann gern etwas für ihn und die beiden anderen stricken, wenn du mir die Größen gibst.«
Gerade hatte sie den Rückenteil des Jäckchens fertig, als ein Klingeln sie nach unten in den Laden rief. Sie spähte durch das Fenster in der Tür ins Dunkle und rief: »Wer ist da? Wir haben geschlossen.«
»Nicht für mich, mein Schatz«, rief ihre Großmutter zurück. »Also sei bitte so gut und lass mich rein.«
»Gran!« Mit einem Lächeln auf den Lippen öffnete Maureen der kleinen, weißhaarigen Frau die Tür. »Was läufst du noch so spät draußen herum?«
»Ich bin durchaus noch jung genug, um abends unterwegs zu sein«, gab Hilda Jackson ungerührt zurück. »Mein Nachbar Martin Porter war bei mir, um mir zu sagen, dass man deinen Dad ins Krankenhaus verfrachtet hat. Anscheinend war er im Royal Oak ein paar Straßen weiter und ist dort zusammengeklappt. Martin war so nett, mir anzubieten, dir Bescheid zu geben, doch ich dachte mir, ich käme besser selbst her.«
»O nein.« Bei Hildas Worten wurde Maureen bang ums Herz. »Dad hat heute Abend nicht mit mir gesprochen. Er war sauer, weil ich ihm gesagt habe, ich ginge Freitagabend mit den anderen ins Gemeindehaus.«
»Typisch Henry.« Hilda schüttelte erzürnt den Kopf. »Er war schon immer selbst sein größter Feind. Sein Vater war genauso, aber damit hat er mich nicht kleingekriegt. Du lässt dir viel zu viel von ihm gefallen. Die meisten Mädchen deines Alters hätten ihn längst einfach sitzen lassen und sich einen netten Ehemann gesucht.«
Maureen wandte sich ab, denn ihren sanften grauen Augen war die Trauer sicher überdeutlich anzusehen. Doch sie war es gewohnt, ihre Gefühle zu verstecken, und schob sich die dunklen, ordentlich zu einem schulterlangen Bob geschnittenen Haare aus der Stirn. »Er käme nie allein zurecht.«
»Wahrscheinlich nicht – aber ich könnte ihm ja helfen –, und wenn er nicht so furchtbar geizig wäre, könnte er problemlos einen jungen Burschen fürs Geschäft bezahlen.«
»Er sagt, der Laden würde nicht genügend Geld abwerfen …«
Hilda schnaubte. »Quatsch. Er ist noch geiziger als sein verstorbener Vater – und mein Ron hatte am Ende seines Lebens ganz schön etwas angespart. Er hat mir meinen Anteil daran hinterlassen – das muss ich ihm lassen –, auch wenn ich den Laden Henry führen lassen muss. Sonst hätte ich ihn bereits vor die Tür gesetzt. Er sollte seinen Anteil an der Arbeit leisten, statt dir alles aufzuhalsen, Kind.«
»Die Arbeit stört mich nicht«, erwiderte Maureen und lächelte die alte Dame, der man ihre über siebzig Jahre niemals angesehen hätte, an. »Ich gehe einfach gerne ab und zu auch mal mit meinen Freundinnen aus.«
»Das sollst du auch.« Die alte Dame nickte zustimmend. »Wir können jetzt nichts tun, mein Schatz, aber am besten überlässt du deinen Vater erst mal mir. Du gehst auf jeden Fall am Freitag ins Gemeindehaus. Ich kümmere mich um ihn, falls er bis dahin aus dem Krankenhaus entlassen wird – wovon ich sicher ausgehe, da es bestimmt nichts Ernstes ist. Ich denke, es ist seine eigene Schuld, wenn er zusammenbricht.«
Die Enkeltochter schwieg, obwohl sie wusste, dass die Großmutter die Wahrheit sagte – aber Henry Jackson war wirklich lungenkrank. Das hatte ihr der Arzt gesagt, nachdem ihr Vater nach dem Tod ihrer Mutter krank geworden war.
»Das wird ihn sicherlich nicht umbringen, Maureen«, hatte ihr Doktor Bond erklärt. »Es heißt einfach, dass er gelegentlich schlecht Luft bekommt, aber wenn er vernünftig ist und sich nicht künstlich über alles aufregt, kommt er schon zurecht.«
Nur leider war ihr Vater geradezu erschreckend aufbrausend und obendrein entsetzlich stur. Ab und zu war er im Winter krank, obwohl er dann bei guter Pflege spätestens nach einer Woche wieder auf den Beinen war. Auf seine Bronchien aber war ganz einfach kein Verlass, und wenn er wütend wurde, hielt er häufig so lange den Atem an, bis er mit hochrotem Kopf zusammenbrach.
»Was soll ich machen, Gran?«, stieß sie verzweifelt aus. »Wenn ich an diesem Abend da gewesen wäre, wäre Mum vielleicht noch …«
»Hat Henry das zu dir gesagt?«, empörte sich die Großmutter. »Dann ist er ja noch schlimmer als sein alter Herr, schließlich hat er selbst deiner armen Mum das Leben schwergemacht. Ich habe sie gewarnt und ihr gesagt, dass sie sich gegen ihn behaupten muss, aber das hat sie nie geschafft. Die arme Doris war ein herzensguter Mensch und hat dich abgöttisch geliebt. Sie hätte nie versucht, dich festzuhalten.« Hilda legte eine Hand auf Maureens Arm und zwang sie sanft, ihr ins Gesicht zu sehen. »Hör zu, mein Schatz. Wenn du ihn lässt, macht Henry dir das Leben schwer. Es war nicht deine Schuld, dass deine Mum gestorben ist. Und falls jetzt auch dein Vater sterben sollte – nun, dann wäre es eben an der Zeit für ihn. Zur Not ziehe ich hier ein und achte darauf, dass er nicht über die Stränge schlägt.«
Das Letzte sagte sie mit einem solchen Nachdruck, dass Maureen bei allem Kummer einfach lachen musste, denn die Vorstellung, diese zierliche Person würde die Peitsche schwingen, um ihren Sohnemann auf Trab zu bringen, war wirklich amüsant.
»Ach, Gran, ich liebe dich. Komm rauf, dann koche ich dir einen Kakao, und danach bringe ich dich heim.«
»Ich gehe heute Abend nirgendwo mehr hin«, erklärte Hilda Jackson ihr in einem Ton, der keine Widerrede duldete. »Ich bleibe hier und leiste dir Gesellschaft, bis dein Vater nach Hause kommt. Und wenn er da ist, helfe ich euch, bis er wieder auf den Beinen ist. Egal, wie lange das auch dauern mag.«
2
Peggy lauschte dem Gespräch der Gäste über Henry Jackson, der im Royal Oak zusammengebrochen war. Er kam nicht oft in ihren Pub, wahrscheinlich, weil sie kein Verständnis für die Wutanfälle dieses Mannes und ihm bereits deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass sie fand, er nutze seine Tochter schändlich aus.
»Ich wette, das war alles inszeniert, um Maureen wieder einmal wegen irgendetwas unter Druck zu setzen«, sagte sie zu Laurence, als sie an diesem Abend auf dem Weg nach oben waren.
Der Tresen war gesäubert, und die Gläser waren gespült, da sie nie eine Arbeit unbeendet ließ. Morgens wischte sie die Tische, Stühle und den Fußboden im Pub sowie auf den Toiletten, da es immer wieder unachtsame Gäste gab, die die Spülung nicht betätigten, die auf den Sitz oder den Boden urinierten, sich erbrachen und das Handtuch einfach fallen ließen, wo sie gerade standen, wenn sie mit dem Abtrocknen der Hände fertig waren. Peggy hatte sich schon oft gefragt, wo diese Männer aufgewachsen waren, denn die Benutzung von Toiletten hatten sie anscheinend nie gelernt. Inzwischen hatten sie jemanden engagiert, der ihr beim Saubermachen half, doch Peggy war gerecht und teilte sich mit Nellie die Drecksarbeit, auch wenn diese behauptet hatte, diese Tätigkeit mache ihr nichts aus.
»Ich habe mein Leben lang geackert, Schätzchen«, hatte sie erklärt, als Peggy von ihr hatte wissen wollen, ob sie auch für das Putzen der Toiletten zur Verfügung stand. »Es gibt wahrscheinlich nichts, das ich nicht bereits gesehen habe und das mich noch überraschen kann.«
Peggy war erleichtert in ihr meckerndes Gelächter eingefallen, und seit diesem Tag waren sie die dicksten Freundinnen. Trotzdem hatte Nellie ihr ihre traurige Lebensgeschichte erst nach Monaten enthüllt und sich bis dahin nie auch nur mit einem Wort über ihr hartes Los beschwert. Im Grunde hatte sie es Peggy nicht erzählen wollen, es war ihr einfach während einer ihrer Unterhaltungen herausgerutscht. Sie hatte Tag und Nacht für andere geputzt, um sich und ihre beiden Kinder nach dem Tod ihres Mannes durchzubringen, der im Großen Krieg gefallen war. Sie war jetzt Mitte fünfzig, und der großen Liebe ihres Lebens war sie begegnet, nachdem sie fast dreißig Jahre lang für ihre kranke Mutter und die beiden jüngeren Geschwister da gewesen war. Dann aber war der Große Krieg gekommen, noch ehe ihre Tochter in der Folge eines wundervollen Besuchs von Dick im Jahre 1916, währenddessen er ihr seine Liebe eingestanden hatte, auf die Welt gekommen war. So glücklich wie bei seinem Heimaturlaub während diesen Jahres war sie niemals mehr gewesen, denn beim nächsten Mal war er mit einem Steckschuss in der Lunge und völlig verändert heimgekehrt und ein paar Monate nach Kriegsende gestorben, ohne zu erfahren, dass sie nochmals – dieses Mal mit einem Jungen – schwanger war.
»Was soll’s, Schätzchen? Für mich bleibt er auf diese Weise immer jung und attraktiv«, hatte sie Peggys Mitgefühl entschlossen abgewehrt. »Ich werde nie mit ansehen müssen, wie er an der Spüle steht und sein Gebiss sauber macht.«
Peggy bewunderte die andere Frau für ihren Mut und dafür, dass sie sich nie unterkriegen ließ, obwohl ihr Sohn und ihre Tochter inzwischen erwachsen und sie deshalb wieder ganz alleine war.
»Mein Pete, der dumme Junge, ist tatsächlich zur Armee gegangen«, hatte Nellie Peggy eines Morgens über einer Tasse Tee erzählt. »Und meine Amy überlegt, ob sie nach Weihnachten nicht zur Marine gehen soll.«
»Ich nehme an, sie denken, dass sie dort ein besseres Leben als hier in der Gegend haben können.«
»Das Einzige, was meinen Jungen erwartet, wenn es wieder Krieg gibt, ist, ein frühes Grab zu finden. Und wenn du mich fragst, legen es die Deutschen geradezu drauf an.«
Lächelnd hatte Peggy Nellie einen Teller mit selbst gebackenem Shortbread hingeschoben. Sie benutzte dafür immer jede Menge Butter, und ihre Familie liebte diese Köstlichkeit.
»Du verwöhnst mich, Peggy«, hatte Nellie dankbar festgestellt. »Ich nehme an, es war mein Glückstag, als ich wegen eines Jobs zu dir gekommen bin.«
»Ich hatte Glück, so jemanden wie dich zu kriegen. Einige der jungen Dinger, die ich vor dir hatte, waren sich für alles Mögliche zu fein.«
»Für mich ist meine Arbeit hier der reinste Urlaub, Schätzchen«, hatte Nellie grinsend festgestellt. »Du bist für mich wie eine zweite Tochter, Peggy Ashley, und ich würde alles für dich tun.«
Peggy war ganz warm ums Herz geworden, als sie das gehört hatte. Nellie war ein echtes Gewächs des alten East End, und man hätte ihr Gewicht in Gold aufwiegen sollen. Menschen wie sie waren das Salz der Erde, hätte ihr ihr Stiefvater erklärt. Sie hatte wirklich Glück mit ihren Freundinnen. Sie machten vieles wieder wett … jetzt aber finge sie am besten erst mal mit der Arbeit an.
*
»Müde, Liebes?«, fragte Laurence, als sich Peggy an diesem Abend auszog und an ihren Frisiertisch setzte, um das wenige Make-up, das sie benutzte, zu entfernen. Sie bürstete sich ihre honigblonden Locken aus und blickte ihn aus klaren, leuchtend blauen Augen an. »Die Gäste waren voll des Lobes für die feinen Käse-Lauch-Törtchen, die es heute Abend gab – aber wenn dir all die Arbeit irgendwann zu viel wird, könnten wir auch aufhören, so viel Essen zu servieren …«
»Wir haben deutlich nettere Gäste, seit es bei uns auch anständiges Essen gibt. Das Letzte, was wir brauchen, sind die Sorte Leute, die nur an den Wochenenden kommen, um sich volllaufen zu lassen und zu randalieren.«
»Und wir verdienen deutlich besser, seit du mit dem Kochen angefangen hast.« Trotzdem wirkte Laurence noch nicht wirklich überzeugt. »Aber ich will nicht, dass du es mit der Arbeit übertreibst. Ich habe keine Ahnung, was ich machen würde, wenn du irgendwann zusammenbrechen würdest ...«
»Keine Angst.« Sie legte ihm die Arme um die Taille, denn sie liebte es, den Körper ihres Mannes zu berühren. Er hatte kein Gramm Fett zu viel und war nach all den Jahren immer noch so herrlich straff und muskulös wie zu der Zeit, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Damals war sie noch ein Schulmädchen gewesen, und ihre Freundinnen hatten ihr von einem gut aussehenden Burschen, der im Pub seines Onkels aushalf, vorgeschwärmt. Natürlich hatten sie damals nicht geahnt, dass er einmal genug von seinem Onkel erben würde, um den Pub dann nach dem Krieg zu übernehmen und selbst zu führen. »Ich bin zwar müde, aber auch nicht mehr als sonst, und davon abgesehen fühle ich mich pudelwohl. Gerade habe ich über Nellie nachgedacht … sie hatte es im Leben alles andere als leicht.«
»Das glaube ich.« Ihr Mann bedachte sie mit einem nachsichtigen Blick. »Du hast ein großes Herz, Peggy, und wenn du könntest, nähmst du sicher alle Streuner dieser Erde bei dir auf. Für wen war übrigens das Essen, das du vorhin aus dem Haus getragen hast? Wahrscheinlich für die Bartons, stimmt’s? Und wem helfen wir sonst noch gerade alles aus?«
»Ich nehme an, du hast die Strampler auf dem Flurtisch liegen sehen. Die sind für Sally Jones, die ihren Mann verloren hat. Seit seinem Unfalltod steht sie alleine mit drei kleinen Kindern da. Im Gegensatz zu ihnen hat es unserem Nachwuchs nie an irgendwas gefehlt.«
»Dafür haben wir beide schließlich pausenlos hart geschuftet«, rief er ihr in Erinnerung. »Es war nicht immer leicht, und während ich mich von den Kriegsfolgen erholen musste, hattest du die Hauptlast der Arbeit zu tragen.«
»Ich war nur froh, dass du zurückgekommen bist«, erklärte sie und blickte zu ihm auf. »Ich liebe dich, Laurie. Das weißt du, oder?«
»Ja, ich weiß.« Er neigte seinerseits den Kopf, und als er leidenschaftlich seinen Mund auf ihre Lippen drückte, wogte ein Gefühl der Wärme in ihr auf, und sie ließ sich mit ihm auf die Matratze ihres Bettes fallen. Sie schmiegten sich begehrlich aneinander an, denn ihre Körper wussten nach so vielen Jahren von alleine, was dem jeweils anderen gefiel. Da sie ein reges Liebesleben hatten, fand es Peggy immer wieder überraschend, dass sie lediglich zwei Kinder hatten, aber vielleicht hatte ja die Mumpserkrankung ihres Mannes kurz nach Pips Geburt ihn unfruchtbar gemacht.
»Falls es noch mal Krieg gibt, wirst du doch bestimmt nicht eingezogen, oder, Laurie?«, fragte sie, als sie in ihrem wohlig warmen Bett an seiner Seite lag.
»Ich glaube nicht, dass es noch einmal dazu kommen wird«, gab er zurück. »Ich weiß, sie haben im West End rund um alle wichtigen Gebäude Sandsäcke verteilt und Gräben ausgehoben, und sie reden davon, Kinder aus der Stadt aufs Land zu schicken, aber meiner Meinung nach ist das bloß heiße Luft. Die Deutschen haben den letzten Krieg verloren, und eine solche Schmach wollen sie doch sicher nicht noch mal riskieren.«
»Vielleicht ist ihre Niederlage ja der Grund, dass sie es jetzt noch mal versuchen wollen«, stellte Peggy ängstlich fest. »Mit Hitler und seinen jugendlichen Schlägertrupps ist nicht zu spaßen. Gestern haben sie im Kino einen ihrer Aufmärsche gezeigt, der hat mir wirklich Angst gemacht.«
»Solange diese Kerle lediglich in Deutschland auf und ab marschieren und dabei salutieren und rumbrüllen, machen sie uns keinen Ärger.« Schläfrig schnupperte ihr Mann an ihrem Hals und fragte: »Habe ich dir je gesagt, wie gut du riechst, mein Schatz?«
»Du elender Schmeichler«, meinte sie, auch wenn sie wusste, dass er ihre Antwort nicht mehr mitbekam. Im Gegensatz zu ihr brauchte er nämlich nur die Augen zuzumachen und schlief auf der Stelle ein.
Sie selbst läge sicherlich noch eine ganze Weile wach, denn das Gespräch mit Nellie über deren Kinder hatte sie ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht. Sie selbst hatte einen sechzehnjährigen Sohn und konnte bloß hoffen, Pip käme nicht auf den Gedanken, zur Armee zu gehen. Und ihre Tochter Janet hatte einen guten Job bei einer Werft in den East India Docks und offenbar seit ein paar Wochen einen Freund. Sie hatte sie gefragt, ob sie ihn mit zu Peggys Weihnachtsfeier bringen dürfte, die inzwischen das gesellschaftliche Großereignis überhaupt in der Straße war, weil sie den Pub an diesem Tag für Fremde schlossen und allein die Stammgäste zu kostenlosem Essen und Freigetränken eingeladen waren.
An diese Dinge dachte Peggy, als sie an der Seite ihres leise vor sich hin schnarchenden Gatten lag. Sie hatte wirklich Glück im Leben, denn sie hatte einen guten Mann, zwei wunderbare Kinder, eine Arbeit, die ihr Freude machte, und dazu noch einen äußerst netten Freundeskreis. Aus irgendeinem Grund jedoch war Laurence seit einer ganzen Weile ungewöhnlich rastlos und fuhr sie bereits bei den kleinsten Kleinigkeiten ungehalten an. Er war schon immer aufbrausend gewesen, aber früher waren sie dann ins Bett gegangen, um sich zu vertragen, während heute … irgendwas war anders, doch sie hatte keine Ahnung, was.
*
Laurence wurde wach und sah das orangefarbene Dämmerlicht, das durch das Fenster fiel. Wie ging noch mal das alte Sprichwort? Abendrot – Schönwetterbot. Morgenrot – Schlechtwetter droht … Wahrscheinlich würde es also ein bitterkalter Tag werden und vielleicht sogar schneien.
Widerstrebend wälzte er sich aus dem warmen Ehebett. Für ihn war es der schlimmste Augenblick des Tages, wenn er aus der wunderbaren Wärme runter in die kalte Küche musste, um sie einzuheizen, damit Peggy es behaglich hätte, wenn sie später runterkam. Und dann müsste er nachsehen, ob der Ölofen in ihrem Toilettenhäuschen vielleicht ausgegangen und das Wasser in der Schüssel des Klosetts gefroren war. Das war im ersten Winter nach dem Einzug in den Pub passiert, und es war ein verdammter Knochenjob gewesen, es vor Eintreffen der ersten Gäste wieder aufzutauen.
Peggy arbeitete morgens immer in der Küche, denn sie hatten mittags für gewöhnlich jede Menge Gäste und die Männer aßen während ihrer Mittagspause gerne eine Kleinigkeit zu ihrem Bier. Mittags kamen überwiegend Handelsreisende, Auslieferungsfahrer, Büroangestellte und ein paar Frauen aus den Geschäften der Umgebung, die ein Sandwich nahmen und statt Bier eher Tee oder Kakao. Abends tauchten dann die jungen Frauen aus den Fabriken in Begleitung ihrer Freunde oder anderer Frauen auf. Zu dieser Tageszeit machten sie aus Laurence’ Sicht das richtige Geschäft. Er hatte sich schon oft gewünscht, er bräuchte nur am Abend aufzumachen, aber wenn er das versuchte, würde ihm die Brauerei wahrscheinlich sofort die Lizenz entziehen. Es war nicht gut, dass sie an eine Brauerei gebunden waren, der Pub jedoch gehörte von jeher Greene King, und Laurence konnte es sich nun einmal nicht leisten, ihn zu kaufen und dann endlich völlig frei zu sein.
Die weiße Frostschicht auf dem Kopfsteinpflaster knirschte unter seinen Sohlen, als er durch den Hof in Richtung des Toilettenhäuschens ging. Er atmete erleichtert auf, weil das Klosett anders als befürchtet doch nicht eingefroren war, drehte den Ölofen etwas herunter und lief schnellen Schrittes zurück zum Haus. Jetzt müsste er das Feuer in der Küche schüren, anschließend im Salon und in der Bar. Peggy und er selbst hassten es zu frieren – und er wagte nicht, daran zu denken, was geschähe, würde irgendwann der Brennstoff knapp.
Er hatte Peggys Angst vor einem neuerlichen Krieg zwar abgetan, weil sie sich keine Sorgen machen sollte, aber in Wahrheit fürchtete auch er, dass eine neue kriegerische Auseinandersetzung mit den Deutschen unvermeidbar war. Es wäre eine Schande, alles zu verlieren, was sie sich hier aufgebaut hatten, und er war sich sicher, dass ein neuerlicher Krieg noch schlimmer würde als der, in dem er selbst gewesen war. Zwar hatten auch die Zeppeline die Bevölkerung in Todesangst versetzt, verglichen aber mit den Flugzeugen und Waffen, die es heute gab, nähmen sie sich wie Kinderspielzeug aus. Laurence wusste, dass er durchaus selbst noch mal dazu aufgerufen werden könnte, für sein Land zu kämpfen, denn mit dreiundvierzig galt man heutzutage beinahe noch als jung, und wenn es zum Schlimmsten käme, zöge man bestimmt auch Männer seines Alters noch heran.
Stirnrunzelnd überlegte er, was es für Peggy heißen würde, wenn er abermals gezwungen wäre, in den Krieg zu ziehen. Sie kochte, putzte und bediente und trug dadurch jetzt schon einen großen Teil zur Führung ihrer Wirtschaft bei. Könnte sie sie, wenn er eingezogen würde, ganz alleine weiterführen? Natürlich würde Pip ihr etwas unter die Arme greifen, bis er irgendwann aufs College ginge, und auch Janet half ihr ab und zu im Schankraum aus, im Grunde jedoch wäre sie dann ganz auf sich gestellt.
Mit Mitte fünfzig hatten sie in Rente gehen wollen. Bereits seit Jahren legte er dafür Geld zur Seite, aber er versagte seiner Frau und seinen Kindern nichts und hatte deshalb längst noch nicht genügend angespart. Sie konnten es sich noch nicht leisten, ihre Wirtschaft aufzugeben, also müsste Peggy, wenn er eingezogen würde, dafür sorgen, dass der Laden weiterlief.
Eins wusste er mit Sicherheit: Er ginge nur, wenn er gezwungen würde, noch mal zur Armee. Urplötzlich wogten die Erinnerungen an den Schlamm der Gräben, an die durchgeweichten Stiefel und die feuchte Kälte in ihm auf. Er hatte dort gelegen, während rund um ihn herum die Sterbenden wie Säuglinge nach ihren Müttern schrien und alle anderen stumm ertrugen, was nicht auszuhalten war. Kein Mann, der dieses Grauen hatte miterleben müssen, würde je vergessen können, wie es dort gewesen war. Sie konnten die Erinnerungen bloß verdrängen und hoffen, dass sie irgendwo in einem möglichst kleinen Winkel des Gehirns gut aufgehoben waren.
Er schüttelte die unerwünschten Bilder ab und ging ins Bad, um sich zu waschen und zu rasieren. Vielleicht machte er sich ja ganz unnötig Gedanken, und es bliebe alles, wie es war. Am besten dachte er statt an den Krieg an Weihnachten. Natürlich würde Peggy wieder groß mit ihren Gästen feiern wollen, und auch wenn ihn der Verlust der Einnahmen an diesem Abend reute, würde er ihr diesen Wunsch auf jeden Fall erfüllen. Sie bat ihn schließlich nicht um eine Woche irgendwo am Meer. Dieses Angebot hatte er ihr gemacht, als die Kinder klein gewesen waren, aufgrund der vielen Arbeit aber hatte sie in all den Jahren nie so lange Urlaub machen wollen.
Er öffnete das Hoftor für die Lieferung der Brauerei und sah, dass Nellie pünktlich wie gewohnt zur Arbeit kam.
»Morgen, Mr. Ashley«, grüßte sie. »Echt frisch heute, nicht wahr? Bestimmt gibt es heute Schnee.«
»Das würde mich nicht überraschen«, stimmte er ihr zu. »Aber schließlich haben wir in zwei Wochen auch schon Weihnachten, da muss man damit rechnen, dass es schneit …«
»Erinnern Sie mich bloß nicht daran.« Nellie lachte meckernd auf. »Ich bin noch nicht zum Einkaufen gekommen – doch ich will, dass es für meine Kinder diesmal etwas ganz Besonderes wird. Mein Pete ist zur Armee gegangen und fängt gleich nach den Feiertagen seine Ausbildung dort an – und Amy ist so dumm, es ihrem Bruder gleichzutun.«
»Hat Peggy Sie zu Ihrer Weihnachtsfeier eingeladen?«
»Klar. Und sie hat ausdrücklich gesagt, dass ich die Kinder mitbringen soll. Ihre Peggy ist ein wunderbares Mädchen, Mr. Ashley.«
»Ja, ich weiß. Kommen Sie rein, und stellen Sie erst mal den Wasserkessel auf den Herd. Dann trinken wir zusammen einen Tee und fangen danach mit der Arbeit an.«
Nachdenklich marschierte Laurence in die Küche und heizte den Ofen noch ein bisschen stärker ein. So früh wie Nellies Sohn hatte sich bisher kaum jemand freiwillig zur Armee gemeldet, aber wenn die Nachrichten noch schlimmer würden, täten es ihm sicher unzählige junge Männer gleich. Er hoffte nur, dass nicht auch Pip so schnell wie möglich zur Armee gehen wollen würde, obwohl er selbst im Großen Krieg ebenfalls sofort dabei gewesen war. Er war neunzehn Jahre jung gewesen, als es angefangen hatte, und so schnell wie möglich eingerückt. Er hatte Peggy damals schon den Hof gemacht und sie in seinem ersten Heimaturlaub offiziell zu seiner Frau gemacht, auch wenn die Kinder erst nach Ende des verdammten Krieges gekommen waren.
Er hatte große Pläne für seinen Sohn. Er selbst hatte sich mit einer Existenz als Kneipenwirt begnügt und sich gesagt, er hätte wirklich Glück gehabt, doch er war alles andere als dumm und wünschte sich bereits seit Jahren, er hätte mehr aus sich gemacht. Und Pip war wirklich klug und könnte mühelos aufs College gehen. Zwar wusste Laurence nicht genau, wie es dann für ihn weitergehen sollte, aber eine Stelle fort vom Elend und dem Schmutz des East End irgendwo als Architekt oder als Flugzeugingenieur wäre genau das Richtige für ihn. Pip liebte Flugzeuge und hatte ein paar selbst aus Balsaholz gebaute Exemplare an der Decke seines Zimmers aufgehängt. Genau: Er wünschte seinem Jungen einen angenehmen, sicheren Job, statt dass er irgendwo in einem schmuddeligen Graben läge, wo ihm Wasser in die Stiefel sickern und die Ratten an den aufgeblähten Leichen seiner Kameraden nagen würden, deren Lachen erst ein paar Stunden zuvor verklungen war. Nach seiner eigenen Zeit im Schützengraben musste er jetzt einfach hoffen, seinem Jungen bliebe Ähnliches erspart.
Als junger Bursche hatte Laurence eigentlich aufs College gehen wollen, und da sich seine eigenen Eltern seinen Schulbesuch nicht hatten leisten können, hatte er im Lauf der Jahre für das Studium seines Sohns gespart. Er war zwar nur ein kleiner East-End-Wirt, doch seinem Jungen sollte die Gelegenheit, etwas aus sich zu machen, nicht verwehrt bleiben.
»Wo warst du?«, fragte er, als Peggy gähnend in die Küche kam. »Nellie und ich haben schon Tee gekocht und uns gefragt, ob ihn die Gnädige vielleicht im Bett serviert bekommen will.«
Sie ignorierte seinen Seitenhieb und prüfte, ob der Ofen bereits warm genug zum Backen war. »Ich mache heute Morgen ein paar Scones und Sodabrot«, erklärte sie »Und dazu eine wärmende Gemüsesuppe, denn die tut bei einem solchen Wetter einfach gut.«
»Köstlich«, stellte Nellie anerkennend fest. »Bei derart feinem Essen wundert es mich nicht, dass man im Schankraum mittags kaum noch einen Platz bekommt. Wir haben gerade gesagt, dass es bis Weihnachten nur noch zwei Wochen sind. Wenn ich es schaffe, hole ich uns dieses Jahr eine Gans. Dann hat mein Junge was Besonderes, an das er sich im Feld erinnern kann.«
»Morgen, Dad. Morgen, Mum.« Pip fegte durch die Küchentür. Er trug den Ranzen lässig über einer Schulter, und seine dunklen Haare fielen bis auf den Kragen seiner Uniform. Sie waren zu lang, im Grunde aber stand ihm die Frisur, und wie sein Vater sah auch er ein bisschen wie Clark Gable aus. Er kaute noch an einem Stückchen Toast mit Bratenfett, mit dem er aus der Küche ihrer Wohnung oberhalb des Pubs gekommen war. »Hast du mir Brote zubereitet, Mum?«
»Sie liegen in der Speisekammer«, sagte sie und lächelte, als sie von ihrem Jungen einen fettigen Schmatzer ins Gesicht gedrückt bekam. »Und dazu habe ich dir auch noch eine Essiggurke, einen Apfel und ein bisschen Shortbread eingepackt.«
»Du bist einfach die Beste«, meinte er und blickte Nellie an. »Ich habe gestern Abend Ihren Pete getroffen, Mrs. Maggs. Er hat erzählt, er wäre jetzt bei der Armee. Ich wünschte mir, ich wäre alt genug, doch leider dauert es noch ewig, bis ich endlich achtzehn bin. Ich hoffe nur, dass dieser Krieg nicht allzu schnell zu Ende geht.«
»Bisher hat er noch gar nicht angefangen«, klärte Laurence ihn mit scharfer Stimme auf. »Und da ich daran zweifele, dass es jemals dazu kommen wird, wirst du aufs College gehen.«
»Falls ich die Prüfungen bestehe«, schränkte Pip mit einem breiten Grinsen ein und wandte sich dann wieder seinem eigentlichen Thema zu. »Es gibt ganz sicher Krieg, aber ich gehe zu den Fliegern und nicht zur Armee. Ich will Pilot werden …«
»Was ohne Schulabschluss nicht geht.« Sein Vater atmete erleichtert auf.
»Ich weiß.« Noch immer hatte Pip das Grinsen im Gesicht, dem alle jungen Mädchen in der Gegend hoffnungslos verfallen waren. »Deshalb werde ich die Schule fertig machen und dann bis zum Kriegsbeginn aufs College gehen. Aber falls sie mich dann brauchen und bereit sind, mich zum Flieger auszubilden, gehe ich auf alle Fälle hin.«
»Am besten tust du, was dein Vater sagt, denn du bist schlau genug, um, statt zu fliegen, selbst Maschinen zu entwerfen, die noch besser als die bisherigen Flieger sind«, riet ihm seine Mutter mit sanfter Stimme. Sie hoffte, dass ihr ihre Angst nicht anzuhören war, doch Laurence und wahrscheinlich auch der Junge kannten sie zu gut, erkannte sie, als Pip mit einem neuerlichen Grinsen durch die Hintertür verschwand.
Im selben Augenblick kam Janet aus dem oberen Geschoss. Sie musste gleich zur Arbeit und trug einen schlichten grauen Mantel über einem eleganten Bleistiftrock aus Tweed. Mit ihrem sanft gelockten, ordentlich zu einem kurz Bob frisierten Haar und den geheimnisvollen grünlich-blauen Augen sah sie mindestens so hübsch wie ihre Mutter aus.
»Wie wäre es mit einem Tee, bevor du gehst?«, bot Peggy an.
Janet schüttelte den Kopf. »Mike wartet vor der Tür. Mir hat der Rest des Tees, den es oben gab, gereicht. Auch wenn Pip mir wieder mal fast alles weggetrunken hat …«
»Dann mache ich dir schnell noch eine Tasse.«
»Keine Zeit. Im Gegensatz zu manchen anderen Leuten muss ich schließlich arbeiten«, erklärte Janet und stolzierte erhobenen Hauptes aus dem Raum.
»Nicht so vorlaut, Fräulein«, bellte Laurence seiner Tochter hinterher, sie aber würdigte ihn keiner Antwort und verließ einfach das Haus. »Eines Tages wird sie sich mit ihrem losen Mundwerk noch in ernste Schwierigkeiten bringen«, murmelte er düster, doch im Grunde war er voll Bewunderung für seine kühne, wunderhübsche Tochter und stolz darauf, dass sie – auch wenn sie mit dem honigblonden Haar, das in der Sonne heller wurde, und den hellen Augen Peggy wie aus dem Gesicht geschnitten war – in anderer Hinsicht eher nach ihrem Vater schlug. Genau wie er sagte sie immer, was sie dachte, und obwohl sie sich nur selten stritten, sprühten Funken, wenn es doch einmal zu einer Auseinandersetzung kam.
»Ich schätze, sie bricht morgens extra etwas früher auf, damit sie noch ein Stück mit Mike spazieren gehen kann«, stellte Peggy fest. »Es wäre mir zwar lieber, wenn sie es langsamer angehen würde, aber schließlich ist sie achtzehn und kein kleines Mädchen mehr.«
»Trotzdem braucht sie sich nicht einzubilden, dass das zwischen ihr und diesem Mike was Ernstes wäre. Über eine Heirat können wir in ein, zwei Jahren reden, früher nicht.«
»Ich war bei unserer Hochzeit auch noch keine zwanzig«, rief ihm Peggy in Erinnerung.
»Das war was anderes«, beharrte er auf seiner Position, und resigniert wandte sich Peggy wieder ihrer Arbeit zu.
Verstohlen lächelnd ging er in die Bar, um dort die Gläser zu polieren, denn Peggy wusste, dass er bei diesem Thema unerbittlich war. Er würde niemals zulassen, dass seine Tochter so zu kämpfen hätte wie er selbst und Peggy in der ersten Zeit nach ihrer Hochzeit, und es würde Janet sicherlich nicht schaden, mit der Gründung einer eigenen Familie noch zu warten, bis sie zwanzig oder älter war …
3
»Hier sind ein paar Trauben, Dad.« Maureen betrachtete den Mann, der aufrecht in den Kissen saß. Er wirkte alles andere als krank, doch ihm war deutlich anzusehen, dass es ihm überhaupt nicht passte, hier im Krankenhaus gefangen zu sein. Sie waren Mitglieder der Krankenkasse, deshalb würde ihn die Behandlung nichts kosten, aber für das Essen und die Übernachtung müssten sie wahrscheinlich etwas zahlen. »Wie fühlst du dich?«
»Hast du ein sauberes Hemd für mich dabei?«, erkundigte er sich in barschem Ton. »Sie haben meins mitgenommen und gewaschen, weil ich Bier darauf verschüttet habe, als ich ohnmächtig geworden bin – und ich will endlich wieder heim.«
»Hat denn der Arzt gesagt, dass du nach Hause gehen darfst?«
»Ich wüsste nicht, was ihn das angeht«, herrschte er sie an. »Falls er oder die Schwestern, die sich ungefragt in alles einmischen, sich einbilden, ich würde für das zweifelhafte Privileg bezahlen, hier eine Woche tatenlos herumzuliegen, haben sie offensichtlich den Verstand verloren.«
»Ach, Dad, es ging dir gestern Abend wirklich schlecht. Der Arzt hat mir gesagt, dass sie dich noch zwei Nächte zur Beobachtung hierbehalten wollen.«
»Davon bin ich überzeugt. Aber ich kann es mir nicht leisten, Geld für so etwas zum Fenster rauszuwerfen«, klärte er sie mit empörter Stimme auf.
»Dann wärst du also lieber tot?«, erkundigte sich Maureen ruhig. »Der Arzt hat mir nämlich gesagt, dass er dich weiter untersuchen will, denn vielleicht hast du so was wie einen leichten Herzinfarkt gehabt.«
»Unsinn. Es waren einfach meine Lungen, genau wie sonst … und du warst schuld an meinem Anfall, weil du ständig ausgehen musst und nie an deinen armen, alten Vater denkst …«
»Das ist nicht wahr«, gab sie, um ihn nicht aufzuregen, möglichst sanft zurück. »Ich gehe nur sehr selten einmal aus. Außerdem ist Gran ja da und wird sich um dich kümmern, falls du morgen schon entlassen wirst.«
»Wenn«, murmelte er und schob nervös die Beine unter seiner Decke hin und her. »Ich bleibe keine weitere Nacht an diesem Ort. Du fährst jetzt heim, holst mir mein Hemd und fragst die Schwestern, was mit meinen Kleidern ist.«
»Ich nehme an, die liegen irgendwo in einem Spind. Ich werde fragen, aber diese Tests solltest du wirklich machen lassen, Dad. Du willst doch sicher nicht noch mal umkippen, oder? Beim nächsten Mal geht es vielleicht nicht mehr so glimpflich aus.«
Er funkelte sie zornig an, doch schließlich nickte er zum Zeichen, dass er sich geschlagen gab. »Das Hemd bringst du mir aber trotzdem her, denn ganz egal, was diese Leute sagen, komme ich auf alle Fälle morgen wieder heim.« Er sah sie fragend an. »Was machst du überhaupt um diese Zeit bei mir im Krankenhaus, statt im Geschäft zu stehen?«
Sie zählte stumm bis zehn. »Ich wollte einfach sehen, wie es dir geht, und dir erzählen, dass im Laden alles bestens läuft. Gran hilft mir, wo sie kann, und heute früh war ich beim Großhändler und habe alles, was wir brauchen, eingekauft.«
»Woher hattest du das Geld, und wie waren die Bedingungen, die du ausgehandelt hast?«, fuhr er sie alles andere als dankbar an. »Die Leute brauchen dich nur anzusehen, um zu wissen, dass man dich problemlos hinters Licht führen kann.«
In diesem Augenblick trug eine Schwester eine Bettpfanne an Henrys Bett vorbei. Sie war zwar abgedeckt, doch der Geruch war alles andere als angenehm, und Maureen konnte nachvollziehen, dass ihr Vater keine Lust hatte, hier länger auszuharren, als nötig war.
»Keine Sorge, Mr. Stewart war sehr nett. Er wünscht dir gute Besserung und hat mir alles zu denselben Preisen überlassen, die du auch bei ihm bekommst. Das Geld habe ich aus der Blechdose genommen, die in deinem Schreibtisch steht.«
»Ach ja?« Die heiße Röte, die ihm bei der Frage ins Gesicht stieg, war wahrscheinlich alles andere als gesund. »Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du es in Zukunft unterlassen würdest, in meinen privaten Sachen rumzuschnüffeln, Fräulein.«
»Keine Angst, die Rechnung und das Restgeld habe ich dir hingelegt«, gab Maureen ungerührt zurück. »Es ist im Übrigen bestimmt nicht gut für dich, wenn du dich derart aufregst, Dad. Vor allem solltest du dich freuen, denn ich habe günstig Lachs bekommen und bereits den größten Teil davon verkauft.«
»Wobei du sicher nicht genügend draufgeschlagen hast«, knurrte ihr alter Herr. »Dass man was billig kriegt, heißt nicht, dass man es auch verramschen muss. Aus dir wird niemals eine richtige Geschäftsfrau, Kind.« Er nestelte nervös an seiner Bettdecke, als wollte er sie abwerfen, um aufzustehen.
»Mr. Stewart hat gesagt, ich sollte ihn zu unserem normalen Preis verkaufen, und das habe ich getan. Wir haben pro Büchse einen Shilling und Sixpence gutgemacht. Das fand ich wirklich gut.« Es war sogar hervorragend, weil die Gewinnspanne bei Büchsenware meistens nicht einmal Sixpence und bei Gebäck und anderen Waren noch weniger betrug. Das Einzige, was mehr einbrachte, war die teure Schokolade, die sie ab und zu an Weihnachten verkauften oder wenn es um ein Geschenk zu einem Geburtstag oder anderen besonderen Anlass ging. Das war auch ihrem Vater klar, denn alles, was ihm an Kritik noch einfiel, war: »Dann können wir nur hoffen, dass das Zeug noch nicht verdorben war …«
»Auf keinen Fall. Ich habe extra nachgefragt, und Mr. Stewart hat mir ausdrücklich versichert, dass es an dem Lachs nichts auszusetzen gibt. Er hat einem neuen Lieferanten eine große Menge günstig abgekauft und diesen guten Preis dann auch seiner Stammkundschaft gewährt. Die anderen haben pro Büchse einen Shilling mehr bezahlt.«
Ihr Vater stieß ein dumpfes Knurren aus, von dem Maureen nicht sagen konnte, ob es Ausdruck der Zufriedenheit oder erneuten Widerwillens war. Sie hatte nicht erwartet, dass er sie für ihren Einkauf loben würde, doch zumindest hörte er ihr schweigend zu und nickte hin und wieder stumm, als sie berichtete, dass Mr. Stewart ihr empfohlen hatte, Büchsenware und vor allem Zucker einzulagern, der womöglich bald schon Mangelware war.
»Also habe ich zwei Dutzend Büchsen Rübensirup mitgenommen«, fügte sie hinzu. »Den kann man gut zum Süßen nehmen, wenn man keinen Zucker hat.«