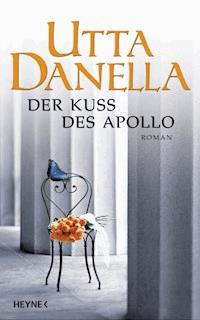6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
60er-Jahre in der Nähe von Frankfurt. Die Familie der von Talliens gehört seit den Zeiten des Großherzogtums zu den angesehenen Familien der kleinen Stadt. Auch nach den Weltkriegen lebt die Familie noch auf dem Stammsitz und betreibt erfolgreich eine Druckerei. Doch ein Fluch scheint auf den Frauen der stolzen Talliens zu liegen. Barbara, die über alles geliebte Schwester des aktuellen Familienoberhaupts Julius, verließ die Familie zwischen den Kriegen, mit einem verheirateten, sehr viel älteren Mann. Und nun kommt ihre Tochter, auch eine Barbara von Tallien, nach dem Tod der Mutter aus Italien, wo sie die letzten schweren Jahre verbracht hat. Auf Schritt und Tritt verfolgt sie der Schatten der schönen, lebenslustigen Mutter, die von der Familie verstoßen wurde. Und auch sie scheint einen ähnlichen Weg zu gehen: eine verbotene Liebe, die den Familienfrieden zu zerstören droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 846
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Die Frauen der Talliens
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet:www.hockebooks.de
Utta Danella: Die Frauen der Talliens. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1958 im Schneekluth Verlag, Darmstadt erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von Oleg Gekman /shutterstock.com und Erik Laan/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51350-2
www.uttadanella.de
www.ava-international.de
I
1
Die Bahnhofsuhr zeigte vier Minuten vor sieben. Noch zehn Minuten bis zur Ankunft des Zuges. Julius von Tallien parkte seinen Wagen auf dem Bahnhofsplatz. Doch er stieg nicht gleich aus. Er blieb sitzen und blickte missvergnügt durch die Scheibe. Es war schon fast dunkel, und es hatte angefangen zu nieseln. Kalt war es nicht, eher ein wenig dämpfig, wie so oft in dieser Stadt. Es war das Wetter, das sich auf sein Herz legte. Er spürte es dann als eine kompakte Masse in der Brust, sehr groß war es, nahe unter die Haut gerückt. Er hatte das Gefühl, er brauche nur hinzugreifen, um es ein wenig zurückzuschieben, dann würde es wieder kleiner sein, nicht mehr zu bemerken. Leichte Gefäßstörungen nannte es sein Hausarzt. Nicht weiter gefährlich, aber man müsse es beobachten und in vielen Dingen vorsichtiger sein. Ein bisschen langsamer gehen im täglichen Geschehen, die Arbeit nicht übertreiben und auch mit dem Rauchen zurückhaltender sein.
Der alte Doktor blickte dabei über seine Brille prüfend auf den Patienten und meinte warnend, es sei das Leiden fast aller Männer seines Alters in der heutigen Zeit. Es sei auch kein Wunder, man hätte schließlich genug erlebt, nicht wahr, genug Belastendes und Niederdrückendes, und das Tempo dieser Tage sei nicht dazu angetan, die Menschen friedvoller und ausgeglichener zu machen. Wenn sich auch die Zeiten geändert hätten, die Konstitution des Menschen sei im Grunde doch die Gleiche geblieben. Das dürfe man nicht vergessen. Wir leben nicht bloß, um zu arbeiten, sagte der Arzt dann wohl noch. Denken Sie an Ihren Vater. Er hat ein erfülltes Lebenswerk hinter sich gebracht, hat stets seine Pflicht getan, aber was Hast war, unwürdige Eile, das hat er nicht gewusst. Er kannte noch die Muße, die Freude an den schönen Dingen des Daseins, und er ist dabei 79 Jahre alt geworden. Und ich bin der Überzeugung, dass er heute noch lebte, wenn der Krieg nicht gewesen wäre.
Julius nickte dazu, aber er schwieg. Sein Leben mit dem des Vaters zu vergleichen, hatte wenig Sinn. Als sein Vater so alt war wie er heute, lag dieses Lebenswerk, von dem der Arzt sprach, schon hinter ihm. Er, Julius aber, hatte wieder von vorn beginnen und sich dabei den Bedingungen der heutigen Welt fügen und anpassen müssen. Mit einem allerdings hatte der Doktor recht. Die Zeiten hatten sich gewandelt. Und wie sie sich gewandelt hatten. Schon zu Lebzeiten des alten Herrn. Nur, dass der keine Notiz davon genommen hatte. Er kannte nicht nur die Muße und die Freude an den schönen Dingen des Lebens, er kannte auch den Eigensinn und den Dünkel, und er leistete sich die Überheblichkeit des Grandseigneurs zu ignorieren, was ihm nicht behagte. Er blieb bis an sein Lebensende, was er gewesen war. Raoul, Baron von Tallien, der Mann vom Hofe, Minister des Großherzogs, ein Mann von Wissen und Würde, ein Herr in hohem Rang. Noch als die Bomben auf die Stadt fielen, saß er so zwischen ihnen, gerade aufgerichtet die schlanke Reiterfigur, unbewegt das scharf geschnittene alte Gesicht, ein Zug von Verachtung um die schmalen Lippen. Seine Augen blickten fremd über sie hinweg.
Manchmal jedoch kam eine seltsame Weichheit in diese Augen, ein verlorener, fast sehnsüchtiger Ausdruck. Julius hatte ihn nicht zu deuten gewusst. Der Vater sprach erst, als er sterben musste. An seine Tochter hatte er gedacht, an die verlorene und verschollene Tochter, das Kind, das er am meisten geliebt und das ihn am tiefsten enttäuscht und verwundet hatte.
»Kümmere dich um sie«, das war der letzte Auftrag, den er seinem Sohn gab. »Du musst sie finden. Sie soll nach Hause kommen. Es wird Zeit. Sie gehört hierher. Und von allem, was da ist, gehört ihr die Hälfte, Julius. Hörst du mich?«
»Ja, Vater«, hatte er erwidert. Es gab nichts Schriftliches über diesen Letzten Willen. Aber für Julius anullierte es das Testament des Alten, in dem von der Tochter nicht die Rede war. Es machte Julius nichts aus. Er war nicht geldgierig. Und damals, im Jahre 1944, war es ohnedies gleichgültig. Der Betrieb war zerstört, das Haus schwer beschädigt, der Himmel wusste, ob man es behalten würde, vom übrigen Besitz war kaum noch etwas geblieben, in die Zukunft, an das, was später kommen würde, vermochte zu jener Zeit keiner zu denken.
Rückschauend konnte man jetzt mit Staunen feststellen, dass es doch eine Zukunft gegeben hatte, nicht einmal eine schlechte. Einige mühselige Jahre, doch dann war die Familie zu Wohlstand gekommen, das alte Ansehen war wiederhergestellt. Geld war auf einmal da. Das hatte die Familie nie übermäßig besessen, hatte übrigens auch keiner angestrebt. Julius hatte ein neues Vermögen geschaffen, vermehrte es täglich. Obwohl es auch ihn nie sonderlich interessiert hatte. Fleiß und Tüchtigkeit der alten Familie, das Bestreben, eine Pflicht zu erfüllen, die ihm oblag, waren selbstverständliche Bestandteile seines Wesens. So war es aufwärtsgegangen, gerade in dieser Zeit, an die man vor zehn Jahren nicht zu denken wagte.
Nur Barbara war nicht nach Hause gekommen. Niemals wieder. Und sie würde nicht mehr kommen. Barbara, seine schöne, seine unbesonnene, leidenschaftliche Schwester.
Heute kam ihre Tochter. Und er war hier, um sie abzuholen. Diese Mission erfüllte ihn mit Unbehagen.
Als er ausgestiegen war, atmete er einige Male tief. Vielleicht wurde davon das Herz wieder kleiner. Doch die feuchte, schwere Luft war unrein, Ruß war darin, Benzin, der giftige Atem der Stadt, die Nebeldecke hielt ihn fest.
Julius zündete eine Zigarette an und ging langsam auf das breite Portal des Bahnhofs zu. Der Platz war belebt um diese Zeit, die Züge aus der Umgebung und aus der Hauptstadt brachten die Berufstätigen nach Hause. Andere verließen die Stadt, um heimzufahren, in die Dörfer und Orte im Umkreis.
In der Bahnhofshalle blieb er stehen. Es würde gut sein, sich einen Gepäckträger zu sichern. Viele gab es nicht, zwei oder drei, meist waren sie unsichtbar. Solche Arbeit war nicht mehr geschätzt. Wenn der Fernzug einlief, war es zu spät.
Er hatte Angst vor der Begegnung, die vor ihm lag. Obwohl es töricht war, vor einem jungen Mädchen, vor diesem Kind Angst zu haben. Würde er sie überhaupt erkennen? Wie mochte sie aussehen? Warum hatte sie kein Bild von sich geschickt? Sie hatte nur kurz mitgeteilt, an welchem Tag und mit welchem Zug sie eintreffen würde. Eine knappe Mitteilung nur, sie hatte nicht geschrieben, ob sie gern käme, und sie hatte sich auch nicht bedankt dafür, dass man sie aufgefordert hatte zu kommen.
Elisa von Tallien hatte geringschätzig den Mund verzogen. »Sie wird ein schöner Bauerntrampel sein. Der Himmel weiß, was wir uns da aufgeladen haben.«
Julius hatte den Fall nicht aufs Neue mit ihr diskutiert, es war genug darüber gesprochen worden. Dass Elisa es ihm nicht leicht machen würde, war zu erwarten gewesen. Hier nun, auf dem Bahnhof, war er ehrlich zornig auf sie. Es wäre ihre Aufgabe gewesen, das Mädchen abzuholen, ihn wenigstens zu begleiten. Sie war eine Frau, sie hätte es besser verstanden, die ersten Minuten zu erleichtern. Aber sie hatte nur gesagt: »Ich? Wie käme ich denn dazu? Schließlich ist es deine Nichte. Wenn sie jetzt schon herkommen muss, dann kümmere du dich gefälligst darum.«
Es war ein ungutes Wort, dieses »wenn sie jetzt schon herkommen muss«, und Julius wollte um alles in der Welt nicht, dass der künftige Aufenthalt des jungen Mädchens in seinem Haus unter diesem Wort stand. Sie hatte ein Recht, in diesem Hause zu sein. Sie war eine Tallien, und seine Schwester war ihre Mutter, mochte auch geschehen sein, was geschehen war. Der Alte hatte gewollt, dass Barbara nach Hause käme, und er selbst hatte es auch gewünscht. Immer und zu jeder Zeit hatte er es gewünscht. Und es war selbstverständlich, dass sie ihr Kind mitbrachte.
Nun kam das Kind allein, die junge Barbara, die keiner hier kannte und die ihrerseits ebenfalls keinen von der Familie je gesehen hatte. Wie sie wohl sein mochte? Das hatte sie alle in letzter Zeit beschäftigt, ihn selbst, seine Frau, die Kinder.
Eine merkwürdige Jugend hatte dieses Mädchen gehabt, unstet, ruhelos. Im fremden Land hatte sie gelebt, unter ganz anderen Verhältnissen. Man wusste so wenig von diesem Leben, eigentlich gar nichts. Denn wenn Barbara auch alles verlassen hatte, den Stolz der Talliens hatte sie mitgenommen. Dieser Stolz, der es ihr verbot, je wissen zu lassen, wie es ihr wirklich erging. Doch gerade dieses Schweigen hatte offenbart, dass es ihr nicht gut gegangen sein konnte, soviel war gewiss.
Er, Julius, ihr Bruder, hätte das ändern können, zumindest in den letzten Jahren. Er hatte es nicht getan. Auch darum hatte er Angst vor der Begegnung mit Barbaras Tochter, jene Angst, die aus einem Schuldgefühl erwächst.
Auf dem Querbahnsteig entdeckte er einen Gepäckträger und beauftragte ihn, in der Nähe zu bleiben. Blieb noch die Frage, ob es nötig sein würde, ob das Mädchen überhaupt Gepäck hatte.
Als der Zug einlief, war er so nervös, dass seine Hände zitterten, sein Herz noch größer geworden war. Es war töricht, es war unsinnig für einen Mann seines Alters und seiner Stellung, Angst zu haben vor der Begegnung mit einem zwanzigjährigen Mädchen. Er besaß selbst zwei Töchter, von denen die eine sogar ein Jahr älter war als der Besuch.
Die Beleuchtung auf dem Bahnhof ließ zu wünschen übrig, stellte er fest. Wie sollte er das Mädchen erkennen.
Dann stand der Zug. Nicht allzu viel Leute stiegen aus, die meisten fuhren in die Hauptstadt weiter.
Auf einmal sah er sie.
Alle seine Sorgen waren unnötig gewesen. Er wusste noch gut, wie seine Schwester ausgesehen hatte. Und die junge Barbara sah ihr ähnlich. So ähnlich, dass es ihn traf wie ein Stoß.
Er stand einige Sekunden wie gelähmt und blickte auf sie. Die gleichen raschen, bestimmten Bewegungen, das leuchtende Haar, glatt und unbedeckt, und trotz des trüben Lichtes glaubte er, das gleiche aufleuchtende Lächeln zu erkennen, mit dem seine Schwester alle Menschen bezaubert hatte. Mit diesem Lächeln blickte das Mädchen am Zug zu jemand auf, der ihr die Gepäckstücke herausreichte. Übrigens waren es mehrere, der Gepäckträger war doch vonnöten. Ein Koffer nur, alt und schäbig, aber Taschen und Beutel und sogar ein Karton waren dabei.
Julius winkte den Gepäckträger herbei, dann erst ging er auf seine Nichte zu.
»Ich bin Julius«, sagte er.
Sie war dabei, die Stücke zu zählen. Blickte flüchtig auf, ein rasches Lächeln: »Oh, Onkel Julius«, sich umwendend, rief sie über die Schulter: »Ich bin gleich wieder da«, und rannte am Zug entlang zum Gepäckwagen.
Julius sah ihr verblüfft nach. Hatte sie noch mehr Gepäck? Ratlos blieb er stehen. Der Gepäckträger betrachtete mürrisch die bunte Sammlung auf dem Bahnsteig. »Wie soll man das denn wegkriegen?«, murmelte er im weichen Dialekt der Gegend. Dann schaute er ebenfalls dem Mädchen nach. »Kommt noch mehr?«
Julius hob die Schultern. »Ich weiß es auch nicht.«
Ein wildes Gejaule und Gebell erfüllte auf einmal den Bahnhof, so laut und stürmisch, dass es alles übertönte. Die Reisenden schauten, blieben stehen, manche lächelten. Ein Hund sprang an der schlanken Gestalt des Mädchens empor, sie umfing ihn mit beiden Armen und redete auf ihn ein.
»’n Hund hat sie auch«, stellte der Gepäckträger fest.
In der Tat, sie hatte einen Hund mitgebracht. Davon hatte sie allerdings nichts geschrieben. Julius dachte an seine Frau. Das fing ja gut an. Was war das überhaupt für ein Köter?
Da kam sie schon zurück, wieder im Laufschritt, den Hund an der Leine, der wie ein übermütiges Böcklein neben ihr hersprang.
»Entschuldigen Sie«, sagte sie atemlos, »ich musste Dino erlösen. Sonst wäre er am Ende noch weiter mitgefahren.«
Barbaras Stimme, ein wenig tief für ein Mädchen, melodisch, sehr musikalisch.
»Aha«, entgegnete Julius ein wenig töricht, ohne näher auf den Hund einzugehen. Dann sagte er, wie er es sich vorgenommen hatte: »Willkommen, mein Kind. Ich freue mich, dass du da bist.«
Sie blickte ihn ernst an. Sie war fast so groß wie er, und nun sah er auch ihre Augen, schöne, klare Augen, dunkel und im Moment ein wenig scheu. »Danke«, sagte sie. »Danke, Onkel Julius.« Sie legte ihre Hand in seine, sie lächelte jetzt nicht. Er sah, dass auch sie Angst hatte. Dann streichelte sie den Hund, der wieder an ihr hochsprang. »Sie … Sie sind mir doch nicht böse, dass ich Dino mitgebracht habe?«
Was sollte er darauf antworten? Er war nicht böse darüber, dass sie einen Hund mitgebracht hatte, er fürchtete nur die Komplikationen. Elisa würde diesen unerwarteten Hausgenossen kaum sehr begeistert begrüßen, soviel war gewiss.
»Aber nein«, sagte er, »natürlich nicht.«
»Dino ist ganz brav. Eigentlich wollte ich ihn nicht mitnehmen. Ein Freund von mir hätte ihn behalten. Aber Dino hat es gespürt. Wie er mich angesehen hat in den letzten Tagen. Ich glaube, er hätte es nicht überlebt.« Ernsthaft sah sie Julius an, und zugleich kindlich, mit bittenden Augen. »Er wird bestimmt keine Arbeit machen.«
Julius schaute zweifelnd auf den Hund herab. Was es für eine Rasse war, konnte er nicht erkennen. Vermutlich gar keine. Er war nicht groß und nicht klein, reichte ihm etwas über das Knie, sein Fell war dicht und lang und ganz schwarz. Der Kopf war schön, schmal und gutgeformt. Es musste eine Art Wolfshund sein. Jetzt stand er ganz still und blickte verständig zu ihnen auf. Er schien zu begreifen, dass von ihm die Rede war.
Der Zug fuhr ab. »Gehen wir?«, fragte der Gepäckträger ungeduldig.
»Ja«, sagte Julius. »Mein Wagen ist draußen auf dem Bahnhofsplatz.«
Der Hund erleichterte die ersten Minuten des Zusammenseins, er bot Gesprächsstoff.
»Wie hast du ihn denn über die Grenze gebracht?«
»Geschmuggelt«, erwiderte sie fröhlich. »Ich hatte ihn unter dem Sitz versteckt, und er blieb mäuschenstill. Die Leute im Abteil waren sehr nett, sie hatten alle die Beine fest vor die Sitze gestellt und sprachen laut miteinander und mit den Zollbeamten. So merkte es keiner. Von mir wollte sowieso keiner etwas. Ich musste nicht einmal meinen Koffer aufmachen. Doch dann hatte ich ganz vergessen, dass wir auch noch über die österreichische Grenze kommen. Aber einer aus meinem Abteil stand im Gang, er sah den Beamten rechtzeitig, und wir konnten Dino noch verstecken.«
»Aha«, meinte Julius. Sie schien noch ein richtiges Kind zu sein.
»Nur hier dann, in Deutschland, da hatte ich Schwierigkeiten. Sie sind sehr gründlich hier, nicht? Dino durfte nicht im Abteil bleiben. Er musste in ein Hundeabteil. Oh, er war ganz verzweifelt. An den Stationen habe ich ihn immer besucht. Und ein Mann bei mir im Abteil hat immer schnell etwas zu essen besorgt für ihn. Na, jetzt sind wir da, und alles ist gut gegangen.«
Sie wandte den Kopf und lächelte Julius von der Seite an. Barbaras Lächeln, rasch und herzlich und so vertraut. War es möglich, dass es ihm noch so vertraut war, zwanzig Jahre später? Es schien ihm, als hätte er es gestern erst gesehen.
»Wir haben auch einen Hund«, sagte er, »einen Pudel.«
Der Pudel war Elisas Wunsch gewesen. Früher hatten sie Schäferhunde besessen, meistens sogar zwei. Plötzlich fiel ihm ein, dass auch seine Schwester stets die Hunde um sich gehabt hatte. Die Tiere hatten sie leidenschaftlich geliebt, schon als sie noch ein Kind war.
»Oh«, sagte das Mädchen und schaute ihn ängstlich an, eine Falte auf der Stirn. »Hoffentlich vertragen sie sich. Dino ist sehr eifersüchtig.«
»Sie werden sich schon aneinander gewöhnen.« Nein, Joker machte ihm keine Sorgen, der war friedlich und gutmütig, der war froh, wenn ihm keiner was tat.
Der Gepäckträger wartete vor dem Bahnhofsportal. Julius wies hinüber zum Parkplatz. »Der schwarze Mercedes.«
Barbara begann wieder die Gepäckstücke zu zählen und verstaute dann gemeinsam mit dem Träger alles hinten im Wagen. Zuletzt stieg sie ein, setzte Dino neben sich, den Arm um seinen Hals gelegt. Autofahren schienen sie beide gewohnt zu sein. Nun ja, schließlich kamen sie nicht aus der Wildnis.
Ehe Julius abfuhr, wandte er sich nochmals an seine Nichte. »Wirklich, mein Kind, ich freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, du wirst dich wohlfühlen hier. Natürlich ist zunächst alles sehr fremd für dich.«
»Ja«, erwiderte sie einfach und blickte ihn ruhig an.
»Du musst ein wenig Geduld haben. Einige Zeit. Wenn du erst vertraut hier bist, wird es dir bestimmt gefallen.« Er wusste nicht, warum er das sagte. Vielleicht im Gedanken an Elisa und an seine Töchter. Er wurde die Angst nicht los, dass sie es dem Mädchen schwer machen würden. Wenn sie ihrer Mutter innerlich so ähnlich war wie äußerlich, dann musste es Schwierigkeiten geben. Barbara war sehr rasch in ihrem Urteil gewesen, leicht reizbar, temperamentvoll und oftmals recht hochmütig, schnell fertig mit Menschen und Dingen, die ihr nicht lagen.
Er zögerte, fügte dann hinzu: »Ich hatte immer gehofft, du würdest eines Tages zusammen mit deiner Mutter hierherkommen.« Hinterher bereute er, dies gesagt zu haben.
Barbara gab nicht gleich eine Antwort. Sie sah ihn auch nicht mehr an. Sie blickte geradeaus durch die Scheibe. Julius sah nur ihr Profil, ein klares, herbes Profil. Eine steile, hohe Stirn, die das glatte Haar nicht verbarg, die gerade, gutgeformte Nase der Talliens, ein energisches, festes Kinn. Die Lippen hatte sie zusammengepresst.
»Ich glaube nicht, dass Barja das gewollt hätte«, sagte sie dann plötzlich, es klang abwehrend und fast ein wenig feindlich. »Ich glaube, sie hätte nicht einmal gewollt, dass ich hierherkomme. Aber ich mochte nicht mehr dortbleiben. Es war für mich – es war für mich – so – so traurig. Und die Leute …«, sie stockte, dann vollendete sie mit einem gewissen Trotz: »Ich wollte einfach weg. Barja hat immer gesagt, ich soll einmal woanders hin, nach Deutschland, und etwas lernen. Aber sie wollte sicher nicht, dass ich gerade hierherkomme.« Nun schaute sie ihn wieder an. »Sie sind mir nicht böse, dass ich das sage?«
»Nein, ich verstehe schon. Aber warum sagst du nicht du zu mir? Ich bin doch dein Onkel.«
»Ja. Ja natürlich. Sie sind – du bist mir eben nur noch fremd. Aber«, und nun lächelte sie wieder, »ich werde mich daran gewöhnen. Vielen Dank, Onkel Julius.«
Julius war gerührt. Sie war ganz anders als die jungen Mädchen, die er kannte, anders auch als seine Töchter.
Er fuhr an. An der Ampel, vorn an der Ecke, musste er halten.
»Wie nennst du deine Mutter? Barja?« Er wiederholte den ihm fremden Namen langsam.
»So nannten wir sie immer. Vater sagte früher Barinja. Das heißt Herrin. Er fand, es passe gut zu ihr. Und daraus wurde dann Barja.«
Julius schwieg irritiert. Natürlich, einen Vater hatte dieses Mädchen auch. Von ihm wollte er nicht reden.
Endlich Grün. Er trat aufs Gas und fuhr heftig an. Nach Hause jetzt. Dass man die Begegnung der Frauen hinter sich brachte.
Barbara sah nicht viel von der Stadt. Der Verkehr war noch immer lebhaft, zu beiden Seiten der Straßen war die glänzende Reihe der hellen Schaufenster, die Häuser waren fast alle neu und modern, nur hier und da ein altes, würdiges, aus vergangener Zeit, gelegentlich auch noch eine Lücke. Die Stadt war schwer zerstört gewesen. Der Wiederaufbau war jedoch weit vorangeschritten, sodass man kaum noch Spuren des Krieges bemerkte. Außerdem war die Stadt reich, die Bewohner hatten zudem mehr Bürgersinn bewahrt, mehr Liebe und Anhänglichkeit an ihre Stadt, als es in den ganz großen Städten üblich ist.
Sie überquerten einen breiten Platz, und eine helle geschlossene Mauerfront leuchtete hinter den Bäumen. »Das Schloss«, sagte Julius.
Barbara wandte bereitwillig den Kopf. »Oh«, meinte sie höflich. »Dort hat der Großvater gearbeitet, nicht wahr?«
Es hörte sich merkwürdig an. Der alte Tallien hätte es auch seltsam gefunden. Hatte er im Schloss gearbeitet? Nun ja, gewiss, man konnte es auch so nennen. Heute nannte man es eben so. Er hatte seinem Fürsten gedient, so nannte man es früher. Die Talliens hatten seit Generationen diesem Fürstenhaus gedient. Und bis zum Jahre 1918 war Raoul Tallien in diesem Schloss und in dieser Stadt nach dem Großherzog die wichtigste Persönlichkeit gewesen. Aber das konnte eigentlich nur noch begreifen, wer es selbst miterlebt hatte. Er konnte sich daran erinnern. Barbaras Mutter schon nicht mehr. Sie war 1916 geboren, und bis sie groß genug war, die Umwelt zu verstehen, war der Großherzog ein Anachronismus geworden, ein freundlicher Herr, der im Park spazieren ging, und dem sie mit einem Knicks das Händchen reichen musste. Ihr Vater war damals noch nicht alt, doch er ging gleichfalls spazieren. Und er hatte eben früher mal in diesem Schloss gearbeitet. So begriff das Kind die Situation, und so hatte sie es auch ihrer Tochter erzählt.
Barbara presste den Hund ein wenig fester an sich, der aufmerksam auf die Straße hinausblickte, aufmerksamer als sie selbst. Für einen Moment legte sie ihr Gesicht in sein weiches Fell. Sie war müde. Sie war die ganze Nacht gefahren und den ganzen Tag, geschlafen hatte sie kaum. Alles war so fremd und neu. Sie hatte Angst vor der Ankunft in dem fremden Haus, bei den fremden Leuten. Im Moment verstand sie nicht, warum sie hierhergekommen war. Von daheim aus hatte es verlockend ausgesehen. Ein anderes Land, ein anderes Leben. Und vor allem eins: vergessen, was geschehen war. Die Leute nicht mehr sehen, die alles wussten und die immer wieder mit ihr darüber sprechen wollten. Sprechen in der sensationslüsternen, lebhaften und lauten Art ihres Volkes. Wenn sie dort auch lange gelebt hatte, sie war nicht von dieser Art. Sie hatte sich fortgesehnt.
Doch nun begriff sie es nicht mehr. Sie wünschte heftig, wieder daheim zu sein. Der Himmel würde klar sein an diesem Abend, voller Sterne. In den engen Gassen zwischen den Häusern war jetzt Leben, war Betrieb. Die Geschäfte noch geöffnet, alles war auf der Gasse, an den Türen, in den Läden, alles schwatzte und redete und lachte. Wenn man heraustrat aus den engen Gassen, dehnte sich das Meer unter dem nächtlichen Himmel, dunkel und geheimnisvoll schimmernd, schlafend und doch leicht bewegt. Die Brandung schlug an den Strand und an die Mauern der Mole im ewig gleichen Rhythmus. Die Boote waren auf den Strand gezogen, ihre Schatten lagen wie dunkle Flecken im Sand. Und vielleicht wäre sie gerade zu dieser Stunde die Promenade am Meer entlanggegangen, die Lungomare, Dino vergnügt vor ihr her laufend, hier und da würde er eine Katze aufjagen, einem Schatten nachrennen, Bekannte begrüßen und wieder schwanzwedelnd zu ihr zurückkehren. Vielleicht wäre auch Piero bei ihr, die Hände in den Taschen würde er neben ihr her schlendern und erzählen, was er an diesem Tag erlebt hatte. Am Ende der Lungomare würde er stehen bleiben, unter der letzten Palme, wo es dunkel war, würde sie an sich ziehen und küssen, zärtlich, dann stürmisch und fordernd, dann würden sie zurückschlendern und bei Giacomo einkehren, gebackene Fische essen und Wein dazu trinken. Die Männer würden mit Piero reden, er würde erzählen, prahlen, lachen, trinken und rauchen und dabei sein Knie an das ihre pressen, und jeder wusste, dass sie zu ihm gehörte. Und dann …
»Wir sind gleich da«, sagte Julius in ihre Träume hinein. »Du wirst sicher Hunger haben.«
»Ja, ein wenig«, sagte Barbara höflich.
»Und müde bist du sicher auch. Es war eine lange und anstrengende Reise.«
Am anstrengendsten war der Abschied von Piero gewesen. Bis zuletzt hatte er nicht glauben wollen, dass sie wirklich fahren würde. Es hatte so wilde Szenen zwischen ihnen gegeben, dass Barbara Angst vor ihm bekommen hatte. Er hatte ihr strikt verboten zu fahren. Doch er vergaß, dass sie sich nichts verbieten ließ, auch nicht von einem Mann, den sie liebte. Dass er damit nur ihren Trotz geweckt hatte. Am Tag, ehe sie fuhr, und am Reisetag selbst hatte sie ihn nicht gesehen. Erst als sie schon im Zug saß, entdeckte sie ihn. Er stand mit finsterer Miene an die Espresso-Maschine im Bahnhof gelehnt und starrte zu ihr herüber. Daraufhin war sie noch einmal aus dem Zug gesprungen, Dino natürlich ihr nach, war über die Gleise gelaufen, geradewegs in seine Arme.
Er drückte sie an sich, dass sie glaubte, ersticken zu müssen. »Rimani!«, stieß er wild hervor. »Rimani qui!«
Sie küsste ihn, doch dann lief sie zum Zug zurück. Alles wartete auf sie. Peppo stand neben dem abfahrbereiten Zug. Die Reisenden, der Zugführer, alles lachte und rief ihr Scherzworte zu. Sie stieg ein, Dino hinterher, und gleich darauf fuhr der Zug ab. Piero stand da drüben, das Gesicht voller Wut und Schmerz. Und dann war er verschwunden.
Warum hatte sie ihn verlassen? Sie liebte ihn doch. Aber sie würde wiederkommen. Sie hatte es ihm versprochen.
»Wir sind da«, verkündete Julius. Sie glitten durch ein weites, offenstehendes Tor. Das Haus lag weit zurück, es wirkte groß und dekorativ. Eine Lampe bestrahlte hell einen Teil der Vorderfront.
Julius hielt, räusperte sich, sagte aber nichts. Er stieg aus und dachte auf einmal verzagt: Wie soll das nur werden?
Er ging um den Wagen herum, öffnete die Wagentür, als Erster sprang mit einem großen Satz Dino heraus, sah sich neugierig um und beschnupperte die Stufen, die ins Haus führten.
»Dies ist das Haus der Familie Tallien«, sagte Julius von Tallien mit einer gewissen Feierlichkeit. »Hier ist deine Mutter geboren und aufgewachsen. Es sieht allerdings heute anders aus als damals. Das Haus war beschädigt, wir haben umgebaut.«
Barbara kletterte aus dem Wagen, sie fröstelte. Kalt war es hier, und es regnete. Jetzt war sie also hier. Im Haus der Talliens. Es bedeutete ihr nichts.
Als Erster kam Joker aus dem Haus, der Pudel. Er wollte auf seinen Herrn zulaufen, dann entdeckte er den fremden Hund und blieb zögernd stehen. Er war keine Angriffsnatur.
Der Gast war von anderem Wesen. Dino knurrte, und die Haare auf seinem Rücken richteten sich auf. Barbara erwischte ihn gerade noch am Halsband. »Cuccia!«, befahl sie energisch. »Sta quieto!«
Als Nächste erschien Anny, das Hausmädchen. Sie besah sich neugierig den Ankömmling. Aber Julius ließ ihr nicht viel Zeit dazu.
»Das Gepäck ist hinten im Wagen. Räumen Sie alles aus, Anny, und bringen Sie es in das Zimmer vom gnädigen Fräulein.«
Dann nahm er Barbaras Arm und sagte: »Komm. Gehen wir hinein.« Je schneller man es hinter sich brachte, umso besser.
Die Familie war im Wohnzimmer versammelt. Als sie hereinkamen, Julius, das Mädchen und der Hund, richteten sich alle Blicke auf sie.
Elisa legte die Zigarette aus der Hand und stand langsam auf.
»So, da seid ihr«, sagte sie. Es klang so, als hätte sie gehofft, es sei in letzter Minute noch etwas dazwischengekommen, das Barbara an der Reise verhindert hätte.
Ihr Blick umfasste die Gestalt des Mädchens, und auch Dino, der sich eng an Barbara drängte. Immerhin brachte Elisa ein Lächeln zustande. Was sie sagen sollte, wusste sie nicht recht. Sie reichte Barbara die Hand und meinte: »Da bist du also. Wir freuen uns alle sehr.«
Barbara kam sich elend und verlassen vor. Sie zwang sich ein kleines Lächeln ab und drückte viel zu heftig die kleine weiche Hand, die ohne Druck in ihrer lag. Gegenüber der elegant gekleideten, gepflegten Dame kam es ihr erstmals in den Sinn, wie sie wohl selbst aussehen mochte. Die lange Fahrt, sie war müde, ihr Haar musste verwirrt sein, und sie hätte sich wenigstens die Lippen nachziehen sollen, ehe sie den Zug verlassen hatte.
Elisas Blick war endgültig auf Dino haften geblieben. »Was ist denn das?«, fragte sie mit deutlicher Abneigung.
Julius versuchte ein fröhliches Lachen. »Das ist Barbaras Hund. Sie hat ihn mitgebracht. Es war ein schwieriger Transport, sie muss euch das nachher mal erzählen.«
»So«, sagte Elisa mit schmalen Lippen.
Ein Junge, er mochte etwa vierzehn Jahre alt sein, pflanzte sich vor Barbara auf und betrachtete sie ungeniert. »Noch ’ne Cousine«, sagte er, »dabei haben wir schon so viel.« Er grinste, dann beugte er sich zu dem Hund hinunter, um ihn anzufassen, aber Dino zeigte knurrend die Zähne und wich zurück.
»Das ist Ralph«, erklärte Julius eilig, »und das sind Marianne und Doris, deine Cousinen.«
Barbara sah von einem zum anderen, drückte ihre Hände, hörte kaum die Begrüßungsworte. Doris zum Beispiel rief laut und unbekümmert: »Hallo, Barbara. Sei gegrüßt in diesen würdigen Hallen. Nein, wie süß sie ist. Und wie schick.«
Das letzte war zweifellos Spott. Julius kannte das kecke Mundwerk seiner jüngsten Tochter. Schick war Barbara gewiss nicht. Er sah jetzt erst mit Bewusstsein, wie sie gekleidet war, ein grauer Rock, ein gelber Pullover, und darüber eine Jacke, die in keiner Beziehung zu den anderen Kleidungsstücken stand.
Sie redeten alle durcheinander, dann schwiegen sie wie auf Kommando und sahen Barbara erwartungsvoll an. Barbara errötete. Was sollte sie jetzt sagen?
Julius kam ihr zu Hilfe. »Zeigt Barbara jetzt ihr Zimmer, sie soll sich die Hände waschen, dann werden wir essen.«
In der Diele stand Anny, umgeben von dem Gepäck. Sie schaute vorwurfsvoll drein.
»Was für ein Ramsch«, schrie Doris begeistert. »Du musst ein Abteil für dich allein gebraucht haben.«
»Es ist gut«, sagte Elisa nervös. »Helft es hinauftragen. Und beeilt euch.«
Doris und der Junge kamen mit hinauf. Das kleine Zimmer lag im Dachgeschoss, ein Bett stand darin, ein Schrank, eine Kommode, ein kleiner Tisch, darauf ein Blumenstrauß. Es sah freundlich aus. Barbara gefiel es, sie war nicht verwöhnt.
»Wir hoffen, es macht dir nichts aus«, plauderte Doris, »wenn du hier oben schläfst. Wir schlafen eine Etage tiefer. Aber da war nichts mehr frei, du hättest zu mir ziehen müssen. Und vielleicht ist es dir lieber, wenn du allein bist. Gefällt es dir?«
»O ja«, sagte Barbara. »Es ist sehr hübsch.«
»Auspacken kannst du nachher. Ich zeig’ dir jetzt das Bad, und dann gehen wir wieder ’runter.«
Im Moment war Barbara ganz wirr vor Müdigkeit. Sie hatte nur den einen Wunsch, allein zu sein, sich hinlegen zu können. Sehnsüchtig blickte sie auf das Bett.
»Und der?«, fragte Ralph und wies auf Dino. »Soll der auch hier oben schlafen?«
Barbara blickte ihn unsicher an. »Wo sonst?«
»Momy mag es nicht, wenn die Hunde in den Schlafzimmern sind. Joker schläft in der Diele.«
»Dino würde sich fürchten«, sagte Barbara eilig, »solange er fremd ist.« Sie hatte wohl bemerkt, wie die fremde Frau ihren Hund angesehen hatte. Wenn sie Dino nicht haben wollen, dachte sie heftig, bleibe ich auch nicht. Er ist mir wichtiger als sie alle zusammen.
Der Junge betrachtete sie eine kleine Weile kritisch, geradezu abschätzend. Doch plötzlich lächelte er, ein helles, zutrauliches Lächeln, in seinem Blick war deutlich Sympathie zu erkennen. Er sagte: »Das findet sich. Besser du fragst gar nicht. Wenn man erst fragt, bekommt man nur eine Antwort. Bis die alten Herrschaften was merken, ist schon ein Gewohnheitsrecht daraus geworden. Das ist die beste Art, mit Eltern umzugehen.«
Seine Schwester Doris gab ihm einen Puff, lachte aber und sagte: »Du bist ein Lümmel, aber zufälligerweise hast du recht. Kommt, wir gehen jetzt.«
Das Abendessen zog sich für Barbaras überreizte Nerven endlos lang hin. Sie aß nicht viel, sie war zu müde, um Hunger zu haben. Dino dagegen war dazu keineswegs zu müde. Er saß neben ihrem Platz und ließ den Blick nicht von ihr. Einmal reichte sie ihm einen Bissen hinunter, und errötete dann, als Elisa tadelnd die Brauen hochzog.
Julius sagte eilig: »Dein Hund wird hungrig sein, Barbara. Anny soll ihm dann draußen etwas zurechtmachen.«
Erst hatte sie Dino oben in dem Zimmer lassen wollen, aber er hatte angefangen zu heulen, sie musste ihn holen. Das Erste, was er tat, als er herunterkam: Er fuhr auf Joker los, der sich daraufhin beleidigt und zitternd in eine Ecke zurückzog. Kein Zweifel, die Gegenwart von Dino erschwerte Barbaras Einzug in das Haus der Familie Tallien.
Doris und Ralph belebten das Abendessen durch Erzählungen. Von der Schule, vom Sport, von ihren Freunden. Sie hatten beide das Bestreben, vor dem Besuch etwas anzugeben. Julius, dem sonst die Lebhaftigkeit der beiden Jüngsten oft auf die Nerven ging, war ihnen heute dankbar dafür.
Barbara aß, ohne viel zu sagen, sie blickte kaum auf. Sie spürte, dass Elisa sie beobachtete. Tante Elisa. Muss ich zu ihr auch Du sagen, überlegte sie. Bis jetzt hatte sie jede Anrede vermieden. Sie wusste, dass ihre Mutter Elisa nicht recht leiden mochte. »Diese eingebildete Gans, die mein Bruder da geheiratet hat«, pflegte sie zu sagen.
Einige Male blickte Barbara auch verstohlen zu dem anderen Mädchen hinüber, zu ihrer Cousine Marianne. Barbara fand sie sehr hübsch, das Haar ganz hellblond und wunderbar frisiert, ein weißes, ebenmäßiges Gesicht mit hellen blauen Augen. Nur der Mund war etwas zu voll und gewölbt, er stahl dem Gesicht die edle Linie. Sie sprach nicht viel, ihre Miene war ein wenig hochmütig. Bei Tisch erfuhr man, dass sie an diesem Abend noch ausgehen würde. Ein gewisser Heinz käme dann, sie abzuholen.
Doris sorgte für weitere Aufklärung. »Mit dem ist sie verlobt«, sagte sie zu Barbara, »und die zwei sind fleißige Partybesucher.«
»Aha«, sagte Barbara und lächelte zu Marianne hinüber. Diese sagte keinen Ton dazu, erwiderte auch das Lächeln nicht.
Komisch, auf einmal Verwandte zu haben. Barbara hatte nie Verwandte gehabt. Sie wusste aus den Erzählungen ihrer Mutter, wie groß die Familie war und welche Rolle sie spielte in dieser Stadt. Auch in Italien hatten die Leute alle viel Familie und maßen dem große Wichtigkeit bei. Früher hatte sich Barbara oft gewünscht, auch Familie zu haben. Geschwister vor allem, und Onkels und Tanten und Großeltern, so wie es die anderen Kinder hatten. Nicht immer ein einsamer, verlorener Fremdling zu sein. Vielleicht war es dieser Kindheitswunsch gewesen, der sie bewogen hatte hierherzukommen. Doch sie hatte sich nicht vorgestellt, wie schwierig es war, eine Familie zu bekommen, wenn man schon erwachsen war. Es war ihr nicht die Idee gekommen, dass man in dieser Familie dann auch wieder ein Fremdling sein würde. Jetzt wusste sie es.
Nach dem Essen gingen sie alle hinüber ins Wohnzimmer, Julius zündete sich eine Zigarette an und griff erleichtert nach der Zeitung. Es würde schon werden. Das Schlimmste war überstanden. Und jedes heikle Thema war vermieden worden, niemand hatte von Barbaras Eltern gesprochen, niemand von der Vergangenheit. Er hatte es den Kindern extra vorher eingeschärft. Natürlich würde man darüber sprechen müssen. Aber es musste nicht gleich am ersten Tag sein. Das hatte Zeit.
Doris ging mit Barbara und Dino in die Küche und machte selbst für ihn das Essen zurecht. Es war genug übrig geblieben. Er bekam eine große Schüssel voll und verputzte alles mit gutem Appetit. Joker sah dem Unternehmen von der Schwelle aus zu. Hinein getraute er sich nicht. Dino hatte bloß einmal über die Schulter geblickt, das genügte.
Nachher ließ er sich sogar von Doris streicheln.
»Ein hübscher Kerl«, meinte Doris. »Er hat wunderschöne Augen. Hast du ihn schon lange?«
»Ja, von klein auf. Er ist jetzt zwei Jahre. Seine Mutter war in einer Gärtnerei auf dem Grundstück, wo wir gewohnt haben. Er sollte getötet werden. Aber ich durfte ihn behalten.«
Zusammen führten sie den Hund in den Garten, Joker kam auch mit. Im Freien beschnupperten sie sich und schienen eine Art Waffenstillstand zu schließen.
Kurz darauf kam der Verlobte von Marianne. Er begrüßte Elisa mit einem Handkuss, Marianne erhielt einen Kuss auf die Wange. Sein Benehmen, die Art, wie er sich bewegte, sich sehr korrekt und vollendet vor den Damen verbeugte, machte großen Eindruck auf Barbara. Er sah gut aus, groß und breitschultrig, hatte ein gut geformtes Gesicht und dichtes blondes Haar. Ein Mann, der zweifellos eine große Wirkung auf Frauen hatte. Barbara reichte ihm ein wenig scheu die Hand. Er lächelte knapp, sein Blick überflog sie diskret musternd, doch nicht ohne Interesse. Gleich darauf verschwand das junge Paar.
Was für ein eleganter Anzug, dachte Barbara bewundernd. Er muss viel Geld haben. Wenn die hier dagegen Piero sehen würden, mit seinem offenen Hemd und seinen ewig zerdrückten Hosen. Die Haare hingen ihm meist in die Stirn. Aber wenn er lachte, war er unwiderstehlich. Er lachte gern. Nur beim Abschied hatte er nicht gelacht. Zornig war er gewesen. Und traurig.
Barbara verspürte in diesem Moment heftige Sehnsucht nach ihm. Warum war sie weggegangen? Er wollte sie heiraten. Wenn er bei ihr wäre, würde er sie jetzt in die Arme nehmen, alles wäre vertraut, sie könnte sich geborgen fühlen. Hier würde sie sich nie heimisch fühlen. Nie.
Endlich konnte sie schlafen gehen. Sie sagte Gute Nacht und Dankeschön, und dann war sie oben in dem kleinen Zimmer, die Tür schloss sich hinter ihr. Sie war allein. Nein, nicht allein. Dino war bei ihr.
Das war der einzige Trost. Niemand hatte etwas gesagt, als er hinter ihr die Treppe hinaufgesprungen war.
Sie kniete neben ihm nieder, umschlang ihn mit beiden Armen, presste ihr Gesicht in sein Fell und hätte am liebsten geweint. Doch sie weinte nicht. Sie weinte selten. Sie hatte zu viel Schlimmes erlebt in ihrem jungen Leben, um leicht zu weinen.
Eine große, wilde Sehnsucht war in ihrem Herzen. Sie war nur noch ein einsames, verlassenes Kind, das sich nach seiner Mutter sehnte. Nach der Liebe ihrer Mutter. Aber Barja war weit fort und würde nie wiederkommen.
»Barja«, flüsterte sie in das Fell des Hundes, »Mami, o Mami!«
Dino blickte sie mit seinen schönen treuen Augen tröstend an, als sie den Kopf hob. Zärtlich glitt seine raue Zunge über ihre Wange.
»Ich hab’ nur noch dich, Dino. Nur noch dich«, flüsterte sie. »Ich verlasse dich bestimmt nicht. Wenn sie dich hier nicht haben wollen, gehen wir alle beide wieder weg. Wir fahren wieder nach Hause. Zu Piero. Und zu Mama Teresa.«
Sie schlief unruhig in der ersten Nacht im Hause der Familie Tallien, da oben in dem kleinen Dachkämmerlein, das man ihr zugewiesen hatte. Das Haus der Talliens war eine fremde, unbekannte Welt für sie, die sie fürchtete. Doch sie hatte alles Recht der Welt, hier zu sein. Sie war Barbaras Tochter. Und sie war eine echte Tallien, Julius hatte es gleich gesehen, auch der alte Tallien, wenn er noch lebte, hätte es mit Genugtuung festgestellt. Sie war eine echte Tallien, im Aussehen, im Wesen, mit ihrem ganzen leidenschaftlichen Herzen.
Das war es auch, worüber Julius und seine Frau zuerst sprachen, als sie allein geblieben waren.
»Es ist erstaunlich, wie sie Barbara ähnlich sieht«, sagte er. »Es gab mir direkt einen Stich, als ich sie sah. Und nicht nur Barbara, sie ist eine richtige Tallien, die Nase, die Stirn, Vaters Augen. Und die Art, wie sie sich hält, gerade, dabei von einer gewissen Lässigkeit. Erstaunlich, wie so etwas erhalten bleibt.«
Dieser Familienstolz, der aus seinen Worten sprach, reizte seine Frau. Das Getue der Talliens, wie sie es nannte, hatte sie immer gereizt. Oftmals konnte sie eine spitze oder gehässige Bemerkung dazu nicht unterdrücken. Nicht solange der Alte lebte. Sie hatte ihn nicht geliebt, aber sie hatte Respekt vor ihm, sie fürchtete ihn sogar ein wenig. Er schätzte sie auch nicht besonders, für ihn war sie zweitklassig. Er hatte nie gelernt, anders als in hergebrachten, ihm angeborenen und anerzogenen Bahnen zu denken. Dass sie aus reichem Hause war, hatte ihm nie imponiert. Geld imponierte ihm überhaupt nicht, gleich ob er welches hatte oder nicht.
Elisa hingegen war stets der Meinung gewesen, ihre Familie sei genauso viel wert wie die der Talliens. Nicht adlig, nun gut, das spielte zu der Zeit, als sie Julius geheiratet hatte, sowieso keine Rolle mehr. Man wusste überdies gut genug, was es mit dem Adel auf sich hatte. Wer weiß, auf welche Art die Talliens einst in grauer Vorzeit zu dem Prädikat vor ihrem Namen gekommen waren. Sie aber, Elisa, stammte aus einer guten, wohlhabenden, um nicht zu sagen, reichen Familie dieser Stadt. Sie besaß dafür einen gesunden Bürgerstolz. Die Talliens brauchten sich durchaus nicht so viel einzubilden auf ihren Namen, ihre Herkunft, auf die Schönheit ihrer Frauen, von der die Familiengeschichte immer wieder berichtete. Diese Frauen hatten allzu oft Unruhe in die Familie gebracht.
Jetzt sagte sie auf die Worte ihres Mannes: »Hoffentlich hat sie nicht allzu viel vom Charakter ihrer Mutter geerbt. Von ihrem Leichtsinn.« Und dann neugierig, ohne sein Stirnrunzeln zu beachten: »Hast du sie gefragt?«
»Nein, natürlich nicht«, erwiderte Julius abweisend. »Ich kann nicht gleich in der ersten Stunde davon anfangen. Ich möchte dich bitten, das mir zu überlassen. Es wird sich schon die Gelegenheit ergeben, mit ihr darüber zu sprechen.«
»Mein Gott, hab’ dich nicht so. Was ist denn für ein Geheimnis dabei? Es ist doch verständlich, dass du als Barbaras Bruder Näheres über ihren Tod wissen willst. Das Normale wäre doch gewesen, dass sie uns darüber geschrieben hätte.«
»Normal ist in diesem Falle überhaupt nichts«, sagte er. »Unsere ganzen Beziehungen sind es in den vergangenen Jahren nicht gewesen. Das lässt sich nicht mit ein paar Worten und nicht innerhalb einer Stunde auslöschen. Man kann auch nicht wissen, wie sie dazu steht. Sie ist noch zu jung. Ich bitte dich, Elisa, ich bitte dich inständig, mache es ihr nicht schwer. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlt bei uns. Sie darf nicht das Gefühl haben, eine Fremde zu sein. Du weißt, was Vater gesagt hat. Barbara hat ein Anrecht darauf, hier zu sein.«
»Jaja, ich weiß es«, gab Elisa zurück, »du hast mir das in letzter Zeit oft genug gesagt. Wir werden alles für sie tun, was möglich ist. An mir soll es nicht liegen.«
»Ich kann mich von einer gewissen Schuld nicht freisprechen«, fuhr Julius fort. »Ich habe es in den letzten Jahren versäumt, mich so um meine Schwester zu kümmern, wie es Vater erwartet hat. Ich hätte längst da hinunterfahren müssen und sehen, was sie treibt. Und sie heimholen. Dass es eines Tages zu spät war …« Es quälte ihn. Es quälte ihn fast jeden Tag. Heute begriff er es selbst nicht mehr, warum er so nachlässig gewesen war.
Als der Krieg zu Ende war, hatte man nicht gewusst, wo sie sich aufhielt. Lange Zeit nicht. Als er dann erfuhr, dass sie in Italien lebte, war er mehr als überrascht gewesen. Wie kam sie dorthin?
Doch er hatte selbst den Kopf so voll. Es waren schwere Jahre gewesen. Der Betrieb musste neu aufgebaut werden, ganz von vorn musste er beginnen. Wäre nicht sein Name gewesen, die alten Beziehungen, auch der gute Name der Firma, wer weiß, ob er es geschafft hätte. Er war manchmal müde, überdrüssig allem. Und er war keineswegs ein geborener Geschäftsmann, das waren die Talliens nie gewesen. Er verstand nur seine Arbeit und wusste mit dem Vertrauen etwas anzufangen, das man ihm entgegenbrachte. Die Banken waren bereit gewesen, ihm zu helfen, die Stadt selbst hatte sich ihm gegenüber stets hilfsbereit und großzügig gezeigt. Dann hatte die Konjunktur der letzten Jahre ganz selbstverständlich seinen leistungsfähigen, modernisierten Betrieb miterfasst, und so war es aufwärtsgegangen.
Als er wusste, wo Barbara war, hatte er ihr geschrieben, hatte angefragt, ob sie nicht nach Hause kommen wolle. Sie hatte kurz und bündig darauf mit einem Nein geantwortet. Dann hatte er einige Male Geld auf eine italienische Bank überweisen lassen. Sie hatte sich nie dazu geäußert. Immerhin war das Geld abgehoben worden, stets bis zum letzten Pfennig. Also hatte sie es wohl gebraucht. Von Jahr zu Jahr hatte er die Absicht gehabt, sie zu besuchen, endlich eine Brücke zu schlagen über die vergangenen zwanzig Jahre. Warum er das Zusammentreffen immer wieder verschoben hatte, er wusste es selbst nicht.
Dieses Jahr nun war er fest entschlossen gewesen, zu ihr zu fahren. Er wusste nichts von ihr. Nicht einmal, ob sie noch mit diesem Mann zusammenlebte.
Er schrieb Anfang des Sommers an sie, er habe die Absicht, nach Italien zu kommen, er wolle sie sehen. Ob er zu ihr kommen könne oder ob sie es vorziehe, ihn in Mailand zu treffen.
Darauf hörte er lange nichts. Man konnte es nur als Ablehnung seines Vorschlages auffassen. Doch dann plötzlich, vor anderthalb Monaten, kam ein Brief ihrer Tochter, ein Brief der jungen Barbara. Er hatte mit einigem Erstaunen das Kuvert mit den steilen großen Buchstaben betrachtet, als es eines Morgens auf seinem Schreibtisch lag. Es war nicht die Schrift seiner Schwester. Der Stempel trug jedoch den Namen Roano, das stimmte. Ehe er den Brief geöffnet hatte, hatte er das sichere Vorgefühl eines Unheils.
Die junge Barbara hatte mit dürren Worten mitgeteilt, dass sie seinen Brief erhalten habe und dass sein Besuch sich erübrige, ihre Mutter und ihr Vater seien in diesem Frühjahr durch einen Unfall ums Leben gekommen. Das war alles.
Julius hatte davorgesessen wie betäubt. Barbara war tot? Konnte das möglich sein? Durfte das möglich sein? Und wie ein drohender Schatten war das Schuldgefühl in ihm erstanden, war immer größer geworden und wuchs täglich. Er hatte versagt, er hatte sich nicht um sie gekümmert.
Der ganze Fall war im näheren und weiteren Familienkreis ausführlich diskutiert worden. Die älteren Glieder der Familie Tallien erinnerten sich gut an Barbara, an den Skandal von damals. Man sprach darüber wie einst. Die Zeit, da es versunken und vergessen schien, die Kriegs- und Nachkriegszeit, in der man andere Sorgen gehabt hatte, war vorbei. Man sprach wieder über Barbara von Tallien, genau wie früher. Die alten Familien der Stadt, die sich behauptet hatten, vergaßen nicht so leicht. Die jüngere Generation erfuhr nun auch, was einmal geschehen war. Und die älteren Frauen sagten mit gewichtiger Miene: Es musste mit ihr ein böses Ende nehmen. Es konnte gar nicht anders sein. Man hatte es ihr damals schon prophezeit.
Julius hasste dieses Gerede. Sterben mussten sie alle. Und jeder konnte durch einen Unfall ums Leben kommen, auch der tugendhafteste dieser Bürger. Er hasste den selbstzufriedenen und hämischen Ausdruck in Elisas Gesicht, wenn sie von Barbara und ihrem rätselhaften Ende sprach. Er hasste die Neugier der Leute, die Neugier seiner eigenen Kinder, und wich jedem Gespräch darüber aus.
Für ihn galt nur eines. Er hatte versagt. Er hatte Barbara nicht heimgeholt, wie es der Vater gewünscht hatte. Und wie er es im geheimsten Herzen ja auch gewünscht hatte. Denn hatte er jemals im Leben einen Menschen so geliebt wie seine schöne Schwester? Keinen. Nie. Nicht seine Frau. Nicht seine Kinder. Wenn er die Empörung aller anderen geteilt hatte, dann darum, weil sie auch ihn verlassen, weil sie auch ihm das alles angetan hatte.
Nun war es zu spät. Aber sofort entschloss er sich, Barbara, das Kind, heimzuholen. Sie war allein. Wie lebte sie? Wovon lebte sie? Sie war noch jung, unmündig, wer kümmerte sich um sie?
Er hatte seinen Entschluss umgehend seiner Frau mitgeteilt. Es gab Debatten, ein Hin und Her, sogar ernsthaften Streit. Doch Julius blieb fest.
»Wozu das?«, hatte Elisa gefragt. »Sie lebt jetzt seit Jahren da unten. Sie ist dort aufgewachsen. Du kennst sie nicht. Keiner von uns kennt sie hier. Sie wird sicher nicht kommen wollen.«
»Ich werde sie fragen.« Er war nicht davon abzubringen. Er schrieb einen herzlichen, ja liebevollen Brief. Dass es ihn tief erschüttert habe, von dem Tod seiner Schwester zu hören. Wie war es denn passiert? Ein Autounfall? – Das vermutete er. Was sonst konnte es sein, wenn sie alle beide ums Leben gekommen waren. Sicher hatte Barbara selbst den Wagen gesteuert. Sie war eine wilde, ungestüme Reiterin gewesen, so war sie wohl auch Auto gefahren. – Dann hatte er seine Nichte aufgefordert zu kommen. »Du bist allein«, schrieb er, »und so jung, dass du noch den Schutz einer Familie brauchst. Du sollst hier leben wie meine Tochter. Du weißt vielleicht von deiner Mutter, dass ich drei Kinder habe, du sollst als viertes nun dazugehören. Du bist eine Tallien, und das Haus der Familie Tallien ist auch dein Haus. Wenn du willst, komme ich, um dich zu holen. Falls irgendwelche Verbindlichkeiten zu regeln sind, oder falls du Geld brauchst, schreibe es mir.«
Unter dem Schreiben war ihm eingefallen, dass es Unsinn war, danach zu fragen. Er hatte gleichzeitig eine größere Summe angewiesen.
Auf diesen Brief hörte er mehrere Wochen lang nichts. Die Tochter schien der Mutter zu gleichen. Sie schrieb nur selten und nur, wenn es nötig war. Sie schrieb weder eine Bestätigung noch einen Dank für das Geld. Und sie teilte auch nichts über den Tod ihrer Mutter mit.
Julius war im Zweifel, was er tun sollte. Einfach hinunterfahren? Noch einmal schreiben?
»Pass nur auf«, stichelte Elisa, »eines Tages steht sie vor der Tür. Sie ist wahrscheinlich unberechenbar und schlecht erzogen wie deine Schwester.«
Julius war so ärgerlich geworden, wie Elisa ihn selten gesehen hatte. »Ich verbiete dir, etwas gegen meine Schwester zu sagen. Was immer sie getan hat, es gibt dir nicht das Recht, sie noch im Tode zu beleidigen und zu beschimpfen.« Er liebte manchmal die großen Worte. Auch dies war eine Familieneigenschaft.
Plötzlich nun, vor genau sechs Tagen, war wieder ein Brief mit den kindlichen Buchstaben gekommen. Kurz und bündig teilte die junge Barbara darin mit, dass sie an dem und dem Tage mit dem und dem Zug eintreffen würde. Weiter nichts.
Nun war sie da. Schlief die erste Nacht im Hause der Talliens. Noch wusste Julius nichts von ihr, nichts von ihrem Leben. Er wusste nur eins: Dass sein Herz erfüllt war wie lange nicht mehr, dass er Freude empfand, ja Glück darüber, dass das Mädchen da war. Und dass sie in allem seiner toten Schwester glich, ihr Aussehen, ihr Lächeln, ihre Art zu gehen und zu sprechen. Eine echte Tallien. Was wusste Elisa davon, wie viel den Männern der Talliens ihre Frauen bedeutet hatten, immer und zu jeder Zeit. Er war glücklich, dass sie da war, schon an diesem ersten Abend. Sie sollte bei ihm bleiben.
2
Das ist Barbara.«
»Das ist also Barbara. Nein, wie reizend. Wie sie ihrer Mutter gleicht.« Dann dämpfte sich die Stimme. »O Gott, es ist so schrecklich. Sie war noch so jung. Und das arme Kind ist nun ganz allein.« Und dann wieder mit betonter Herzlichkeit: »Gefällt es dir bei uns? Nun, du wirst dich schon eingewöhnen. Wir freuen uns alle, dass du da bist. Du musst uns demnächst einmal besuchen.«
Barbara kannte diese Gespräche schon. Obwohl es ihr nicht so schnell gelang, die weitverzweigte Verwandtschaft auseinanderzuhalten. Da waren Onkels und Tanten, eine Menge von Cousinen und Vettern, ältere und jüngere Familienmitglieder, eine große Sippschaft, und dazu eine Menge von Freunden und Bekannten des Hauses. Alle hatten sie neugierige Augen, aber alle waren freundlich zu ihr, jeder tat, als sei es ganz selbstverständlich, dass sie nun hier sei. Sie fühlte, wie alle diese Augen ihr folgten, wie man sie beobachtete, über sie sprach. Und alle taten ein wenig so, als käme sie aus dem Urwald.
Manchmal kam es ihr selbst so vor. Das Leben, das sie jetzt führte, war so verschieden von dem, das sie bisher gekannt hatte. In Rock und Bluse, in flachen Sandaletten und mit nackten Beinen war sie in den engen Gassen von Roano umhergelaufen. Sie hatte wenig anzuziehen, sie hatte nie viel gegessen, das Leben war unruhig und unsicher, aber es war voller Freiheit. Wenn sie am Wochenende mit Piero zum Tanzen ging, trug sie ein kurzes weites Kleidchen aus gelber Seide, immer das gleiche, und um den Hals eine Kette mit grünen Steinen, die er ihr geschenkt hatte. Sie war überschlank, mit langen Beinen, schmaler Taille einer kleinen festen Brust, schönen breiten Schultern und einem schmalen beweglichen Hals. Das leuchtende Haar trug sie halblang und glatt, selten, dass sie einmal einen Friseur aufsuchte. Das kostete alles Geld. Immer war ihre Haut leicht gebräunt, auch im Winter, ein haltbarer sanfter Goldton auf Armen, Schultern und Beinen, der sich doch stets von der Hautfarbe der Italiener unterschied. Eine junge, ein wenig verwilderte Schönheit der Talliens, die wurzellos in fremdem Lande aufgewachsen war.
Jetzt hatte man sie neu eingekleidet. Elisa und vor allen Dingen ihre Cousine Marianne hatten sich dieser Aufgabe mit echt weiblicher Freude angenommen. Marianne hatte sie mit zu ihrem Friseur genommen. Der hatte nicht glauben wollen, dass die Farbe ihres Haares echt sei. Er hatte ihr eine leichte Dauerwelle gemacht, das Haar ein wenig gekürzt und dann auf moderne und daher sehr natürliche Weise frisiert. Wie eine einzige leuchtende weiche Welle umschloss es ihren schmalen Kopf, dunkelblond mit diesem goldrötlichen Schimmer darin. Wenn die Sonne darauf schien oder wenn sie im Licht einer Lampe saß, schien es Funken zu sprühen. Irgendein alter Onkel, Barbara wusste nicht mehr, wie er hieß, hatte genießerisch den alten französischen Kognak im Glas geschwenkt, dass das Licht darin blitzte, und ihr vergnügt zugerufen: »Sieh, Barbara, er hat die gleiche Farbe wie dein Haar. Nach Jahrhunderten sieht man noch, wo die Talliens herkommen. Das ist alles unter Frankreichs Sonne gewachsen.«
Sie hatte unsicher gelächelt. Die Damen machten süßsaure Gesichter zu dem Kompliment.
Und dazu die dunklen, fast schwarzen Augen unter breiten, schöngezeichneten Brauen, die hohe Stirn und das schmale, edle Oval ihres Gesichts. Julius musste sie immer wieder ansehen. Auch als sie schon einige Wochen in seinem Hause lebte, war sie immer noch wie ein Wunder für ihn. Die Jahre schienen ausgelöscht. Es war, als säße Barbara ihm gegenüber. Die andere Barbara.
Übrigens gab die Namensgleichheit von Mutter und Tochter oft Anlass zu Verwirrung. Nicht immer war die gegenwärtige Barbara gemeint, wenn der Name fiel. Barbara merkte es an den unsicheren Blicken, die sie streiften, an den gedämpften Stimmen, wenn sie von ihrer Mutter sprachen. Sie hätte gern gesagt: Erzählt mir! Erzählt mir alles von ihr. Wie sie war, wie sie gelebt unter euch, und warum es so furchtbar war, was sie getan hat, dass ihr es bis heute nicht vergessen könnt.
Aber natürlich fragte sie nicht. Nicht einmal Julius, denn sie merkte, dass er am allerwenigsten darüber sprechen mochte. Sie verstand es, auch sie sprach nicht von dem, was geschehen war.
Für die jüngere Generation war das Thema nicht interessant. Sie mokierte sich über die Wichtigkeit, die die Alten den vergangenen Geschichten beimaßen. Das war so lange her. Für sie war die junge Barbara, die plötzlich hier hereingeschneit kam und die mit einem Mal im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit stand, weitaus interessanter. Die Mädchen waren zurückhaltend, oft sogar ablehnend, denn natürlich widmeten die jungen Männer dieses Verwandten- und Bekanntenkreises der reizvollen Fremden große Aufmerksamkeit. In diesem Fall nun bewegte sich Barbara auf sicherem Boden. Mochte sie auch nicht die gesellschaftliche Gewandtheit der anderen Mädchen besitzen, so hatte sie doch lang genug unter Südländern gelebt, hatte von Jugend an lebhafte Verehrung von Männern entgegengenommen und gelernt, darauf mit der lässigen Sicherheit der Frauen dort zu reagieren. In dieser Beziehung war sie reifer als die gleichaltrigen Mädchen hier. Und nicht zuletzt – sie hatte zwei Jahre lang einen Geliebten gehabt, einen leidenschaftlichen, zärtlichen Geliebten. Sie wusste mehr von der Liebe als manche der verheirateten Frauen, die ihr die Wangen streichelten und sie liebes Kind nannten.
Piero war immer stolz auf sie gewesen. Als es ihm damals gelungen war, sie zu verführen, sie war erst achtzehn, doch sie hatte ihm nicht viel Widerstand geleistet, hatte er nicht gezögert, sich offen zu ihr zu bekennen, zu zeigen, dass sie zu ihm gehöre, dass sie sein Mädchen sei. Der ganze Ort hatte es mit der Zeit akzeptiert. Nur ihre Eltern wussten es zunächst nicht, der Vater hatte es nie erfahren. Für ihn war Barbara noch ein Kind, der lustige Piero nichts als ein guter Freund der Tochter. Barja hatte es natürlich bald gemerkt. Sie hatte nicht viel dazu gesagt. Nur einmal. »Willst du diesen Piero etwa heiraten?« – »Ich weiß nicht«, hatte Barbara erwidert. »Tu es nicht«, sagte Barja darauf, und um ihren Mund war der harte Zug erschienen, den Barbara nicht liebte. »Wir werden fortgehen von hier. Bald. Ich will mein Leben nicht in diesem Nest beschließen. Du vielleicht? Mit Piero als Ehemann und einem Haufen Bambini?« Und auf Barbaras unsicheres Schweigen: »Er ist ein netter Kerl. Und sehr tüchtig, wie man sagt. Aber trotzdem, Barbara, tu es nicht. Ich bleibe nicht, das weißt du. Ich gehe auf jeden Fall. Später.«
Ja, so war Barja gewesen, sachlich und ohne falsche Sentiments. Seit die Tochter annähernd erwachsen war, hatte sie vollends darauf verzichtet, die Mutterrolle zu spielen, die ihr ohnedies nie gelegen hatte. Als Barbara klein war, hatte sie nicht viel von der Mutter gehabt. Barja war selbst zu jung. Sie hatte das Kind widerstrebend und mit Abneigung bekommen und mochte es nicht sonderlich, als es da war. So führte es sein kleines, unruhiges Leben nur so am Rande. Aber es hatte die schöne, einmalige Mutter immer heiß geliebt und rückhaltlos bewundert.
Als Barbara älter wurde, hatte sich das Verhältnis zwischen ihnen verbessert. Sie waren Freundinnen geworden. Barja ließ die Tochter teilnehmen an ihren Träumen und Hoffnungen. O ja, das hatte sie vor allem, Träume und Wünsche und Hoffnungen. Sie erwartete noch so viel vom Leben. Und alles gipfelte immer in dem Wort: später.
Barbara wusste, was damit gemeint war. Später, das war, wenn der Vater tot sein würde. Später, das war, wenn sie frei sein würde. Oft war sie nahe daran gewesen, doch zu gehen. Aber sie hatte den Mann nicht verlassen, den sie aus seinem friedlichen Leben, aus seiner gesicherten Existenz gerissen hatte. Sie liebte ihn schon lange nicht mehr, doch sie hatte ihn nicht verlassen. Sie war eine Tallien, sie besaß Pflichtgefühl, sie war ritterlich und fair. Bis zuletzt. Da wollte sie doch gehen und ein neues Leben suchen.
Aber sie kam nicht mehr fort. Es gab kein neues Leben für sie. Jetzt musste sie für immer dortbleiben, auf dem kleinen Friedhof mit der harten steinigen Erde, nahe den Weinbergen. Zusammen mit dem Mann, der ihr Schicksal geworden war.
Ihr ruheloses Später aber, ihr ständiger Wunsch fortzugehen, hatte in Barbara seine Spur hinterlassen. Vielleicht war sie deswegen jetzt hierhergekommen. War fortgegangen in ein anderes Leben, trotz Piero. Obwohl sie ihn liebte. Seit sie hier war unter den Fremden hatte sie oft Sehnsucht nach ihm, nach seinem Lachen, seinen Zärtlichkeiten, nach seinen Küssen und nach seinen Armen, die sie festhielten.
Piero war stolz gewesen. Er hatte den fremden Vogel für sich eingefangen. Er war stolz auf ihre Haltung, ihre andere Art, den Kopf zu tragen, auf ihr leuchtendes Haar, ihre freie, selbstbewusste Art, und sogar auf den Widerstand, den sie ihm manchmal leistete. La Tedesca war sie dort gewesen. Die Fremde, die Sonderbare. Hier war sie nun die Italienerin. Die Fremde, die Sonderbare. War sie nirgends daheim?
Ihr Zusammenleben mit der Familie Tallien gestaltete sich verhältnismäßig reibungslos. Barbara selbst gab keinen Anlass zu Schwierigkeiten. Sie war reif für ihr Alter, besonnen und mit einer gewissen sicheren Anmut ausgestattet, die überraschte. Sie bewegte sich in dem neuen Rahmen, ohne besonders aufzufallen oder Befremden zu erregen. Dabei hatte sie nur die gewöhnliche Volksschule in Roano besucht, ihre Bildung wies ganz schauerliche Lücken auf, wie die Verwandtschaft und besonders Elisa immer mit geheimem Entsetzen feststellten. Doch sie besaß sehr viel natürliche Intelligenz, und die war ihr in diesem Falle nützlicher als der glänzende Abschluss einer höheren Schule. Der Stolz und das Selbstbewusstsein, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, verhinderten von vornherein, dass sie jemals unter Komplexen litt. Sie war niemals, zu keiner Stunde, das arme junge Mädchen, das bei den reichen Verwandten aufgenommen worden war. Sie kam nie in die Verlegenheit, die Situation von dieser Seite zu sehen. Ihr Auftreten, ihre Haltung strafte den Lügen, der sie zum Aschenbrödel stempeln wollte. Dabei war sie niemals unbescheiden oder vorlaut, hatte tadellose Tischmanieren und geriet niemals wegen irgendwelcher Äußerlichkeiten in Verlegenheit. Jeder musste zugeben, dass Barbara ihre Tochter gut erzogen hatte.
Julius war tief befriedigt und ein wenig amüsiert, als sie, kaum 14 Tage nach ihrer Ankunft, das erste Mal abends mit ihnen ausging. Auswärtige Geschäftsfreunde waren zu Besuch. Manchmal bewirtete er sie zu Hause, doch an diesem Abend hatte er ein Essen im Restaurant veranlasst. Es sollte im Park-Hotel stattfinden, dem ersten Haus am Platz, der gute Ruf seiner Küche war weit über die Stadt hinaus bekannt.
Für gewöhnlich begleitete ihn Elisa bei solchen Gelegenheiten, oft war auch Marianne dabei. An diesem Abend war Marianne jedoch verhindert. Aus einem plötzlichen Einfall heraus sagte er mittags zu Elisa: »Eigentlich könnte Barbara heute Abend mitkommen.«
Elisa machte eine ablehnende Miene. »Wozu das?«
Er ließ sich nicht abschrecken. »Wir sind drei Herren. Du wärest die einzige Dame am Tisch. Es wäre doch nett, wenn Barbara mitkäme. Sie ist noch nirgends weiter hingekommen, hat nur Leute aus dem Verwandtenkreis kennengelernt.«
»Ich glaube nicht, dass du ihr damit einen Gefallen tust. Du kennst den Rahmen im Park-Hotel. Sie würde sich vermutlich sehr unbehaglich fühlen.«