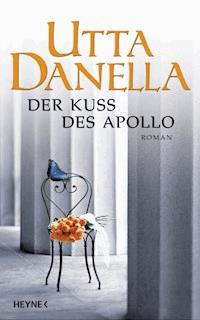6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1968: Virginia Stettenburg-von Maray feiert im Klosterinternat ihren 18. Geburtstag. Überraschend bekommt sie Besuch von ihrem Vater, den sie seit drei Jahren nicht mehr gesehen hat, und als Geschenk ein Familienerbstück, das ihrer adligen Großmutter gehörte. Virginia wuchs ohne Familie auf: Ihre Mutter sei tot, hatte man ihr gesagt, und die neue Frau ihres Vaters wollte nichts mit ihr zu tun haben. Am Tag nach ihrem Geburtstag taucht ein mysteriöser Mann auf, der Virginia eröffnet, dass ihre Mutter lebt und er sie zu ihr bringen wird. Ohne eine Nachricht zu hinterlassen, folgt sie verstört dem undurchsichtigen Mann. Die Reise führt sie nach Südfrankreich, in die einsamen, gefährlichen Berge der Provence, wo der wilde Lavendel blüht. Findet Virginia dort endlich Geborgenheit und Liebe oder ist sie nur Mittel zum Zweck und wieder alles eine große Lüge?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Die Jungfrau im Lavendel
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet: www.hockebooks.de
Utta Danella: Die Jungfrau im Lavendel. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1984 im Heyne Verlag, München erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von StevanZZ/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51359-5
www.ava-international.de
www.uttadanella.de
Das Mädchen
Virginia Elisabeth Stettenburg-von Maray sah ihren Vater, genauer gesagt den Mann, den sie für ihren Vater hielt, zum letzten Mal an dem Tag, an dem sie achtzehn Jahre alt wurde. Natürlich konnte sie nicht wissen, dass es das letzte Mal sein würde. Doch es fiel ihr auf, dass er schlecht aussah, die hagere Gestalt hielt sich nicht mehr so gerade wie früher, er ging leicht vornübergebeugt, das schmale, strenge Gesicht war blass und von tiefen Furchen durchzogen.
Die grauen Augen blickten müde und gleichgültig, und sie fand auch diesmal nicht darin, wonach sie stets so sehnsüchtig gesucht hatte: eine Spur von Anteilnahme und Wärme, so etwas wie Zuneigung. Liebe vielleicht sogar.
Dennoch war es eine freudige Überraschung für sie gewesen, als ihr sein Besuch am Tag zuvor angekündigt wurde, nachdem sie sich bereits damit abgefunden hatte, dass sie ihren Geburtstag nur wieder mit den Schwestern und den wenigen Schülerinnen, die genau wie sie die Ferien im Kloster verbringen mussten, feiern würde.
Das waren wie immer Anna-Luisa, die Vollwaise war, und die Zwillinge Sabine und Barbara, deren Eltern, beide Ärzte, bei einem Forschungsteam in Afrika arbeiteten. Die Zwillinge waren nette, heitere Mädchen, aber mit ihrer gegenseitigen Gesellschaft so beschäftigt, dass man mit ihnen nicht wirklich befreundet sein konnte. Sie waren durchaus kameradschaftlich, aber man kam sich in ihrer Gesellschaft immer etwas überflüssig vor, nur eben gerade geduldet. Virginia, die sehr sensibel war, empfand es jedenfalls so.
Anna-Luisa war als Freundin denkbar ungeeignet. Dunkel wie ihr Haar und ihre Augen sei ihr Gemüt, so hatte Teresa es einmal ausgedrückt, die um treffende Formulierungen nie verlegen war. Teresa hingegen war echt und wirklich Virginias Freundin.
Nur hatte ihre Mutter sie schon in der vergangenen Woche abgeholt, um mit ihr stracks nach Italien zu fahren, auf das Landgut der Familie in der Toskana, wo Teresa wie jedes Jahr die Ferien verbringen würde.
»Du musst unbedingt einmal mitkommen, Gina«, hatte Teresa gesagt, aber dazu würde es wohl nie kommen. Zu einer Auslandsreise brauchte Virginia sicher die Erlaubnis ihres Vaters, und sie hätte es nie gewagt, ihn darum zu bitten. Sie hätte auch gar nicht gewusst, wie sie mit ihm in Verbindung treten sollte. Denn unverständlicherweise war es nicht erwünscht, dass sie sich, sei es auch nur mit einem kleinen Brief, direkt an ihn wandte. Eine Verbindung bestand nur über die Oberin.
»Er muss ein Unmensch sein, dein Vater«, hatte Teresa einmal erbost gesagt, Teresa, die ein so herzliches und zärtliches Verhältnis zu ihrer gesamten Familie hatte. »Du darfst so etwas nicht sagen. Du kennst ihn ja gar nicht«, hatte Virginia, wenn auch zögernd, darauf erwidert.
»Ah, dio mio, mach nicht solch ein Engelsgesicht! Ich sage es, und ich meine es auch so. Und ich weiß natürlich, wer schuld daran ist. Dieses schreckliche Weib, mit dem er verheiratet ist, deine Stiefmutter. Sie will von dir nichts wissen.«
Virginia hatte geschwiegen. Das entsprach ja wohl der Wahrheit. Sie kannte die Frau ihres Vaters nicht, hatte sie nie zu Gesicht bekommen, und nie hatte diese Frau nach ihr gefragt, auch nur einen Gruß bestellt, geschweige denn sie einmal besucht. Warum das so war, wusste Virgina nicht.
In der Woche, die seit Teresas Abreise vergangen war, hatte Virginia Zeit genug gehabt, darüber nachzudenken, wie herrlich es sein müsste, mit Teresa zu verreisen. Einerseits. Andererseits wäre sie wohl vor Angst gestorben, sich so vielen fremden Leuten gegenüberzusehen. Und was Teresa betraf, so war es wohl nur dahingeredet und nicht ernst gemeint. Ihre Familie war ohnedies groß genug, sie besaß drei fabelhafte Brüder, und die Anzahl der österreichischen und italienischen Verwandten ließ sich sowieso nur schätzen. Bis heute hatte Virginia keinen klaren Überblick gewonnen.
»Addio, cara«, hatte Teresa zum Abschied gesagt und sie auf beide Wangen geküsst. »Sei nicht traurig. Es ist doch sehr hübsch hier vor den Bergen und in den Wäldern. Bei der nonna ist es immer grässlich heiß. Hoffentlich fahren wir mal ans Meer. Aber da ist es im Sommer auch so überlaufen. Nichts als Touristen, und wenn ferragosto erst beginnt, kann man kaum auftreten vor lauter Menschen. Das Schwimmbad in Gollingen ist viel hübscher. Geh öfter mal zum Baden! Und mal ein Eis essen. Und …« Viel mehr an Ferienfreuden für Virginia fiel ihr auch nicht ein.
»Lass dich nicht einsperren. Und lass dir von dieser blöden Anna-Luisa das Leben nicht verdüstern. Du bist ohnehin viel zu schwermütig. Kümmere dich nicht um ihr Gerede.«
Das war leicht gesagt. Anna-Luisa redete viel und immer nur über unerfreuliche Dinge: über die Sinnlosigkeit des Daseins und die ewige Verdammnis, die ihnen ohnehin sicher sei, über alle Krankheiten, die es gab und die man bestimmt bekommen würde, über den Weltuntergang, die Schlechtigkeit der Menschen und die unbegreifliche Ungerechtigkeit Gottes. Letzteres bereute sie dann wieder in langwierigen Beichten bei Pater Vitus in der Klosterkirche und legte sich selbst so strenge Bußübungen auf, wie sie dem gutmütigen Pater im Traum nicht eingefallen wären.
Kein Grund also, den Ferien und dem kurz auf deren Beginn folgenden Geburtstag mit großen Erwartungen entgegenzusehen. Nach der Messe ein Händedruck der Oberin und ein paar freundliche Worte von Pater Vitus, beim Frühstücksgedeck ein kleiner runder Kuchen und ein bescheidenes Sträußchen aus dem Klostergarten.
Von Teresa würde sicher kein Brief kommen; sie war ja auch gerade erst in Italien angekommen, mitten in den Familientrubel hinein, und sie würde Virginias Geburtstag bestimmt vergessen. Warum auch nicht, dachte Virginia bitter, ich bin hier gerade gut genug für sie. Aber sonst? Sonst braucht sie mich wirklich nicht. Keiner braucht mich. Niemand hat mich lieb. Am besten wäre ich gar nicht geboren.
Jedoch am Tag zuvor, beim Abendessen, sagte Schwester Serena: »Heute hat dein Vater angerufen, Virginia. Er kommt morgen im Laufe des Tages.«
Zuerst erschrak Virginia, wie immer, wenn etwas Unerwartetes geschah. Das zweite Gefühl war Angst, die sie ihrem Vater gegenüber immer empfand, doch dann meldete sich tief innen eine zitternde Freude.
Er würde kommen. Der einzige Mensch auf dieser Welt, der zu ihr gehörte, ihr Vater, würde kommen. Sie würde an ihrem Geburtstag nicht allein sein.
In der Nacht konnte sie vor Aufregung kaum schlafen, und am Morgen stand sie noch früher auf als gewöhnlich, hatte den Waschraum ganz für sich allein und betrachtete lange und prüfend ihr Gesicht in dem kleinen Spiegel.
Ob sie ihm ein wenig gefallen würde? Es war drei Jahre her, seit er sie zum letzten Mal gesehen hatte, und damals war sie ihrer Meinung nach noch ein dummes Kind gewesen. Aber nun war sie erwachsen, und allein der Umgang mit Teresa hatte sie um vieles reifer und erfahrener gemacht.
Wenn sie doch nur schön wäre! Vielleicht würde ihr Vater sie dann liebevoller ansehen. Sie vergaß nie die Bemerkung, diese einzige Bemerkung, die er je über ihre Mutter gemacht hatte. Er hatte nie über sie gesprochen. Jede schüchterne Frage von ihr war so abweisender Kälte begegnet, dass ihr das Wort im Hals stecken blieb. Und sie hatte dann auch nichts mehr gesagt, weil sie glaubte, dass der Schmerz über den frühen Tod der Mutter schuld daran sei, es ihm einfach unmöglich mache, von ihr zu sprechen.
Aber es war so lange her, und schließlich hatte er ja wieder geheiratet. Warum konnte er denn nicht zu ihr ein einziges Mal über ihre Mutter sprechen? Bei seinem letzten Besuch vor drei Jahren hatte sie sich ein Herz gefasst und gefragt, unsicher und stockend.
»Ich meine nur … Wie … Wie war sie denn? Bin ich ihr ähnlich?« Ihr Vater hatte sie angesehen, doch sein Blick war leer gewesen, ging durch sie hindurch.
Schließlich sagte er: »Sie war sehr schön.«
Dieser knappe Satz hatte Virginia viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Umso mehr, als er aus dem Mund ihres Vaters höchst befremdlich klang. Jede andere Charakterisierung der Toten wäre von ihm zu erwarten gewesen, aber nicht dies – sie war sehr schön.
Als er sich an der Klosterpforte von ihr verabschiedete, wagte sie noch eine Frage.
»Du hast – kein Bild von ihr?«
»Nein.«
Nichts weiter. Ein kurzes, hartes Nein, das jede weitere Frage verbot.
Sehr schön also. Virginia stand vor dem Spiegelchen und runzelte bekümmert die Stirn. Schön war sie gar nicht. Als sie einmal zu Teresa davon sprach, hatte die gelacht und gesagt: »Du machst dir unnötige Sorgen, cara. Ich finde dich sehr reizvoll. Du hast so etwas Rührendes, du siehst aus wie die Unschuld persönlich. Große ahnungslose Kinderaugen. Dazu ist dein Mund ein höchst interessanter Gegensatz, deine Unterlippe ist geradezu sinnlich.«
Solche Sachen sagte Teresa, die weder so ahnungslos noch so unschuldig war, wie es dem Ort und der Erziehung der Schwestern angemessen gewesen wäre.
Aber Teresa lebte auch erst seit zwei Jahren in der Abgeschiedenheit der Klosterschule, sie war zuvor weit in der Welt herumgekommen, denn ihr Vater war ein österreichischer Diplomat, dazu mit einer bildschönen Italienerin aus reichem Haus verheiratet. Teresa war mehrsprachig aufgewachsen; zuletzt lebte sie mit ihren Eltern in Madrid, doch als sich herausstellte, dass sie bei ihrem guten Aussehen auch noch ziemlich temperamentvoll und eigenwillig war – sie war noch nicht sechzehn, da hatte sie einen ausgedehnten Flirt mit einem Botschaftssekretär und wollte mit ihm durchbrennen –, steckte man sie in das altrenommierte österreichische Kloster zu den frommen Schwestern.
Teresa trug es mit Gleichmut; sie war sich des amüsanten Lebens gewiss, das sie erwartete, wenn die Schulzeit zu Ende sein würde. In Virginias Augen war Teresa von einmaliger Schönheit; volles dunkelbraunes Haar, lebhafte braune Augen, eine golden getönte Haut, bereits voll entwickelt, dabei voll Grazie in jeder Bewegung und mit angeborenem Charme ausgestattet – keine Rede davon, dass Virginia je so begehrenswert sein würde, wie Teresa es zu jeder Stunde war, schon morgens im Waschraum, wenn sie im langen Nachthemd eine ihrer beliebten Vorstellungen gab, die Schwestern imitierte oder aus dem Leben in diplomatischen Kreisen berichtete, von Intrigen, Geheimnissen, Liebschaften und Ehebrüchen. Die Mädchen hörten jedes Mal fasziniert zu und kicherten noch stundenlang über das Gehörte.
»Aber, aber, liebes Kind«, sagte Schwester Serena mit sanftem Tadel, wenn sie etwas von den Erzählungen mitbekam. Mehr sagte sie nicht, denn auch auf die gutmütige Hausschwester verfehlte Teresas Charme seine Wirkung nicht. War die Mutter Oberin in der Nähe, oder Schwester Justina, die strengste der Schulschwestern, konnte Teresa sehr sittsam die Augen niederschlagen und wirkte so wohlerzogen und tugendhaft wie nur je eine Tochter aus gutem Hause.
»Die Frauen in Italien lernen das von Kindheit an«, klärte sie Virginia auf. »Dabei verstehen sie zu leben, mamma mia. Doch nach außen hin sind sie alle gehorsame Töchter und Ehefrauen.«
»Ist deine Mutter auch so?«, wollte Virginia wissen.
»Sie hat mit Papa genug zu tun. Er ist ein richtiger Mann. Und er sieht doch toll aus, findest du nicht auch?« Doch, das fand Virginia, das fanden alle Mädchen. Wenn Teresas Vater kam, um seine Tochter zu besuchen oder zu irgendeinem vergnüglichen Unternehmen abzuholen, suchten alle Mädchen nach einem Vorwand, ihm zu begegnen. Allein sein Lächeln! Sein Lächeln ließ die Klosterschülerinnen von etwas träumen, was sie nicht kannten und was auch kaum eine von ihnen je kennenlernen würde. So ein Mann war Teresas Vater. Und natürlich waren auch Teresas Brüder großartige Burschen, obwohl man sie nur von Bildern kannte. Ihr Auftreten war dem Kloster bisher erspart geblieben, was wohl gut war, denn, so Teresa: »Fabrizio, mein großer Bruder, o Madonna, wenn der herkäme, dann müsste die Mutter Oberin alle Mädchen einsperren.«
Alles in allem war es eine wundervolle Familie, und Virginia war von Neid erfüllt, wenn sie an Teresa dachte. So hässlich so ein Gefühl auch sein mochte, noch dazu einer Freundin gegenüber.
Ich dagegen, dachte Virginia, noch immer vor dem Spiegel im Waschraum, ich habe gar nichts. Zwar auch eine schöne Mutter, doch sie ist tot. Und einen Vater, der sich kaum um mich kümmert. Und habe ich ihn je lächeln sehen? Und diese Stiefmutter, die ich gar nicht kenne. Sie muss mich hassen. Warum nur? Was war so Geheimnisvolles um den Tod ihrer Muter, dass man sie dafür büßen ließ in trostloser Verbannung?
Keine guten Gedanken an diesem Morgen ihres Geburtstages. Und gleichzeitig kam es wie Zorn über sie, eine Art Aufsässigkeit: Eines Tages werde ich fortgehen von hier. Ich werde mein eigenes Leben haben, mein Leben für mich. Und ich werde so wenig nach ihnen fragen wie sie nach mir.
Dann fiel ihr ihre Großmutter ein, bei der sie gelebt hatte, bis sie sieben Jahre alt war. Auch sie war tot. Doch sie war der einzige Mensch, bei dem sie so etwas wie ein Zuhause gehabt hatte. Liebe hatte Virginia von ihr auch nicht bekommen; sie war unzugänglich gewesen, sehr schweigsam, aber doch immer gerecht bei aller Strenge. Von dem Leben der Gräfin Maray wusste Virginia nichts, nur eben gerade, dass auch sie als junges Mädchen in dieser Klosterschule erzogen worden war.
Nachdenklich kämmte Virginia das lange, blassblonde Haar und band es im Nacken zusammen, denn die Schwestern duldeten keine offenen Haare. Sicher würde der Vater mit ihr irgendwohin gehen, dann konnte sie das Band entfernen, vielleicht gefiel sie ihm dann besser. Das Wetter war schön, also konnte sie das weiße Kleid mit den kleinen blauen Blümchen anziehen. Wenn sie doch nur weiße Schuhe hätte …
Sie zog die Unterlippe zwischen die Zähne, damit sie ein wenig röter wurde. Teresa besaß einen Lippenstift, aber den hatte sie mitgenommen. Ob die Zwillinge einen hatten? Falls der Vater sie nach einem Geburtstagswunsch fragte, würde sie ihn um weiße Schuhe bitten. In Enzensbach gab es zwar keinen Schuhladen, aber fünf Kilometer entfernt, in Gollingen, wo immerhin eine ganze Menge Sommergäste hinkamen, hatte sie im Fenster weiße Sandaletten gesehen, aus geflochtenem Leder, die Fersen frei.
Teresas Mutter hatte solche Schuhe angehabt. Mit sehr hohem Absatz, und nicht nur die Fersen waren frei, auch die rot lackierten Zehennägel waren zu sehen gewesen. »Wenn ich zu Hause bin«, hatte Teresa verkündet, »lackiere ich mir die Nägel auch. Sieht viel hübscher aus. Soll ich dir Nagellack mitbringen? Hoffentlich denke ich daran.«
Ob weiße Schuhe ihm zu teuer sein würden? Er war kein armer Mann, das wusste sie. Die Klosterschule war auch nicht gerade billig. Wenn man eine Tochter hier zur Schule schicken konnte, würde man ihr zum Geburtstag auch ein Paar weiße Schuhe kaufen können.
Was für aufsässige Gedanken an diesem Geburtstagsmorgen!
Dann hörte sie Anna-Luisas nörgelnde Stimme auf dem Gang. Das fehlte gerade noch, dass sie die Erste war, die ihr gratulierte; sicher hatte sie wieder einen besonderen Spruch bereit. Etwa: Gebe Gott, dass du das nächste Jahr überleben wirst. Du bist sowieso immer sehr blass in letzter Zeit. Meine Mutter ist an Leukämie gestorben, das weißt du ja. Soll ich dir mal erzählen, wie das war? So ungefähr hatte sich im vergangenen Jahr Anna-Luisas Gratulation angehört.
Virginia verdrückte sich in die Toiletten und verschwand durch die kleine Tür, die von dort aus in die Wäschekammern und dann weiter in den Haushaltstrakt führte. Schwester Serena als Erster zu begegnen, würde besser sein.
Der Vater
Der Oberst a. D. Ferdinand Stettenburg-von Maray kaufte seiner Tochter keine weißen Schuhe zum Geburtstag, weil er bereits ein Geburtstagsgeschenk mitbrachte.
Und zwar ein so unerwartetes und prächtiges Geschenk, dass Virginia die weißen Schuhe darüber vergaß. In einem schmalen, länglichen Kästchen lag auf hellblauer Watte eine Kette aus Gold, die sich zur Mitte hin verbreiterte, wo drei blasse Opale in Filigran eingefasst waren.
Es war auf der Terrasse des Gasthofs »Zum Klosterhof«, wo Virginia das Kästchen überreicht bekam und mit zitternden Fingern öffnete.
»Das ist für mich?«
»Es gehörte meiner Mutter«, sagte der Oberst steif. »Es ist das Einzige, was von ihrem Schmuck übrig blieb. Ich denke, du bist nun alt genug, um so etwas zu tragen.«
»Darf ich sie ummachen?«
»Natürlich.«
Virginia legte sich die Kette vorsichtig um den Hals. Das Weiße mit den blauen Blümchen hatte einen bescheidenen runden Ausschnitt, wie man ihn in der Klosternäherei als passend erachtete, und die Kette fügte sich vortrefflich hinein.
»Danke«, sagte sie und blickte ihren Vater mit leuchtenden Augen an, »ich danke dir sehr. Ich freue mich ganz schrecklich.«
Er hat mich lieb, dachte sie glücklich, er hat mich eben doch lieb.
Der Oberst räusperte sich. So etwas wie Rührung überkam ihn, ein Gefühl, das er nicht schätzte und das hier auch vollkommen fehl am Platze war. Seit dieses Mädchen auf der Welt war, hatte er sein Herz gegen es verhärtet, und er hatte triftige Gründe dafür.
Dennoch war er heute seltsamerweise bewegt gewesen, als er sie nach so langer Zeit wiedersah, überrascht von ihrer Erscheinung, als sie ihm im Empfangszimmer des Klosters gegenübertrat.
Er hatte ein schlaksiges, scheues Kind in Erinnerung, das kaum wagte, ihn anzusehen. Nun, scheu war sie immer noch, aber sie war hübsch geworden, auf eine sanfte, verträumte Art, die in gewisser Weise etwas – ja, man konnte sagen, die etwas Rührendes hatte. Sie wirkte so unschuldig und hilfsbedürftig, ein Wesen, das man beschützen musste.
Er war, ohne die geringste Ahnung davon zu haben, zu dem gleichen Ergebnis gekommen wie die junge, allerdings nicht ganz unerfahrene Teresa.
Nachdem er mit der Oberin ein kurzes Gespräch geführt hatte – genau wie in ihren regelmäßigen Berichten ließ sie ihn wissen, man sei mit Virginia sehr zufrieden, sie sei gehorsam, fleißig und fromm, ihre schulischen Leistungen seien zufriedenstellend –, hatte er mit dem Mädchen das Kloster verlassen. Das, was er eigentlich mit der Oberin hatte besprechen wollen, war ungesagt geblieben. Man erledigte es besser brieflich.
Mit andächtiger Miene war Virginia in den Mercedes geklettert und hatte die kurze Fahrt von der Anhöhe am Wald, wo das Kloster lag, bis hinunter in den Ort sehr genossen.
Es war noch früh am Nachmittag, sie saßen zunächst fast allein auf der Terrasse des Gasthofs, doch nach und nach füllte sie sich; die Mehlspeisen des Hauses waren berühmt, und die Sommergäste aus der Umgebung kamen gern zur Jause herauf.
Virginia spürte die Kette am Hals, deren Kühle sich auf ihrer Haut zu erwärmen begann, sie hätte gern in einen Spiegel geschaut, aber dazu hätte sie aufstehen und ins Haus gehen müssen. Bei dieser Gelegenheit könnte sie auch ein wenig Lippenrot auflegen, Sabines Lippenstift lag in ihrem Handtäschchen.
Der Oberst räusperte sich noch einmal und wusste nicht, was er sagen sollte. Glücklicherweise kamen der Kaffee und Virginias Kuchen, ein mächtiges Stück Nusstorte mit Schlagobers, und so waren sie zunächst einmal beschäftigt. Der Oberst aß keinen Kuchen, zündete sich stattdessen eine Zigarre an, was für ihn auch nicht bekömmlich war; er hatte Magengeschwüre, und in letzter Zeit war Essen für ihn zur Qual geworden. Die vorgeschriebene Diät widerte ihn an; das Einzige, was die Schmerzen betäuben konnte, waren Alkohol und Zigarren.
Er aß zu wenig, er trank zu viel. Früher hatte er nicht getrunken, aber jetzt suchte er Betäubung. Denn nur nach außen hin erschien sein Leben geordnet, zufriedenstellend, ein Mann mit einer anständigen Familie, mit Geld und Besitz.
Es war nicht sein Besitz, nicht sein Geld, und schon gar nicht seine Familie. Seine Frau hatte es immer verstanden, ihn das spüren zu lassen, und er war ihrer so müde, so wie er bei allem, was zu ihr gehörte, nur noch Müdigkeit, Überdruss empfand. Er war einsam, aber es machte ihm nichts aus. Schon lange nicht mehr. Er war siebzig. Und er hatte eigentlich genug.
Selbst dieses Mädchen gehörte nicht zu ihm, auch wenn es seinen Namen trug. Es war nicht seine Tochter, und es bestand kein Grund, sie mit Wohlwollen zu betrachten. Das mit der Kette war so ein plötzlicher Einfall gewesen, er hatte das Schmuckstück, dies letzte Andenken an seine Mutter, lange nicht mehr in der Hand gehabt. Seine Mutter hatte er geliebt, und sie ihn, auch wenn er ihr oft Anlass gegeben hatte, unzufrieden mit ihm zu sein.
Eigentlich hatte er die Kette nur mitgenommen, um Mechthild zu ärgern.
»Du willst diesen Wechselbalg wirklich besuchen?«, hatte sie gehässig gefragt.
»Ich denke, dass es meine Pflicht wäre«, war seine steife Erwiderung gewesen.
»Ich würde sagen, du tust mehr als deine Pflicht. Sie bekommt eine erstklassige Erziehung, die wir schließlich bezahlen.«
»Die ich bezahle.«
Sie lachte höhnisch.
»Von deiner Pension, ich weiß. Dafür wird ja dein sonstiger Aufwand von mir bestritten.«
Das war so einer der Momente, wo sich der Magen in ihm aufzubäumen schien, wo er meinte, sein Gesicht müsse gelb werden wie eine Zitrone, und gleichzeitig hatte er das entsetzliche Verständnis dafür, wie man einen Mord begehen konnte.
»Aber wenn du schon hinfährst«, fuhr seine Frau ungerührt fort, »könntest du ja mit der Oberin mal darüber sprechen, wie es weitergehen soll. Du weißt ja, was ich meine.«
Er wusste, was sie meinte. Denn davon hatten sie schon gesprochen.
Was sollte aus Virginia werden, wenn sie in einem Jahr die Schule verließ? Mechthild lehnte es natürlich ab, diese sogenannte Tochter, wie sie sich ausdrückte, in ihrem Haus aufzunehmen. Und auch noch eine Ausbildung für sie zu bezahlen, das ginge wohl zu weit, fand sie.
Von dieser Seite aus betrachtet, war es also von Vorteil, dass sie in die Klosterschule ging, es bot sich von selbst an, dass man sie dort gleich behielt. Nachwuchs brauchten sie bestimmt, und das Mädchen war dann sicher untergebracht und würde aus ihrem Leben verschwinden. Ein für alle Mal. Und falls sie das Wesen und den Charakter ihrer Mutter geerbt hatte, so weiter Mechthild Stettenburg – den Doppelnamen zu führen, hatte sie stets abgelehnt –, dann war das Kloster genau der passende Ort. Man konnte sie dort als Schulschwester oder sonst irgendetwas ausbilden, da gab es sicher mehrere Möglichkeiten. Auf jeden Fall wäre dann das Problem Virginia gelöst.
Mechthild hatte keine Ahnung vom Klosterwesen, und auch der hervorragende Unterricht, den die durch Studium ausgebildeten Schwestern dort erteilten, interessierte sie nicht. Sie wollte das Mädchen los sein. Denn, wie sie klarsichtig voraussah, ihr Mann würde sowieso nicht mehr lange leben.
Sie hielt sein Magenleiden für Krebs, und am Ende kam es dann noch darauf hinaus, dass sie für diesen Bastard aufkommen musste.
»Also vergiss nicht, mit der Oberin zu sprechen«, war ihr Abschiedswort gewesen.
Er hatte es nicht getan. Wie sollte er davon sprechen? Sie lebten nicht mehr im Mittelalter, wo man ein Mädchen einfach für das Kloster bestimmte, ohne es zu fragen. Und da war auch noch der Brief in seiner Tasche. Davon wusste Mechthild nichts. Und natürlich war es seine Pflicht, ja, verdammt, genau das, mit Virginia über diesen Brief zu sprechen. Das war viel wichtiger als das Gespräch mit der Oberin. Nur wusste er nicht, was er sagen sollte, wie man solch ein Gespräch begann. Eine Mauer einzureißen, die achtzehn Jahre alt und um das Zehnfache dick war, bedeutete für einen Mann seiner Art keine Kleinigkeit.
Er konnte den Brief auch zerreißen, genau wie er die anderen zerrissen hatte.
Als er dem Mädchen jetzt gegenübersaß, suchte er nach Ähnlichkeiten mit jener Frau, die es geboren hatte und die einmal seine Frau gewesen war.
Von Anitas aparter, verführerischer Schönheit besaß dieses Kind nichts. Das Haar war blasser, nicht von so leuchtendem Gold. Der Mund – nun ja, der Mund ähnelte ein wenig Anitas Mund, auch wenn er noch kindlich ungeprägt war. Die Form des Gesichtes jedoch, schmal, mit den hohen Backenknochen und den Schatten auf den Wangen, erinnerte sehr genau an Anitas Gesicht. Die Augen? Ihre Augen waren grün gewesen, sie konnten funkeln und leuchten und locken …
Was für idiotische Gedanken! Er sog heftig an seiner Zigarre, trank seinen Kaffee aus, dann sprach er das Mädchen an, damit es ihn ansah.
»Schmeckt der Kuchen?«
»O ja, danke, sehr gut.«
Die Augen waren grau. Mit einem leichten Grünschimmer darin, doch, das schon. Es waren die Augen eines unschuldigen Kindes. Ein Kind, das man büßen ließ. Wofür denn eigentlich? Was hatte es denn verbrochen? Es war geboren worden. Das war sein ganzes Verbrechen.
Wie er da so saß, der Oberst a. D. Ferdinand Stettenburg-von Maray, mitten in der warmen Sommersonne, vor sich eine Wiese in tiefem Grün, unter der Terrasse leuchtend bunte Sommerblumen, und dazu die Luft wie reiner Balsam, über ihnen der Wald, und dahinter die Berge, wie er da so saß, der Oberst, den niemand liebte und der keinen lieben durfte, da fühlte er sich alt und zutiefst elend, so verlassen von Gott und allen Menschen, dass es ihn die ganze, ein Leben lang geübte Beherrschung kostete, nicht einfach aufzustehen, wegzugehen, ganz egal wohin, und nie zurückzukehren. Zurück? Wohin denn? Zu wem?
»Du könntest ja noch ein Stück essen«, sagte er mühsam. »Oder einen anderen versuchen.«
Ebenso mühsam gelang Virginias Lächeln. Er behandelte sie immer noch wie ein Kind. Ein Kind, das man mit Kuchen füttert, damit es zufrieden ist.
Trotz der Kette und der Freude über seinen Besuch erfüllte Traurigkeit ihr Herz. Sie war nun erwachsen, und sie wollte anderes von ihm als ein Stück Kuchen und noch ein Stück Kuchen. Sie würde es nicht bekommen, auch diesmal nicht, das hatte sie schon begriffen. Er hatte sie nicht lieb, kein bisschen. Wenn sie nur begriffe, warum das so war.
Er könnte viel eher mein Großvater sein als mein Vater, dachte sie auf einmal. War meine Mutter viel jünger als er? War sie auch schon älter, als ich geboren wurde, starb sie bei meiner Geburt? Ist es das, was er mir nicht verzeihen kann, dass ich geboren wurde und sie tötete? Diese Gedanken waren ihr noch nie gekommen. Aber sie war nun alt genug, um darüber nachzudenken. Als sie klein war und bei ihrer Großmutter lebte, hatte sie die Situation als gegeben hingenommen, hatte niemals Fragen gestellt. Dann hatte sie einige Jahre in einer Privatschule verbracht, dort war es eigentlich sehr nett gewesen, sie kam mit Kindern zusammen, sie hatten Unterricht, aber es gab viel Spaß, sie machten Ausflüge, sie lernte schwimmen, sie war eine gute Turnerin, alle waren lieb und freundlich zu ihr. Und ging es ihr im Kloster etwa schlecht? Gewiss nicht. Aber sie wollte endlich einmal wissen, warum …
Sie war so allein, so verzweifelt allein auf der Welt. Es gab keinen Menschen, der zu ihr gehörte, und sie sehnte sich so sehr nach Zuneigung. Sie war hungrig auf das Leben, hungrig auf Liebe, aber es gab keinen, der sie lieb hatte. Keine Mutter, keinen Vater, keine Geschwister – nur die Freundschaft zu Teresa, die ihr so überlegen war. Eine Freundschaft, die enden würde, wie sie begonnen hatte, das wusste Virginia sehr genau, nämlich dann, wenn Teresa die Klosterschule verließ und ihr eigenes so erfolgversprechendes und abwechslungsreiches Leben begann.
Es war vier Jahre her, da hatte Virginia im Wald, nahe dem Kloster, ein kleines halb verhungertes Kätzchen gefunden. Es war Winter, sie nahm das Tier mit, wärmte und fütterte es und war so selig wie nie zuvor in ihrem Leben, denn da war endlich ein Wesen, das sie lieb haben durfte und das diese Liebe erwiderte, mit Schmeicheln und Schnurren, mit Wärme und Leben. Sie durfte das Kätzchen nicht behalten, die Oberin erlaubte es nicht. Sehr freundlich, aber bestimmt wurde ihr klargemacht, dass es leider nicht möglich sei, denn wenn jedes Mädchen ein Tier bei sich hätte, so würde man bald einen Zoo im Haus beheimaten. Für das Kätzchen wurde im Ort ein guter Platz gesucht, sie durfte es auch besuchen, aber was half ihr das, es war nicht mehr ihr Gefährte, es lebte bei anderen Menschen, zu denen gehörte es, die liebte es.
Sie hatte sich damals sehr unvernünftig und kindisch aufgeführt, sie weinte und bockte, wollte nicht mehr essen, war unansprechbar, bis man sie sehr energisch zurechtwies.
Schwester Serena tröstete sie.
»Ich darf niemanden lieb haben«, schluchzte Virginia. »Und mich hat auch niemand lieb, ich will nicht mehr leben.«
»Aber wir haben dich doch alle lieb. Wir alle hier. Und der Herr Jesus. Vergisst du ihn ganz? Er hat dich vor allem lieb. Und du liebst ihn doch auch zu jeder Stunde. Nicht wahr, Virginia, das tust du doch?«
Was hatte der Herr Jesus damit zu tun, dass sie ein kleines Kätzchen im Arm halten und streicheln wollte, dass es nachts zu ihren Füßen auf dem schmalen Lager schlafen sollte? Sie konnte in dem Herrn Jesus nicht das finden, was Schwester Serena offenbar in ihm gefunden hatte. Er konnte nicht der Ersatz für alles sein.
»Wenn der Herr Jesus mich lieb hätte«, sagte sie trotzig, »dann hätte er gemacht, dass ich mein Katzerl behalten darf.«
Sie blickte ihren Vater an, und ihre Augen schienen auf einmal grüner zu sein als zuvor.
»Danke, nein, ich kann nichts mehr essen. Es war ein sehr großes Stück Kuchen.«
»Tja, hm, dann«, machte der Oberst und ließ den Blick über die Terrasse schweifen, die inzwischen voll besetzt war. Wo die Leute bloß alle herkamen? Müsste eigentlich schön sein, hier Urlaub zu machen, in dieser Ruhe und dieser – dieser, ja, wie sollte man das nennen, dieser Harmonie. Er hatte seit zwei Jahren keinen Urlaub gemacht, es reizte ihn nicht, mit seiner Frau zu verreisen. Sie fuhr nach Florida, zu Bekannten, nahm ihre Söhne mit. Er hatte Hemmungen, in die Staaten zu reisen. Gut, der Krieg war über zwanzig Jahre vorbei, aber er war Offizier gewesen, Hitlers Offizier, er hatte lange Zeit in einem amerikanischen Lager gesessen, und man hatte ihn behandelt wie einen Verbrecher. Nein, er wollte nicht nach Florida, er wollte überhaupt nirgends hin, er blieb zu Hause und arbeitete.
Es wäre an der Zeit, ein ernsthaftes Gespräch zu beginnen. Etwa so: Was hast du vor, Virginia, wenn du mit der Schule fertig bist, hast du irgendwelche Pläne? Vielleicht könntest du …
Er fand die richtigen Worte nicht, stellte stattdessen ein paar Fragen nach der Schule, nach den verschiedenen Fächern, was sie für Fortschritte gemacht hatte, und dann auf einmal war sie es, die anfing, von dem Thema zu sprechen, das er so ängstlich vermied.
»Da wir gerade davon sprechen«, sagte sie und gab sich große Mühe, mit fester Stimme und einer gewissen Sicherheit das auszusprechen, womit sie sich dauernd beschäftigte, »später, meine ich, wenn ich hier fertig bin – ich würde gern eine Kunstakademie besuchen.«
Dem Oberst fiel fast die Zigarre aus der Hand. »Eine was?«
»Na ja, ich meine eine Kunstschule oder so etwas.« Ihre Sicherheit geriet ins Wanken. »Wo man das alles lernen kann.«
»Was willst du lernen?«
»Wir haben doch gerade davon gesprochen, und du hast mich gefragt, was ich am besten kann und was ich am liebsten tue.«
»Du sagtest, zeichnen und malen.«
»Ja! Das habe ich gesagt.«
»Soll ich das so verstehen, dass du daraus einen Beruf machen willst?«
Sie nickte.
Es fiel ihm ein, dass in den Berichten der Oberin einige Male von gewissen künstlerischen Fähigkeiten Virginias die Rede gewesen war. »Sie ist eine gute Beobachterin, und es gelingt ihr, das, was sie sieht und was sie dabei empfindet, mit erstaunlicher Intensität darzustellen.«
Diesen Satz hatte er sich gemerkt, weil er ihm unverständlich, aber irgendwie bedeutungsvoll vorgekommen war. Ein anderes Mal hatte die Oberin geschrieben, dass man Virginia immer damit beauftrage, die Kirche für Fest- und Feiertage zu schmücken, da niemand es so gut verstehe wie sie.
Er hatte sich damals gedacht, dass in den Briefen an ihn ja immer etwas stehen musste und dass die Oberin vermutlich nicht jedes Mal das Gleiche schreiben wollte. Womit er die Oberin ganz falsch einschätzte. Wenn es ihr so beliebte, beschränkte sie sich immer auf die gleichen zehn Zeilen.
»Du willst doch nicht etwa behaupten, dass du Malerin werden willst?«
Das klang so verächtlich, dass Virginia errötete, diesmal vor Ärger.
»Ich würde mir nie anmaßen, zu behaupten, dass ich eine wirkliche Künstlerin werden könnte. Ich meine nur, dass ich gern auf diesem Gebiet arbeiten würde. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Grafik zum Beispiel, Illustrationen, Buchumschläge, Modezeichnen …« Weiter kam sie nicht.
»Mode!« Er spuckte das Wort geradezu aus. »Es ist mir unbegreiflich, wie man in einem Kloster auf solche Ideen kommen kann.«
»Ich bin ja schließlich nicht im Kloster, sondern in einer Klosterschule. Unsere Erziehung ist sehr modern und aufgeschlossen«, sagte sie tapfer. »Wir leben hier nicht hinter dem Mond. Ich natürlich, ich komme ja nirgends hin. Fast alle Mädchen, die hier sind, waren schon in einer Ausstellung oder in einem Museum. Sie werden von ihren Eltern mitgenommen, in den Ferien. Meine Freundin Teresa zum Beispiel war schon im Louvre, sie kennt den Prado und das Rijksmuseum in Amsterdam und die Pinakothek in München und …«
Sie verstummte. Teresa war wirklich kein Beispiel, sie war die Ausnahme von der Regel. Und es war überhaupt töricht, von Teresa zu sprechen zu einem Menschen, der Teresa nicht kannte. Sie benahm sich höchst kindisch, das war ihr klar.
Ihr Vater blickte sie stumm an, sie las in seinen Augen Ablehnung, Spott.
»Schwester Borromea hat gesagt, sie wird einmal mit mir nach Wien fahren und in die Oper gehen und ins Burgtheater und – du müsstest das natürlich erlauben – und in alle Museen und …«
»Warum nicht gleich auf den Opernball«, unterbrach er sie sarkastisch. »Wer ist denn diese seltsame Schwester Borromea?«
»Unsere Kunsterzieherin. Sie sagt … sie sagt …« Angeborene und noch mehr die anerzogene Bescheidenheit ließen sie stocken, aber dann vollendete sie den Satz. »Sie sagt, ich bin begabt, und ich müsste eine richtige Ausbildung haben.«
Virginia verstummte und schluckte. Ihr Blick irrte über die Terrasse. Ihr war heiß vor Schreck, dass sie das alles gesagt hatte, doch gleichzeitig war sie froh, dass sie es gesagt hatte.
Ihr Vater schwieg eine Weile, sein Blick ging an ihr vorüber. Sie konnte nicht ahnen, dass er mit einem Lachen kämpfte. Kein gutes Lachen allerdings. Er dachte an Mechthild, seine Frau, was für ein Gesicht die machen würde, wenn er ihr erzählte: Virginia wird eine Kunstakademie besuchen. Sie hat großes Talent und wird Künstlerin.
In Essen, fiel ihm auch noch ein, in Essen gab es doch eine berühmte Schule dieser Art. Dann würde sie ganz in ihrer Nähe sein.
Seine Laune hatte sich jäh gebessert. Er winkte der Bedienung, bestellte noch einen Kaffee und einen doppelten Kirsch dazu.
»Für dich auch?«, fragte er Virginia.
»Ja, gern. Einen kleinen Braunen.«
»Keinen Kirsch?«
Sie blickte ihn unsicher an.
Er nickte dem jungen Mädchen im Dirndl zu.
»Für die Dame auch einen Kirsch.«
Als die Bedienung gegangen war, sagte er: »Wenn du nun schon achtzehn bist und dazu noch so fabelhafte Pläne entwickelst, kannst du auch ruhig mal einen Schnaps trinken. Oder willst du behaupten, ihr hättet das in eurer Schule noch nie getan? Du bist ja nicht im Kloster, hast du gesagt, und Taschengeld bekommst du auch, da werdet ihr ja wohl dafür gelegentlich etwas einkaufen. Weißt du, ich bin auch in solch einer ähnlichen Institution zur Schule gegangen. Man nannte das Kadettenkorps. Es war kein Kloster, aber so etwas Ähnliches. Unsere geheimen kleinen Gelage hatten wir dennoch.«
Virgina lächelte erleichtert. Er war auf einmal freundlich, blickte sie verständnisvoll an. Väterlich. Und sie hatte zuerst gedacht, ihre Ankündigung habe ihn ärgerlich gemacht.
»Doch, wir kaufen uns schon was ein. Meist Schokolade oder Pralinen. Wir haben uns auch schon Wein gekauft. Schnaps noch nie.«
»Na, dann probierst du jetzt einmal, wie er dir schmeckt.« Wein hatte meist Teresa gekauft, die erstens über viel Taschengeld verfügte und zweitens der Meinung war, ohne Wein könne der Mensch nicht existieren.
»Und Zigaretten?«, fragte er.
»Doch, manchmal schon«, gab sie zu.
»Soll ich dir welche bestellen?«
»O nein, danke, wirklich nicht. Ich mache mir nichts daraus.«
Als der Kirsch kam, nippte sie daran, schluckte dann den halben Inhalt des Glases hinunter.
»Schmeckt gut«, sagte sie.
»Freut mich«, sagte der Oberst. »Und nun zurück zum Thema. Du sagst also, künstlerische Arbeit, Malen, Zeichnen, Grafik, was auch immer, würde dir Freude machen, du hast Talent und möchtest darin ausgebildet werden. Wie ich höre, gibt es in der Schule«, er vermied das Wort Kloster, »eine Schwester, die euch darin unterrichtet. Wo hat sie es denn gelernt? Vielleicht wäre das eine Möglichkeit für dich. Du könntest dann später, genau wie Schwester Borromea, die Schülerinnen hier unterrichten.«
Sie begriff sofort, was er meinte, das Blut stieg ihr hitzig in die Wangen, und nun waren ihre Augen wirklich grün. »Du willst, dass ich hier im Kloster bleiben soll? Mein ganzes Leben lang? Das tue ich nicht. Nie. Nie.«
Ihre Stimme war laut geworden, leidenschaftlich. Er blickte besorgt zu den umliegenden Tischen.
»Nun, errege dich nicht. Es erschien mir als guter Gedanke.«
»Du willst mich los sein«, sagte sie bitter. »Für immer. Das ist es doch. Sag es doch ehrlich.«
Er war sichtlich verlegen. Trank den Kirsch aus, zündete sich eine neue Zigarre an. Schwieg.
»Schwester Borromea ist an der Kunstakademie in Wien ausgebildet«, erzählte sie nach einer Weile, nachdem von ihm keine Antwort kam und das Schweigen drückend wurde.
»Sie hatte keineswegs die Absicht, Klosterschwester zu werden. Sie hat Bühnenbilder gemacht für die Wiener Staatsoper. Natürlich hieß sie damals anders. Sie ist keine Nonne, verstehst du. Sie ist Laienschwester. Sie war verheiratet, ihr Mann fiel in Russland, und ihr Kind starb im ersten Jahr nach dem Krieg. Sie war ganz allein und sehr verzweifelt. Später kam sie dann hierher.« Eine befremdliche Geschichte. Er hatte nie darüber nachgedacht, dass es für manche dieser Frauen auch ein Vorher gab.
»Bühnenbildnerin, so«, meinte er. »Zweifellos ein interessanter Beruf.«
»Wenn man bedenkt, dass ich noch nie in einem Theater war«, murmelte Virginia.
»Man tut alles in seinem Leben zum ersten Mal. Heute hast du deinen ersten Schnaps getrunken, eines Tages wirst du ins Theater gehen. Eine Ausbildung an einer Akademie …«
»… für bildende Künste«, warf Virginia eifrig ein.
»Danke. Ich weiß in etwa, was das ist. Auch wenn ich nur ein einfacher Soldat bin und heute ein mittelmäßiger, eben gerade so geduldeter Fabrikbesitzer …«
Er verstummte, ärgerte sich, dass er das gesagt hatte. Das Mädchen wusste nichts von seinem Leben. Aber der Gedanke an das Gesicht seiner Frau, wenn er ihr von Virginias Plänen erzählen würde, war einfach überwältigend.
Mein Geld, meines Vaters hart verdientes Geld, so sagte sie, wenn von der Fabrik die Rede war, und sie ließ es ihn immer deutlich spüren, dass er eingeheiratet hatte, dass er ihr das ausgepolsterte Leben verdankte, dass er sich von seiner Offizierspension weder die feudale Villa noch den Mercedes hätte leisten können, geschweige denn die Klosterschule für den Bastard. Nun, die Villa gehörte nicht ihm, die hatte der Alte lange vor dem Krieg gebaut; ein Prachtgebilde war sie, wirklich, als Heim jedoch hatte er sie nie empfunden. Der Mercedes war ein Geschäftswagen, seine Frau besaß ihren eigenen Wagen, ebenso die beiden Söhne. Und dass er schließlich arbeitete in dieser Fabrik, nicht minder hart, als sein Schwiegervater es getan hatte, ja, dass die Arbeit ihm um vieles schwerer fiel, weil sie ihm so fremd gewesen war, davon wurde nie gesprochen. Er war kein Geschäftsmann, er war kein Unternehmer, er war immer nur Soldat gewesen, hatte nie etwas anderes sein wollen. Er hatte gelernt, was von ihm verlangt wurde, doch schon jetzt ließ man ihn merken, dass er bald überflüssig sein würde. Mechthilds ältester Sohn aus erster Ehe war fünfundzwanzig, er hatte Betriebswirtschaft studiert, volontierte zur Zeit in einem ähnlichen Werk in Amerika, und wenn er im nächsten Jahr nach Hause kam, würde er hinter dem Schreibtisch des Großvaters sitzen, ein Platz, dem man dem Oberst nie überlassen hatte.
Ihm war das egal. Je eher er von der Last der Verantwortung für die Fabrik befreit sein würde, umso besser. Vielleicht konnte er dann tun, wovon er manchmal träumte. Wenn er es sich erlaubte, zu träumen. Einfach fortgehen, irgendwohin. Seine Pension würde ihm zum Leben reichen, er war nicht anspruchsvoll. Und allzu luxuriös war das Leben, das sie dort im Ruhrgebiet führten, absolut nicht. Die Sparsamkeit hatte Mechthild von ihrem Vater übernommen, ihr ständiger Ausspruch lautete: Wir müssen für die Kinder alles erhalten, wir müssen weiter aufbauen. Schließlich wissen wir, was schwere Zeiten bedeuten.
Was Unsinn war, denn gerade in der sogenannten schweren Zeit, also während des Krieges, hatte Mechthilds Vater mit seiner Röhrenfabrik das meiste Geld verdient. Nach dem Krieg kam die Demontage, die der Alte bis an sein Lebensende bejammerte, was ebenso unsinnig war, denn freiwillig hätte er sich zu einer derart weitgehenden Modernisierung der Fabrik nie entschlossen.
Ein Musterbetrieb war entstanden, doch der Alte nörgelte ständig daran herum. Früher hatte sein Unternehmen ihm besser gefallen. Vor sieben Jahren war er gestorben, mitten in der höchsten Blüte des Wirtschaftswunders. Es wäre eine Lüge, zu behaupten, Ferdinand habe über seinen Tod allzu viele Tränen vergossen. Und er war durchaus in der Lage, die Arbeit des Alten fortzusetzen, das hatte er gelernt.
Aber sonst?
Er machte sich selbst nichts vor, er wusste genau, warum er Mechthild geheiratet hatte. Aus Feigheit, aus Lebensangst. Sie war die Witwe eines gefallenen Kameraden, er hatte sie schon während des Krieges flüchtig kennengelernt, er war es, der ihr die Nachricht vom Tod ihres Mannes brachte. Gleichzeitig mit dem posthum verliehenen Ritterkreuz. Sie feuerte es mit Schwung in die Ecke, sie weinte nicht, sie schrie nur: Ist denn dieser verdammte Krieg nicht bald zu Ende?
Sie hatte noch einen Bruder draußen, wie der Oberst wusste, als er bei diesem traurigen Anlass zum zweiten Mal in ihr Haus kam. Und auch für ihren Bruder dauerte der Krieg zu lange, er fiel Anfang 1945.
War sie darum so hart geworden, sah sie darum den einzigen Lebensinhalt nur noch in Geld und Besitz?
Sie liebte ihre Söhne, sie war eine gute Mutter. Aber ob sie ihren zweiten Mann je geliebt hatte, das war zu bezweifeln. Doch deshalb konnte Ferdinand ihr keinen Vorwurf machen. Liebte er sie denn? Geliebt hatte er nur einmal in seinem Leben, das Luder Anita. Existenzangst war es, die ihn veranlasste, Mechthild zu heiraten. Er wollte nicht noch einmal erleben, was er als junger Leutnant nach dem Ersten Weltkrieg erlebt hatte. Er war ja nun nicht mehr jung. Außerdem musste es eine Frau in seinem Leben geben, damit er Anita vergessen konnte, damit er seinen Hass überwand. Und schließlich musste er an seine Mutter denken. Wer sollte für sie sorgen, wenn nicht er? So heiratete er. Das war 1951. Er war dreiundfünfzig, das Kind, das Anita geboren hatte, zählte gerade ein Jahr. Seine Mutter, die Gräfin von Maray, mochte die zweite Frau ihres Sohnes genauso wenig, wie sie die erste gemocht hatte. Auch wenn da ein enormer Unterschied zwischen den beiden Frauen bestand; die zweite Frau Stettenburg war eine höchst ehrbare Dame. Und sie hatte Geld.
Sein Blick fiel wieder auf das Mädchen, das ihm gerade aufgerichtet gegenübersaß, eine unübersehbare Frage in den Augen. Sie hatte sich ihm anvertraut und erwartete eine Antwort.
Geld? Das spielte keine Rolle. Er konnte ihr ein Studium von seiner Pension bezahlen, genauso wie er die Klosterschule bezahlte. Und sei es auch nur, um Mechthild zu ärgern. Und nun gab es auch noch Anitas Geld.
Ein Lächeln erschien um seine Lippen, ein etwas schiefes, boshaftes Lächeln.
»Es war sehr interessant, etwas über deine Pläne zu erfahren«, sagte er. »Heute brauchen wir ja noch keine Entschlüsse zu fassen, nicht wahr, erst musst du mit der Schule fertig sein. Nur eins kann ich dir heute schon in aller Deutlichkeit sagen: Du wärst ganz allein auf dich gestellt. Meine Frau wird dich nie im Haus und in der Familie dulden. Und du bist immerhin an Schutz und Geborgenheit gewöhnt.«
»Warum kann sie mich denn nicht leiden? Sie kennt mich doch gar nicht«, sagte Virginia leise.
»Vielleicht werde ich dir einmal später erklären, warum das so ist. Obwohl natürlich, da hast du ganz recht, soweit es meine Frau betrifft, besteht eigentlich wirklich kein Anlass …« Er verstummte, selbst überrascht. Warum eigentlich hatte Mechthild immer diese unnachgiebige Haltung dem Mädchen gegenüber gezeigt? Sie war doch nicht gekränkt worden. War es nur Geiz? Oder war es das, was sie einmal zu Beginn ihrer Ehe so ausgedrückt hatte: In meiner Familie darf es keine Unsauberkeit geben.
Und er? Hatte er damals nicht zugestimmt?
Was würde Mechthild wohl dazu sagen, wenn sich herausstellte, dass dieses kleine, unscheinbare Ding, das ihm hier gegenübersaß, eines Tages möglicherweise eine reiche Erbin sein würde? Er schob die Hand unter die Jacke, zu seiner Brieftasche. Darin befand sich der Brief. Er begann mit den Worten: Mein liebes Kind … Virginia hielt das Gesicht geneigt, die Schatten auf ihren Wangen vertieften sich. Es gab da irgendein Geheimnis, und es hing mit ihrer Mutter zusammen. Es war ein so schreckliches Gefühl, dieser unverdiente Hass, der ihr entgegenschlug und sie bei der Kehle packte, würgend, bösartig. Sie spürte, wie ihr Tränen in die Augen stiegen.
Sie legte die Hand um den Hals, spürte die Kette.
»Darf ich hineingehen? Ich möchte mich gern einmal im Spiegel ansehen. Wegen der Kette.«
»Natürlich kannst du hineingehen. Aus welchem Grund auch immer. Du brauchst mich nicht um Erlaubnis zu fragen.«
Sie blickte nicht auf – er sollte nicht sehen, dass in ihren Augen Tränen standen. Rasch erhob sie sich und ging mit gesenktem Kopf über die Terrasse, zu der Tür, die ins Haus führte.
Der Fremde
An einem Tisch an der Wand der Terrasse, direkt neben der Tür, die in das Innere des Lokals führte, saß allein ein Mann, braun gebrannt, dunkles Haar, eine große Sonnenbrille vor den Augen. Dennoch war es unübersehbar, dass es sich um einen außerordentlich gut aussehenden Mann handelte. Er ließ die Zeitung sinken, als Virginia vorbeiging, doch sie bemerkte ihn nicht.