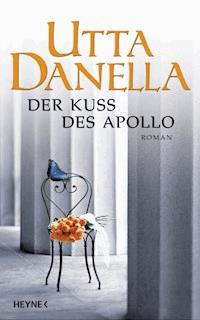6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Julius Bentworth sollte eigentlich die Familientradition fortsetzen und wie sein Vater ein angesehener Jurist in der norddeutschen Großstadt werden, in der er aufgewachsen ist. Während des Jura-Studiums in München wird ihm allerdings klar, dass seine Leidenschaft dem Theater gehört. Daran ist nicht nur seine Liebe zu der kapriziösen Schauspielerin Janine schuld, nach der Trennung widmet er sich zielstrebig seinem großen Lebenstraum: Einmal den Hamlet spielen. Nach der Schauspielschule und verschiedenen Stationen landet er in den 60er-Jahren am Stadttheater der Provinzstadt H. Er genießt das Leben unter dem „Zauberdach“ der schillernden Theaterwelt, die unverbindlichen Beziehungen; ein bürgerliches Leben kann er sich schon lange nicht mehr vorstellen. Dann begegnet er der jungen Schauspielerin Hilke, die in der Rolle der Julia nach den Sternen greift …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Unter dem Zauberdach
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet: www.hockebooks.de
Utta Danella: Unter dem Zauberdach. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1967 im Schneekluth Verlag, Darmstadt erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von shupian/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51356-4
www.ava-international.de
www.uttadanella.de
Prolog eines Prologes
Rosinen sind die süßesten und bittersten Früchte zugleich. Jene Rosinen meine ich, die man im Kopf hat. Man hat ein gutes Recht auf sie, solange man jung ist, da gehören sie gewissermaßen zur Einrichtung jedes Kopfes. Und da sind sie meist auch noch süß, verkleben wohltätig den nüchternen Denkapparat und lassen Welt und Leben begehrenswert erscheinen. Behält man sie jedoch bis in spätere Jahre hinein, verwandeln sie sich leicht in die berühmten sauren Trauben, ein umgekehrter Reifeprozess gewissermaßen, und machen zudem ihren Besitzer ein wenig lächerlich, beziehungsweise den Kopf, der sie beinhaltet, suspekt.
Allerdings – es gibt Ausnahmen. Leute gibt es, denen man die Rosinen mehr oder weniger zugesteht, zu deren lebenslanger Ausrüstung sie gehören, die sie hüten und pflegen und sich an ihnen ergötzen. Das sind jene Leute, die sich Künstler nennen. Und ganz besonders jene Gattung, die mit dem Theater zu tun hat.
Wir vom Theater betrachten es als unser gutes, verbürgtes Recht, lebenslang Rosinen im Kopf zu haben. Und sie schmecken süß und bitter zugleich. Wer glaubt, dass sie, die Rosinen, mit zunehmendem Lebensalter ein wenig schrumpfen würden, dem sage ich: mitnichten. Die Zahl der Jahre besagt gar nichts. Womit wir die Rosinen zu den Akten legen wollen. Sie waren nur als Einleitung gedacht.
Prolog Leonce und Lena
Als Einleitung wozu, fragte ich mich, als ich kürzlich diese Notiz in einem alten Schminkkasten fand. Welche Ausführungen schwebten mir damals vor, ewiger Theoretiker, der ich wohl immer bleiben würde. Es muss in meinem ersten Engagement gewesen sein, als ich dies niederschrieb. Damals, als ich die erste wirkliche Alltagsbegegnung mit dem Theater hatte, von dem ich zuvor nur geträumt hatte. Klang es nicht etwas skeptisch? Machte sich meine hoffnungslos bürgerliche Erziehung hier Luft und wollte ansetzen zu einem längeren Essay?
Ich wusste es nicht mehr. Heute, einige Jahre später, um vieles erfahrener, aber keineswegs klüger, kann ich nur zugeben, dass der Anfänger nicht unrecht gehabt hat. Süß und bitter zugleich, gewiss. Doch der Zauber war geblieben. Ich bereute nie, was ich getan hatte: neu zu beginnen, alles über Bord zu werfen und das zu tun, von dem ich glaubte, dass ich es tun müsste. Pathetisch ausgedrückt, dass es meine Bestimmung sei.
Ich kam aus einem hochachtbaren norddeutschen Bürgerhaus, mein Großvater war Senator in dieser Hansestadt, deren Namen verschwiegen sei, weil die Familie ihn nicht gern in diesem Zusammenhang lesen würde. Sie schämt sich meiner. Zwar sind Schauspieler heute durchaus gesellschaftsfähig, sie verkehren in besten Kreisen und sind sogar beim jährlichen Presseball in Bonn zugelassen, aber bis zu meiner Familie hat sich das noch nicht herumgesprochen. Wer diese Art Familie kennt, von der hier die Rede ist, wird mich verstehen. Aber diese Scham ist einseitig. Ich bin stolz auf meine Familie.
Der Bruder meines Großvaters, also mein Großonkel, war Reeder, heute ist mein Onkel, also der Bruder meines Vaters, Besitzer jener Reederei, und mein leiblicher Vater ist ein hoch angesehener Anwalt und Notar mit strengen Grundsätzen in eben jener Stadt, die wir im Dunkel lassen wollen.
Zu seinem Mitarbeiter und späteren Nachfolger war ich von Kindheit an bestimmt. Und zunächst entwickelte ich mich durchaus in der Richtung, in die man mich haben wollte. Ich war ein einigermaßen wohlerzogener Knabe, in der Schule immer recht gut, und dass ich gern las und besonders gern ins Theater ging, verübelte mir niemand, denn wir waren eine kultivierte und gebildete Familie, das durchaus. Meine Mutter spielte Klavier, und mein Vater zitierte manchmal, wenn es gerade hinpasste, aus dem Faust oder aus Schillers Glocke.
Meinen großen Traum, einmal selbst auf der Bühne zu stehen, verbarg ich vor jedermann. Zwar tat ich mich einmal in einer Schüleraufführung hervor, aber das wurde mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Ich machte mein Abitur, verbrachte ein halbes Jahr bei meiner in England verheirateten Schwester, und schließlich bezog ich die Universität, um Jura zu studieren.
Wenn ich es mir recht überlege, hatte ich es nicht vor, meinen Lebenslauf zu schildern. Wen interessiert das schon? Ich hatte vor, ein wenig von dem Leben zu erzählen, das ich führe, von den Leuten, die es teilen. Aber ich bin ein methodischer Mensch, ich muss beim Anfang beginnen. Und so will ich eine Art Prolog vor das Ganze setzen.
Zum dritten Semester ging ich nach München. Und da begann es. Das war die Zeit, wo mich das Theater immer mehr, das Studium immer weniger interessierte. Oder genauer gesagt: Ich vernachlässigte meine juristischen Studien, besuchte stattdessen die theaterwissenschaftlichen Vorlesungen und Seminare, war Hörer in Literaturgeschichte und Germanistik, meine Freunde kamen aus diesem Kreis, ich ging häufig ins Theater.
Und schließlich: Ich verliebte mich. Nicht dass es das erste Mal gewesen wäre, aber es war die erste richtig große Liebe. Sie hieß Janine – eigentlich Johanna, aber das gefiel ihr nicht –, war blond, kapriziös, sehr hübsch, sehr begabt, ein wenig extravagant, und sie war Schauspielerin. Ist es nötig, mehr zu sagen? Sie war genau das Mädchen, das mir gefehlt hatte. Sie gewöhnte mir eine Menge meiner bürgerlichen Vorurteile und meiner norddeutschen Steifheit ab, und von da an ging es hoffnungslos bergab mit mir. Letzteres sagte mein Vater, nicht ich.
Es begann damit, dass ich meiner Freundin die Rollen abhören musste, ihr die Stichworte gab und an ihren Übungen teilnahm. Zuletzt blieb es nicht nur bei den Stichworten, ich lernte die Rollen ihrer Partner auswendig und arbeitete mit ihr sehr ernsthaft zusammen. Genau genommen war Janine meine erste Lehrerin.
»Lerne ordentlich sprechen«, sagte sie zu mir. »Auch als Anwalt wird dir das später von Nutzen sein.« Sie machte Sprachübungen mit mir, gewöhnte mir den s-pitzen S-tein ab, brachte mich zum Bewusstsein meines Zwerchfells, ließ mich auf dem Bauch liegend deklamieren, steckte mir einen Korken zwischen die Zähne, wenn ich zu einer längeren Rede ansetzte, hielt mir lange Vorträge über die Stanislawskische Methode, zeigte mir, wie ich mich bewegen soll, und nahm mich mit zum Fechtunterricht. Sie setzte sich mitten im Zimmer auf einen Stuhl und spielte, ohne zu sprechen, mit sparsamer Mimik und Gestik eine ganze dramatische Szene, deren Inhalt vollkommen klar wurde. Und dann musste ich es nachmachen.
»Gar nicht schlecht«, sagte sie. »Du mit deinen blöden Paragrafen. Aus dir wäre gar kein schlechter Schauspieler geworden.«
Erbarmen mit meiner ahnungslosen Jugend! War die Versuchung nicht groß? Da ich so gern versucht sein wollte, kam es ja nur meinen geheimen Träumen entgegen.
Es gab noch vieles, was sie mit mir tat und was ich mit Begeisterung mitmachte. Meinem Studium bekam auch dies nicht sonderlich gut. Es kann der Mensch nicht zween Herren dienen, das steht – glaube ich – schon in der Bibel. Und Janine war eine außerordentlich zeitraubende Herrin. Ich musste sie von den Proben und von den Vorstellungen abholen, ich musste mit ihr im Regen spazieren gehen, im Englischen Garten oder im Isartal; Regen bekam ihrem Teint gut, und kalte Luft härtete die Stimmbänder ab. Ich musste abends, wenn sie spielfrei hatte, in ihrer Wohnung oder in Schwabinger Kneipen an den endlosen Diskussionen mit ihren Kollegen teilnehmen, musste ihr den Rücken oder die Füße massieren, je nachdem, was gerade besonders ermüdet war. Vom Rollenabhören sprach ich schon; ich musste ihr Liebe schenken und ihre immer etwas unberechenbare Liebe entgegennehmen oder mich aber auch verständnisvoll im Hintergrund halten, wenn andere Dinge im Moment wichtiger waren als ich. Ich musste zum Beispiel auch stundenlang in der Funkhauskantine warten, wenn sie für ein Hörspiel probte, ich musste sie nach Geiselgasteig oder in ein Hotel begleiten, wenn ein Filmregisseur oder Produzent sie zu sehen wünschte, ich musste obskure Talentsucher in gebührendem Abstand halten – in diesen Fällen stellte sie mich als Verlobten vor –, ich musste aber auch in der Versenkung verschwinden, wenn Männer, die ihr für die Karriere wichtig erschienen, sich um sie bemühten.
Ich musste – na, Schluss damit, ich könnte stundenlang so fortfahren, denn Janine war dazu geschaffen, eines Mannes Leben restlos auszufüllen. Ganz bestimmt das Leben eines so jungen und eines so relativ unerfahrenen Mannes, wie ich damals war. Ich versäumte mehrere Zwischenprüfungen, war ein seltener Gast in den Vorlesungen und noch seltenerer Gast bei den Seminaren, und meine Professoren vergaßen langsam meine Existenz.
Es rettete mich, oder es hätte mich jedenfalls retten können, dass Janine nach einer ersten erfolgreichen Fernsehrolle ein Engagement nach Berlin bekam und gleichzeitig den Regisseur des Fernsehspiels heiratete.
Sie verabschiedete mich liebevoll, wünschte mir alles Gute, und da stand ich nun. Ohne diese Frau, die zwei Jahre lang mein Leben bis in den letzten Winkel ausgefüllt hatte.
Ich war fünfundzwanzig Jahre alt, und ich war sehr unglücklich. Meine Freunde versuchten, mich zu trösten. »Nimm’s nicht so schwer, Julius. Geht vorbei. Wusstest doch sowieso, dass es eines Tages so kommt.« Und so weiter.
Zurück zur Familie. Es war ihr natürlich nicht verborgen geblieben, was vorgegangen war. Mein Vater hatte sich sehr großzügig gezeigt: »Lass den Jungen sich ein bisschen austoben, muss ja wohl sein!« Meine Mutter war besorgt: »Mein Gott, Junge, binde dich nicht zu früh, und das ist überhaupt keine Frau für dich!«
Wem sagte sie das? Dasselbe hatte Janine auch immer gesagt. Alles in allem stand einem strebsamen und mit Volldampf betriebenen Studium nun nichts mehr im Wege.
Ich hatte die besten Absichten, besuchte regelmäßig die Universität, saß über den Büchern, ließ mich prüfen, wo geprüft werden musste, statt im Shakespeare studierte ich im Bürgerlichen Gesetzbuch, statt des Romeos und des Homburgs lernte ich Paragrafen und Gerichtskommentare, doch was nützte es? – Es war zu spät, ich war verloren. Verhext und bezaubert. Bewitched, bothered und bewildered, wie Frankie Sinatra singt. Nicht mehr nur von einer Frau, nicht von der Liebe. Vom Theater.
Und dann kam es zu dieser Büchner-Aufführung. Ich hatte mich früher einmal einer Studentengruppe angeschlossen, die Theater spielte. Als ich Janines Leben teilte, hatte ich mich dort aber kaum blicken lassen. Jetzt jedoch zog es mich öfter dorthin in meiner wenigen Freizeit, es war der letzte Rest der geliebten Welt, von der ich Abschied nehmen musste und auch wollte. Wollte ich wirklich? Es waren alles theaterbesessene junge Leute so wie ich. Sie kamen meist aus dem theaterwissenschaftlichen Seminar, aber es waren auch aus anderen Fakultäten viele dabei, die mit großer Begeisterung daran teilnahmen und oft recht sehenswerte Aufführungen zustande brachten.
Damals planten sie eine Büchner-Inszenierung. Zunächst redeten sie vom »Woyzeck«, aber dann bekamen sie wohl doch Angst vor dem eigenen Mut, und man einigte sich schließlich auf »Leonce und Lena«. Ich kannte das Stück gut. Janine hatte die Lena studiert für eine Studioaufführung, und ich war ihr Leonce gewesen. Bei den Proben zu Hause natürlich.
Nun, ich sollte bei dieser Aufführung eigentlich nur die kleine Rolle eines Bedienten spielen, wie es mir zustand als bescheidenem Mitglied dieser Gruppe verdienter junger Leute. Aber wie der Zufall so spielt – oder sollte es Schicksal gewesen sein? –, der vorgesehene Leonce brach sich beim Skifahren ein Bein, der zweite, der infrage kam, hatte ein Examen vor sich, schließlich sagten sie, es wäre doch auch eine Rolle für mich. Vom Typ her passe ich ganz gut, und den zynischen lebensmüden Ton habe ich sowieso.
Hier muss ich einfügen: Beides stimmt nicht. Vom Typ her bin ich eigentlich ganz norddeutsch und zu groß für den Leonce, und den zynischen lebensmüden Ton hatte ich nur vorübergehend, er war die Folge meiner Enttäuschung, von Janine so stehen gelassen worden zu sein wie ein Schirm, den man nicht mehr braucht. Ich hatte daraufhin eine zynische Periode.
Kein Regisseur, der seine Sache versteht und ausreichend Darsteller zur Hand hat, würde mich heute noch als Leonce einsetzen, aber damals ergab es sich, dass man mich eben brauchte.
Nun kurz und gut – ich spielte den Leonce. Oder besser gesagt, ich begann mit Feuereifer, ihn zu proben.
Und nun – Zufall, Schicksal? – geriet ich abermals an ein Mädchen, das eine begabte Schauspielerin war. An Lena. Meine Partnerin. Bei ihr muss ich einen Augenblick verweilen. Zunächst fand ich an Verena nichts Besonderes. Kein Wunder, ich war die rassige, sehr selbstbewusste, leicht egozentrische Janine gewohnt. Eine Frau schon, sehr bewusst und oft recht raffiniert in ihrer Handhabung des Daseins. Dieses Mädchen Verena nun – sie war wirklich ein Mädchen, sehr zierlich, sehr anmutig, dunkelbraunes Haar und dunkle Augen, aber keineswegs eine auffallende Erscheinung; sie war bescheiden, fast schüchtern, sehr zurückhaltend, leicht zu erschrecken, und die stählerne Kraft, die in diesem Persönchen wohnte, war weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick zu erkennen. Zudem – sie war gar keine Schauspielerin, sie studierte neue Sprachen und Geschichte und wollte Lehrerin werden. Ich wunderte mich, wie es sie zu dieser Gruppe verschlagen hatte. Und noch mehr wunderte ich mich, warum man ausgerechnet ihr die Hauptrolle anvertrauen wollte.
Ich wunderte mich nur so lange, bis wir mit den Proben begannen.
Zum ersten Mal erlebte ich eine echte Verzauberung und Bezauberung nicht vom Parkett aus, sondern direkt auf der Bühne, neben mir.
Sie war schön, wenn sie spielte. Ihr Gesicht blühte auf, ihre Augen leuchteten, jede ihrer Bewegungen war von unbeschreiblicher Grazie, von unbewusster Grazie wie bei einer Tänzerin. Und dazu ihre Stimme! Sie war tiefer, als man es bei dieser zarten Erscheinung erwartete, und hatte einen seltsamen spröden Bruch darin, einen echten Zauberklang, den man noch Stunden später hörte.
»Die Grasmücke hat im Traum gezwitschert. – Die Nacht schläft tiefer, ihre Wange wird bleicher und ihr Atem stiller. Der Mond ist wie ein schlafendes Kind, die goldenen Locken sind im Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. – Oh, sein Schlaf ist Tod! Wie der tote Engel auf seinem dunklen Kissen ruht und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen. Armes Kind! Es ist traurig, tot und so allein.«
Wenn sie diese Worte der Lena sprach, hielt alles den Atem an. Ich hatte den Eindruck, und die anderen mit mir, eine bessere Lena, eine bessere Schauspielerin für diese Rolle könne man nicht finden, und suche man landab, landauf alle Staatstheater ab.
»Menschenskind, Verena«, sagte Tom Dietzen, Theaterwissenschaftler im achten Semester, angehender Regisseur und auch in unserem Fall Regisseur, »wann wirst du den irren Gedanken aufgeben, ungezogene Kinder zu unterrichten, und endlich in eine ordentliche Schauspielschule gehen und dich auf deinen dir vorbestimmten Beruf vorbereiten?«
Verena lächelte scheu und hob in einer unschlüssigen Gebärde die Schultern. Ich wusste nun schon, dass sie gern Schauspielerin geworden wäre, es aber einfach nicht wagte, das Studium abzubrechen und ihr ganzes Leben umzukrempeln. Ich rankte mich gewissermaßen mit meinem kleinen Talent an dieser Partnerin empor. Ich wurde täglich besser, Begabung steckt an, Eifer steckt an und schließlich auch – Besessenheit steckt an. Besessen waren sie alle und Verena besonders.
Wir machten unsere Sache gut, wir bekamen sogar eine lobende Kritik in einer großen Tageszeitung und hatten fünf ausverkaufte Vorstellungen.
Damals war ich schon dicht daran, den entscheidenden Schritt zu tun. Einfach aufzuhören mit der Juristerei und neu anzufangen. Ich sprach mit meinem Vater davon und stieß auf Unverständnis und eisige Ablehnung. Nicht einmal Zorn oder Ärger; denn er nahm mich gar nicht ernst. Er sagte nur: »Langsam wirst du zu alt für Pubertätserscheinungen.«
Aber ich muss weiter von Verena erzählen. Denn wie nicht anders zu erwarten, vergaß ich Janine sehr schnell und verliebte mich in Verena.
Wir waren viel zusammen, wir studierten unsere Rollen gemeinsam, ich brachte sie nach Hause, wir redeten, wir gingen spazieren, wir – ja, weiter nichts. Außer auf der Bühne durfte ich sie nicht küssen. Aber wenn ich auch immer mehr in meiner Rolle aufging, so war es doch gerade an dieser Stelle nicht allein Leonce, der Lena küsste, es war immer auch Julius, der Verena küsste. Aber sie – sie war nur Lena. Und für sie war ich Leonce – soweit es die Liebesszene betraf.
Und mit der Zeit merkte ich auch, dass es einen anderen Mann in ihrem Leben gab. Ich erfuhr nie, wer er war. Sie ging abends fort, sie verschwand für ein oder zwei Tage, wenn sie wiederkam, war sie müde und traurig, manchmal auch hektisch und mit einer bei ihr ganz fremden Munterkeit. So war es während der Proben, während der vierzehn Tage, als unsere Vorstellungen stattfanden, dann fiel ich bei einer Zwischenprüfung durch, dann war das Semester zu Ende, und ich sah überhaupt nichts mehr von Verena.
Ich fuhr nach Hause, für zwei Wochen nur, denn ich wollte während der Ferien in Ruhe arbeiten, nachholen, was ich verbummelt hatte, und das konnte ich in München besser, zu Hause hatte ich zwei jüngere Geschwister, eine neugierige Mutter und viel Familie.
Während meines Aufenthalts zu Hause hatte ich das zuvor erwähnte Gespräch mit meinem Vater, das mich noch einmal zur Besinnung brachte. Ich kam nach München zurück mit dem festen Willen, nur noch zu studieren und zu arbeiten und ein seriöser Mensch zu werden.
Zu diesem Zweck vermied ich es, meine Freunde anzurufen oder aufzusuchen, ich hielt mich von Schwabinger Lokalen fern und hatte mir ein strenges Theaterverbot selbst auferlegt. An Verena jedoch dachte ich unausgesetzt. War sie in München? War sie nach Hause gefahren? Sie stammte aus einer badischen Kleinstadt, aus bescheidenen bürgerlichen Verhältnissen, sie hatte immer wenig Geld und musste zu ihrem Studium dazuverdienen.
Eines Tages ging ich zu dem Haus, in dem sie wohnte. Ein grauer Altbau, muffig und mies, in einer engen Schwabinger Straße. Ihre Wirtin öffnete mir und erkannte mich sofort.
»Das Fräulein ist nicht da.«
»Ist sie nach Hause gefahren?«
»Ah naa, in München is scho. Grad halt heut’ is net da.«
»Sie soll mich doch bitte anrufen, meine Telefonnummer hat sie ja.«
Sie rief nicht an. Nicht an diesem, nicht am nächsten Tag. Drei Tage später, der Frühling ließ sich ahnen, erster kühler Frühjahrswind, blauer Himmel, kein Schnee mehr auf den Straßen, und in den Vorgärten die ersten Krokusse und Schneeglöckchen – drei Tage später also klingelte ich wieder bei Verenas Wirtin.
»Grad is fortgegangen.«
»Wohin denn?«
»Des weiß i net. Aber weit kann’s no net sein.«
Ich spurtete auf die Straße hinunter, blickte rechts und links, entschied mich dann, die Richtung zur nächsten Trambahnhaltestelle einzuschlagen, und hätte Verena bald über den Haufen gerannt, denn sie trat gerade vor mir aus einem Papierwarengeschäft.
»Da bist du ja!«
»Oh! Julius!«
»Du solltest mich doch anrufen. Hat es dir deine Wirtin nicht gesagt?«
»Doch.«
»Und? Warum hast du nicht angerufen?«
Sie hob die Schultern mit jener hilflosen Gebärde, die ich kannte.
»Freust du dich denn nicht, dass ich wieder da bin?«
Sie blickte mich groß an, gab keine Antwort.
»Also nicht?«
»Doch.«
»Hast du was?«
Sie presste die Lippen ein wenig zusammen, etwas, was ich an ihr noch nie gesehen hatte und was sie älter und härter machte. Denn ihr Mund, das habe ich wohl vergessen zu erwähnen, war weich und voll, ohne jedoch die heute so beliebten Schmolllippen zu haben, nein, er war schön geschwungen, fast ein wenig zu groß für dieses kleine Gesicht, genau wie ihre Augen eigentlich zu groß waren für die zarten Wangenbögen und die schmalen Schläfen.
»Ist was los?«
Sie schüttelte den Kopf, wandte ihn dann zur Seite, aber ich sah, dass sich ihre Augen plötzlich mit Tränen füllten.
»Verena!«, rief ich erschrocken, und in diesem Moment wusste ich ganz genau, was mir bisher nur verschwommen bewusst gewesen war: Ich liebte sie. »Was hast du? Sag es mir!«
Sie schüttelte wieder den Kopf und ging dann einfach los, nicht in Richtung zur Trambahn, sondern in entgegengesetzter Richtung, die graue alte Straße entlang, sie ging so rasch, dass ich kaum nachkam, denn natürlich blieb ich an ihrer Seite. Sie ging, ohne aufzublicken, und sah starr vor sich aufs Pflaster. Ich musste sie am Arm zurückreißen, sonst hätte ein Auto sie gestreift, so achtlos trat sie vom Trottoir auf die Straße.
Wir kamen zum Englischen Garten und marschierten hinein, immer noch in diesem Geschwindschritt, die Wege waren noch nass, auf den Wiesen lagen an schattigen Stellen letzte Schneereste, die Bäume waren noch kahl, aber die Vögel ließen sich hören, und man spürte die Sonne auf den Schultern und im Gesicht.
»Es wird Frühling«, sagte ich schließlich. »Merkst du es?«
Sie gab keine Antwort, ließ es aber geschehen, dass ich ihr das kleine Päckchen, das sie trug, abnahm.
»Ich bin seit einer Woche wieder da. Warum hast du mich denn nicht angerufen?«
»Wozu denn?«
Es klang hart und abweisend, es kränkte mich, dass sie so mit mir sprach. Wir waren doch gute Freunde geworden während des Theaterspielens, wir hatten gemeinsam eine feine Sache auf die Bühne gestellt, das hatte jeder gesagt, und außerdem hatte ich mir eingebildet, sie hätte mich ganz gern, trotz dieses nebulösen Kerls da irgendwo im Hintergrund.
»Eben. Wozu auch? Hast du auch wieder recht.«
Beleidigt schwieg ich. Wir kamen bis zum Kleinhesseloher See und machten uns daran, ihn zu umrunden, im Tempo etwas gemäßigter. Mütter mit Kinderwagen waren hier unterwegs, ein paar ganz Mutige saßen schon im Sonnenschein auf Bänken, ein paar Liebespaare gingen Hand in Hand spazieren, und alte Männer schlurften langsam an uns vorüber. Englischer Garten im Vorfrühling. Wie ich München liebte! Es tat ihr wohl leid, dass sie so ruppig gewesen war, sie begann nach einer Weile, ein paar Fragen an mich zu stellen.
»Wie war es denn zu Hause?«
»Wie immer.«
»Und warum bist du so schnell zurückgekommen?«
»Weil ich arbeiten muss.«
Jetzt war ich es, der kurz angebunden war.
»Weiterstudieren?«
»Was sonst?«
»Ich dachte nur – du hattest doch gesagt, du würdest lieber Schauspieler werden.«
»Viele Leute würden lieber etwas anderes tun, als was sie tun müssen.«
»Musst du?«
Darüber dachte ich eine Weile nach. Angesichts meines Vaters hatte ich gedacht, ich müsste. Hier jetzt – in der weichen Münchner Vorfrühlingsluft – kamen die Träume wieder. Die Träume, die ich in Wirklichkeit verwandeln konnte, wenn ich nur ernsthaft wollte.
»Glaubst du denn wirklich, dass ich begabt bin?«
»Das hast du mich schon oft gefragt, und ich habe immer mit Ja darauf geantwortet.«
»Erfolglose Schauspieler gibt es viele.«
»Sicher. Es wird für dich natürlich etwas schwieriger sein, als in der Kanzlei deines Vaters zu sitzen.«
Hatte ich Hohn, Verachtung in ihrer Stimme gehört? »Und du, großmächtige Prinzessin auf der Erbse? Es ist auch einfacher, sich auf ein Katheder zu setzen und das Abc zu lehren, als die Penthesilea zu spielen.«
Jetzt musste sie sogar lachen. »Ausgerechnet die Penthesilea! Das wäre die richtige Rolle für mich. Außerdem werde ich nicht das Abc lehren.«
»Nein, nein, Fräulein Doktor, entschuldigen Sie vielmals. Sie werden natürlich Studienrätin und lehren französische Grammatik.«
Große Pause.
Dann: »Für mich wäre es einfacher, Theater zu spielen, als Kinder zu unterrichten. Es ist immer einfacher, das zu tun, was man gerne tun möchte.«
»Du bist sehr weise, Fräulein Doktor. Und warum tust du es dann nicht?«
Schulterheben, Schweigen.
Und so ging unser Gespräch weiter, wir waren schließlich um den See herum, verließen den Park, spazierten bis zur Leopoldstraße, und ich lud sie zu einer Tasse Kaffee in einem der Espressos ein.
»Warum bist du denn nicht nach Hause gefahren?«
»Ich wollte nicht. Außerdem habe ich einen Job in Aussicht für die Ferien, nächste Woche fang’ ich an.«
»Ganztägig?«
»Ja.«
»Schade.«
»Warum?«
»Na, dann können wir nicht spazieren gehen so wie heute. Und wir können uns überhaupt nicht so oft sehen, wie ich möchte.«
»Ich denke, du willst arbeiten.«
»Schon.«
»Na also. Und ich muss Geld verdienen.«
»Was ist es denn für ein Job?«
»Nichts Besonderes. So im Büro halt.«
Es war schon eine vertrackte Sache. Da studierte sie nun und verdiente sich mühselig das Geld dazu, und zu Hause sparten sie wahrscheinlich, damit sie ihr noch was schicken konnten, alles nur, damit eine Studienrätin aus ihr würde, und sie wollte gar keine werden, sie hatte ein großes Talent – doch, das hatte sie –, das sagte jeder, nicht nur ich, aber wenn sie eine Schauspielschule besuchen würde, das kostete auch Geld, und es war ziemlich sicher, dass sie als Lehrerin mal ihr ordentliches Einkommen haben würde, ob aber als Schauspielerin, das war sehr fraglich, und ob sie überhaupt, so wie sie war, sich dazu eignete, sich immer durchzusetzen, war noch fraglicher. Talent war nur die eine Seite, nur die kleinere Seite der Karriere, das wusste schließlich jeder.
Ich dachte an Janine. Sie war ein ganz anderer Typ. Sie war auch begabt – aber nicht so begabt wie Verena. Aber sie würde sich bestimmt durchsetzen, sie war die geborene Siegerin.
Das Mädchen hier neben mir – was war sie? Die geborene Dulderin? O nein, gewiss nicht. Aber eine Träumerin, eine Zaghafte, eine Zurückhaltende. Eine, die nicht viel wagte.
»Wenn du nächste Woche arbeiten willst, dann müssten wir uns diese Woche noch viel sehen.«
»Wozu denn?«
Jetzt reichte es mir.
»Himmeldonnerwetter, sei doch nicht so unausstehlich. Wenn ich dir so lästig bin, kann ich ja gleich gehen. Brauchen wir uns überhaupt nicht mehr zu treffen, mir auch recht. – Fräulein, zahlen bitte!«
Ich hatte im Zorn laut gesprochen, von den Nebentischen sah man zu uns herüber. Verena war rot geworden und legte ihre Hand auf meinen Arm.
»Jules, bitte!«
Statt zu zahlen, bestellte ich zwei Himbeergeist. Wir schwiegen eine Weile verbissen, das heißt verbissen war ich, denn als ich sie dann doch wieder ansah, bemerkte ich, dass ihr Tränen über die Wangen liefen. Gott sei Dank, es war nicht sehr hell in dem Espresso, draußen dämmerte es, die Beleuchtung war schummerig.
»Verena! Liebling!« Ich nahm ihre Hand, streichelte sie, küsste sie sogar, aber das verschlimmerte ihren Zustand noch, ich sah, dass ein Schluchzen sie würgte, ich schob ihr schnell das Schnapsglas zwischen die Finger, sie kippte den Inhalt mit einem Ruck hinunter und nahm sich dann eine Zigarette aus dem Päckchen, das vor uns auf dem Tisch lag. Ich gab ihr Feuer.
»Schon gut«, sagte sie. »Es ist gleich vorbei.«
Sie rauchte mit hastigen Zügen, sie tat mir leid, an ihren langen Wimpern zitterten noch zwei Tränen, ich wollte ihr so gern helfen, ich wusste zwar nicht, wie, aber wenn es irgendwie möglich war, musste ich es tun. Ob sie kein Geld hatte? Mit Geld war ich auch nicht übermäßig gesegnet. Mein Vater bezahlte das Studium und gab mir dreihundert Mark im Monat. Hundertfünfzig allein kostete mich mein Zimmer, in München waren Zimmer rar und teuer, und meins war recht hübsch, ich bewohnte es, seit ich in München war, und behielt es jedes Mal auch über die Ferien, wenn ich nach Hause fuhr. Blieben mir hundertfünfzig zum Leben, das war nicht viel, aber es reichte.
Für meine Kleidung brauchte ich nicht zu sorgen, die bekam ich von zu Hause, meine Mutter schickte mir gelegentlich einen Hunderter, und dann und wann kam vom Onkel Reeder eine Postanweisung. Zu Janines Zeiten natürlich hätte das alles nicht gereicht, denn manchmal machte ich ihr ein Geschenk, das mein gesamtes Budget zusammenbrechen ließ. Gingen wir jedoch aus, fein aus, wie Janine es nannte, dann schob sie mir vorher das Geld dazu in die Sakkotasche. Was wollte ich machen?
Manchmal hatte ich hier und da kleine Schulden, aber irgendwie kam ich über die Runden.
Was aber war mit Verena? Ich wusste nicht, wie viel Geld sie bekam, ich wusste nicht, was ihr Vater war, sie sprach nie von ihren Eltern, genau genommen führten wir ja nie Gespräche über unsere Verhältnisse zu Hause. Keiner von uns tat das. Hier führten wir ein anderes Leben, wir waren unter uns, wir lebten in unserer eigenen Welt. Wie also lebte Verena? Ihr Zimmer hatte ich nie von innen gesehen, das Haus, die Straße waren mies, ihre Kleidung sehr einfach, ich kannte ein Kostüm, einen abgetragenen Wintermantel, sonst nur Hosen oder Röcke, Pullover, Blusen.
Einmal allerdings hatte ich sie anders gesehen. Das war ganz am Anfang unserer Bekanntschaft, als wir gerade mit den Proben begonnen hatten. Sie war eilig nach der Probe fortgestürzt und hatte ihr Rollenbuch liegen gelassen. Tom Dietzen bat mich, es ihr zu bringen, er selbst hatte keine Zeit. Er sagte mir ihre Adresse, und ich ging auf dem Heimweg bei ihr vorbei.
Die Wirtin rief sie heraus, und als sie kam, staunte ich. Sie war zum Ausgehen angekleidet und kaum wiederzuerkennen. Mit Make-up und glänzenden Augen, das Haar, das sie sonst halb lang und glatt trug, hochgesteckt, sie trug ein schmales dekolletiertes Kleid aus silbernem Stoff, das teuer wirkte. Sie sah bildhübsch aus, geradezu umwerfend hübsch. Und elegant dazu.
Ich war eine elegante und teuer angezogene Frau gewöhnt durch Janine. Aber Verena hätte neben ihr bestanden. Auf einmal war sie ein ganz anderes Mädchen. Später auf der Bühne, geschminkt und im Kostüm, sollte ich sie auch so erleben, so aufgeblüht, so seltsam schön, wie von innen erleuchtet.
Von Janine wusste ich auch, was ein wenig Anstrich und die Erregung über einen abendlichen Ausgang bei einer Frau ausmachen. Es hier zu finden überraschte mich.
Damals hatte sie wohl ein Rendezvous mit diesem Mann gehabt, den keiner kannte und von dem sie nicht sprach. Sicher hatte er ihr das Kleid geschenkt.
Daran musste ich jetzt denken. Und hatte auf einmal die Erklärung für ihre Traurigkeit. Sie hatte einfach Kummer mit diesem Kerl. Er hatte sie verlassen. Es war aus. So etwas war es wohl. Na ja, das passierte jedem mal. War mir schließlich auch passiert. Aber ein Mädchen wie Verena litt sicher sehr darunter. Am Ende hatte sie den Kerl geliebt.
Bestimmt sogar hatte sie ihn geliebt. So eine wie Verena würde nur mit einem Mann zusammen sein, den sie liebte. Das war also des Rätsels Lösung. Das würde vorübergehen. Ich verspürte sogar etwas wie Befriedigung. Wozu brauchte sie diesen Kerl! Ich war ja da.
»Du musst so etwas nicht so schwer nehmen«, sagte ich weise.
Sie gab mir einen schrägen Blick von der Seite. »Was so etwas?«
»Na ja, so ein bisschen Liebeskummer und so. Gehört nun mal zu jedem Leben.«
Sagte sich leicht. Als Janine mich verließ, war es September gewesen. Jetzt, Ende März, war ich darüber hinweg. Aber damals – die Wochen und Monate danach, vielen Dank, da hatte ich es ernst genug genommen.
»Ich meine, mit der Zeit kommt man darüber hinweg, da vergisst es sich. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede.«
»Aber du weißt nicht, wovon ich rede.« Das klang kühl und knapp und sehr überlegen.
Überheblich, wie ich fand. Immer kamen sich die Frauen so schrecklich schlau vor, das war mit Janine genauso gewesen. Als ob sie alles besser wussten und konnten, als wir geistig offenbar benachteiligtes Geschlecht. Und das Anrecht auf echte Gefühle hatten sie sowieso gepachtet. Nur sie wussten, was Liebe war, obwohl sie kühl wie eine Hundeschnauze blieben und einem ungerührt den Rücken kehrten, wenn man nicht mehr benötigt wurde.
»Gehen wir?«, fragte sie nach einer Weile.
»Bitte sehr.«
Ich war verärgert. Wir hatten genau genommen kein vernünftiges Wort miteinander gesprochen. Und ich hätte mich so gern einmal richtig ausgesprochen. Mit wem nur?
Da war ich nun zurückgekommen nach München voll der besten Vorsätze und war dabei unglücklich hin und her gerissen zwischen Wollen und Müssen, zwischen dem, was ich für meine Pflicht, und dem, was ich für meine – na schön, scheuen wir uns nicht vor den großen Worten – Pflicht – ist schließlich auch ein anspruchsvoller Begriff –, und zwischen dem also, was ich für meine Bestimmung hielt.
Blieb noch die Frage: War es denn wirklich meine Pflicht, Jurist zu werden und die Kanzlei meines Vaters zu übernehmen? Mein kleiner Bruder, unser Jüngster, würde in diesem Sommer sein Abitur machen und dann ebenfalls Jura studieren, das stand schon fest. Meine Schwester Regine war mit einem Referendar aus Hamburg verlobt, beste Familie und, Gott behüte, auch Jurist. Es gab also noch zwei naheliegende Möglichkeiten für meinen Vater, seine traditionsbeladene Firma in brauchbare Hände zu übergeben.
Martina, meine große Schwester, war in England sehr gut und wohlhabend verheiratet, zwar mit einem Kaufmann, aber sie hatte bereits einen kleinen Sohn, und vielleicht würde der später auch noch Jura studieren; es waren alles so hochachtbare und tüchtige Leute, sie taten alles, was sie sollten und was man von ihnen erwartete, konnte denn nicht wenigstens ich tun, was ich wollte, konnte nicht wenigstens ich ein ganz kleiner, ganz bescheidener Außenseiter sein? Und wenn ich mir also partout mein Leben verderben wollte – so hatte es meine Mutter genannt –, so lasst mir doch den Spaß, es ist schließlich mein Leben, und vielleicht schmeckt es mir verdorben immer noch besser als wohlgeordnet und eng eingezäunt. Ich hasste die Paragrafen und die ganze Juristerei, das wusste ich inzwischen ganz genau, ich hatte sie immer gehasst und würde sie mein ganzes Leben lang hassen, und mit ihnen leben zu müssen, all die Jahre lang, die möglicherweise noch vor mir lagen, das würde ein verdorbenes Leben sein.
»Himmelherrgottsakrament!«, fluchte ich auf gut bayerisch, als wir vor dem Espresso standen, und starrte wütend in den blassen Frühlingshimmel.
»Galt das mir?«, fragte Verena.
»Nein, dem ganzen Dasein.«
»Ich schließe mich an.«
Da standen wir nun beide und wussten nicht, was wir tun sollten, und dabei war es so ein schöner Abend, die Luft war noch milder geworden, es ging ein sanfter weicher Wind, der Verena das braune Haar um die Schläfen wehte. Sie sah nicht mehr überlegen aus, sondern verloren und traurig, sie glich meiner Lena, ich legte den Arm um ihre Schultern und sagte: »Ärgere du mich wenigstens nicht.«
»Nein«, erwiderte sie leise, »das will ich ja nicht. Es ist alles nur so …«
Ja, es war alles nur so. Da waren wir nun jung, und jeder meinte, wenn man jung sei und das Leben vor sich habe, sei man auch glücklich und voller Zuversicht, und das war verdammt durchaus nicht so. Man hatte Kummer mit der Liebe und mit dem Beruf und mit dem Leben, mit einfach allem, und es musste viel besser sein, das alles hinter sich zu haben und alt zu sein. Ich sah mich vierzig Jahre später, so alt etwa wie mein Vater, ich saß in der Kanzlei dort in der ehrbaren Hansestadt im Norden, ich saß hinter meinem altmodischen Schreibtisch, war ernst und würdig und ein angesehener Bürger, ich gehörte zu den Honoratioren und kümmerte mich um die Angelegenheiten anderer Honoratioren, ich hatte eine brave Frau, die mollig geworden war und graue Haare hatte, ich hatte Söhne, die tun mussten, was ich wollte, und nicht, was sie wollten – und das Leben war vorbei.
Ich mochte meinen Vater, ich liebte meine Mutter und meine Geschwister und alle, die sonst noch dazugehörten, ich wünschte ihnen das Allerbeste, aber ich wollte nicht so leben wie sie, ich wollte etwas anderes.
Es lag nur an mir. Ich durfte nicht feige sein. Ich musste den ersten Schritt tun und noch viele Schritte dazu. Und die Folgen auf mich nehmen.
Ich würde es tun.
»Ich werde es tun.«
»Was?«
»Was ich will und was ich muss. Ich werde Schauspieler.«
»Na, dann trau dich doch endlich«, meinte Verena, gänzlich unbeeindruckt von meiner Entschlossenheit. »Wie lange willst du noch warten? Für den Romeo bist du sowieso bald zu alt.«
»Auf den Romeo bin ich gar nicht scharf, der liegt mir nicht. Aber ob ich eines Tages den Hamlet spielen könnte?«
Sie blickte mich schräg von der Seite an. »Sehr fraglich! Zwar ein Grübler und ein Zweifler bist du. Aber es ist nicht gesagt, dass man immer am besten das spielt, was man ist. Geh doch mal zu Burckhardt.«
»Zu Burckhardt?«, fragte ich eingeschüchtert.
»Ja, warum nicht? Er ist sehr nett. Mit ihm kannst du reden. Mit allen wirklich großen Leuten kann man reden.«
»Kennst du ihn denn?«
Sie nickte. »Ja. Ich war bei ihm. Es war eigentlich ganz einfach.«
Walter Burckhardt war der von uns allen sehr bewunderte, sehr geliebte Charakterschauspieler am hiesigen Schauspielhaus. Ich wusste auch, dass er Schauspielunterricht gab.
»Und?«
»Er hat gesagt, ich hätte Talent. Ich habe ihm Verschiedenes vorgesprochen. Und dann hat er mich als Lena angesehen.«
»Aber da hat er mich ja auch gesehen?«
»Natürlich.«
»Hat er was über mich gesagt?«
»Nein«, sagte sie kühl, »wir haben von mir gesprochen.«
»Und er hat gesagt, du sollst …«
»Er hat gesagt, ich soll. Er würde mir helfen, dass ich ein Stipendium für die Schauspielschule bekäme. Und er würde mir auch helfen, dass ich gelegentlich mal kleine Rollen beim Funk bekäme, damit ich etwas verdiene.«
»Aber Menschenskind, warum tust du es dann nicht? Tu’s gleich. Fang nicht erst einen blöden Job an.«
»Ich wollte ja. Ich hatte es fest vor.«
»Und? Wegen deiner Leute zu Hause? Die werden sich daran gewöhnen.«
»So wie deine, was?«
»Du meinst, ich könnte auch einfach mal zu Burckhardt gehen?«
»Versuch’s doch. Er ist wirklich nett. Gar nicht von oben herab. Und er wird dir ehrlich seine Meinung sagen. Ich wäre eine gute Julia, hat er gesagt. Ich könne die Julia spielen, und das können wenige junge Schauspielerinnen heute. Ich hab’ mir alles schon so schön ausgemalt. Später, wenn ich im Engagement wäre, würde Mutti zu mir kommen, und wir könnten zusammen leben, und sie würde mir helfen …«
»Deine Mutter hätte nichts dagegen?«
»Nein. Genau genommen nicht.«
»Ja, aber Mensch, Verena, worauf wartest du noch?«
Sie stand, blickte zum Himmel hinauf und nagte an ihrer Unterlippe. Ihr Gesicht war hart und verschlossen.
»Gehen wir?«
»Wohin?«
»Egal.«
Wir setzten uns in Bewegung und schlenderten die Leopoldstraße entlang, den berühmten Schwabinger Boulevard, der belebt und bewegt war zu dieser frühen Abendstunde, viele junge Paare waren unterwegs. Hand in Hand, verliebt und manche davon sicher auch glücklich.
»Du machst dir nicht viel aus mir, nicht wahr?«
»O doch.«
»Das klang sehr matt. Aber ich weiß schon, Mädchen lieben keine Zweifler und Zögerer. Mädchen lieben Männer der Tat.«
»Wer spricht von Liebe?«, sagte sie abweisend.
»Ich.« Mit einem Ruck war ich stehen geblieben, hielt sie am Arm fest, dass sie auch stehen bleiben musste, nahm ihren Kopf in die Hände und küsste sie. In Schwabing konnte man das auch auf der Straße, da fand niemand etwas dabei. Sie hielt still, ließ sich küssen, aber ihre Lippen waren steif und kalt.
»Ich mache mir nichts aus Liebe«, sagte sie, als ich sie losließ.
»Ach! Auf einmal. Alles wegen dieses Kerls.«
»Was für ein Kerl?«
»Na der, um den du so trauerst. Ist er abgehauen?«
»Er ist kein Kerl, und er ist nicht abgehauen. Er ist für seine Firma auf einige Jahre nach Südamerika gegangen.«
»Ach so. Drum.«
»Gar nicht drum. Er ist sowieso verheiratet. Und ich wünschte, er wäre schon vor einem halben Jahr verschwunden. Ich wünschte, ich hätte ihn nie gesehen.«
Das letzte klang leidenschaftlich und böse.
Ich schwieg beeindruckt. War wohl allerhand dramatisch, diese Geschichte.
Beim Siegestor angelangt, drehten wir um und gingen den gleichen Weg zurück.
»Wir kriegen Föhn«, sagte ich, »wahrscheinlich sind wir deswegen so depressiv gestimmt.«
»Du vielleicht. Ich habe wirklich Sorgen, ich brauche keinen Föhn dazu.«
»Ich versteh’ nicht. So eine tolle Sache, was du mir da eben von Burckhardt erzählt hast, und dann machst du dir Sorgen wegen so was. Ich hab’ dir doch gesagt …«
»Ja, ja, ich weiß. Liebeskummer ist unwichtig. Geht vorbei, hat man bald vergessen. Sonst noch was?«
»Nimm dir einen neuen Freund, da vergisst man am schnellsten.«
»Vielen Dank für den guten Rat. Dich vielleicht?«
»Warum nicht?«
Sie lachte kurz und spöttisch. Verächtlich, wie mir schien. Ich war ihr wohl nicht gut genug, ein Student, der nicht fertig studieren wollte. Dieser Boss da, der in Südamerika mit seiner Frau herumkreuzte, hatte ihr wohl mehr imponiert. Ein verheirateter Mann! Das hatte sie nötig. Ein Mädchen wie sie.
»Weißt du was?«, sagte ich und blieb wieder einmal stehen. »Ich mache dir einen Vorschlag zur Güte. Wir fangen ein neues Leben an. Du und ich. Womit nicht gesagt sein soll, dass wir es zusammen tun müssen. Wenn ich dir eben nicht gefalle, na gut, ich werd’s überleben. Aber sonst – hör zu, wir schmeißen den alten Kram weg, du deine verflossene Liebe, ich hab’ das ja schon hinter mir, du dein Studium, ich mein Studium, ich geh’ auch zu Burckhardt, dann fangen wir an. Zum Teufel – das muss doch möglich sein. Verena! Überleg doch mal. Ist das nicht möglich?«
»Nein«, sagte sie hart.
»Doch«, ich fasste sie an den Schultern, schüttelte sie. »Doch, es ist möglich. Man kann, wenn man will.«
Ich sah, dass ihre Augen sich wieder mit Tränen füllten, ich zog sie an mich, küsste sie wieder, und diesmal erwiderte sie meinen Kuss sehr heftig.
»Na na, langsam, wartet, bis ihr zu Hause seid«, sagte ein Mann, der vorüberging.
Ich spürte Salz auf meinen Lippen, nun weinte sie wieder, warum weinte sie denn, sie hatte allen Grund, glücklich zu sein mit diesem großartigen Urteil Burckhardts in der Tasche. Liebte sie denn diesen Kerl in Südamerika immer noch so sehr?
»Denk immer daran, was Burckhardt dir gesagt hat. Er ist der größte Schauspieler, den ich kenne. Weißt du noch, wie wir ihn als Wallenstein gesehen haben? Er ist einfach eine Wucht. Und wenn er sagt, du hast Talent, dann ist das eine Million Dollar wert. Viel mehr als jeder Mann auf der Welt. Du wirst eine berühmte Schauspielerin werden, pass auf. Hör auf zu weinen, Verena! Wir fangen ein neues Leben an.«
»Ich bekomme ein Kind«, sagte sie.
Ich ließ sie los. Da stand sie vor mir, ihr Blick ging an mir vorbei ins Leere. Nein, nicht ins Leere, in das neue Leben, das vor ihr lag und das sie nicht gewählt hatte. Sie bekam ein Kind.
Ich schämte mich. Da gab ich an, als lägen alle Probleme der Welt auf meinen Schultern, und da war dieses zarte kleine Ding – und sie hatte wirklich eins.
Was sagt man auf so eine Eröffnung? Mir fiel absolut nichts Passendes ein.
Jetzt sah sie mich an, ein wenig spöttisch.
»Na, nun bist du sprachlos, wie? So furchtbar einfach ist das alles gar nicht mit dem bisschen Liebeskummer, wie du meinst. Hast du noch ein paar gute Ratschläge in der Tasche? Viel unternehmen kann ich nämlich nicht. Erstens habe ich kein Geld, und zweitens ist es auch schon zu spät. Ich bin eben dumm gewesen. Für Dummheit muss man immer bezahlen. Das hat mir meine Mutter schon gepredigt, und sie hat genau recht.«
»Und er?«
»Er weiß es nicht. Er ist schön weit weg. Und scheiden lassen kann er sich sowieso nicht. Er hat selber Kinder. Ich bin nicht nur dumm, ich bin auch leichtsinnig gewesen. Aber ich habe ihn geliebt. Und die Julia, die kann eine andere spielen.«
Ich war restlos erschüttert. Wir liefen die Leopoldstraße entlang, ich hielt sie an der Hand wie ein heimatloses Kind, sie war auch nicht mehr krötig und abweisend, sie war sanft und zutraulich und schien froh zu sein, dass sie endlich einmal mit jemandem über alles hatte reden können. Keiner wusste bisher davon.
Später aßen wir in einer kleinen Schwabinger Kneipe zu Abend, und sie erzählte mir von ihrer Familie.
»Ich habe es meiner Mutter schon gesagt, dass ich aufhören werde zu studieren. Sie war gar nicht überrascht. Sie versteht es. Sie war selber Schauspielerin, weißt du. Sie hat gesagt, es ist ein schweres Leben, und es kann ein sehr demütigendes Leben sein. Und ich wäre wie sie und würde mich doch nie durchsetzen. Aber ich bin nicht wie sie, ich könnte mich durchsetzen. Aber so, wie es jetzt ist …«
Ihre Mutter war eine kleine erfolglose Schauspielerin gewesen, die gegen den Willen ihrer Eltern – natürlich – zum Theater gegangen war. Der Vater war Lehrer in einer Kleinstadt, enge bürgerliche Verhältnisse. Dahin war Verenas Mutter zurückgekehrt, nachdem sie nichts erreicht hatte.
Verenas Vater, ein junger Schauspieler, fiel im Krieg, sie kam zu den Großeltern, die Mutter reiste mit einer Truppe im besetzten Gebiet, Wehrmachtsbetreuung nannte man das, dann wurde sie krank, sehr krank, und kam schließlich ins Elternhaus zurück. Und da war sie geblieben, enttäuscht, allein und ohne Mut. Nach dem Krieg bekam sie nie mehr ein Engagement.
»So ein Leben hat meine Mutter gehabt. Sie ist noch nicht alt, und sie ist immer noch hübsch, aber sie ist … sie ist wie zerbrochen. Sie arbeitet halbtags in einem Schreibwarengeschäft und führt meinem Großvater den Haushalt. Meine Großmutter ist vor zwei Jahren gestorben. Mein Großvater ist pensioniert und nörgelt und schimpft den ganzen Tag. Ich war so froh, als ich von zu Hause fortkonnte. Ich sollte Lehrerin werden, das wollte mein Großvater, und Mutti sagte auch, es wäre das Beste. Aber sie wusste immer, was ich wirklich wollte. Und ich habe mir gedacht, ich schaffe es doch, ich werde Karriere machen, und dann würde Mutti mit mir kommen und …«
Und. Und.
»Es wird vorbeigehen«, versuchte ich sie zu trösten, »dann kannst du doch noch tun, was du willst.«
»Unsinn«, sagte sie kurz. »Wie stellst du dir das vor? Und was soll ich jetzt überhaupt machen? So in dem Zustand nach Hause kommen? Du weißt nicht, wie das ist in einer Kleinstadt. Am liebsten wäre ich tot.«
Gretchentragödie im zwanzigsten Jahrhundert! Es hatte sich in dieser Welt gar nicht so viel geändert. Das wurde mir an diesem Abend klar.
Und genauso wenig hat es sich geändert, dass wir Männer dieser Situation immer reichlich hilflos gegenüberstehen. Selbst da, wo es sich um unser eigenes Kind handelt, was ja hier nicht einmal der Fall war. Man kann sich im Grunde nicht hineindenken, was eine Frau fühlt und denkt. Man weiß auch nicht, wie schwach oder – wie stark eine Frau ist. Was hätte ich damals tun können, wie hätte ich Verena helfen können?
Wir waren in den Wochen dieses Frühlings viel zusammen, praktisch jede freie Stunde, die sie hatte. Sie weinte nie wieder, sie war ernst, manchmal betrübt, aber nicht verzweifelt, nicht kleinmütig.
Im Mai erklärte sie mir plötzlich, ohne große Vorbereitung, dass sie nach Hause fahren würde.
»Du wirst es deiner Mutter sagen?«
»Ja. Ich kann ihr alles sagen. Und wir werden beraten, was geschehen soll.«
»Aber du wirst nach München zurückkommen?«
»Ich denke. Es wird für mich hier leichter sein als zu Hause. Die Großstadt ist barmherziger in solchen Fällen.«
»Ich – ich meine, Verena –, was ich noch sagen sollte«, ich suchte hilflos nach Worten, »ich kümmere mich schon um dich. Ich – ich …«
Sie lächelte. »Danke, Julius. Ich ruf’ dich an, wenn ich wieder hier bin.«
Sie rief nicht an. Sie kam auch nicht zurück. Erst als sie fort war, fiel mir ein, dass ich ihre Adresse nicht besaß. Nun, sie wäre zu beschaffen gewesen. Aber zunächst dachte ich, dass sie wirklich wiederkäme. Und dann entglitt sie mir – Lena, Verena. Meine erste Partnerin auf der Bühne. Ich vergaß sie. Nein, das ist nicht wahr. Vergessen habe ich sie nie. Und heute, zwölf Jahre später, indem ich diese Zeit beschwöre – die Zeit meines Aufbruchs –, sehe ich sie vor mir, zart und anmutig, mit den großen dunklen Augen und dem scheuen Lächeln.
Lena: Du weißt, man hätte mich eigentlich in eine Scherbe setzen sollen. Ich brauche Tau und Nachtluft, wie die Blumen. – Hörst du die Harmonien des Abends? Wie die Grillen den Tag einsingen und die Nachtviolen ihn mit ihrem Duft einschläfern! Ich kann nicht im Zimmer bleiben. Die Wände fallen auf mich.
Wo mag sie sein, Lena, Verena? Was mag aus ihr geworden sein? Was tut sie heute, jetzt, in dieser Stunde, da ich in B. an meinem Schreibtisch sitze und an sie denke?
Der Nudeltopf
Womit ich also mit einem gewaltigen Sprung in der Gegenwart angekommen wäre. Der Übergang ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich bin kein geübter Memoirenschreiber, und Memoiren sind es ja auch keineswegs, die ich schreiben will. Ich glaube, das sagte ich schon.
So alt bin ich nun auch wieder nicht, obwohl es mir manchmal so vorkommt, als läge der größte Teil meines Lebens bereits hinter mir. Habe ich doch vielleicht das Bedürfnis, Bilanz zu ziehen? Mir darüber klarzuwerden, ob ich das Rechte getan habe, als ich meinen Willen durchsetzte und meine eigenen Bedenken und den Widerstand meiner Familie bezwang?
Ich habe zu manchen Zeiten meines Lebens Tagebuch geführt. Nein, Tagebuch klingt zu hochtrabend, ich habe mir Notizen gemacht. Manche sind erhalten geblieben, andere sind verschwunden. Ich sage dies nur zur Erklärung, dass ich immer schon die Neigung hatte, schriftlich meine Gedanken zu klären. Und vielleicht meine Gefühle auch. Wenn ich darüber nachdenke, habe ich es immer in den Zeiten getan, wo ich nicht ganz einig mit mir selber war. Nicht ganz glücklich, wenn man es einmal simpel ausdrücken will.
Bin ich also nicht glücklich, bin ich nicht einig mit mir, wenn ich jetzt darangehe, Papier vollzuschreiben, und mir klar zu werden versuche über das, was war und was ist? Ist die Unruhe wieder da, die einige Jahre fort war, muss ich mein Leben ändern, muss ich mich zwingen dazu, es zu ändern?
Oh, ich bin immer noch ein Zweifler, ein Grübler und Zögerer. Und trotzdem habe ich den Hamlet noch nicht gespielt.
Ich habe Briskow einmal gefragt, ob er nicht daran dächte, den Hamlet zu bringen. Er sah mich eine Weile schweigend an und sagte dann: »Noch nicht.«
Ich bin jetzt bald vierzig Jahre alt. Und er sagte dennoch: noch nicht.
Wie alt sind die anderen, die den Hamlet machen? Und hat es überhaupt etwas mit dem Alter zu tun?
Als ich damals, nachdem ich genügend Mut gesammelt hatte, zu Burckhardt ging – es war übrigens nicht so leicht, wie Verena es hingestellt hatte, aber sie war schließlich ein hübsches junges Mädchen, es dauerte bei mir mehrere Wochen, bis es mir gelang, den großen Burckhardt einmal zu sprechen –, als ich damals bei Burckhardt war, sprach ich ihm den Hamlet vor.
Er hörte sich das schweigend an. Und gab schließlich nur einen undeutlichen Brummlaut von sich.
Darüber zum Beispiel habe ich noch eine Notiz:
Vielleicht war es falsch von mir, ihm den Hamlet vorzusprechen. Er hält mich vermutlich für größenwahnsinnig. Er nickte bei Melchthal und bei Marc Anton. Und es ist komisch, was er zu mir gesagt hat: Bei Ihrem Aussehen und Ihrer Statur wird man Sie brauchen können. Was Sie daraus machen, ist allein Ihre Sache. Es gibt einen leichten und kurzen Weg. Und einen schweren und langen Weg. Es kommt darauf an, worin Sie Befriedigung finden. Begabung ist vorhanden. Aber bilden Sie sich nicht ein, dass das genügt. Begabt sind viele. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Und was man eigentlich will.
Alles so nebulöses Gerede. Das hilft mir gar nichts.
So schrieb ich damals.
Abends ging ich in eine kleine Kneipe, ganz allein, und trank. Ich bin kein Trinker, aber ich vertrage viel, wenn es sein muss. Damals trank ich mit voller Absicht. Warum? Um einen klaren Kopf zu bekommen.
Ich fand nach einer Weile einen Gefährten. Den Toni. Toni Wylos, ein bekanntes Schwabinger Original, ein leicht verkommener Dichter und Denker, den jeder kannte und mochte und von dem keiner wusste, wovon er eigentlich lebte.
»Man soll niemals trinken, um zu saufen«, sagte er zu mir, nachdem er eine Weile stumm neben mir gesessen hatte. »Das führt zu gar nix. Wo drückt dich denn der Schuh, Bürscherl?«
Eigentlich kannte ich den Toni gar nicht. Ich hatte ihn zwei- oder dreimal in Gesellschaft einiger Freunde getroffen, und wir hatten eigentlich noch nie miteinander geredet. Im Moment empfand ich ihn als aufdringlich.
»Was geht Sie denn das an?«, fragte ich mürrisch.
»Gar nix. Aber ich kümmere mich nur um Sachen, die mich nix angehen. Sachen, die mich angehen, sind mir lästig. Ist dir deine hübsche Blonde davongelaufen?«
Was für ein erstaunliches Gedächtnis! Ich erinnerte mich, dass wir einmal eine lange Nacht an einem Tisch verbracht hatten, in großer Gesellschaft, als Janine noch mein Leben teilte.
»Schon lange«, sagte ich.
»Sixt es«, sagte er drauf und weiter nichts.
»Macht nix«, erwiderte ich, unwillkürlich seinen Ton aufgreifend.
»Sag i eh, Weiber gibt’s grad gnua. Hast koane andre?«
»Die ist auch grad weg.«
»Sauf ma halt«, fasste der Toni zusammen und bestellte zwei neue Viertel. »Ich lad dich ein, Bürscherl. Zufällig hab i grad a Geld.«
»Ich bezahle meinen Wein selbst«, sagte ich widerborstig.
»Mir aa recht.«
Und dann kam ich ins Reden. Ich erzählte von meinem ganz persönlichen Dilemma. Meinen Plänen, meinen Hoffnungen, meinen inneren und äußeren Widerständen. Und schließlich von meinem Vorsprechen bei Burckhardt. Der Toni hörte sich das alles geduldig an, grunzte mal vor sich hin, schüttelte den Kopf und trank dabei ein Viertel nach dem anderen.
»Jetzt sag i dir was«, meinte er schließlich, als ich nun, wirklich benebelt, den Faden verlor, »ihr Jungen heit, ihr taugt alle nix. Künstler wollt’s sein und gleichzeitig wollt’s mit einem fetten Arsch auf am Bürgerstuhl sitzen. Spießer seid’s ihr, alle.«
Und dann kam er mir plötzlich hochdeutsch. »Die Kunst ist kein Stundenmädchen. Du kannst sie nicht ein bisschen lieben, ein bisschen haben. Wenn du dich nicht traust, ganz und für immer mit ihr zu leben, dich ihr mit Haut und Haaren auszuliefern, dann lass es bleiben. Dann kriegst du sie nicht. Dann kriegst du sie nie. Schauspieler ist ein schöner Beruf. Ein paar von den feinsten Burschen, die ich kenne, das sind Schauspieler. Ein paar von den erbärmlichsten auch. Da hat dein Burckhardt schon recht. An dir liegt’s, was du daraus machst. Aber du traust dich ja doch nicht.«
Und dann, nach einem längeren Schweigen, nach ein paar kräftigen Schlucken: »Na, du traust di net. Du bist so ein Bürscherl aus dem Bürgersuppennudeltopf. Du willst die Nudeln haben und die Brühe und das Ochsenfleisch noch dazu. Aus dem Topf kletterst du net raus. Du net.«
Es ist albern, so etwas zu sagen. Es kommt mir lächerlich vor. Hamlet, Faust, Marc Anton in Ehren, der Suppennudeltopf gab den Ausschlag.
»Ich klettere raus«, rief ich und muss wohl eine drohende Miene dazu gemacht haben. »Ich schon!«
»Du net.«
Unnötig, den weiteren Verlauf des Gesprächs hier zu schildern, das zweifellos nicht druckreif ist. Der Bürgersuppennudeltopf blieb mir haften. Er war auch am nächsten Morgen noch da. Er stärkte mir gewissermaßen das Rückgrat. Er begleitete mich zur Aufnahmeprüfung an die Städtische Schauspielschule, er schwebte vor mir bei dem entscheidenden Gespräch mit meinem Vater, er fing die Tränen meiner Mutter auf und verkochte sie erbarmungslos.
Ich kletterte heraus.
Ich wurde Schauspieler.
Die große und die kleine Freiheit
I