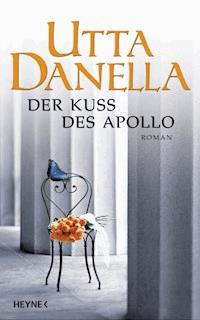6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
München, Anfang der 70er-Jahre. Nach einer enttäuschenden Vorstellung flüchtet Lorena Rocca in das luxuriöse Haus ihres Freundes Sandor. Sie weiß, dass diese Beziehung am Ende ist, auch ihre Karriere, und beschließt, sich das Leben zu nehmen. In dieser Stunde nach Mitternacht lässt sie ihr Leben noch einmal Revue passieren. Ein Leben als Artistenkind, ohne Heimat, bis zum 2. Weltkrieg mit den Eltern auf Tournee. Nach deren Tod verbrachte sie ihre Jugendjahre in München, bevor sie in den 50er-Jahren aus einem kurzen geordneten Leben wieder ausbricht in ein Leben im Scheinwerferlicht. Sie feierte große Erfolge als Sängerin und Schauspielerin, genoss Ruhm, Ehre, Erfolg und Liebe. Doch in dieser Nacht kennt sie nur die Angst vor dem Alter, der Einsamkeit und die Sehnsucht nach ihrer großen Liebe, die sie verloren hat … oder ist es doch noch nicht zu spät?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Utta Danella
Gestern oder Die Stundenach Mitternacht
Roman
hockebooks
Besuchen Sie uns im Internet: www.hockebooks.de
Utta Danella: Gestern oder Die Stunde nach Mitternacht. Roman
Copyright ©2016 by Erbengemeinschaft Utta Danella vertreten durch AVA international GmbH, Germany
Die Originalausgabe ist 1971 im Schneekluth Verlag, Darmstadt erschienen.
Überarbeitete Neuausgabe ©2020 by hockebooks gmbh
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Erlaubnis des Verlags wiedergegeben werden.
Covergestaltung: Joachim Luetke (www.luetke.com) unter Verwendung eines Motivs von Slava Gerj/shutterstock.com
ISBN: 978-3-957-51358-8
www.ava-international.de
www.uttadanella.de
Unsere Herrin ist die Zeit,
sie ist die Fessel,
die uns bindet.
Ob heute oder Ewigkeit,
ihr gilt es gleich,
da sie uns stets
in ihrem Käfig findet.
Die Stunde nach Mitternacht … In der Stunde nach Mitternacht schlafen normale Menschen. Ich habe eigentlich nie oder fast nie um diese Zeit geschlafen. Heute, in dieser Mitternachtsstunde, bin ich allein. Allein mit mir und der ganzen Welt, allein mit meinem Leben und mit dem, was geschehen wird.
In dieser Nacht werde ich sterben. Hoffentlich reichen die Tabletten. Nichts ist peinlicher als ein missglückter Selbstmord. Jeder würde dann glauben, es sollte nur ein Selbstmordversuch sein.
Soll es nicht sein. Ich will niemanden erpressen, nicht einmal das Schicksal. Das sich sowieso nicht erpressen lässt. Ich will wirklich sterben.
Diese eine verfluchte Freiheit muss man doch haben, zu gehen, wenn man nicht mehr bleiben will. Ich habe sie mir immer genommen, diese Freiheit – ich bin gegangen, wenn ich nicht bleiben wollte: von Partys, auf denen mir die Gesellschaft nicht passte, aus einem Vertrag, der mich drückte, von einem Mann, den ich nicht mehr mochte. Und jetzt nehme ich mir die Freiheit, aus dem Leben zu verschwinden.
Ich will nicht mehr. Hörst du mich, Leben? Ich nehme mir die Freiheit und gehe.
Nur blamieren möchte ich mich nicht gern. So vieles ist in den letzten Jahren schiefgegangen – hoffentlich klappt das wenigstens.
In der Zeitung werden ein paar Zeilen stehen, dazu ein Archivbild;· wenn sie fair sind, nehmen sie ein gutes. Einigen Leuten wird es leidtun um mich. Die meisten werden sagen: Es war sowieso aus mit ihr, sie war passé, restlos passé. Nicht mehr jung genug. Es ist eine Weile her, dass sie im Geschäft war, wer kennt sie noch? Und so toll war es mit ihren Erfolgen eigentlich auch nicht. Das ist ungerecht. Aber sie sind immer ungerecht – später. Einmal gehörte ich zur ersten Garnitur. Nicht international, das gebe ich zu. Meine einzige Gastspielreise in den Vereinigten Staaten war nur ein mäßiger Erfolg. Aber hierzulande war ich lange in der Spitzengruppe.
Jetzt bin ich unten, ganz unten. Der Saal war heute Abend nicht einmal halb voll. Die Zeiten haben sich geändert – sie ändern sich für alle und jeden. Andere Stars, andere Namen – und ein anderes Publikum. Wenn Jack wenigstens gekommen wäre! Dann würde ich jetzt irgendwo mit ihm sitzen, wir würden trinken und reden, er würde mich trösten, vielleicht hätte ich geweint oder ein Glas an die Wand geschmissen, und er würde sagen: »Hör auf, verrückt zu spielen. Das gehört zu dem Geschäft, es geht rauf und runter. Manche sind zwei, drei Jahre top und dann verschwunden. Was willst du denn eigentlich? Du machst das seit fünfzehn Jahren und verkaufst dich immer noch. Du wirst dich wieder besser verkaufen.« Er würde ein paar Namen nennen von solchen, die oben waren, dann unten und abgeschrieben und plötzlich ein großes Comeback hatten. So was hat’s gegeben. Weiß ich selber. Aber ich würde ihm nicht glauben, er würde es nicht glauben, doch seine Ruhe und sein Optimismus hätten mir geholfen. Sie haben mir immer geholfen.
Natürlich wusste er genau, dass es eine Pleite sein würde, darum ist er gar nicht erst gekommen. Und auch weil er wusste, die Pleite würde so groß sein, dass selbst ihm keine Trostworte mehr einfallen würden. Ich bin passé. Er weiß es genauso gut wie ich.
Nicht einmal angerufen hat er. Warum auch? Er hat ein paar neue gute Leute in seinem Stall, er kann es auch brauchen, mit mir hat er sowieso schon zu viel Zeit verplempert. Heute ist nur noch die Jugend gefragt. Und Jack hat jetzt junge Leute. Die sind unbelastet und haben im Moment die besseren Nerven.
Nicht so gute Nerven, wie ich sie hatte. Und sie werden nicht so lange durchhalten wie ich. Aber jedenfalls, solange sie zwanzig sind, haben sie nun mal bessere Nerven. Und Nerven braucht man in diesem Geschäft. There’s no business like show business. Bei Gott!
Es ist das härteste Geschäft der Welt. Es ist erbarmungslos. Wenn ich bedenke, dass ich es als Kind schon gehasst habe und dennoch nicht davon loskam – absurd! Und dass es mir trotz aller Rückschläge immer wieder Spaß gemacht hat, dass ich einfach nicht glücklich sein konnte ohne meine Arbeit – nochmals absurd! Aber so bin ich, so war ich immer, voller Widersprüche; was ich nicht hatte, wollte ich haben – was ich besaß, mochte ich nicht mehr. Ohne meine Arbeit kann ich nicht leben, das weiß ich seit Langem. Immer wieder bin ich in die Manege gegangen wie ein gut dressiertes Zirkuspferd, das den Kopf hebt, wenn es die Musik hört.
Nur heute Abend, als ich den leeren Saal sah, da wäre ich am liebsten umgekehrt. Ich habe diesen Abend durchgestanden, aber es hat mir den Rest gegeben.
Nun nicht mehr. Nein, nie wieder.
Ich wollte es wissen. Diese gute neue Band, die Jade da unter Vertrag hat, ein paar erstklassige Nummern für mich, dazu meine alten Hits – die Leute, die da waren, haben geklatscht wie wild, denen hat’s gefallen.
Aber ich sah nur die leeren Stühle. Und dachte an das, was morgen oder übermorgen in der Zeitung stehen wird. Nein! Man muss wissen, wenn es aus ist. Vorhang!
Jetzt sterbe ich an diesem Beruf, an diesem gehassten und geliebten Beruf – das ist nicht absurd.
Das ist eigentlich ganz in Ordnung.
Gemein ist es nur von mir, dass ich mir gerade diesen Ort ausgesucht habe, um zu sterben. Immerhin ist es ein gepflegter Rahmen für meinen letzten Akt – alles teuer, geschmackvoll und wertvoll in diesem Haus: die Möbel, die Bilder, die Teppiche. Ich habe mich entsprechend zurechtgemacht: ganz dezentes Make-up, ein hochgeschlossenes, sehr teures Kleid aus flaschengrünem Seidensamt. Grün war immer meine Farbe.
Ihn wird es ärgern. Ob er weiß, dass ich den Schlüssel noch hatte? Sicher, so etwas weiß er. Natürlich war er zu vornehm, ihn zurückzuverlangen, dachte wohl, ich werfe ihn in den Papierkorb. Weil es ihm und mir gleichermaßen kindisch vorgekommen wäre, wenn ich gesagt hätte: »Hier sind übrigens die Schlüssel. Ja, also dann …«
So sind wir beide nicht. Wir haben nicht viel Gemeinsames, aber wir sind weder kitschig noch sentimental; wir haben uns so ganz beiläufig voneinander getrennt, es wurde gar nicht darüber gesprochen, kein Krach, keine Abschiedsszenen, kein melancholischer Blick und kein resigniertes Lächeln, nicht die abgedroschenen guten Wünsche auf den Lippen und das obligate Versprechen, gute Freunde zu bleiben.
An die Schlüssel habe ich gar nicht gedacht, ich habe sie sowieso selten benutzt.
Ich habe nie Freundschaft gehalten mit den Männern, die ich geliebt habe und die ich verließ oder die mich verließen. Entweder – oder.
Was Sandor betrifft, so kann ich nicht einmal sagen, dass ich ihn geliebt habe. Ich ihn so wenig wie er mich. Eine Weile war es ganz amüsant mit ihm. Aber dass ich bei ihm blieb, war Berechnung. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas tat. Es ist fast so schlimm wie der leere Saal heute Abend. Und beides gehört natürlich zusammen. Nicht ihn, sein Geld habe ich gebraucht. Weil ich selbst keines mehr verdienen konnte. Nicht so viel, wie ich brauchte. So kam das zustande: ein Mann mit viel Geld und entsprechendem Society-Glanz, trotz seines fragwürdigen Lebens, und eine Frau, die ihren eigenen Ruhm überlebt hat, aber immerhin den bekannten Namen hat und dazu ein Auftreten, das vergessen lässt, dass sie und ihr Ruhm von gestern sind. Mit Liebe hat das natürlich nichts zu tun.
Wenn ich darüber nachdenke, wann und wen ich denn wirklich geliebt habe – oh, no! Das ist das Letzte, worüber ich jetzt nachdenken werde. Jetzt noch nicht. Vielleicht in den letzten Minuten.
Jetzt werde ich erst mal über das Sterben nachdenken. Dazu brauche ich etwas zu trinken.
Alles ist vorhanden in diesem Haus. Die edelsten Sorten aus internationalen Weinbergen und Barschränken. – Was eignet sich am besten, um die Tabletten hinunterzuspülen? Wein wäre dafür zu schade. Wein ist für die Lebenden, für die Liebenden. Nehmen wir Whisky. Der passt zu diesem Anlass am besten. Ich habe nie gern Whisky getrunken.
Ich kann natürlich auch Champagner nehmen. Champagner habe ich getrunken, als ich das erste Mal in diesem Haus war, das ist fast vier Jahre her. Wäre doch ganz sinnig.
Auch wieder nicht, sonst bildet er sich noch ein, ich hätte kurz vor Ladenschluss an ihn gedacht.
Warum hasse ich ihn eigentlich? Stimmt nicht – ich hasse ihn nicht. Ich kann ihn so wenig hassen, wie ich ihn lieben konnte. Und ich brauche es mir jetzt nicht einzureden, nur um es dramatischer zu machen.
Wir haben nebeneinanderher gelebt, ich habe ihn betrogen, er hat mich betrogen, obwohl selbst diese dramatische Vokabel in unserem Fall zu bombastisch ist, und manchmal gingen wir uns auf die Nerven.
Als er vergangenes Jahr zu meinem Geburtstag mit dem Smaragdarmband ankam – das dritte Geburtstagsarmband in drei Jahren –, konnte ich mich nicht einmal darüber ärgern. Just bored – that’s all.
Er sah mir wohl an, was ich dachte, denn ich war nie eine Frau, die sich die Mühe machte, sich zu verstellen. »Wäre dir ein neuer Nerz lieber gewesen? Ich dachte nur, weil du schon zwei hast …« Es klang ironisch.
»Ein paar Armbänder habe ich auch schon. Und zwei davon bekam ich von dir zum Geburtstag, Schätzchen. Nerz ist Weihnachten dran. Es hat mich immer schon an dir bezaubert, dass du so unerhört fantasievoll bist.«
Blattschuss. Zu der Zeit, als wir noch miteinander schliefen, habe ich ihm einmal mitgeteilt, er sei der fantasieloseste Liebhaber, den ich je gehabt hätte.
So etwas vergisst kein Mann, das trifft ihn tief.
Vielleicht habe ich deswegen nie einen Mann behalten, weil ich ihnen so gern die Wahrheit sagte.
Merke, Mädchen, im Umgang mit Männern: Lasse sie immer glauben, sie seien in jeder Beziehung einmalig. Und wunderbare, vollkommene Liebhaber. Lüge das Blaue vom Himmel herunter, mit Worten und Blicken, mit Seufzern und Stöhnen – sie werden es vorbehaltlos glauben und werden dich lieben, lieben, lieben.
Diese Weisheit lernte ich von Marja, als ich sechzehn war und noch niemals, verlogen oder wahr, aus Liebe gestöhnt hatte.
Sie hatte recht. Sie hatte immer mit allem recht, was sie sagte. Ich begriff das ziemlich schnell, aber ich habe dennoch nie, oder fast nie, ihre Ratschläge befolgt. Marja! An dich denke ich in dieser Nachtstunde, und die Welt ist nicht mehr so kalt und leer. Wenn du jetzt hier wärst, würdest du mich ohrfeigen.
Du hast mir oft eine geklebt – und jedes Mal hatte ich es verdient. Viel lieber hast du mich gestreichelt und bemuttert, hast für mich gesorgt, hast für mich gekocht, oh, wie gut gekocht; nicht in den teuersten Restaurants habe ich so gut gegessen wie bei dir.
Mütterchen! Als ich ein Kind war, stecktest du mir Bonbons in den Mund, zum Trost, zur Belohnung, zur Ablenkung. Jetzt gibt mir keiner ein Bonbon, um mich zu trösten, jetzt werde ich Tabletten schlucken. Du kennst mich, nicht wahr, du weißt, dass ich mich nicht mit dem Rest bescheiden kann, so wie du es getan hast. Ich kann nicht leben mit dem sicheren Wissen, dass es nur noch abwärts geht.
Du warst niemals so preisgegeben wie ich. Du hattest uns. Und du hattest mich.
Oh, mein Papa … Marja gehörte zu unserer Truppe. Sie trat nicht auf, dazu sei sie zu alt, fand Papa. Das war sie zu jener Zeit gewiss noch nicht. Was würdest du denn zu mir sagen, Papa, heute?
Wie jung und lebendig Marja noch war, bewies sie dadurch, dass sie in fast jeder Stadt, in der wir gastierten, einen Liebhaber auftat. Vielleicht war es manchmal kein richtiger Liebhaber, auf jeden Fall wimmelte immer ein Mann um sie herum, mit dem sie sich abgab. Soweit ihre Zeit reichte.
Unsere Männer zogen sie auf mit ihrem jeweiligen Freund, das gehörte dazu, sie tat dann jedes Mal sehr geheimnisvoll, als sei ihr diesmal die große Liebe begegnet.
Einmal war es ein Feuerwehrmann, und auf diese Eroberung war sie besonders stolz. Sie stand neben ihm in der Kulisse, wenn wir Auftritt hatten, Mamas Kostüm zum Wechseln über dem Arm, in der Kitteltasche Puderquaste und ein paar Schminkstifte, und sie lehnte sich leicht an ihren uniformierten Helden, dem das ein wenig peinlich war. Aber stolz war er auch auf sie, schließlich war sie einmal eine große Künstlerin gewesen, das hatte sie ihn wissen lassen.
Bestimmt verstand sie viel von der Liebe. Jemand, der so fachmännisch darüber reden konnte, musste wohl auch in der Praxis einiges aufzuweisen haben.
»Wenn doch bloß mal einer kleben bleiben und sie heiraten würde«, sagte Papa. »Sie hat so ein gutes Herz. Und kann so gut kochen.«
»O nein, José, nein, was täten wir ohne sie? Ich wäre restlos verloren, wenn sie nicht mehr da wäre.« Das sagte darauf Mama.
Marja war alles für sie: Zofe, Garderobiere, Vertraute, Helferin in allen Lebenslagen, sie schminkte Mama, zog sie an und aus, massierte ihr die Füße nach dem Tanzen und kümmerte sich schließlich und endlich um mich. Marja war unentbehrlich, das musste Papa zugeben. Wenn wir weiterzogen ins nächste Engagement, blieb der Liebhaber zurück, Marja weinte ein bisschen, aber in der nächsten Stadt musste alles etabliert und arrangiert werden, und dann vergaß sie ihn und hielt Ausschau nach einem neuen Mann. – Den Feuerwehrmann – das weiß ich zufällig noch genau – behielt sie zwei Monate, denn wir waren verlängert worden. Er war ein großer, stattlicher Mann, und er gefiel auch mir ausnehmend gut. Ich war damals vielleicht zwölf oder so. Marja war Russin und hatte eine richtige klassische Ballettausbildung gehabt. Die Anfangsgründe des Tanzens lernte ich von ihr, und später, als die Morawa mich unterrichtete, war Marja meist dabei und beobachtete kritisch, was mir beigebracht wurde. Das war in Berlin. Die Truppe war im Wintergarten auf getreten, und ich blieb dann ein halbes Jahr in Berlin, als die anderen nach Amerika gingen. Ich müsste endlich einmal ordentlichen Unterricht haben, fand Papa, sonst würde nie etwas aus mir. Die Morawa gab sich große Mühe, aber ich war zur Tänzerin nicht geboren.
Marja war die Erste, die das entdeckte. »Das ist ganz nett, was du machst. Aber eine große Tänzerin aus dir wird nie. Du bist zu eigenwillig. Zum Tanzen gehört Disziplin und wieder Disziplin. Man muss sich ganz klein machen können. Man muss sich zerbrechen lassen. Und dann neu zusammensetzen.«
»Zusammengesetzt werden.«
»Sage ich ja.«
Ich war nicht so leicht zu zerbrechen, nicht einmal von der Morawa. Auch nicht von Père Fortune, der mich später in Paris unterrichtete.
»Mizzi, das wäre eine Tänzerin geworden. Sie hätte es gebracht zur Primaballerina. Du musst ansehen ihre Hände. An den Händen man sieht sofort, ob eine sich hingeben kann für Tanz. Es ist so schade um Mizzi, dass sie muss machen das Gehopse.«
Mizzi war Mama. Ausgebildet im Wiener Opernballett und vielleicht wirklich zur Primaballerina geboren, hätte sie sich nicht mit achtzehn in Papa verliebt und sich ihm statt dem Tanz hingegeben. – Was heißt verliebt? Das traf es wohl nicht. Was ich erfuhr von der Begegnung dieser beiden Menschen, die meine Eltern wurden, so muss es sich wohl eher um einen Vulkanausbruch, um einen mittleren Weltuntergang gehandelt haben. Natürlich nicht, soweit es die kleine Mizzi betraf. Aber Papa!
Oh, mein Papa … Ich habe das Lied auch gesungen, und wer hätte es mit mehr Berechtigung singen können als ich? Er war der schönste Mann, den man sich vorstellen kann. Ein Traum von einem Mann, schwarzhaarig, schwarzäugig, groß, geschmeidig, voll Musik bis in die Fingerspitzen, und von einem Temperament, das alles überfuhr, was sich ihm in den Weg stellte.
Und da hätte dieses kleine Wiener Mädel widerstehen sollen, diese sanfte Unschuld aus kleinbürgerlichem Haus, gut und brav erzogen – küss die Hand, ergebensten Dank, Frau Baronin, ich bitt’ recht schön –, so habe sie geredet, erzählte mir Papa, als er sie kennenlernte. Dieses kleine Mädel, zart und feingliedrig, scheu und keineswegs verdorben von der Arbeit im Ballett, o nein, dazu war die Schule zu streng, das Training zu hart, das Pensum zu gewaltig, Disziplin und nochmals Disziplin, sich zerbrechen und wieder zusammensetzen lassen, das musste ja sein, wenn man eine große Tänzerin werden wollte; und so eine Kleine sollte diesem Märchenprinzen von Mann widerstehen können, der mit seiner südländischen Glut, seinem Elan, seinem Charme um sie warb?
Denn das hatte er getan, der Papa. War nicht so einfach gekommen und hatte sie verführt, das tat er nur in nebensächlichen Fällen. Aber die Mizzi wollte er ganz, für immer. Und er bekam sie auch.
Er war Argentinier, mein Papa, und hatte Geige gespielt, solange er denken konnte. Erst in einem Kaffeehaus, dann in einem Tanzorchester, und dann hatte er die Idee, er müsse noch etwas dazulernen, und war in Wien zu einem großen Maestro gegangen. Vielleicht spukte ein wenig Virtuosenehrgeiz in seinem Kopf herum, zu jener Zeit in Wien. Aber die Zwanziger-Jahre waren hart für einen Künstler, und die Stunden bei einem Maestro teuer, und er musste wieder in einem Kaffeehaus spielen. Doch dafür war er viel zu schade, er spielte so gut, er war ein Zauberer auf seinem Instrument, das sagte jeder. Und später konnte man es in der Zeitung lesen, als er der berühmte José de Santander geworden war.
Damals, als er Mama kennenlernte, war er gerade dabei, das Orchester zu gründen. Erst waren sie neun Mann, und es war nicht leicht, Engagements zu bekommen. Aber sie konnten viel und wurden täglich besser. Papa war immer probenbesessen, das war er noch zu meiner Zeit, als sein Orchester fünfzig Mann stark war, das weltberühmte Tangoorchester von José de Santander, ausgebucht für Jahre von den großen Varietés und Showtheatern. Jeder ein Könner, und jeder ein Künstler in diesem Orchester. Wenn ihre Geigen einsetzten zu den berühmten argentinischen Tangos, dann riss es die Leute förmlich von den Sitzen, und nicht auf die Art, wie es die Teenager heute produzieren, wenn einer ins Mikrofon winselt – nein, da war noch Leidenschaft darin, wenn die spielten, es war richtige Musik, wild und stark und voll – eine sehr erotische Musik war das. Und zu alldem noch Papa. Wie er vor dem Orchester stand, hell angestrahlt in seinem weißen Frack, manchmal bei einem Solo in Rot getaucht – und wie er spielte!
Er und seine Geige waren eins, und dazu sein schönes dunkles Gesicht mit den brennenden Augen und das schwarze Haar, das ihm in die Stirn fiel. Ich sehe es noch und höre es noch, heute und hier, ich habe den Klang noch im Ohr, denn so etwas hat es nie wieder gegeben. Es war Kitsch in Vollendung. Aber es war auch Kunst. Und es wirkte immer. Die Frauen waren verrückt nach ihm. Sie schrieben ihm Briefe, sie schickten ihm Blumen und ihre Telefonnummern und ihren Chauffeur, und manchmal –, mag sein –, aber er war sehr diskret, ich glaube, so oft hat er Mama gar nicht betrogen, denn er liebte sie ja, liebte sie abgöttisch, die süße kleine Mizzi aus dem Opernballett mit den Rehaugen unter den langen Wimpern,· und darum war auch keine Primaballerina aus ihr geworden, sondern seine Frau, die mit ihm durch die Welt reiste und nicht den Kaiserwalzer tanzte, sondern Tango und Rumba und einen hinreißenden Flamenco gelernt hatte. Zwei Nummern hatte Mama meist während des Auftritts des Orchesters, manchmal sogar drei, sie beherrschte die spanischen und südamerikanischen Tänze perfekt. Maria Cadero hieß sie jetzt, ihr Haar, lang und dunkelbraun, flog um ihre Schultern, sie ließ die Kastagnetten klappern, doch das Beste war ihr großer Tangoauftritt in einem langen roten Kleid mit schwarzen Rüschen, geschlitzt bis zu den Oberschenkeln, dann bog sich ihr Körper, bis ihr Haar den Boden berührte, sie war zerbrochen worden und wieder zusammengesetzt, und ganz etwas anderes war aus ihr geworden, als sie gedacht hatte. José de Santanders Frau. Maria Cadero, der Star der Santander-Truppe. Mizzi? – Wer war das gewesen?
Das hochgeschlitzte rote Kleid mit den schwarzen Rüschen ist mir gut in Erinnerung geblieben. Es war das letzte, in dem ich sie tanzen sah. Das war in Berlin, im Scala, während des Krieges, ein Zweimonatsengagement in einer großen Ausstattungsrevue. Kurz danach wurde das Scala zerstört.
Ich durfte auch schon auftreten mit einer Rumba und einem kleinen spanischen Lied. Gegen Mamas Tanz war meine Hopserei vermutlich sehr bescheiden. Aber mit dem Lied kam ich gut an; was mir an Technik fehlte, verdeckte das Mikrofon, ein paar Triller, ein wenig Tremolo, ein wenig Koketterie – es gefiel den Leuten. Ich war fünfzehn, als ich das erste Mal auftreten durfte. Marja sagte: »Bei dir es dauert länger. Du bist keine Südländerin. Ist noch nichts dran an dir.«
»Ich bin zur Hälfte Südländerin. Papa ist Argentinier.«
»Täubchen, du nicht denken, Marja ist dumm – sie ist nicht von Zeitung. Kein Reporter, dem man erzählt Märchen. Der Papa von deinem Papa war Argentinier. Vielleicht. Seine Mama stammt aus Neukölln. Und der Papa davon kam aus Polen. Das ist Ahnenforschung, Täubchen, das ist Mode heute. – Und deine Mama ist aus Wien. Und von der Mama die Mama aus Slowenien, und was glaubst du, der Papa von der Mama seinem Papa vermutlich aus dem Zigeunerwagen.«
Ich musste lachen und ärgerte mich dabei. »Hör auf! Du redest Unsinn. Der Papa von dem Papa und die Mama von der Mama – kein Mensch findet sich da durch. Das geht wie Kraut und Rüben durcheinander.«
»Das ist es, was ich sagen will. Rüben und Kraut. Und du bist davon die Produkt. Eine fürchterliche Mischung. Kann man sich nicht vorstellen, was das wird.«
»Papa ist Argentinier und damit basta. Und was meinst du, wenn du sagst, es dauert bei mir länger?«
»Ist das zu verstehen schwer? Bist du keine Frau. Bist du noch nicht einmal junges Mädchen. Bist du Rotznase, sehr dumm und ein bisschen frech. Kann man nicht wissen, was soll werden aus dir.«
»Findest du nicht, dass ich schön bin?«
Sie schüttelte sehr energisch den Kopf. »Gar nicht. Bist du viel zu mager. Hast keinen Busen und keinen Popo. Und kein Gesicht. Kannst du schön werden. Ist möglich.«
»Wann? Wann, Marja?«
»Kann man wissen? Nächstes Jahr vielleicht. Oder übernächstes. Vielleicht auch in fünf Jahren erst. Vielleicht morgen schon. Vielleicht wenn du erste Mal geliebt hast.«
»Ich habe schon oft geliebt.«
»Ich meine, richtig geliebt. Nicht dummes Tenor angehimmelt, wo nicht zählen kann bis drei.«
Damals liebte ich Tino, den Italiener, der zwei Schmachtfetzen im Programm sang und der fast so schön war wie Papa. Auch ihm liefen die Frauen nach, und mich sah er überhaupt nicht an.
»Tenor?«, fragte ich kühl. »Von welchem Tenor redest du?«
»Sage ich nur so allgemein. Bloß um zu sagen etwas. Kann ich auch sagen Jongleur.«
Ich schwieg erbittert. Marja wusste immer alles. Im vergangenen Engagement hatte ich einen Jongleur geliebt: ein hübscher, schlanker, behänder Junge, der sein Lächeln und seine Blicke nicht weniger tanzen ließ als Tassen, Ringe und Bälle. Er hatte den Auftritt vor uns, und ich stand in der Kulisse und sah ihm zu, im Gegensatz zu dem Tenor nahm er Notiz von mir, streichelte mir die Wange, wenn er atemlos von der Bühne kam, oder warf mir irgendetwas zu, wenn wir uns im Garderobengang begegneten, ein Bällchen, einen Ring und einmal sogar ein Kätzchen, das er mitgebracht hatte; und zweimal küsste er mich im Vorübergehen, leichte, rasche Küsse, ohne Bedeutung, jedenfalls für ihn – aber nicht für mich. Für mich bedeuteten sie viel, und als das Engagement zu Ende war und unsere Wege sich trennten – er ging nach Stockholm, und wir gingen, ach, genau weiß ich nicht mehr, wohin –, da weinte ich, genau wie Marja manchmal weinte, und ich träumte noch tagelang von seinem Lächeln, seinen Bällen und den zwei kleinen Küssen, die durch die Luft geflogen waren.
»Und wird man schön, wenn man richtig liebt?«
»Ja, Täubchen, jede Frau wird schön, wenn sie richtig liebt.«
»Das ist Unsinn, Marja. Dann müsste jede Frau schön sein. Denn jede Frau hat einmal richtig geliebt.«
»Wer hier Unsinn redet, Täubchen, bist du. Nicht jede Frau hat einmal richtig geliebt. Es ist nicht Liebe, wenn man sich mal auf den Rücken legt und …«, sie bekam einen Hustenanfall, schob sich und mir einen Hustenbonbon in den Mund, sie trug sie immer in der Schürzentasche, »ja, so ist es nicht. Was wollte ich sagen?«
»Wenn sie sich auf den Rücken legt«, erinnerte ich sie, begierig auf die Fortsetzung der Belehrung.
»Ist wieder Unsinn. Wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte sagen, wenn sie, und sie hat mit einem Mann, verstehst du, das muss nicht sein richtige Liebe. Das bedeutet gar nichts.«
»Aber wenn einer sie küsst, das ist doch Liebe.«
Wenn man bedenkt, in welcher Umgebung ich aufgewachsen war, so war es erstaunlich, wie naiv und ahnungslos ich in diesen Dingen war. Doch dafür hatte Papa gesorgt. Und Mama und Marja auch. Ich wurde sehr sorgsam behütet. Keiner der Männer aus unserem Orchester war mir je zu nahe getreten. Sie waren alle so eine Art Onkel für mich, es kam vielleicht daher, dass ich die meisten seit meiner Kindheit kannte. Denn als Papas Orchester erst einmal stand und berühmt war, hielt er seine Leute gut zusammen. Sie hatten es gut bei ihm, und sie mochten ihn. Er war der Chef. Er war die anerkannte Autorität, der Beste von allen, das wussten sie. Aber er war auch ihr Freund, der alle Sorgen mit ihnen teilte. Er ließ keinen im Stich, der krank wurde oder sonst wie in Schwierigkeiten geriet, was immer wieder einmal vorkam: Frauengeschichten, Ehequerelen, Geldkalamitäten. Papa war immer für sie da. Und sie blieben bei ihm. Und darum kannte ich sie alle. Ich war für sie ein Kind, ein kleines Mädchen. Die Tochter vom Chef.
Was kannte ich sonst für Männer? Die Artisten, das immer wechselnde Bühnenpersonal,·alle vier Wochen, und alle acht Wochen bei einem verlängerten Engagement, andere Menschen, andere Gesichter. Gewiss, man traf sich auch immer wieder. Und sie waren alle viel bürgerlicher, als der normale Bürger sich das vorstellt. Sie waren verheiratet, sie hatten eine feste Partnerin, und so ein kleines Ding, das zwischen ihnen aufwuchs, war tabu.
Sonst kannte ich keine Menschen. Ich hatte keine Freunde oder Freundinnen. Keine Schulfreunde, keine Nachbarskinder, keine Tanzstundenverehrer.
Ich dachte über die Küsse des Jongleurs nach und kam zu der Erkenntnis, dass sie wohl nicht von der Art gewesen waren, die nötig war, um mich schön zu machen. »Aber wenn man richtig geküsst wird und richtig geliebt wird, dann ist man schön?«
»Dann ja, Täubchen.« Marja seufzte. »Aber auch nur so lange, wie es da ist.«
»Es bleibt nicht?«
Marja schüttelte bekümmert den Kopf. »Es bleibt nicht.«
»Ich will aber, dass ich immer schön bleibe.«
Ich konnte mich endlos im Spiegel betrachten. Und Spiegel gab es überall. Ich konnte auch bereits mit Stiften und Farbe umgehen. Marja hatte mir gezeigt, wie man sich schminkt.
Oftmals fand ich mich schön, wenn ich mich dick und bunt angestrichen hatte. Mein Haar war dunkel wie Mamas, ich trug es lang und offen. Es lockte sich ein wenig an den Spitzen, es fühlte sich weich und seidig an. Meine Augen waren dunkel, dunkler als Mamas, fast so schwarz wie die von Papa. Aber meine Arme waren noch dünn und mein Busen klein. – Eines Tages würde ich richtig lieben, um endlich schön zu werden. Und damit es blieb – das Schönsein –, musste ich immer wieder lieben. Dann würde ich auch immer schön sein. An die Liebe dachte ich viel. Und natürlich an mich und mein Leben, wie es werden würde. Nicht so sehr an eine Karriere auf der Bühne. Das interessierte mich nicht. Ich hatte in der Beziehung keinen Ehrgeiz. Denn eigentlich – und das war es, was meine Kindheit nicht so glücklich machte –, eigentlich liebte ich das Leben nicht, das wir führten. Ich beneidete immer die anderen Kinder. Ich wünschte mir, irgendwo bleiben zu können, an einem Ort, in einer Stadt. An einem festen Platz, wo ich zu Hause sein könnte. Wo es eine Wohnung für uns geben würde und nicht die ewig wechselnden Hotel- und Pensionszimmer.
Und ich wollte gern in eine Schule gehen. Ein Kind sein wie die anderen Kinder.
Yesterday … Da sitze ich mitten in der Nacht allein, trinke Whisky und rauche. Vor mir auf dem Tisch habe ich die Tabletten ausgebreitet. Fünfunddreißig Stück.
Es eilt nicht, die Nacht ist lang genug. Und dann ist morgen ein Tag und dann noch eine Nacht, und dann erst kommt Frau Winter zurück und wird mich finden. Arme Frau Winter! Tut mir leid für sie. Unangenehme Geschichte. So leid auch wieder nicht, denn sie mochte mich nie, und manchmal war sie biestig.
Sie wird also meine Leiche finden, und bis dahin werde ich wohl noch einigermaßen ansehnlich sein. Hoffe ich jedenfalls. Es wäre mir schrecklich, einen widerlichen Anblick zu bieten.
Im Hotel bin ich nicht geblieben, weil man mich dort vielleicht zu früh gefunden hätte. Irgendwann im Laufe des morgigen Tages wäre das Zimmermädchen gekommen. Oder sie hätten sich gewundert, dass ich keinen Anruf beantworte.
Falls jemand anruft. Könnte ja sein, Jack ruft doch noch an, um zu hören, wie es war.
Finden sie mich zu früh, bin ich noch zu retten. Sie pumpen mir den Magen aus, und was weiß ich, was sie sonst noch alles mit einem machen. Was für eine Blamage! Ich wache auf, hässlich und aufgelöst, und muss in ein spöttisches Arztgesicht blicken. Nein.
Ich habe mir das schnell, aber gut überlegt. In letzter Zeit habe ich oft mit dem Gedanken gespielt, es zu tun. Doch heute Abend vor den leeren Stühlen, ein einziges knappes Interview und dann noch Heide – da wusste ich plötzlich, dass ich es heute tun würde.
Als ich mit dem Taxi ins Hotel fuhr, überlegte ich mir, dass es nie wieder eine bessere Gelegenheit geben würde. Vorgestern traf ich Sandor zufällig in der Hotelhalle, er saß da mit zwei Herren. Er kam zu mir und begrüßte mich, charmant wie immer – nett, dich zu sehen, wie geht’s denn immer so? Blendend schaust du aus.
Das übliche Geschwätz.
»Ich fliege heute Abend noch nach New York, sonst hätten wir zusammen diniert. Aber wenn ich zurück bin, treffen wir uns mal. Bleibst du länger in München?«
»Einige Zeit. Ich weiß noch nicht. Wir verhandeln wegen einer neuen LP.«
Das war gelogen, und er wusste es sicher.
»Schade, dass ich nicht da bin zu deinem Konzert. Ach – übrigens, du solltest deine Pelze abholen, es ist November. Du wirst sie bald brauchen.«
»Ach ja, gelegentlich.«
»Frau Winter ist zurzeit nicht da, sie ist gestern nach Karlsruhe gefahren, ihre Schwester ist krank. Aber Montag, spätestens Dienstag ist sie zurück. Falls du dann noch hier bist …«
»Sicher. Ich rufe sie an und hole mir die Pelze. Nett, dass du daran denkst.«
»Du sollst doch nicht frieren, Baby.«
Sein charmantes Lächeln, Handkuss. »Also, toi, toi, toi für dein Konzert. Und auf bald.«
Daran dachte ich vorhin, als ich ins Hotel fuhr. Eine vorzügliche Konstellation.
Eine Weile suchte ich die Schlüssel, sie waren ganz unten in einem Koffer.
Die Tabletten brauchte ich nicht zu suchen. Die hatte ich sorgfältig aufbewahrt.
Abschminken, neues Make-up, das elegante Kleid, hinunter, der Portier schiebt mir Post zu, ich stecke sie unbesehen ein, Taxi …
»Zum Herzogpark bitte!«
Ich saß ganz still, ohne mich zu rühren. Ich war ganz ruhig, richtig erleichtert. – Heute also.
Das war der passende Abschluss für diesen Abend.
Der Saal halb voll. Halb leer. Das sieht fürchterlich aus. Und kein Mensch verhandelt mit mir wegen einer neuen Platte.
Und dann auch noch Heide. Sie kam nach dem Konzert und brachte mir Blumen.
Es war wie ein Hohn. Ich empfand es so. Sie nicht, boshaft war sie nie.
Aber da war das Gestern auf einmal da und erschlug mich geradezu.
»…love was such an easy game to play, now I need a place to hide away– oh, I believe in yesterday…«
Ich verstecke mich in dieser Nacht hier in diesem Haus im Herzogpark, ich verstecke mich vor der ganzen Welt, und nie – nie! – werdet ihr mich wiederfinden.
Es ist zu Ende, ich weiß es. Man muss wissen, wann es so weit ist, dass man die Hand aufmacht und sich fallen lässt.
Der Herzogpark ist eines der vornehmsten Wohnviertel von München. Und Sandors Haus ist eines der vornehmsten der vornehmen Häuser, die hier stehen. Kein Neubau, ein altes, verspieltes Jahrhundertwendehaus, eine Villa. Mit einer Auffahrt, mit Säulen neben der Eingangstür und riesigen hohen Zimmern, mit einem kleinen romantisch verwilderten Garten. Gepflegt verwildert gewissermaßen, ein Gärtner macht das.
Sandor legt Wert darauf, in dieser Gegend unter lauter feinen Leuten zu wohnen. Genau wie er Wert darauf legt, zur feinen Gesellschaft zu gehören. Was man eben heute so darunter versteht.
Mit Geld lässt sich so ziemlich alles kaufen. Die Gesellschaft fragt nicht danach, woher einer kommt, wenn er nur Geld hat und sie amüsiert. Zu Sandors Partys kommen die Leute gern, die sogenannte High Society dieser Stadt: die echten und die falschen Konsuln, die Bosse aus der Wirtschaft und der Industrie, die Playboys, die Film- und Partymädchen, auch eine Menge Adel, davon gibt es hier viel, und sie sind nicht wählerisch in ihrem Umgang.
Sandor ist nicht nur ein großzügiger Gastgeber, er ist auch ein großzügiger Freund. Wenn einer mal in Verlegenheit ist, pumpt er ihm gern was, oder er löst einen, Wechsel ein. Er tut das ganz nonchalant und mit größter Selbstverständlichkeit. Es sei sein unverwechselbarer ungarischer Charme, sagen die Leute, diese wunderbare Art von savoir vivre, die leider immer mehr ausstirbt.
Er leiht ihnen Geld, er vermittelt Geschäfte, er küsst ihre Frauen und schläft auch mal mit der einen oder anderen, wenn es seine Eitelkeit gerade kitzelt, er finanziert mal ein Filmchen, er bringt die Leute mit Leuten zusammen. Er kennt so viele in dieser Stadt. In anderen Städten auch.
Anfangs habe ich mich darüber gewundert, wie er das eigentlich macht, mit seiner nebulösen Import- und Exportfirma so viel Geld zu verdienen. Ich kenne das Büro in der Stadt, seine Sekretärin, die drei oder vier · Mitarbeiter, die da herumsitzen. Es war mir ziemlich bald klar, dass er dort und mit denen das Geld nicht macht. Aber ich bin nicht so dumm, wie er vielleicht denkt, ich habe manches gesehen und gehört im Laufe der Jahre, ich glaube, ich weiß, woher das Geld kommt, mit dem er so großzügig umgeht und an dem kein Finanzamt partizipiert: Er ist im Waffenhandel drin. Das ist immer noch ein lukratives Geschäft, heute mehr denn je. Überall auf der Welt bringen sie sich ja so gern um.
Er weiß, dass ich mich nicht seinetwegen umbringe, auch wenn es in diesem Hause geschieht. So dumm ist er nun wieder nicht. Aber ein bisschen bringe ich mich doch seinetwegen um. Vielleicht, weil ich mich schäme.
Ich schäme mich, so lange von ihm, von seinem Geld gelebt zu haben. Obwohl ich ihn nicht liebte und obwohl ich weiß, was für einer er ist. Erst versuchte ich mir einzureden, es sei ein Übergang. Ich würde wieder ins Geschäft kommen, würde wieder eigenes Geld verdienen. Eine neue Platte, die ein Erfolg wird. Ein neuer Film, eine gute Rolle. Ein Musical. Mein alter Traum. Ich habe mir immer so sehr gewünscht, ein Musical zu machen, ich kann singen, ich kann tanzen, ich bin eine leidliche Schauspielerin. »Kiss me Kate« – das war meine Traumrolle.
Jack hat sich lange darum bemüht. Aber hierzulande macht man selten Musical. Es kommt nicht an, heißt es. In Amerika brauchen sie mich natürlich nicht, sie haben da Bessere als mich. Und dabei wird man immer älter und älter. Man zählt nicht mehr die Jahre, man zählt die Monate, die Wochen, die Tage. Und die Jungen kommen. Sie können auch tanzen und singen und spielen. Viele können es nicht so gut wie ich. Aber sie sind jung. Nur das zählt noch. Nur das.
Und dann der veränderte Stil. In den Fünfziger-Jahren, als ich meine großen Erfolge hatte, sang man ganz anders. Heute … Für mich ist es ein Gegröle. Ein Gejaule. Ich kann mich nicht hinstellen mit vierzig Jahren und Beat machen. Das wäre lächerlich.
Sie machen Lärm heute – keine Musik.
Und ich habe kein Publikum mehr. Heute Abend habe ich es gesehen, deutlich genug. Ich sehe es seit Jahren. Seit sechs Jahren keinen Film. Seit zwei Jahren keine Platte. Wovon soll man eigentlich leben?
Darum blieb ich bei Sandor. Darum in diesem Haus. Darum brauchte ich sein Geld. Und darum schäme ich mich. Und darum will ich nicht mehr.
Ich will mich nicht besser machen, als ich bin. Sicher – ich habe eine Menge Fehler, ich war leichtsinnig, unbedacht, ich habe viel Böses getan. Aber ich war nie berechnend. Und schon gar nicht, wenn es ich um einen Mann handelte. Und dass ich es nun doch war, sein musste, und dass es so einer war wie Sandor – deswegen bin ich mir selber so zuwider geworden. So zuwider, dass ich lieber sterbe, als mich länger zu ertragen. Und noch älter zu werden, noch erfolgloser, noch unglücklicher.
Ja, ich bin unglücklich. Ich bin es seit Langem. Auch wenn es mir keiner angesehen hat. Oh, ich verstehe mich auf mein Geschäft. The show must go on. Und darum lache ich und strahle und bin wie das sprühende Leben. Das täuscht sie alle. Eine gut einstudierte Maske. Der Einzige, der weiß und immer wusste, wie mir zumute ist, war Jack.
Jack konnte Sandor nie ausstehen. Dabei ist er in seinem Beruf daran gewöhnt, mit allen Menschen auszukommen und Toleranz zu üben. Vermutlich kommt es daher, dass Jack mich sehr gern hat. Wir sind Freunde. Nicht nur Star und Manager. Star – lächerlich. Ich bin schon lange kein Star mehr. Genaugenommen war ich nie einer. Leidlich bekannt für einige Jahre, das ist alles. Aber Jack tut immer so, als sei ich einer. »Die Einzige in diesem Land, die Chanson machen kann«, sagte er früher immer.
Aber Chanson in diesem Land geht eben nicht. Und wenn es gehen soll, muss es aus Frankreich kommen, damit man es anerkennt.
Und wenn es Jazz ist – das konnte ich auch –, muss es aus Amerika kommen, damit man es anerkennt. Und wenn es Beat ist – das kann ich nicht –, muss es aus England kommen, damit es anerkannt wird. Sie sind so in diesem Land. Ich weiß auch nicht, warum sie so sind, aber sie sind so. Sie waren immer so.
Und darum ist man gezwungen, Schlager zu singen, möglichst schmalzige, möglichst billige Schlager. Und dann heißt es: Ja, was anderes können sie eben hier nicht, Schnulzen, das ist alles, was sie zustande bringen. Wenn man ein anständiges Chanson hören will, muss man die Greco oder die Piaf holen. Und wenn es ordentlicher Jazz sein soll – na, und so weiter.
Es ist ein Teufelskreis, aus dem keiner einen befreien kann. Auch Jack konnte es nicht. Ich habe ein paar gute Nummern gehabt im Laufe der Jahre, wirklich gute Nummern. Aber keine davon ist ein echter Erfolg geworden. Erfolge waren immer die Sachen, die eigentlich unter meinem Niveau lagen. Zwei hervorragende Songs hatte Andy für mich geschrieben, wir waren damals ganz berauscht davon, wir drei, Andy, Jack und ich. Wir dachten, jetzt landen wir den großen Treffer. »Tränen im Regen« hieß die eine Nummer. »Midnight-Blues« die andere. Beide waren, na, sagen wir mal, Achtungserfolge – mehr nicht. Die Platten gingen einigermaßen, aber nicht gerade berauschend. Große Erfolge hatte ich mit den sentimentalen Schlagern, mit den üblichen Schnulzen.
»Tränen im Regen« wurde unter dem Titel »Lost in the rain« später ein großer Hit in Amerika. Andy ging für einige Jahre hinüber, nachdem wir uns getrennt hatten. Mit dieser Nummer kam er drüben gut an, Sheila Anderson hat es gesungen. Jack meinte, ich wäre besser gewesen.
Jack versteht viel von Musik, auch wenn er ein harter Geschäftsmann ist. Aber bei allem Verständnis lebt er auch besser von den großen als von den kleinen Erfolgen. – Also lieber Schnulzen oder das derzeitige Geschrei, wenn es Geld bringt.
Vor zwei Tagen hat er aus London angerufen. »Also, wenn ich es schaffe, bin ich da.«
Ich habe nie einen Abend gegeben, ohne dass Jack dabei war. Diesmal war es das erste Mal. Und das letzte Mal. Es wird ihm leidtun, dass er mich im Stich gelassen hat. Es soll ihm leidtun. Er soll es bereuen. Ja.
»This time is the last time …« Ach, verflucht, jetzt werde ich gleich hier sitzen und heulen. Möchte wissen, warum. Jeder muss sterben. Spielt es eine Rolle, wann? Bloß nicht sich selbst überleben. Hinter dem herstarren, was man einmal war. Klein und kümmerlich dasitzen und an einem stinkenden Rest herumknabbern. Ich kann das nicht.
Wenn man einmal erkannt hat, dass das Leben gestern stattfand, wenn man weiß, dass das Heute nur noch eine Pleite ist und das Morgen einfach nicht mehr vorhanden – okay, das ist der Zeitpunkt, die Tür hinter sich zuzuschmeißen.
Übrigens eine Nummer, die ich liebe, obwohl sie von den Beatles ist – »Yesterday«.
Das passt prima, das passt großartig auf mich. Als wenn sie mich gekannt hätten.
Vermutlich passt es mehr oder weniger auf jeden Menschen. Für jeden kommt einmal der Punkt, wo er sagen muss: Mein Leben war gestern. Bloß dass es bei anderen nicht so wichtig ist.
Ich wollte so gern eine Aufnahme von »Yesterday« machen, mir gefiel die Nummer immer schon. Aber Jack meinte, das ginge nicht, ich könnte schließlich nicht den Beatles eine Nummer nachsingen. Womit er sicher recht hatte. Ein paar haben es ja getan. Sinatra zum Beispiel. Bei ihm ist der Song noch viel schöner als im Original. Bei ihm ist alles top. Ganz mein Geschmack. Eben – yesterday.
Na schön, das wäre geklärt. Gar kein Grund zur Traurigkeit. Einmal ist eben gestern, und dann ist Schluss. Noch einen Whisky, Madame? Noch eine Zigarette? Bisschen Musik vielleicht? Was Lautes, Vergnügtes …
Sieh an, auf dem Plattenteller liegt »Tränen im Regen«, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie komme ich denn zu der Ehre? Hat er das seiner neuen Freundin vorgespielt? »Lorena Rocca, kennst du die noch? Kaum, dazu bist du zu jung, Baby. Sie war mal recht bekannt mit ihren Songs. Hör dir’s mal an.« So etwa.
Weg damit, ich brauche was Lautes, etwas ganz Lautes. Da – das ist gut –, wie das brüllt und röhrt, passt in die Zeit, passt zu ihnen, damit sollen sie nur weiterleben. Ich nicht. Ich muss mir das nicht mehr anhören.
Gestern gab es Musik. Gestern gab es Liebe.
Andy hat in Amerika geheiratet, es soll eine glückliche Ehe gewesen sein. Sie ist später mit einem Flugzeug abgestürzt. Vor zwei Jahren habe ich ihn auf einer Party getroffen. Er war sehr höflich und sehr kühl, immerhin machte er mir ein Kompliment über meine letzte Platte.
»Eine gute Nummer, Lorena. Ich hab’ sie mir oft angehört. Ein trauriges Lied.« Er lächelte, doch seine Augen waren auch traurig.
»Ja, ein sehr trauriges Lied. Und darum auch nur ein bescheidener Erfolg.«
Immerhin mein letzter, einigermaßen ansehnlicher Erfolg. »L’amour est mort«, sparsamer Text, sehr geschickt arrangiert. Der junge Bender, eine Entdeckung von Jack, hatte es für mich geschrieben.
L’amour est mort, da standen wir voreinander, Andy und ich, jeder ein Glas in der Hand.
Und plötzlich sahen wir uns richtig an. Keiner sprach ein Wort.
Ich dachte: Ich werde dich immer lieben. Du und ich, das war das Einzige für mich, was zählt. Sag ein Wort, sag, dass es bei dir auch so ist. Sag, dass du vergessen hast, was damals war. Sag, dass du mich auch liebst.
Er schwieg. Und was er dachte, das wusste ich nicht. Dann kam Sandor mit irgendjemand, den er mir vorstellen wollte. Später sah ich mich nach Andy um, er war nicht mehr da.
Ich dachte: Er kann mich finden, wenn er will. Er weiß, dass ich hier bin.
Aber er hat mich nicht gesucht.
Warum habe ich an jenem Abend nicht gesagt …
Schluss damit jetzt! Man sollte im Angesicht des Todes nicht kitschig sein.
Angesichts des Todes … Du machst mich schwach, Lorena. Trink noch was! Je mehr du trinkst, desto besser wirken die Tabletten. Es soll möglichst schnell gehen. Dir wird es auch leidtun, Andy, wenn ich tot bin. Genau wie es Jack leidtun wird. Ihr habt mich alle im Stich gelassen.
Und du, Heide, du bist auch schuld. Vielleicht, wenn du heute Abend nicht gekommen wärst … Aber dass du auch noch meine Niederlage mit angesehen hast … Hat es dich sehr gefreut? Hat es dir gutgetan?
Ich denke, dass es dir guttut – so etwas Dummes. So etwas sagst du zu mir. Wenn du wüsstest, wie egal du mir bist, du und dein Leben – das war nicht mal gestern, das war vorgestern.