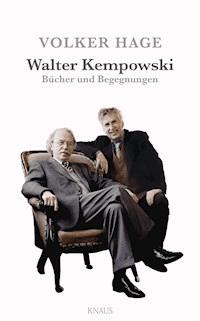8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
» Jules und Jim« im Schwabing der 70er Jahre
Anfang der 70er Jahre kommt Wolf Wegener aus Lübeck nach München, um dort zu studieren. Er träumt davon, später einmal Regisseur zu werden. Vorerst aber genießt er es, endlich der Enge des Elternhauses und seiner Heimatstadt sowie den eingefahrenen Bahnen der Beziehung zu seiner Freundin Anna zu entkommen und die Freiheit der Großstadt zu genießen.
In einer Wohngemeinschaft (»Repressionsfreie Bude in Studentenwohnung, Küchen-, Badbenutzung, Trambahn 6 und 8, 100 Mark«) im Münchner Norden findet er bei dem Pärchen Andreas und Larissa ein Zimmer. Der vernünftige, sanfte Andreas und die gefühlsbetonte Lissa, wie sich Larissa nennt, sind zu Wolfs Erstaunen »tatsächlich« verlobt – eine Konzession an Andreas‘ konservative, katholische Eltern, aber auch eine Konzession an Larissas unterschwelliges Sicherheitsbedürfnis. Und doch führen die beiden eine »offene« Beziehung, in der Lissa – mit Wissen und Akzeptanz von Andreas – auch eine kleine Affäre mit einem anderen Mann hat: »Man ist eben heute nicht mehr eifersüchtig«, wie Wolf verwirrt feststellt, als er davon erfährt. Wolf seinerseits flirtet gerne mit den Frauen, denen er im Citta 2000 oder in den Diskotheken der Stadt begegnet. Sobald eine Frau aber zu erkennen gibt, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlt, tritt er die Flucht an. Nur Lissa gegenüber ist er hilflos. Eines Abends lädt Lissa, als Andreas nicht zuhause ist, Wolf zu sich auf ihr Zimmer, um beim Schein von Teelichtern und während Joan Baez im Hintergrund läuft, noch ein Glas Wein mit ihm zu trinken und tiefschürfende, auf unheimliche Weise vertraute Gespräche zu führen. Und von diesem Abend an entwickelt sich »eine Geschichte« zwischen Lissa und Wolf: eine Jules-und-Jim-Geschichte, die ihnen – auch wenn in diesen Tagen der sexuellen Befreiung alles als erlaubt behauptet wird – doch köstlich verboten erscheint. Eine nur mühsam in Zaum gehaltene Anziehung zunächst, dann Liebe, dann rasendes Begehren, von dem sie umso weniger lassen können, je mehr sie versuchen vernünftig zu bleiben und ihm zu entfliehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Ähnliche
Volker Hage
Die freie Liebe
Roman
Luchterhand
Buch
Einst endeten Dreiecksgeschichten meist tragisch. Was aber ist in Zeiten, in denen die Liebe frei sein soll von allen Zwängen?
München,AnfangdersiebzigerJahre:DerangehendeSchauspielerAndreasunddiejungeLissaführen–wiesovieleinihrerGeneration–eine»offene«Beziehung.Sieglaubenandie»freieLiebe«–aneingemeinsamesGlückohneBesitzanspruchundEifersucht.DaziehteinesTagesderStudentWolfgangausLübeckindieWohngemeinschaftdesPaares.Wolfträumtdavon,spätereinmalRegisseurzuwerden.Vorerstabergenießteres,endlichderEngedesElternhausesentronnenzuseinunddieFreiheitderGroßstadtauskostenzukönnen:RockkonzerteimCircus-Krone-Bau,dieNouvelleVagueundderNeueDeutscheFilmindenKinosvonSchwabing,flüchtigeDiskotheken-Flirtsund dann und wann eine Nacht in den Armen eines Mädchens …
Doch dann entwickelt sich unerwartet »eine Geschichte« zwischen Wolf und Lissa: eine Jules-und-Jim-Geschichte, die beiden – auch wenn der vernünftige, sanfte Andreas alles zu tolerieren und zu verstehen versucht – doch auf erregend widersprüchliche Weise ebenso unschuldig wie verboten erscheint. Was als vermeintlich harmlose Anziehung beginnt, wird Liebe, dann rasendes Begehren, dann amour fou, von der sie umso weniger lassen können, je mehr sie sich schwören, vernünftig zu bleiben.
»Die freie Liebe« ist ein feinfühliges, genau gezeichnetes Zeitporträt der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts – ihrer Träume, ihres Lebensgefühls und ihrer Widersprüche. Und es ist der große Roman einer wilden, verrückten Liebe in den Zeiten der sexuellen Befreiung.
Autor
Volker Hage, geboren 1949 in Hamburg, kam nach Stationen bei der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« und der »ZEIT« zum »Spiegel«, wo er von 1992–2014 als Literaturredakteur arbeitete. Er hatte Gastprofessuren in Deutschland und den USA inne. Als Herausgeber und Autor zahlreicher Bücher hat er die deutsche sowie die internationale Literaturentwicklung publizistisch begleitet und kommentiert. Volker Hage zählt zu den bekanntesten Literaturkritikern im deutschsprachigen Raum. »Die freie Liebe« ist sein erster Roman.
© 2015 Luchterhand Literaturverlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlaggestaltung: Buxdesign, München
ISBN 978-3-641-16020-3
www.luchterhand-literaturverlag.de
https://www.facebook.com/luchterhandverlag
https://twitter.com/luchterhandlit
Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart.
Johann Wolfgang von Goethe
Brown Sugar, how come you taste so good
Brown Sugar, just like a young girl should.
The Rolling Stones
Drei Figuren auf engstem Raum, kaum eine Bühne zu nennen: eine Inszenierung im kleinen Saal, seit Wochen ausverkauft. Es hatte hervorragende Kritiken gegeben. Zwei Männer, eine Frau: Hannes, Antoinette und ein namenloser Spielleiter. Der Spielleiter, das war er: Andreas Kern. Daß er wieder einmal im Theater zu sehen war, hier in Berlin und hautnah, war allein schon eine Attraktion. Bis Hollywood hatte er es geschafft, einmal war er für einen Oscar nominiert worden. Und zwischendurch zog es ihn immer wieder ans Theater zurück.
Vierzig Jahre hatten wir uns nicht gesehen. Dabei gab es Berührungspunkte genug: dieselbe Branche, wenn auch nicht dieselbe Liga. Wir waren uns aus dem Weg gegangen. Oder es hatte sich nicht ergeben, was bisweilen dasselbe war.
Ich hatte mir seine Mobilnummer besorgt. Am nächsten Morgen rief ich ihn an. Ich mußte nicht viel sagen. Wir verabredeten uns für den Abend im »Alt Luxemburg«, in der Nähe meiner Wohnung. Ich konnte mit dem Rad hinfahren. Es war ein schöner Tag im Mai 2012, die Luft weich und warm.
Andreas saß schon da, als ich das Restaurant betrat. Es fehlte nicht viel, und wir hätten uns umarmt. Im letzten Moment beließen wir es bei einem Händedruck, wobei ich ihm die freie Hand auf die Schulter legte und er mir seine auf den Unterarm. Nicht zu distanziert, nicht zu vertraulich. Zwei Herren von Mitte Sechzig.
Er kam mir größer vor als früher. Seine schwarzen Haare zeigten auch aus der Nähe wenig graue Strähnen. Das Gesicht ein wenig schmaler, strenger. Ansonsten: eine unaufdringliche Sicherheit in Gesten und Umgangsformen.
»Gut schaust du aus«, sagte ich. »Nicht nur auf der Leinwand.«
»Danke, du auch. Ich habe uns schon ein Wasser bestellt. Trinkst du Wein? Weiß oder rot?«
»Am liebsten einen Rosé, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß: Weinkenner verabscheuen das.«
»Keine Sorge. Ich trinke ein Glas mit.«
Ich fühlte mich auf Anhieb wohl mit ihm. Wir bestellten uns einen offenen Sancerre Rosé. Und auch sonst das Gleiche, rasch entschieden: Hummersuppe und Lammrücken. Wie zwei alte Freunde, die sich gelegentlich zum Abendessen treffen.
Beim Lesen der Kritiken war der Wunsch entstanden, ihn endlich einmal wiederzusehen. Zunächst auf der Bühne, dann unter vier Augen. Es war an der Zeit, fand ich. Das Thema des Stückes tat ein übriges: Was, wenn die eigene Biographie nur ein Entwurf wäre und danach erst die Reinschrift käme? Würde man Weichen anders stellen, wenn das Leben – in Kenntnis des späteren Verlaufs – noch einmal zu leben wäre? Mit der Möglichkeit, es zu korrigieren? Die alte Tschechow-Frage, verhandelt am Beispiel eines Schweizer Ehepaars im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts.
»Du warst großartig als Spielleiter.« Ich ergriff das Wort, nachdem der Kellner gegangen war. »Ich weiß, daß du das Stück schon in München mochtest, in eurer Theater-AG.«
»Ich hatte nur eine Nebenrolle. Der ›Spielleiter‹ hieß damals übrigens noch ›Registrator‹. Frisch hat das Stück später völlig umgekrempelt und dabei das Bühnenpersonal massiv reduziert. Von über dreißig Figuren blieben ganze fünf übrig.«
»Und bei euch sind es jetzt nur noch drei. Funktioniert aber prächtig.«
»Drei ist immer eine spannende Konstellation«, sagte er.
»›Drei Schwestern‹«, sagte ich schnell. »Und natürlich ›Stella‹.«
Ich fragte nach seiner Familie. Er war seit über dreißig Jahren mit seiner zweiten Frau verheiratet, einer Ärztin, das wußte ich. Was man heute eben so Wissen nennt: Wikipedia. Sie arbeite viel in Krisengebieten, sagte er. Und er eben an verschiedenen Drehorten. Man sehe sich nicht sehr häufig. Voller Stolz erzählte er von seinen beiden Töchtern, die noch studierten.
Ich hätte nichts Vergleichbares zu bieten, sagte ich auf die Gegenfrage. Keine eigenen Kinder, keine Ehe. Seit einigen Jahren eine Lebensgefährtin, Christiane. »Und, haben deine Töchter schon Heiratspläne?« wollte ich wissen. »Neuerdings sind ja große Hochzeitsfeiern wieder modern.«
»Soweit ich weiß, nein. Aber die beiden erzählen wenig über ihre privaten Belange. Und umgekehrt wollen sie auch von unseren Erfahrungen nichts wissen. Vielleicht auch ganz gut so.«
Die Suppe kam, sie war köstlich und sehr heiß. Ich legte kurz den Löffel weg und sagte: »Am besten hat mir in dem Stück eine Äußerung des Spielleiters über Hannes gefallen – daß der sich mit Frauen auszukennen glaubt, weil er bei jeder denselben Mist baut.«
»Exakt heißt es: ›Sie halten sich für einen Frauenkenner, weil Sie jeder Frau gegenüber jedes Mal denselben Fehler machen‹.«
»Genau. Klingt gut, finde ich.«
»Mir gefällt besonders: ›Haben Sie nichts anderes im Kopf als die Ehe?‹ So hat jeder seinen Lieblingssatz.«
Ich fragte nach einer Weile: »Was ich übrigens bis heute nicht verstehe: Wie lernst du das alles auswendig? Wird das im Alter schwieriger?«
Er lachte. Das sei kein Problem, das gehöre eben zum Beruf, eine Frage der Übung. »Das ist schließlich der Reiz an der Sache: in fremden Zungen zu sprechen.«
»Ich dagegen werde immer vergeßlicher«, sagte ich. »Furchtbar. Was ich mir nicht sofort aufschreibe, ist wie weg. Und wenn ich es aufschreibe, verlege ich den Zettel. Fragt mich einer, in welchem Film ich zuletzt war, habe ich oft ein totales Blackout. Bei Filmtiteln oder Namen von Schauspielern kann es mir auch so gehen, und wenn mir einer einfällt, bin ich oft genug unsicher, ob es auch wirklich der richtige ist.«
Er nickte, sagte aber nichts dazu. Mir kam es vor, als sei er weitaus stärker in der Gegenwart verwurzelt als ich. Als wüßte er, wo er herkommt, wo es längs geht und welche Weiche er als nächstes stellen müßte. Falls noch eine käme. Wovon ich nichts erzählte, war eine Gedächtnisstörung, die mir vor ein paar Wochen widerfahren war. Ich wollte mir unterwegs das Stichwort »Berlinale« auf einem Zettel notieren, um mich später daran zu erinnern, im Festival-Büro einen Termin zu erfragen. Statt dessen schrieb ich: »Berliane«. Ich wußte gleich, daß etwas nicht stimmte. Ich sprach mir das Wort leise vor, kam aber nicht auf den richtigen Begriff. Es dauerte ein paar Minuten, dann war er mir plötzlich wieder wie selbstverständlich präsent und geläufig.
»Ich weiß, daß du viel fürs Fernsehen gearbeitet hast«, sagte er.
Ich erzählte in groben Zügen, wie ich nach dem Studium mit einigem Glück zu einem Redakteursposten beim NDR gekommen war und mich zwei Jahre später als Regisseur selbständig gemacht hatte. Es gab viel zu verdienen damals. Die Privaten gaben in ihren Anfängen noch große Formate in Auftrag. »Bis sie kapierten, daß mit billigen Produktionen viel mehr Quote zu machen ist. Danach gab es Aufträge nur noch von den Öffentlich-Rechtlichen.«
»Ich habe einmal einen ›Tatort‹ von dir gesehen«, sagte er. »War nicht übel. Bist du noch im Geschäft?«
»Nicht mehr so richtig. Ich bilde den Nachwuchs aus, zukünftige Regisseure und Schauspieler. Mit den Studenten die großen alten Filme anzusehen und zu analysieren, ist ein großes Vergnügen.«
Während die Suppenteller abgeräumt wurden, sagte er: »Ich habe mein Studium damals abgebrochen. Die Schauspielerei war für mich die Rettung. Und es läuft ja nicht schlecht.«
»Ich bitte dich! Drei Hollywood-Produktionen, einmal knapp am Oscar vorbei.«
»Die Nominierung war einfach ein Glücksfall.«
Das Gespräch machte mir Freude. Fast fürchtete ich, Lissa könnte jeden Moment zur Tür hereinkommen, sich zu uns setzen und alles verderben. Sie wäre jetzt 68, schwer vorstellbar.
Statt dessen kam der Lammrücken. Wir wünschten uns gegenseitig guten Appetit, und er sagte, während er in das perfekt rosa gebratene Fleisch schnitt: »Ich habe immer nur fürs Theater und das Kino gearbeitet. Weniger aus Prinzip als aus Zeitgründen. Es hat sich einfach nicht ergeben mit dem Fernsehen.«
Wir redeten lange an diesem Abend, auch noch, nachdem wir längst zu Ende gegessen hatten. Wir sprachen über Berlin, über unsere Lieblingsfilme, über das Theater und die Unsitte, Romane für die Bühne zu bearbeiten. Über die große Koalition, den Bürgerkrieg in Syrien, den gefährdeten Euro und den idiotischen Kapitän, der die »Costa Concordia« hatte Leck schlagen lassen. Nur über uns drei sprachen wir nicht.
»Noch einen Espresso?« fragte ich schließlich.
»Gut, aber dann muß ich leider los.«
Wir bestellten und baten zugleich um die Rechnung. Dann faßte ich mir ein Herz: »Hast du eigentlich noch Kontakt zu ihr?«
»Zu Lissa? Schon lange nicht mehr. Sie hat mir Jahre nach unserer Scheidung noch eine Karte geschickt, ohne Absender. Daß sie wieder verheiratet sei. Keine Ahnung, wo sie abgeblieben ist. Und du?«
»Als ich zuletzt von ihr hörte, wart ihr noch zusammen.«
»Ist doch eigentlich verrückt«, sagte er. »Da sind heute alle online, jeder ist mit jedem vernetzt. Und trotz Facebook, Twitter und Google kann immer noch jemand durch alle Maschen fallen. Ich nehme an, daß sie einfach den Namen ihres Mannes angenommen hat. Und schon ist sie unauffindbar. Vielleicht lebt sie auch gar nicht mehr, wer weiß.«
Wir zahlten. Dann sagte er: »Du hast doch damals alles aufgeschrieben. Existiert das noch?«
»Mein Tagebuch? Keine Ahnung, wo das hingekommen ist.«
Vor der Tür verabschiedeten wir uns mit festem Händedruck. Er hatte sich ein Taxi rufen lassen, ich stieg auf mein Fahrrad. »Ich melde mich bei dir, wenn ich wieder einmal nach Berlin komme«, versprach er. »Dann müssen wir uns ausgiebiger unterhalten.«
»Mach das unbedingt«, sagte ich und meinte es auch so.
Keine zwei Monate später, Mitte Juli, starb meine Mutter. Ich machte mich auf den Weg nach Lübeck, um die Beerdigung zu organisieren und die Wohnung aufzulösen.
Es gibt diese seltsamen Erfahrungen. Koinzidenzen. Wie es der Zufall will, sagt man dann. Oder das Schicksal. Aber wahrscheinlich will es der Zufall gar nicht, und dem Schicksal ist es völlig egal. Vielleicht wollen wir es. Oder etwas in uns will es. Jedenfalls: Im Kleiderschrank, tief vergraben, fanden sich in einer großen Schachtel nicht nur Schulhefte von mir, einige Schülerzeitungen mit meinen ersten Filmkritiken, Seminarscheine und das Studienbuch, sondern auch die Aufzeichnungen aus der Münchner Zeit, dazu eine Film- und eine Tonbandspule. Überrascht war ich eigentlich nicht. Ich wußte sofort, was drin war, als ich die Schachtel sah.
Und ich wußte auch wieder, was ich damals im Nachtzug nach München gedacht hatte: Mit 21 muß das Leben beginnen. Wie kann es anders sein?
ERSTES BUCH
When I was twenty-one, it was a very good year,
it was a very good year for city girls
who lived up the stair, with all that perfumed hair
that came undone, when I was twenty-one!
Frank Sinatra
MÜNCHEN, 4. MAI 1971
Am Hauptbahnhof kein einziges Taxi. Zwanzig Menschen warten und drängeln. Kommt ein Wagen, rennen sie einander rücksichtslos um. Fahrgäste, die aussteigen wollen, werden kaum rausgelassen. Eine Frau reißt einem alten Mann, der schon fast im Auto sitzt, die Tür aus der Hand und schwingt sich an ihm vorbei aufs Polster. Auf die Idee, eine Schlange zu bilden, kommt niemand. Filmen!
Ich trage meine beiden Koffer auf die andere Seite des Bahnhofs. Kein Taxistand. Allerdings kommen die Taxis dort vorbei, bevor sie das Gebäude umrunden. Man kann sie ohne Mühe abfangen. Anfängerglück. Die Stadt beginnt mir zu gefallen. Schön die Ludwigstraße, Leopoldstraße, kilometerlang schnurgerade. Die Universität. Schwabing. Bis ich etwas gefunden habe, werde ich in einer Pension in der Herzogstraße wohnen, die einer alten Freundin meiner Mutter gehört.
Später mit der Tram – so nennt man hier die Straßenbahn – zur Uni. Sie fährt mitten durch das Siegestor hindurch (lächerlich gegen unser Holstentor). Die merkwürdige Frage: »Karte oder Fahrschein?« Ich sage: »Zur Münchner Freiheit, bitte.« Ich muß 80 Pfennig zahlen. Erst später erfahre ich: »Karte« hätte zwei Mark gekostet und für drei Fahrten gegolten. Nächstes Mal. Man sagt hier tatsächlich »Grüß Gott«. Das Semester läuft längst. Mein Vater will, wenn ich eine Bleibe gefunden habe, noch ein paar Sachen vorbeibringen. Er muß deswegen extra bei meiner Mutter vorbeischauen, was er sehr ungern tut.
Abends ins Kino: »Blondie’s Number One« (Regie: Robert van Ackeren), ein Film, der in Berlin spielt – als ob einer einfach seine Kamera aufgestellt und draufgehalten hat in einer Wohngemeinschaft. Zu zweit in der Badewanne, zu dritt auf dem großen Bett. Beim Sex der kreisende Hintern des Mannes. Man fragt sich da schon: real oder gespielt? Ansonsten: total öde.