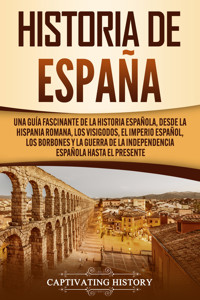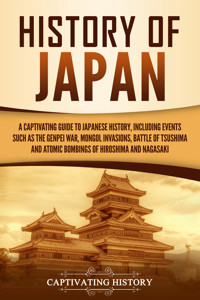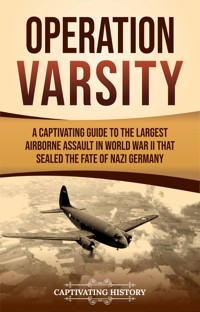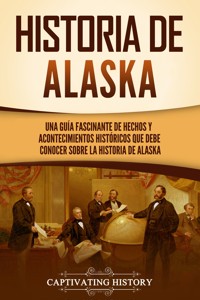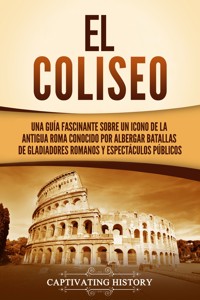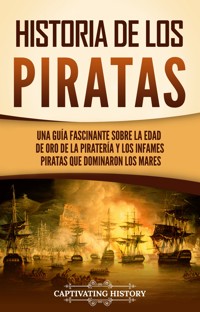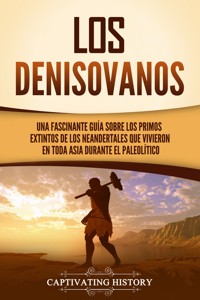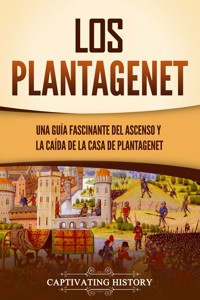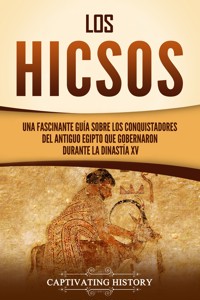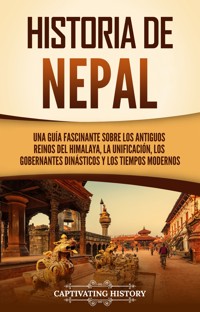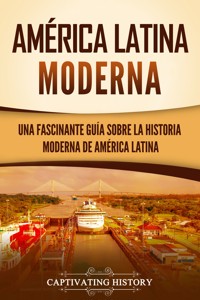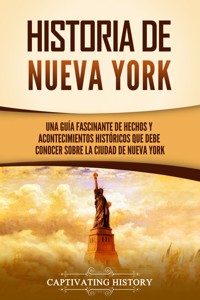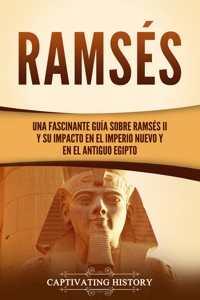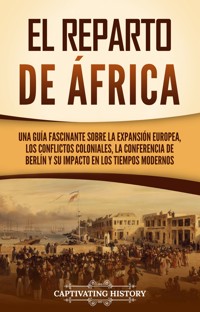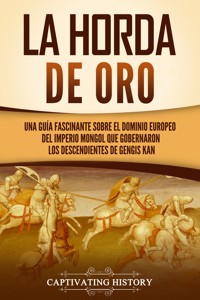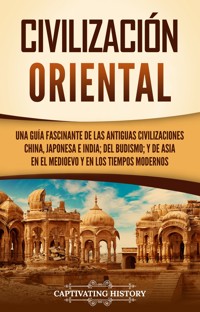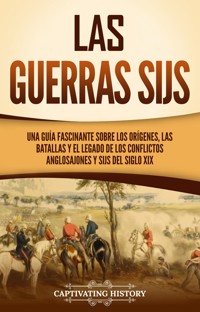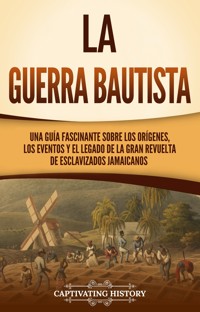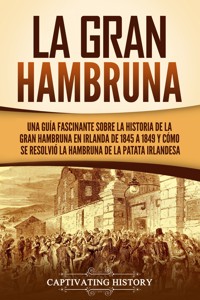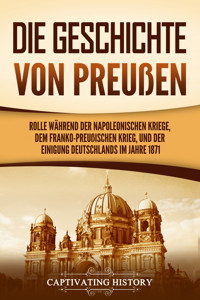
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Captivating History
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Haben Sie sich schon immer gefragt, wie es einem kleinen und unbedeutenden germanischen Herzogtum gelingen konnte, so sehr zu wachsen und zu expandieren, dass aus ihm schließlich ein viel größeres, deutsches Reich entstand? Wenn Sie eine Antwort auf diese Frage suchen, werfen einen Blick auf unser Handbuch zur Geschichte Preußens! Dieses Buch nimmt Sie mit auf einen spannenden Ritt durch die Geschichte, beginnend mit den bescheidenen Anfängen Preußens und seiner Hohenzollern-Dynastie. Sie werden darüber erstaunt sein, wie die Preußen den historischen Stacheldraht des späten Mittelalters durchdringen konnten und unfreiwillig in Kriege mit größeren Mächten und sogar in die religiöse Reformation verwickelt wurden. Schließlich erfahren Sie in diesem Handbuch die spannende Geschichte darüber, wie Preußen durch eine Reihe von Kriegen und durch kühne Politik und heimliche Machenschaften genug Kraft sammelte, um die Einigung der deutschen Länder zu einem einzigen Nationalstaat zu erreichen. Durch all dies werden Sie erfahren, wie die Weichen für die deutsche Geschichte gestellt wurden, die das 20. Jahrhundert derartig stark beeinflussen sollten. In diesem fesselnden Handbuch über die Preußische Geschichte lernen Sie die Antworten auf Fragen wie: - Wie machte sich der Preußische Staat auf der historischen Weltbühne bemerkbar? - Wie wurde sein Wachstum gesteigert und wie passte er zum Heiligen Römischen Reich? - Welchen Einfluss hatte die Dynastie der Hohenzollern auf die Preußische Geschichte? - Wie konnte Preußen den dreißigjährigen Krieg überleben? - Was bewahrte Preußen vor dem Zusammenbruch unter Napoleon? - Welche Veränderungen machten das Preußische Militär schließlich zu einem der mächtigsten der Welt? - Wie nutzte Preußen Zeiten des militärischen Konfliktes zur Einigung Deutschlands? - Warum war König Friedrich II Preußens wichtigster Monarch? - Wie wichtig war die Rolle, die Otto von Bismarck spielte, während der letzten Jahre der Preußischen Entwicklung? - Wo lagen die Wurzeln des Nationalismus in Preußen? Scrollen Sie hoch und klicken Sie auf "In den Einkaufswagen", um mehr über die Geschichte Preußens zu erfahren!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Geschichte von Preußen
Ein fesselndes Handbuch zum Königreich Preußen und dessen Rolle während der Napoleonischen Kriege, dem Franko-Preußischen Krieg, und der Einigung Deutschlands im Jahre 1871
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Die Geschichte von Preußen: Ein fesselndes Handbuch zum Königreich Preußen und dessen Rolle während der Napoleonischen Kriege, dem Franko-Preußischen Krieg, und der Einigung Deutschlands im Jahre 1871
Einleitung
Kapitel 1 – Bescheidene Wurzeln
Kapitel 2 - Der Aufstieg aus der Asche
Kapitel 3 – Das Erklimmen der Leiter
Kapitel 4 – Gesellschaftliche Veränderungen
Kapitel 5 - Stolz und Ruhm
Kapitel 6 – Von Ruhm und Erniedrigung
Kapitel 7 – Erholung durch Reformen
Kapitel 8 - Expandierende Macht über die germanische Welt
Kapitel 9 - Finale Entwicklungen auf dem Weg zum germanischen Reich
Epilog
Fazit
Bibliographie
© Copyright 2022
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert werden. Rezensenten dürfen in Besprechungen kurze Textpassagen zitieren.
Haftungsausschluss: Kein Teil dieser Publikation darf ohne die schriftliche Erlaubnis des Verlags reproduziert oder in irgendeiner Form übertragen werden, sei es auf mechanischem oder elektronischem Wege, einschließlich Fotokopie oder Tonaufnahme oder in einem Informationsspeicher oder Datenspeicher oder durch E-Mail.
Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die in diesem Werk enthaltenen Informationen zu verifizieren, übernehmen weder der Autor noch der Verlag Verantwortung für etwaige Fehler, Auslassungen oder gegenteilige Auslegungen des Themas.
Dieses Buch dient der Unterhaltung. Die geäußerte Meinung ist ausschließlich die des Autors und sollte nicht als Ausdruck von fachlicher Anweisung oder Anordnung verstanden werden. Der Leser / die Leserin ist selbst für seine / ihre Handlungen verantwortlich.
Die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze und Regelungen, einschließlich internationaler, Bundes-, Staats- und lokaler Rechtsprechung, die Geschäftspraktiken, Werbung und alle übrigen Aspekte des Geschäftsbetriebs in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich regeln oder jeglicher anderer Jurisdiktion obliegt ausschließlich dem Käufer oder Leser.
Weder der Autor noch der Verlag übernimmt Verantwortung oder Haftung oder sonst etwas im Namen des Käufers oder Lesers dieser Materialien. Jegliche Kränkung einer Einzelperson oder Organisation ist unbeabsichtigt.
Einleitung
Preußens Geschichte, von den Anfängen bis zum glorreichen Sieg bei der Vereinigung Deutschlands, ist die eines Außenseiters, der zu wahrer Größe aufsteigt. Über Jahrhunderte hinweg führte die Hohenzollern-Dynastie ihr Volk und ihr Land durch einen Hindernisparcour, der zum Scheitern verurteilt schien. Doch irgendwie schafften es die Hohenzollern, die Herausforderungen zu überwinden und sich gegen viele Konkurrenten zu behaupten. Die Geschichte des Königreichs mag Ihnen daher fast wie ein Märchen oder eine moralische Fabel vorkommen. Zum Teil ist sie sogar genau das, eine sagenumwobene Geschichte, denn Preußens Geschichte folgt der klassischen Erzählung vom kleinen Mann, der es schafft, sich in der Welt durchzusetzen. Nur dass es statt um das Leben eines kleinen Mannes um ein kleines Land in einem Mischmasch mittelalterlicher deutscher Staaten geht, das im späten 19. Jahrhundert zu einer europäischen Großmacht heranwächst.
Gleichzeitig ist die preußische Geschichte aber auch von Militarismus, Expansionismus und Nationalismus geprägt. In einer solchen Darstellung werden die Preußen als Kriegstreiber oder als ein Volk von bösartigen Soldaten ohne jegliche Skrupel dargestellt. Es wird als ein Land von „Eisen und Blut“ angesehen. Diese Darstellung hat das gleiche Gewicht und den gleichen Wahrheitsgehalt wie das frühere, eher heroische Bild. Es handelt sich um zwei verschiedene Seiten derselben Medaille, der Gesamteindruck hängt ganz von unserer persönlichen Perspektive ab.
In diesem Leitfaden wird versucht, jede Bewertung Preußens zu vermeiden, unabhängig von seinen positiven oder negativen Aspekten. Es wird lediglich die Geschichte des Landes nacherzählt, denn dieses hat die europäische - und sogar die Weltgeschichte – schließlich maßgeblich geprägt. Daher ist sie unserer Aufmerksamkeit würdig. Sie bietet außerdem auch einen Einblick in die deutsche Geschichte und Kultur, denn viele Dinge, die als „typisch deutsch“ gelten, haben ihre Wurzeln im alten Preußen. Daher muss das moderne Deutschland durch das Prisma seiner preußischen Vorfahren betrachtet werden, da diese eine Schlüsselrolle bei der Entstehung und Entwicklung der deutschen Nation und des deutschen Staates gespielt haben.
Letztendlich ist die preußische Geschichte eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, eine mäandernde Erzählung, die sich über einen langen Zeitraum hinwegzieht und die Komplexität der menschlichen Vergangenheit widerspiegelt. Es gibt Kriege mit Siegen und Verlusten. Es gibt wirtschaftliche Entwicklungen und die Industrialisierung, Bildungs- und Religionsreformen, Diplomatie, Handel und vieles mehr. Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, Preußen, Deutschland und die Geschichte der Menschheit im Allgemeinen besser zu verstehen.
Kapitel 1 – Bescheidene Wurzeln
Die meisten Bücher über die preußische Geschichte beginnen im 17. Jahrhundert und ignorieren alle Ereignisse, die in den vorherigen Jahrhunderten geschahen. In diesem Buch gehen wie auf die Wurzeln des Preußischen Reiches genauer ein, da diese die Entwicklung des späteren Königreichs von Preußen entscheidend geprägt haben. In diesem Sinne wird dieser Leitfaden so weit wie möglich zurückgehen, um einen Bezugsrahmen zu schaffen, der zum besseren Verständnis der preußischen Geschichte beitragen kann.
Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass der preußische Staat aus drei Komponenten besteht. Die ersten beiden sind die Territorien Brandenburg und Preußen, während die dritte und wichtigste Komponente die Hohenzollern-Dynastie ist. Sie tauchte im 11. Jahrhundert aus dem Dunkel des Mittelalters auf. Die historischen Quellen aus dieser Zeit erwähnen Burkhard I., den Grafen von Zollern, als Herrscher über ein Gut auf der Schwäbischen Alb. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Dynastie ihren Namen von diesem frühen Titel erhielt, da ihre Mitglieder damals nur als die Zollern bekannt waren. Es ist aber auch möglich, dass der Name von der Burg abgeleitet wurde, die das Zentrum der fraglichen Grafschaft darstellte, aber letztendlich lässt sich der Ursprung des Namens nicht eindeutig festlegen. Es ist außerdem sehr wahrscheinlich, dass Burkhards Vorfahren ebenfalls dem Adel angehörten, auch wenn keine glaubwürdigen Verbindungen oder Quellen dies bestätigen können. So bleibt er als der bekannte Begründer der Dynastie bestehen.
Ein späteres Gemälde, welches den ersten Herrscher der Hohenzollern darstellt: Burkhard I (oben) und Friedrich I (unten). Quellen: https://commons.wikimedia.org
Burkhards Nachfolger vergrößerten langsam ihre Besitztümer, zumeist als treue Untertanen des Heiligen Römischen Kaisers, doch blieben sie relativ unbedeutend und ihr Einfluss eher bescheiden. Den ersten Schritt in Richtung eines ambitionierteren Schicksals machte Friedrich III., als er die Erbin der Burggrafschaft Nürnberg heiratete. Im Jahr 1191 erbte er das Territorium durch seine Frau und wurde als Friedrich I., Burggraf von Nürnberg, bekannt, da dieses Territorium aufgrund seines besser entwickelten Handels als angesehener und reicher galt.
Ungefähr zu dieser Zeit scheint er seine Dynastie in Hohenzollern umbenannt zu haben, was Stärke und größere Ambitionen zum Machtgewinn suggeriert, wahrscheinlich um den Bedeutungszuwachs der Familie zu vermitteln. Nach seinem Tod, wahrscheinlich um das Jahr 1204 herum, teilten seine Söhne Konrad und Friedrich das Erbe in zwei Hälften auf. Da Conrad älter war, erhielt er Zollern, während Friedrich Nürnberg bekam. Um das Jahr 1218 herum tauschten die beiden Brüder ihr Erbe jedoch untereinander, aus uns heute nicht bekannten Gründen. Damit wurde das Haus Hohenzollern in zwei Zweige aufgeteilt. Der jüngere Zweig Friedrichs wurde als der schwäbische Zweig bekannt, während die Linie des älteren Bruders Konrad als fränkisch bekannt wurde, da Nürnberg in der Region Franken lag, dem heutigen Nordwestbayern.
Während der nächsten zweihundert Jahre blieben Konrad und seine Nachfolger recht treue und verlässliche Verbündete des Heiligen Römischen Reiches. In dieser Zeit gelang es ihnen durch geschickte Politik, ihre Besitztümer rund um Nürnberg herum leicht zu vergrößern und auszuweiten, während die Stadt selbst zur inoffiziellen Hauptstadt des Reiches wurde, in der von Zeit zu Zeit der Reichstag tagte. Doch erst zu Beginn des 15. Jahrhunderts gelang den Hohenzollern der nächste Schritt auf dem Weg zu größerer Bedeutung. Um 1410 erlangte Friedrich VI. die Kontrolle über die Markgrafschaft Brandenburg, die im Nordosten Deutschlands um die Stadt Berlin herum lag. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Unterwerfung der örtlichen Adligen festigte Friedrich seine Herrschaft auf dem Gebiet. Um 1415 wurde er dann offiziell als rechtmäßiger Herrscher anerkannt, als er 400.000 Goldstücke an König Sigismund von Ungarn zahlte, der den rechtmäßigen Titel bis zu diesem Zeitpunkt besaß. So wurde er als Friedrich I., Markgraf von Brandenburg, bekannt, ein Titel, der hierarchisch zwischen dem eines Grafen und dem eines Herzogs angesiedelt war.
Die Ländereien selbst waren relativ unscheinbar und wertlos. Obwohl sie in der mitteleuropäischen Tiefebene lagen, war der Boden für die Landwirtschaft nicht sehr geeignet, da er oft sandig und von insgesamt schlechter Qualität war. Außerdem gab es hier viele Sümpfe und Moore. Brandenburg verfügte auch über keine nennenswerten Mineral- oder Metallvorkommen. Es war durch die Flüsse Oder und Elbe mit der Ostseeküste verbunden, aber diese Flüsse waren eher träge und hatten keine miteinander verbundenen Wasserstraßen. Da das Gebiet zudem wenig Handelsmöglichkeiten bot, war die Verbindung zum Meer von geringer Bedeutung. Außerdem verfügte Brandenburg über keine natürlichen Grenzen, was bedeutete, dass es für Invasionen offen und damit verwundbar war.
Insgesamt war die Region in Bezug auf ihren materiellen Wert völlig unbedeutend. Ihr wahres Potenzial lag in der politischen Bedeutung, denn der Markgraf von Brandenburg war einer der sieben Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches. Dessen offizielle Aufgabe war es, bei Bedarf den nächsten Kaiser zu ernennen, und dementsprechend handelte es sich um einen ziemlich angesehenen Titel. Daher war Friedrich auch als Kurfürst von Brandenburg bekannt (ein Kurfürst hatte eine Rolle, die sich etwas von der des Markgrafen unterschied).
Ein Portrait von Friedrich I aus dem 15. Jahrhundert, dem Fürsten von Brandenburg. Quelle: https://commons.wikimedia.org
Um sowohl die Bedeutung einer solchen Unterscheidung als auch den Rest der Geschichte der Hohenzollern und Preußen zu verstehen, muss man wissen, wie das Heilige Römische Reich funktionierte. Anders als die meisten anderen Reiche war es nicht sehr zentralisiert oder einheitlich aufgebaut. Es glich eher einer losen Föderation von etwa dreihundert kleineren souveränen territorialen Einheiten, deren Rechtsbeziehungen und Status innerhalb des Reiches unterschiedlich waren. Außerdem war der Kaisertitel wählbar, was seine Erlangung zu einem regelrechten politischen Ränkespiel machte. Wichtig ist auch, dass es trotz der Existenz eines Reichstages keine kaiserliche Zentralregierung, kein Steuerrecht und kein stehendes kaiserliches Heer gab. Die tatsächliche Macht des Kaisers war also eher begrenzt. Oft hing die Stärke des Herrschers allein von seinem persönlichen Besitz, seinen Fähigkeiten, Verbindungen und seiner Politik ab, die es ihm ermöglichten, die Unterstützung seiner zahlreichen Untertanen zu gewinnen (oder zu erzwingen). Dennoch war der Titel theoretisch immer noch recht prestigeträchtig, da das Heilige Römische Reich als Nachfolger des Römischen Reiches angesehen wurde. In dieser politischen Landschaft bedeutete der Titel eines Kurfürsten viel mehr Einfluss und galt als ein nützliches diplomatisches Instrument, da es den Herrschern die Option gab, ihre Stimmen gegen andere Zugeständnisse wie zum Beispiel Gebietsgewinne einzutauschen.
Den Hohenzollern gelang es, ihren neugewonnenen Einfluss zu nutzen, um sich für den Rest des 15. und den Beginn des 16. Jahrhunderts eine verbesserte Machtposition zu sichern. Sie setzten ihre Unterstützung und ihre Stimme weise ein, aber trotzdem blieb die Dynastie wirtschaftlich und militärisch relativ schwach. Etwa zur gleichen Zeit stieg die berühmte Dynastie der Habsburger, deren Machtzentrum in Österreich lag, zu den Herrschern über das Heilige Römische Reich auf. Nach Jahrzehnten politischer Instabilität wurde 1452 der Habsburger Friedrich III. zum Kaiser gekrönt. Zu diesem Zeitpunkt verfügte seine Dynastie über beträchtliche Territorien in ganz Europa, die es ihm und seinen Nachfolgern ermöglichten, relativ kleine Reichsstaaten und -einheiten zu beherrschen. Von nun an wurde der Kaisertitel innerhalb der habsburgischen Linie faktisch vererbt, blieb aber offiziell und theoretisch wählbar. Die Habsburger begannen auch damit, das Reich zu reformieren, obwohl es ihnen nie gelang, ihre Herrschaft über diese Länder zu zentralisieren, wie sie es in ihren anderen Besitzungen wie Ungarn oder Böhmen getan hatten. Außerdem wurde das Reich ab 1512 offiziell als Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation bezeichnet, obwohl es Untertanen verschiedener anderer Ethnien hatte. Manche sehen darin die Geburtsstunde einer übergreifenden deutschen Nationalidentität, auch wenn sie noch weit von dem entfernt war, wie wir sie heute wahrnehmen.
Für die Hohenzollern war diese Zeit auch eine Zeit der dynastischen Konsolidierung. Bis zum späten 15. Jahrhundert folgte die Familie der im Mittelalter üblichen Erbfolgetradition und teilte den Besitz der Familie unter den Brüdern auf. Dieses Verfahren ermöglichte ihnen eine angemessene finanzielle Absicherung für alle Kinder des Herrschers, was wiederum auf dem geteilten familiären Bedürfnis beruhte, für die Nachkommenschaft zu sorgen. Aus der Perspektive der Staatsbildung war diese Strategie jedoch eher kontraproduktiv. Dies veranlasste Albert (Albrecht) III. dazu, Achilles, der die Markgrafschaft von seinem älteren Bruder übernahm, im Jahr 1473 die Dispositio Achillea zu erlassen, ein Gesetz, das festlegte, dass Brandenburg in seiner Gesamtheit als ganzes Stück Land erhalten bleiben musste und nur an den ältesten Sohn vererbt werden durfte. Der Rest der Nürnberger Ländereien blieb jedoch teilbar.
Dies war das erste hohenzollerische Erbrecht, das jedoch zunächst nur die Zukunft des erstgeborenen Erben Alberts absichern sollte. Der neue Plan einer unteilbaren brandenburgischen Erbmasse wurde 1541 mit dem Regensburger Hausvertrag noch einmal bestätigt, der die Neuverteilung der Nürnberger Territorien unter den späteren Hohenzollern betraf. Auf dem Weg dorthin gab es immer wieder Gegenversuche und sogar kurzfristige Teilungen Brandenburgs, doch gegen Ende des 16. Jahrhunderts setzte sich in der Dynastie der Gedanke der Einheitlichkeit durch und signalisierte den Vorzug von Sippenhäuptlingen zu Staatsoberhäuptern für die Familie.
Trotzdem erwies sich die Jahrhundertwende für die Hohenzollern wie auch für das gesamte Heilige Römische Reich als sehr turbulent. Im Jahr 1517 lösten Martin Luthers nächtlich angebrachte fünf Thesen den Beginn der religiösen Reformation aus, die die Spaltung zwischen Katholiken und Protestanten formalisierte. Dies führte in ganz Europa zu Erschütterungen und provozierte zahlreiche religiöse Konflikte, erwies sich jedoch als besonders schädlich für den Frieden des Reiches. Viele der nordgermanischen Staaten wandten sich dem Protestantismus zu, vor allem aber dem Luthertum im Besonderen. Für den katholischen Süden war dies Ketzerei, insbesondere für die tiefgläubigen Habsburger, die sich aufgrund der langanhaltenden Auseinandersetzungen mit den osmanischen Türken auf dem Balkan oft als Bollwerk des Christentums sahen. So sah sich Kaiser Karl V. aus dem Hause Habsburg dazu veranlasst, gegen den lutherischen Norden zu kämpfen und dieses Vorhaben gleichzeitig auch zur Festigung seiner kaiserlichen Herrschaft zu nutzen. Damit befanden sich die Hohenzollern inmitten des entstehenden politischen Chaos.
Die Schwäbische Erblinie blieb katholisch, genauso wie die meisten anderen südgermanischen Staaten auch. Brandenburg wurde jedoch stark von der neuen Religion beeinflusst. Als das Luthertum aufkam, verhielt sich Kurfürst Joachim I. wie ein überzeugter Katholik und versuchte sofort, es zu unterdrücken. Dies lag zum Teil daran, dass er persönlich erheblich vom Ablasshandel profitierte (Martin Luthers größtes Problem mit der korrupten katholischen Kirche), der von seinem eigenen Bruder Albert, dem Erzbischof von Magdeburg, betrieben wurde. Tatsächlich war Albert einer der kirchlichen Führer, die Luthers Rebellion auslösten, und einer derjenigen, die in den fünfundneunzig Thesen direkt angeklagt wurden. Seine Frau, Elisabeth von Dänemark, trat jedoch öffentlich zum Luthertum über und löste damit eine Spaltung zwischen den beiden aus.
Gleichzeitig wandte sich das brandenburgische Bürgertum dem neuen christlichen Zweig zu, was Joachim dazu veranlasste, seinen Sohn und Erben Joachim II. zu zwingen, einen Vertrag zu unterzeichnen, in dem er versprach, katholisch zu bleiben. Joachim II. hielt sich an die Vereinbarung, aber nur eine Zeit lang. Bereits 1539, vier Jahre nach dem Tod seines Vaters und seiner eigenen Thronbesteigung, trat er zum Luthertum über. Dennoch weigerte er sich, seine Untertanen zu zwingen, ihm zu folgen, und vermied auch jede öffentliche Unterstützung für seine neue Religion. Joachim II. war zu Recht besorgt, dass jede Übertreibung in solchen Angelegenheiten ihn und Brandenburg damals in Gefahr bringen konnte, da das Reich immer noch mehrheitlich katholisch war.
Politisch blieb er also ein loyaler Untertan des habsburgischen Kaisers. Joachim II. schickte sogar ein kleines Truppenkontingent zur Unterstützung des Kaisers im Schmalkaldischen Krieg (1546-1547), einem religiösen Konflikt mit den deutschen lutherischen Fürsten. In den meisten Fällen versuchte Joachim II., sich von den radikalen und kriegerischen lutherischen Führern abzugrenzen, weigerte sich aber gleichzeitig, seine Überzeugungen aufzugeben. Stattdessen versuchte er, den Frieden für sein Reich zu sichern, indem er sich als Vermittler zwischen den beiden Seiten betätigte. In den 1550er Jahren entspannte sich die Lage ein wenig, als der römische Kaiser Karl V. sich bereit erklärte, mit den Protestanten zu verhandeln. Dazu war er teilweise gezwungen, da Frankreich begann, die aufständischen Fürsten zu unterstützen, um seine Herrschaft zu destabilisieren. Dies führte zum Augsburger Religionsfrieden von 1555, der sowohl das Luthertum als auch den Katholizismus nach dem Prinzip „Wessen Reich, dessen Religion“ zuließ. Dies bedeutete, dass die Herrscher die Konfessionen ihrer eigenen Ländereien wählen durften. Es ist erwähnenswert, dass andere Zweige des Protestantismus durch diese Vereinbarung nicht zugelassen wurden. Ungeachtet dessen konnte Joachim II. 1563, als sich die Lage beruhigt hatte, das Luthertum öffentlich befürworten.
So vollzog sich in der Mark Brandenburg im 16. Jahrhundert langsam ein religiöser Wandel. Dieser Prozess beschleunigte sich in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts, als die Nachfolger Joachims damit begannen, das Luthertum stärker zu fördern. Doch selbst dann verzichteten sie darauf, sich mit anderen katholischen Fürsten anzulegen, und blieben den habsburgischen Kaisern gegenüber loyal. Die Hohenzollern wussten, dass der Augsburger Vertrag ihnen nur eine relative Sicherheit bot. Obwohl sie sich in einer etwas schwierigen Lage befanden, da sie ihr Territorium nicht durch Kriege oder Transaktionen erweitern konnten, um mehr Macht zu erlangen, waren die Markgrafen von Brandenburg dennoch ehrgeizig. In Anlehnung an die bewährte Methode ihrer Vorfahren setzten die Hohenzollern-Fürsten dabei auf Heirat. Zunächst schienen diese Versuche vergeblich zu sein. Im 16. Jahrhundert wurden keine größeren Erfolge erzielt, da Ehen mit den Herrscherhäusern von Dänemark und Pommern den Hohenzollern nicht die dringend benötigten Ostseehäfen bescherten. Dennoch gelang es Joachim II., die Grundlage für eine entscheidende Expansion zu schaffen, die das Schicksal der Dynastie für immer verändern sollte.
Ein Portrait von Joachim II. Quelle: https://commons.wikimedia.org
Im Jahr 1535 heiratete Joachim II. die Prinzessin Hedwig von Polen, das zu dieser Zeit ein ziemlich mächtiger Staat war. Noch wichtiger war, dass König Sigismund I. von Polen Lehnsherr eines baltischen Herzogtums war, das Joachims Interesse weckte. Das Herzogtum Preußen war der dritte Bestandteil des preußischen Staates, und dieses preußische Territorium sollte später dem gesamten Land seinen Namen geben. Das Herzogtum lag an der Ostseeküste, rund um die heutige Stadt Kaliningrad herum. Es ist erwähnenswert, dass das Herzogliche Preußen nur die östliche Hälfte des historischen preußischen Territoriums ausmachte, da der westliche Teil um das heutige Danzig vollständig in die polnische Krone integriert wurde und als Königliches Preußen bekannt war. Dennoch war das Herzogtum Preußen für Brandenburg ein mehr als würdiger Preis. Es erhielt nicht nur wichtige Ostseehäfen, sondern auch fruchtbares Land, das sich für den Weizenanbau eignete. Neben diesen wertvollen Eigenschaften fiel das Herzogtum Joachim auch deshalb ins Auge, weil es von seinem Cousin aus dem Hohenzollernzweig, Herzog Albert von Preußen, regiert wurde.
Albert, der Enkel von Albert III. Achilles, kam eher durch Zufall zu diesem Titel. Als Angehöriger eines Nebenzweiges und dritter Sohn war er für eine klerikale Laufbahn prädestiniert. Er war ein gläubiger Katholik und schien ein zuverlässiger und gelehrter Mann zu sein. Als der Deutsche Orden einen neuen Großmeister brauchte, wurde er 1511 in dieses Amt gewählt. Zu dieser Zeit hatte der Orden Preußen inne, da er dort seit dem frühen 13. Jahrhundert mit dem Ziel präsent war, die Bevölkerung zu christianisieren. Nachdem das Ziel erreicht war, blieben die Ritter dort und wurden zu einem Rivalen für die umliegenden Staaten, vor allem für Polen und Litauen. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts rettete sich der Deutsche Orden vor dem Untergang, indem er die Oberhoheit der polnischen Könige akzeptierte und ein polnisches Lehen wurde. Dennoch blieben die Beziehungen angespannt. Albert wurde unter anderem deshalb ausgewählt, weil seine Mutter aus der polnischen Herrscherfamilie stammte und er somit ein Neffe des Königs war. Trotz seiner Versuche, die Situation zu retten, entglitten ihm die Angelegenheiten in Preußen. In dieser Zeit traf er sich mit Martin Luther, der ihn dazu überredete, das Luthertum anzunehmen und Preußen zu seinem persönlichen Besitz zu machen.
Eine Karte von Preußen unter den Teutonischen Königen (in Orange). Quelle: https://commons.wikimedia.org
Dank seiner Beziehungen zum polnischen König gelang es Albert, dies zu erreichen. So wurde 1525 das Herzogtum Preußen formell gegründet und blieb ein polnisches Lehen. Gleichzeitig gehörten Preußen und Albert zu den ersten öffentlichen Befürwortern des Luthertums. Die Jahre vergingen jedoch, und als er sich dem Ende seines Lebens näherte, hinterließ er nur einen einzigen männlichen Erben, den zu diesem Zeitpunkt noch minderjährigen Albert Friedrich. Dies veranlasste Joachim II. zum schnellen Handeln, und 1564 nutzte er die Beziehungen seiner Frau, um ein Dekret zu erwirken, das seine Söhne als zweite Erben des Herzogtums vorschlug, sollte Albert Friedrich ohne Erben sterben. Dieser Fall trat vier Jahre später nach dem Tod des alten Herzogs ein.
Es war ein langfristiger Plan, um an die Macht zu kommen, der sich schließlich auszahlte. Obwohl Albert Friedrich ein langes Leben führte und erst 1618 starb, hinterließ er keine Erben, da er geistig krank war. Doch schon vor seinem Tod handelten die brandenburgischen Hohenzollern entschlossen, um ihre Nachfolge zu sichern. Joachims Enkel, Joachim Friedrich, überredete den polnischen König, ihm 1603 die Regentschaft über den geistig labilen Albert zu übertragen. Außerdem arrangierte er 1594 die Heirat seines Sohnes Johann Sigismund mit Alberts Tochter Anna von Preußen, obwohl seine Mutter ihn eindringlich darauf aufmerksam gemacht hatte, dass die Herzogin nicht gerade ein Augenschmaus sei.
Als wäre das nicht schlimm genug, heiratete Joachim Friedrich auch noch Annas jüngere Schwester und wurde so zum Schwager seines Sohnes. Solche Aktionen zeigen nur, wie kompliziert und verworren politische Ehen zwischen den Adligen jener Zeit waren. Die Komplexität der Ehe und der Erbfolge wurde durch Annas weibliche Abstammung noch verstärkt. Ihre Mutter gehörte der Familie Jülich-Kleves an, die ein eigenes Erbrecht hatte, das es weiblichen Mitgliedern erlaubte, Titel zu erhalten, wenn es keine anderen Erben gab. Da Annas Onkel, der wie ihr Vater geisteskrank war, keine direkten Erben hatte, war sie die nächste in der Erbfolge der Jülich-Klevesschen Ländereien, die nahe der deutsch-niederländischen Grenze am Rhein lagen. Natürlich war Annas Erbe alles andere als sicher, sowohl in Bezug auf Preußen als auch in Bezug auf die Jülich-Kleves'schen Territorien.