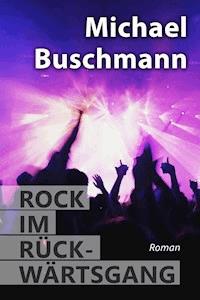Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
An einem Sonntagmorgen passiert im südrussischen Atommeiler Permsk-7 ein schwerer Störfall, der zunächst wie ein Routinevorfall aussieht. Doch als Guido Marschall und Galina Vivarowa von der Umweltschutzorganisation Greenworld mit der Untersuchung beauftragt werden, entdecken sie schnell, dass der Unfall nur die Spitze eines viel größeren Problems ist. Warum zeigt sich die russische Atombehörde plötzlich so ungewöhnlich kooperativ? Und welche Rolle spielt der geheimnisvolle Fremde, der unerwartet in der Atomanlage auftaucht? Die beiden Ermittler stoßen immer tiefer in ein Netz von Intrigen und Abenteuern, das ihr Leben auf dramatische Weise verändern wird. Während sie einen Skandal aufdecken, der weitreichende Folgen hat, wird auch Guidos Kollegin Bea Kemp mit einem persönlichen BSE-Fall konfrontiert, der das Thema auf erschreckende Weise in ihr eigenes Leben bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Greenworld-Affäre
Roman
Michael Buschmann
Impressum
© 2017 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Michael Buschmann
Cover: Eduard Rempel, Düren
ISBN: 978-3-95893-055-1
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Aus verschiedenen Tageszeitungen:
Die Hauptpersonen
Prolog
DER AUFTAKT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DIE INTRIGE
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
DIE ENTHÜLLUNG
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Anmerkungen
Unsere Empfehlungen
Danksagungen
Für die freundliche Unterstützung bei meinen Recherchen über Castoren und die Atomwirtschaft im Allgemeinen sowie über den Aufbau und die Arbeitsweise einer Umweltschutz-organisation von globaler Bedeutung bin ich Greenpeace sehr dankbar.
Mein Dank für Informationen und Anregungen über BSE und die heimtückische nv-CJK gilt einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern und Ärzten, die mit viel Engagement den Kampf gegen diese todbringende Seuche aufgenommen haben.
Alle Fehler, die sich eingeschlichen haben, gehen wie gewöhnlich auf mein Konto.
»Es reicht der ganz normale Menschenverstand,um zu erkennen, dass wir uns in einer Todesspirale befinden,die sich immer schneller in die Tiefe schraubt.«David McTaggartChairman von Greenpeace
Aus verschiedenen Tageszeitungen:
Zug mit Atommüll entgleist
Saarbrücken/Bonn. Zum ersten Mal ist ein mit deutschem Atommüll beladener Zug verunglückt. Wie die saarländischen Behörden mitteilten, seien die Lokomotive und die drei mit abgebrannten Brennelementen aus dem Atomkraftwerk Lin-gen im Emsland beladenen Waggons beim Rangieren aus den Gleisen gesprungen. Als mögliche Ursache kämen Schäden an den Gleisen in Frage. Radioaktive Strahlung wurde offenbar nicht freigesetzt. Der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BUND) kritisierte, dass das Bonner Umweltministerium nicht sofort und ausreichend die Öffentlichkeit informiert habe.
Ozonloch wird immer größer
Washington. Die gefährliche UVB-Strahlung ist in vielen Regionen der Welt stark angestiegen. Auch in Deutschland hat die Strahlung, die Hautkrebs und Augenschäden verursachen kann, deutlich zugenommen. Das haben Messungen der US-Raumfahrtbehörde NASA ergeben. Als Ursache für die Zunahme gilt der rapide Ozonschwund in der Atmosphäre, der bereits Werte von bis zu 20 % erreicht hat. Die Ozonschicht ist jedoch lebenswichtig, da sie die Erde vor den schädlichen ultravioletten Strahlen der Sonne abschirmt.
Meeresspiegel steigt
Oslo. In der Arktis ist in den vergangenen 17 Jahren eine Eisfläche geschmolzen, die doppelt so groß ist wie Norwegen, also 124.000 qkm umfasst. Einhergehend damit hat sich der Meeresspiegel in den vergangenen 2 Jahren um fast 4 Millimeter gehoben. Das ist doppelt so schnell wie im gesamten zurückliegenden Jahrhundert. Dies ergaben Messungen des US-Forschungssatelliten Topex-Poseidon. Norwegische Wissenschaftler des Nansen-Zentrums in Bergen werten diese Daten als klares Zeichen dafür, dass im Zuge der globalen Umweltverschmutzung die Klimaerwärmung voranschreitet. Im Auftrag der UNO prognostizierten 2.500 Wissenschaftler aus aller Welt anhand von Computermodellen, dass viele Inselstaaten in den nächsten Jahrzehnten untergehen werden; Floridas Strände in 25 Jahren. Teile der Malediven-Inseln sind bereits im Meer versunken.
BSE auf Menschen übertragbar
Brüssel/London. Bisher bewies das dichte Netz der bekannten Infektionsmöglichkeiten nur, dass selbst genetisch weit entfernte verwandte Arten an BSE erkranken können, wenn sie den Erreger mit der Nahrung aufnehmen. Jetzt haben britische Wissenschaftler die Übertragbarkeit des Rinderwahns auf Menschen offenbar zweifelsfrei nachgewiesen. Die jüngst in Großbritannien aufgetretenen Fälle einer neuen Variante der Creutzfeldt-Jacob-Krankheit sind demnach auf eine Ansteckung mit dem Rinderwahnerreger zurückzuführen. Das ergaben Forschungen an der St. Mary's Medical School in London. Das vermehrte Auftreten der tödlichen Gehirnkrankheit vor allem bei jüngeren Menschen, bei denen das Gehirn wie zu einem Schwamm zerfressen wird, sei eine Konsequenz der Seuche BSE, so die britischen Forscher.
Die Hauptpersonen
Greenworld-Zentrale Deutschland
Roy Martens Geschäftsführer
Guido Marschall stellv. Geschäftsführer
Bea Kemp Guidos geschiedene Frau
Petra Vialli Guidos Sekretärin
Heidrun Faller Beas Sekretärin
Sven Juncker Guidos »rechte Hand«
Gerda Schaven-Klos Pressesprecherin
Björn Roxin Jurist
Gerd Roosen Labor-Chef
Greenworld-Zentrale Moskau
Galina Vivarowa Geschäftsführerin
Larissa Bondarewa stellv. Geschäftsführerin
Aram Awansian PR- u. Kommunikationsabteilung
Weitere Personen
Samantha Beas und Guidos Tochter
Elfriede Sandmann Beas Haushälterin
Dr. Gerold Marschall Staatssekretär/Guidos Vater
Eduard Bessedin Manager von Nu-Clear
Dr. Lutz Hoppe Direktor des AKWs Wahnsdorf
Jürgen Garz Journalist
Konstantin Morgan Administrationschef von Permsk-7
Grigori Pantschow Gouverneur des Permsker Gebiets
Prolog
Neckarwestheim, Baden-Württemberg
Um 500 Meter zurückzulegen hatte der ungewöhnliche Zug nun schon 3 Stunden benötigt. Seit einer halben Stunde war er keinen Zentimeter vor- oder zurückgerollt. Durch die vergitterten Frontscheiben konnte der inzwischen völlig entnervte Lokführer nicht viel von dem erkennen, was da draußen vor sich ging. Einer der Farbbeutel, die die Demonstranten gegen den Castor-Zug geschleudert hatten, war beim Aufprall zerplatzt und hatte die Scheibe größtenteils verschmiert.
»Dass es so schlimm kommen würde, hätte ich nicht gedacht«, sagte der Lokführer bestürzt zu dem uniformierten Sicherheitsbeamten neben sich, der mit einem Funkgerät den einzig möglichen Kontakt zur Außenwelt hielt.
»Haben Sie eine Ahnung! Diese militanten Krawallmacher und die ganzen Umwelt-Freaks – die wissen, wie man einen solchen Protest anheizt.«
Das Funkgerät knackte, Störungen, dann eine weibliche Stimme: »Letzte Hakenkralle entfernt!«
»Verstanden!«, antwortete der Beamte, nur bedingt erleichtert. Ihm war klar, dass dieser gezielte Anschlag auf die Stromoberleitung lediglich eine von vielen Tricks war, um sie aufzuhalten.
Hunderte Demonstranten hatten sich in Sitzblockaden auf die Gleise platziert. Etliche waren von Polizeibeamten schon weggetragen worden. Der dickste Brocken lag allerdings noch auf den Gleisen: Ein gelber Stahlklotz, an den sich vier Greenworld-Aktivisten angekettet hatten. Schweißgeräte waren bereits im Einsatz.
»Ich glaube, gleich haben sie es geschafft«, schloss der Lokführer aus dem, was er sah.
Seine Einschätzung schienen viele der rund 600 militanten Demonstranten zu teilen. Denn plötzlich brach er los – der Krieg! Steine flogen gegen die Polizisten, dann sogar Brandsätze. Die bewaffneten Grenzschutzbeamten reagierten sofort auf die Aggression.
»Sind die verrückt?«, brüllte der Sicherheitsbeamte in der Lok.
»Was zum Teufel ist das?«
»Die schießen mit Leuchtspurmunition auf meine Kollegen. Diese verdammten Irren! Man sollte sie glattweg –«
Eine Detonation erfolgte. Ein Streifenwagen stand in Flammen.
»Das ist doch Wahnsinn!«, schrie der Lokführer entsetzt, den nun die blanke Angst packte.
Selbst dem hart gesottenen Beamten wurde zunehmend mulmiger. Obwohl er schon so manche Straßenschlacht mit Demonstranten erlebt hatte, ließ ihn diese Eskalation doch schlucken. Dicke Rauchschwaden hüllten die Lok ein. Rufe, Schreie, Motorengeräusche – eine wahre Kakophonie schwappte über den Castor-Zug hinweg.
Dann ein heftiges Rumpeln von Metall, das schwere Arbeiten eines Motors. Die beiden Männer in der Lok konnten beobachten, wie ein Räumfahrzeug einen Trecker, der sich quer auf den Gleisen postieren wollte, mit seiner Gabel seitlich packte und kurzerhand den Bahndamm hinunterschob. Wasserwerfer attackierten nun die umliegenden Wiesen mit für die Demonstranten schmerzhaften Fontänen. Ein Hubschrauber knatterte wie aus dem Nichts über den Schienen. Tausende triefend nasser Demonstranten zogen sich zurück.
Die erste Schlacht schien vorüber …
Kent, England
Der dunkelgrüne Range Rover hatte seit einer Viertelstunde London hinter sich gelassen und fuhr nun die Autobahn M 20 in Richtung Süden entlang. Seine beiden Insassen schienen es nicht eilig zu haben. Der Rover blieb deutlich unter der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.
Kurz hinter London hatte der Regen allmählich nachgelassen. Die dicke Wolkendecke wurde jetzt dünner. Hier und da riss sie auf, so dass ein paar Sonnenstrahlen hindurchfielen wie gigantische Scheinwerfer aus einem Raumschiff, das sich hinter den milchig-grauen Wolken verbarg. Die Scheibenwischer schrappten mit einem unangenehmen Quietschen über die fast trockene Windschutzscheibe. Der Fahrer stellte sie schnell mit einer Miene aus, als habe soeben etwas Eiskaltes einen blankliegenden Zahnnerv berührt.
Im gleichen Moment überholte sie ein voll besetzter Mini-Cooper, in dessen beiden Seitenfenstern lange Schals des Fußball-Clubs Manchester United eingeklemmt waren und heftig im Fahrtwind flatterten. Der Fahrer des Minis hupte in einem melodischen Stakkato, während die drei übrigen Insassen händefuchtelnd irgendetwas mit Inbrunst zu singen schienen.
»Das ist schon der Zweite«, stellte die junge Frau auf dem Beifahrersitz des Rover fest. Es klang fast wie eine Frage.
Brad Foster, der Fahrer, lachte. »Der Elfte, meine Liebe. Und mit Sicherheit nicht der Letzte«, prophezeite er und fügte nicht ohne Stolz hinzu, »Manchester steht morgen in Hamburg im Europapokal-Endspiel.«
Dieser Gedanke schien ihn sichtlich zu erfreuen. Doch das währte nicht lange, da sie kurz darauf an einer Entfernungstafel vorbeifuhren, die ihn an eine andere Realität erinnerte.
»Noch 10 Meilen«, sagte er. »Hier beginnt das Gebiet, in dem die Krankheit gehäuft auftritt.« Er atmete tief durch, als gelte es, noch mal sauberen Sauerstoff zu tanken, bevor sie weiter in diese Gegend eindrangen.
»Bislang fünf Fälle, nicht wahr?«, fragte Bea Kemp.
»So gehäuft wie sonst nirgends in Großbritannien. Drei in Ashford. Einer in Canterbury. Und einer in High Halden. Alle im Umkreis von 10 Meilen.« Er rechnete kurz um. »Also 16 Kilometer.«
»Ashford?«, wiederholte die Frau nachdenklich. »Wurde dort nicht 1985 die erste BSE-Kuh entdeckt?«
Brad Foster nickte. »In fünf Minuten erreichen wir den Ort, der damit zweifelhafte Berühmtheit erlangt hat.«
Der Castor-Zug befand sich auf offenem Gelände und steuerte mit zunehmender Geschwindigkeit auf Heilbronn zu. Der Lokführer in der Kanzel schob erleichtert seine Kappe in den Nacken, wischte sich mit der Hand über die Stirn und atmete tief durch. Das war geschafft. Fürs Erste zumindest.
Der Sicherheitsbeamte, der sich erleichtert hingesetzt hatte, meldete über Funk Warnstufe »Gelb«, also leichte Entwarnung, an den Begleitwagen, der als letzter Waggon angehängt war. Zwischen ihm und der Zugmaschine befand sich der knapp 6 Meter lange V/19-Behälter, der in seinem 106 Tonnen schweren Bauch 19 Brennelemente trug.
Der Atommeiler Neckarwestheim war mittlerweile außer Sicht. Eine 500 Kilometer lange Zitterpartie des hoch radioaktiven Nuklearabfalls ins Zwischenlager Ahaus in Nordrhein-Westfalen hatte begonnen. Und niemand konnte im Voraus sagen, von welchen weiteren Zwischenfällen sie überschattet werden würde.
Die Ortschaft Ashford lag in der südenglischen Grafschaft Kent. Mit den vielen bunten Blumen an den Straßenrändern, den weiten Feldern und Wäldern galt Kent als der »Garten Eng-lands«. Und dieser Name traf umso mehr im Mai zu, wenn alles üppig blühte.
Der Range Rover hatte die M 20 verlassen und fuhr jetzt durch Ashford. Brad Foster schien genau zu wissen, wohin er wollte. Zielstrebig bog er ein paar Mal ab und hielt dann an einer Straßenecke vor einem kleinen Lebensmittelgeschäft.
Eine Frau von etwa Mitte 60 mit einer blauen Regenjacke über dem Arm und schweren Gummistiefeln an den Füßen löste sich vom Gemüsestand und stapfte auf den Rover zu. Wie selbstverständlich, als habe sie ein Taxi bestellt, öffnete sie die hintere Tür und stieg ein.
»Hallo, Mrs. Grice.«
»Hallo, Mr. Foster«, entgegnete sie freundlich und drückte dem Fahrer kräftig die Hand. »Fast auf die Minute pünktlich. Das lobe ich mir.«
»Man tut, was man kann. – Darf ich vorstellen?« Er wies auf seine Beifahrerin. »Das ist Frau Bea Kemp aus unserem Greenworld-Büro in Deutschland.« Dann wandte er seinen Kopf nach hinten. »Mrs. Anne Grice. Die Gründerin der Aktionsgruppe.«
Die beiden Frauen gaben sich die Hand. »Freut mich, Sie kennen zu lernen, Mrs. Grice. Brad hat mir eine Menge von Ihrem couragierten Engagement berichtet.«
»Was bleibt einem anderes übrig, wenn die Behörden alles in bester Ordnung finden. Aber nichts ist in Ordnung, sage ich Ihnen. Gar nichts. Schlimm ist es. Sehr schlimm«, sprudelte es aus der älteren Dame hervor. »In sämtlichen Dörfern um Canterbury Mills leben die Menschen in ständiger Angst um ihre Gesundheit. Viele befürchten, dass das Grundwasser bereits mit BSE-Erregern verseucht ist. Und niemand kann ihnen diese Angst nehmen.«
»Wie auch? Bei drei infizierten Personen allein in Ashford. Das ist ja Horror pur«, sagte Bea Kemp. »Wie viele Leute gehören denn Ihrer Aktionsgruppe an?«
»Bisher knapp 30, aber es werden von Tag zu Tag mehr. Erst vorgestern hat sich uns ein Architekt aus Chartham Village angeschlossen. Einer dieser stinkenden Transporter hatte seine Ladung verloren. Überall auf der Straße vor seinem Haus lagen Tierköpfe, Augen, Mägen und Gehirne. Ist das nicht ekelhaft?«
Bea Kemp verzog angeekelt das Gesicht.
Anne Grice sprach unbeirrt weiter. »Nicht genug, dass man die BSE-verseuchten Kadaver hier bei uns verbrennt. Nein, man beauftragt damit auch noch ein schlampiges Unternehmen. Als wären wir nicht schon genug gestraft.«
Bea Kemp nickte verständnisvoll. »Ich denke, es war das Beste, was Sie tun konnten, dass Sie Greenworld informiert haben. Wir werden alles genau recherchieren und dann den notwendigen politischen Druck machen.«
Brad Foster schaute seine Greenworld-Kollegin verwirrt von der Seite an. Was sollte das? Nicht Anne Grice hatte sich mit Greenworld in Verbindung gesetzt, sondern umgekehrt. Wollte sie die ältere Dame auf den Arm nehmen? Diese schien die Verdrehung dieses kleinen Details nicht weiter zu stören. Ganz im Gegenteil. Ihr Gesicht hellte sich sichtbar auf.
»Mr. Foster deutete bereits an, dass Greenworld über gute Verbindungen zur EU-Agrar-Kommission verfügt.«
Das klang für Bea Kemp etwas zu euphorisch, so dass sie es für ratsam hielt, ein wenig auf die Bremse zu treten. »Wie gut, das wird sich in diesem Fall erst noch erweisen müssen. Zumindest sind die Fakten, die Sie von dem behandelnden Neurologen und der Medizin-Statistikerin gesammelt haben, ein wichtiger Aufhänger.«
»Was an diesem Aufhänger dranhängt, werden wir in spätestens 15 Kilometern mit eigenen Augen sehen«, warf Brad Foster dazwischen und startete den Motor.
Anne Grice legte ihren Regenmantel neben sich und tastete ihn nach ihrer Schachtel Zigaretten ab. Brad Foster bemerkte im Rückspiegel ihr Vorhaben noch rechtzeitig, bevor der Tabak erglimmte.
»Macht es Ihnen etwas aus, im Wagen bitte nicht zu rauchen? Danke.«
»Äh, natürlich, ja«, sagte die Frau.
Kemp lächelte dankbar zu Foster herüber. Sie wusste, dass er um ihretwillen eingeschritten war. Sie hatte ihm gegenüber offen den Grund erläutert, weshalb sie ihr erstes Kommen nach England im vergangenen Jahr um Wochen hatte verschieben müssen. Bei einer Routineuntersuchung durch den Betriebsarzt hatte sich ein Krankheitsverdacht ergeben, der sie bis ins Mark erschüttert hatte: Verdacht auf Lungenkrebs. Schlagartig hatte sie das Rauchen aufgegeben und auch nicht wieder damit angefangen, als ein Lungenszintigramm mit Kontrastmittel die schlimme Befürchtung widerlegt hatte.
Anne Grice bemerkte das halb heruntergelassene Seiten-fenster. Da sie nichts von Bea Kemps starken Kopfschmerzen wusste, die sie in letzter Zeit ungewöhnlich oft plagten, beugte sie sich vor und sagte:
»Das Fenster sollten Sie besser schließen. Der Gestank weht meilenweit. Er wird Ihnen noch früh genug den halben Verstand rauben.«
Der Atomtransport hatte die Universitätsstadt Heidelberg hinter sich gelassen und ratterte mit 80 Stundenkilometern am Rand des Odenwalds entlang auf die Main-Metropole Frankfurt zu. Wolf Frings, der Lokführer, goss sich einen Becher Kaffee aus seiner Thermoskanne ein, während er immer wieder einen raschen Kontrollblick aus dem mit Stahlstreben vergitterten Fenster auf die Strecke vor ihm warf.
»Soll ich das nicht lieber machen?«, fragte der Sicherheitsbeamte besorgt.
Wolf Frings zog unbeirrt das Gummiband von seiner Brotdose. »Danke. Geht schon.«
Er rümpfte die Nase. Schmierwurst! Wie oft hatte er seiner Frau schon gesagt, dass sie ihm keine Schmierwurst auf die Brote streichen sollte! Er fischte sich das Schinkenbrot heraus, das zuunterst lag, und biss genüsslich hinein.
Der Beamte, der angestrengt aus dem zweiten vergitterten Vorderfenster auf die Gleise sah, rang zum x-ten Mal seine Hände.
»Der wievielte Transport ist das, den Sie mitmachen?«, fragte Frings schmatzend.
»Der sechste.«
»Na, dann wissen Sie ja, wie gut das immer klappt.« Die Worte trieften vor Sarkasmus.
»Und ob. Beim ersten Mal drohte ein anonymer Anrufer, das Gleis unterwegs mit einer Rohrbombe in die Luft zu jagen. Sie erwies sich zum Glück nur als Attrappe. Beim zweiten Mal wäre der Zug um ein Haar mit einem Lastwagen kollidiert, weil eine Bahnschranke nicht geschlossen worden war. Beim dritten Mal gab es mehrere Anschläge auf die Oberleitungen. Ein paar Idioten hatten Auto-Überbrückungskabel darüber geworfen. Beim vierten und fünften hatten Demonstranten vor dem Bahnhof Ahaus die Schienen unterhöhlt. Und beim letzten hatten ganz perverse Brutalos in den Wäldern bei Dannenberg dünne Drahtseile zwischen Bäumen aufgespannt, die in der Dunkelheit nicht wahrnehmbar waren. In Kehlkopfhöhe. Die Absicht war klar: Hätten meine Kollegen die Demonstranten in die Wälder verfolgt, hätten sie sich lebensgefährlich stranguliert – soll ich noch mehr erzählen?«
Frings, der mit offenem Mund zugehört hatte, kaute nur langsam weiter. Ihm schien der Appetit sichtlich vergangen zu sein.
Als er wieder konzentriert durch die Stahlstreben nach vorne schaute, dachte er an Auto-Überbrückungskabel, unterhöhlte Schienen und Rohrbomben. Plötzlich störte er sich zum ersten Mal an dem Gitter. Er fand, dass es seinen Sichtwinkel bedenklich einengte.
Brad Foster setzte den Blinker und steuerte den Range Rover von der kleinen einspurigen Landstraße in einen Waldweg. Dort wendete er den Wagen und parkte ihn sichtgeschützt hinter Strauchwerk, so dass er von der Straße aus nicht zu sehen war. Trotz der inzwischen stickigen Luft im Auto wagte keiner der drei Insassen, ein Fenster auch nur für einen Moment zu öffnen. Der Geruch, der selbst durch die geschlossenen Lüftungsschlitze noch ins Wageninnere eingedrungen war, ließ erahnen, dass es draußen geradezu bestialisch stinken musste.
Während Anne Grice interessierte Fragen an Bea Kemp stellte, bereitete die deutsche Greenworlderin schon mal ihren 8-mm-Camcorder vor, um damit die Wirklichkeit der britischen BSE-Bekämpfung in stichhaltigen Bildern festzuhalten.
»In Deutschland ist der Dornröschenschlaf nach dem Motto ›Bei uns gibt's kein BSE‹ ja zum Glück jetzt zu Ende«, sagte Bea Kemp und kramte angestrengt in der Kamera-Tasche, weil sie vorsichtshalber den alten Akku durch einen frischen ersetzen wollte. »Die Tausenden von Tonnen verseuchten Tiermehls konnten ja nicht ohne Folgen bleiben … nanu, wo ist er denn?«
»Was suchst du?«, fragte Brad Foster.
»Den Ersatzakku. Ich hatte extra einen neuen besorgt. Muss ihn im Hotel vergessen haben.« Sie zuckte die Achseln. »Hoffentlich ist noch genug Saft drin.”
»In Frankreich sind es mindestens 12 Fälle, so viel ich weiß. Und ein 19Jähriger ist auch schon an der neuen Creutzfeldt-Jakob-Variante gestorben«, warf Anne Grice dazwischen und beobachtete das technische Geschick der Umweltschützerin.
Kemp nickte. »Frankreich war Hauptabnehmer von verseuchtem britischem Tiermehl. Genauso wie Spanien und die Schweiz. Außerdem gelangte der Erreger nach Dänemark, Belgien, Kanada, Israel, Thailand und in die ehemaligen Ostblockländer. Wohin überall sonst noch, ist kaum noch nachzuprüfen.«
Sie drehte am Menü-Schalter und wählte die Zoomgeschwindigkeit aus.
»Ich glaube, die Befürchtung vieler Experten wird sich bewahrheiten. Der weltweite Ausbruch der tödlichen Seuche ist nicht mehr zu stoppen«, meldete sich Brad Foster zu Wort und spähte unverwandt durch das dichte Blätterwerk.
»Zumal der Erreger selbst durch Verbrennen nur sehr schwer abzutö-« Weiter kam Anne Grice nicht.
Foster hatte mit einem »Pst« seine Hand gehoben. »Ich glaube, da bewegt sich was.«
»Wo?«, fragte Kemp gespannt und versuchte angestrengt mit ihren Augen die Wand aus Ästen und Blättern zu durchdringen. »Ich sehe nichts.«
»Na, da!«, rief Foster und starrte gebannt auf irgendetwas, das offenbar nur für seine Augen sichtbar zu sein schien. »Gerade vor uns. Es kommt direkt auf uns zu.«
Kemp hob ihren Camcorder ans Auge, hielt ihn in die ungefähre Richtung, in die ihr britischer Greenworld-Kollege mit dem Finger deutete und suchte systematisch das Blickfeld nach einem sich rasch fortbewegenden Objekt ab. Das moderne Augensteuerungssystem des Camcorders erleichterte ihr die Sache.
»Ich hab es!«, rief sie plötzlich aus, legte ihren Finger aber noch nicht auf den Aufnahmesensor. »Ist ja verdammt schnell. – Mein Gott, was fair ein Ungetüm!«
Dunkle Wolken hingen über dem Ruhrgebiet wie ein schwerer Mantel. Wolf Frings drosselte kontinuierlich die Geschwindigkeit, seit sie durch Dortmund fuhren.
»Wie lange noch bis zum Signal?«, fragte der Sicherheitsbeamte, der die Lichtkegel der Lok genau beobachtete, wie sie unablässig die schier endlose Düsternis vor ihnen zerschnitten.
»Ein Kilometer etwa«, antwortete Frings kurz angebunden.
Vor ihnen tauchte der Rheinlanddamm auf, der nach Westen hin immer tiefer ins Herz des Ruhrgebiets vorstieß und nach Osten an den Westfalenhallen vorbeiführte. Für einige Momente schaute Wolf Frings zur Seite hinaus auf die Emscher, die im Dämmerlicht aussah wie ein unendlich tiefer schwarzer Schlund, der sich gierig durch eine Großstadt fraß.
»Was ist das?«, platzte der Sicherheitsbeamte plötzlich argwöhnisch hervor.
Frings zuckte zusammen und sah irritiert nach vorn, dann zu seinem Begleiter. »Wo? Was denn?«
»Hören Sie das nicht? Dieses … dieses … Da stimmt doch was nicht!« Der Mann lauschte angestrengt. Seine Augen hatten sich erwartungsvoll geweitet.
Frings spitzte ebenfalls seine Ohren. Der Zug ratterte nun um einiges lauter und unruhiger über die Gleise. Ansonsten konnte er beim besten Willen nichts Außergewöhnliches hören. »Wir fahren über einige Weichen, weiter nichts«, sagte er. »Da vorne ist ein Güterbahnhof.«
Die Antwort beruhigte den Beamten nicht. Er griff zu seinem Funkgerät, das ihn mit dem Sicherheitswagen am Ende des Zuges verband. Er wollte gerade die Sprechtaste drücken, als das Rumpeln unter der Lok leiser wurde.
»Aha, da ist es ja«, sagte Frings mehr zu sich selbst und begann zu bremsen. Ein schrilles Quietschen setzte ein.
Der Beamte warf einen Blick aus dem Fenster, um festzustellen, was gemeint war. Dann sah er es: Das Signal schien sich wie aus dem Nichts zu materialisieren. Die beiden roten Halt-Lichter glichen zwei gemalten Punkten auf einer schwarzen Wand, die hoch in den Himmel hinaufschoss, um dort in einer unheilvollen Symbiose mit dem düsteren Wolkenkleid zu verschmelzen.
Es kam näher. 50 Meter … 40 Meter … 30 … 20 …
Die Lichter sprangen auf Grün.
Der Sicherheitsbeamte machte ein Gesicht, als tanze vor ihm eine Fata Morgana. »Das gibt es doch nicht! Grün?!« Er blickte auf seine Uhr. »Es ist 19 Uhr 7. Genau nach Plan.«
»Und?«, meinte Frings, der nicht verstand, worin das Problem liegen sollte.
»Nach Plan müssten wir jetzt drei Minuten auf den entgegenkommenden Zug warten.«
Frings runzelte die Stirn. »Ein Fahrplan ist kein Gesetzbuch. Und Sie sehen doch das Signal. Aber bitte, Sie sind hier der Boss. Fahren wir weiter oder nicht?«
Der Beamte überlegte kurz. »Müssen wir wohl.« Er nickte dem Lokführer auffordernd zu.
Frings löste die Bremsen und beschleunigte den Zug wieder. Dann schaute er den Beamten skeptisch von der Seite an. »Oder halten Sie das für eine Falle der Demonstranten?«, fragte er unsicher.
»So weit werden die nicht gehen, dass sie Signale manipulieren. Wäre das erste Mal«, entgegnete der Mann, schien aber unsicher.
Der Castor-Transport bewegte sich mit zunehmendem Tempo in Richtung Nord-Ost auf den Dortmunder Hauptbahnhof zu.
Der 30-Tonner nahm nahezu die gesamte Breite der einspurigen Landstraße ein. Trotzdem raste er mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Grafschaft Kent. Brad Foster musste mehr auf das Gaspedal seines Rovers drücken als ihm lieb war, um dem stählernen Ungetüm in sicherer Entfernung zu folgen.
Bea Kemp behielt den Lastwagen mit ihrem Camcorder genau im Visier. »Meinst du, dass er uns entdeckt hat, Brad?«
Anne Grice gab die Antwort. »Die donnern hier immer so mörderisch entlang. In letzter Zeit sogar fast stündlich. Das Notschlachtungsprogramm läuft auf Hochtouren und trotzdem wird London der Berge von toten Kühen nicht Herr.«
»Wie meinen Sie das?«, fragte Kemp.
»Die verbrennen nur die Köpfe und einige besonders infektiöse Innereien. Damit sind ihre Kapazitäten erschöpft. Der Rest wird in Abdeckereien zu Tiermehl verarbeitet. Dieses Tiermehl soll später verbrannt, auf Deponien verbuddelt oder einfach ins Meer gestreut werden.«
»Und bis dahin?«
»Bis dahin wird es gelagert. Meterhohe Berge Tiermehl türmen sich in alten Flugzeughallen. Professionell und hygienisch, nicht?«
»Aber sicher. Solange die Baggerfahrer Atemschutzmasken tragen«, entgegnete Kemp ironisch, die solch armselige staatliche Maßnahmen bis zum Überdruss kannte.
Sie sahen, wie der Lastwagen in das Dorf Chartham rauschte, das 25 Kilometer von Dover entfernt lag. Ihnen entging jedoch, dass das Monstrum an der Eisenbahnbrücke im Dorf wegen eines alten Mannes mit einer Handkarre abrupt bremsen musste. Die Ladung geriet in Bewegung. Ein gurgelndes Schmatzen drang aus dem Innern des 30-Tonners. Kurz darauf schwappte eine braunschwarze Flüssigkeit über die Bordwand.
»Was ist das denn?«, stieß Kemp hervor, als sie die Eisenbahnbrücke erreichten und hielt mit dem Camcorder genau auf die verdächtig schmutzige Spur auf dem Asphalt. »Sagt bloß, das ist-«
»Es ist«, bestätigte Foster ihre Vorahnung. »Es wurden sogar schon Leute von der stinkenden Flüssigkeit bespritzt.«
Der Rover folgte der Dreckspur. Sie zog sich bis zur Schule hinauf und verlor sich erst nach einem Kilometer. Nur etwa zwei Kilometer weiter stoppte Foster den Rover am Straßenrand und deutete auf einen Gebäudekomplex, der in einem Waldstück versteckt lag.
»Das ist die Tiermehl-Mühle Canterbury Mills. Fast 80 Jahre alt. Hier werden wir unseren stinkenden Raser gleich wieder sehen.« Er legte seine Hand in geradezu väterlicher Fürsorge auf Kemps Arm. »Wenn wir jetzt aussteigen und uns umsehen, sei bitte auf das Schlimmste gefasst. Nicht nur der Gestank wird dir den Magen umdrehen.«
Ahaus, Nordrhein-Westfalen
Das Atommüllzwischenlager war trotz tiefer Nacht taghell erleuchtet. Überall brannten Lampen und Flutlichtstrahler wie in einem Fußballstadion.
Rund 400 Meter vom Zufahrtstor des Zwischenlagers entfernt stand auf einer Anhöhe ein PKW Kombi. Der Motor war abgestellt, die Scheinwerfer tot. Im Innern des Wagens flackerte ab und zu ein Licht auf.
Der 39-jährige Fahrer faltete ein DIN-A3-großes Blatt über dem Lenkrad aus und strahlte es mit seiner Taschenlampe an, die er sich in den Mund geklemmt hatte. Die etwa gleichaltrige Frau, die neben ihm saß, beugte sich leicht zu ihm herüber, um eine bessere Sicht auf die Skizze zu haben.
»Das ist der Grundriss?«, fragte sie.
Der Mann nickte. »Wir stehen hier. Da ist das Tor. Von da wird der Zug hineinrollen.« Er zeigte mit dem Finger auf drei Stellen des Plans.
»Das Gestrichelte ist die Lagerhalle?«.
»20 Meter hoch, mit 55 Zentimeter dicken Stahlbetonmauern. Die Anlage wurde zunächst nur für die 60.000 Graphitkugeln aus dem gescheiterten Experiment mit dem Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop in Betrieb genommen. Deshalb sind auch nur 50 von 420 Stellplätzen belegt.«
»Und die restlichen werden mit Castor-Behältern gefüllt.«
Der Mann nickte wieder. »Die Lagerkapazität soll von derzeit 1.500 auf 4.200 Tonnen aufgestockt werden. Der Antrag ist schon gestellt. Eine Genehmigung ist notwendig, damit Castor-Container mit 15 Druckwasser- oder 52 Siedewasserbrennstäben eingelagert werden dürfen.«
»Behälter wie die aus Neckarwestheim.«
»Apropos.« Der Mann sah wie aufs Stichwort auf seine Armbanduhr. ›Jetzt sind es schon 21 Minuten über die Zeit, und der Zug ist immer noch nicht da.«
»Ist das ungewöhnlich?«
»Eigentlich schon. Nach der letzten Meldung gab es keine Zwischenfälle mehr. Er müsste also längst angekommen sein. Andererseits – 500 Kilometer sind ein verdammt langer Weg.«
Er hatte es gerade ausgesprochen, da knallte etwas gegen sein Seitenfenster. Er zuckte so heftig zusammen, dass ihm der harte Feldstecher vor Schreck schmerzhaft in die Augen abrutschte. Noch bevor er den Kopf zur Seite drehen konnte, schrie seine Begleiterin auch schon laut auf.
An ihrer Fensterscheibe klebte ein weißes rundes Gesicht.
»Das stinkt ja pervers!«, presste Bea Kemp angeekelt hervor. und rümpfte die Nase. Sie stapfte dicht hinter Anne Grice und vor Brad Foster durch den tiefgrünen Wald.
Vor einem mit dichtem Moos bewachsenen Stein blieb Grice unvermittelt stehen. »Von hier hat man den besten Blick auf die Mühle. Sehen Sie die Einfahrt?« Sie deutete mit ausgestrecktem Arm quer durch den Wald.
Kemp legte den Camcorder an. »Meinen Sie das verrostete Blechtor?«
»Ja.«
Habe ich, wollte sie antworten, als das Bild vor ihren Augen verschwamm. Ihr wurde schwindelig. Vermutlich vom Gestank, dachte sie und munterte sich selbst auf Mach jetzt bloß nicht schlapp, hörst du!
Die Videokamera surrte leise und lichtete das Tor mit dem verbeulten Schild Zutritt strengstens verboten ab.
»Rechts vom Tor haben sie eine Holzblende errichtet, um neugierige Blicke abzuwehren. In unsere Richtung zum Glück noch nicht.«
Kemp schwenkte langsam mit der Kamera vom Tor auf den Hof. »Sieh an, sieh an! Da ist ja unsere Stinkbombe auf Rädern.«
Sie filmte den Lastwagen, dann den Fahrer, der sich aufgeregt mit einem Arbeiter unterhielt. Der Arbeiter zeigte auf eine Stelle im Hof. Kemp folgte der Richtung mit ihrem Sucher. Als sie die Stelle einfing, schrak sie heftig zusammen.
»Igitt!«
»Was ist?«, fragte Foster neugierig.
»Da stapeln sich die Tierkadaver.« Sie blinzelte zu Grice, die davon nicht überrascht schien.
»Das passiert öfter«, sagte sie ungerührt. »Der Manager nennt so was eine logistische Herausforderung.«
Kemp betätigte die Zoom-Funktion des Camcorders, um das Bild näher heranzuholen. Das im Sucherfeld durch einen Rahmen eingeschlossene Bild von den Kadavern vergrößerte sich. Jetzt konnte sie in dem blutigen Matsch einzelne Körperteile erkennen. Jedoch nicht lange. Etwas Verschwommenes, Gelbes flutschte auf einmal ins Bild. Sie schaltete zurück auf Großaufnahme. Es handelte sich um einen Radlader. Er senkte seine riesige Schaufelmulde und schob sie mitten in den Kadaverhaufen. Dann setzte er zurück, fuhr ein Stück über den Hof und verschwand mit der triefenden Schaufel in einem der Gebäude, aus dem beißende Dampfschwaden aufstiegen.
»Die Abdecker schaffen 1.100 Tonnen pro Woche«, erklärte Grice, »dafür wird hier aber auch Tag und Nacht geschuftet.« Sie zupfte Kemp sachte am Ärmel. »Kommen Sie! Noch ein Stück an der Mühle vorbei, dann können Sie das Grässlichste sehen, was man sich vorstellen kann.«
»Warum so eilig?«
»Weil ich nicht will, dass man uns entdeckt. Die Arbeiter der Mühle halten nicht viel von Umweltschützern. Sie meinen, wir wollen ihre Arbeitsplätze vernichten. Das macht sie ziemlich aggressiv.«
Kemp folgte ihr tiefer in den Wald. Erst jetzt fiel ihr auf, dass der Boden merkwürdig aufgeweicht war und mit jedem Meter, den sie gingen, noch weicher wurde.
Hinter ihnen krachte irgendwo im Wald ein Ast. Kemp fuhr erschrocken zusammen. »Einer der Arbeiter?«, flüsterte sie angespannt. Sie wollte sich umdrehen, als sich eine Hand auf ihre Schulter legte.
»Keine Angst«, beruhigte sie Brad Foster. »Das war nur eine streunende Katze. Von denen laufen eine Menge herum. Wahrscheinlich ziehen die Kadaver sie an.«
»Sagen Sie bloß, Sie haben Angst vor Katzen?«, schmunzelte Grice.
»Vor diesen Katzen sollte sich jeder in Acht nehmen. Katzen sind besonders BSE-anfällig.«
Das Schmunzeln auf Grices Gesicht erstarb augenblicklich.
Kemp fiel auf, dass der Boden unter ihren Füßen bei jedem Tritt schmatzte. »Nähern wir uns einem Bach?«, fragte sie verwundert.
Blattlose Baumgerippe tauchten auf. Sie blieb stehen und machte Aufnahmen von den unheimlich anmutenden Baumstaken, die rings um die Fleischmühle in den Himmel ragten.
»Meine Güte!«, entfuhr es ihr. Das Entsetzen über diesen verheerenden Anblick stand ihr ins Gesicht geschrieben.
»Weiter gehen wir lieber nicht«, schlug Grice vor. »Da vorne wird der Boden zu schlammig. – Sehen Sie da drüben den kahlen Strauch?«
Kemp nickte. »Was ist da-?« Sie brach ihre Frage mitten im Satz ab, weil sie selbst sah, was Anne Grice meinte.
In der Nähe des Strauches lag ein alter Feuerwehrschlauch, aus dem sich ein armdicker Strahl Brühe auf den Waldboden ergoss. In einem Umkreis von 30 Metern wuchs dort nichts mehr. Legionen von Fliegen zogen ihre Kreise und schwärzten die Luft und den Boden.
»Das sind die Abwässer von Canterbury Mills«, erläuterte Grice mit belegter Stimme. Der Anblick des Unvorstellbaren setzte ihr immer wieder von neuem zu. »Laut Firmenmanager absolut legal. Laut Umweltbehörde gereinigt und sauber.«
Brad Foster ergänzte: »Die uralte Mühle ist nicht an die Kanalisation angeschlossen.«
»Gereinigt und sauber!«, wiederholte Kemp fast trotzig. »Sicher, und der Wald ist gar nicht tot, sondern hält nur einen längeren Winterschlaf als üblich.«
»Der Wald? No problem, beteuert der Firmenmanager«, sagte Grice. »Für ihn sind die Bäume und Sträucher wegen des vielen Wassers eben einfach ertrunken.«
Kemp schüttelte fassungslos den Kopf. »Wenn es nicht so bitterernst wäre, würde ich jetzt laut loslachen.«
Sie schaute Foster an, der die Augenbrauen hob, als wolle er sagen: »Was willst du bei so viel Schwachsinn machen?« Dann sagte er: »Über 100.000 Liter von der Giftbrühe werden jeden Tag in die Umgebung gepumpt. Und dass das Abwasser frei von BSE-Erregern ist, muss sehr bezweifelt werden. Wir wissen nämlich aus zuverlässiger Quelle, dass die Mühle ihren Fleischbrei nur 13 Minuten lang auf 120 Grad erhitzt. Für das sichere Abtöten des Erregers gilt als wissenschaftlicher Standard jedoch eine wesentlich längere Dauer und eine viel höhere Temperatur.«
»So fahrlässig gehen die mit unserer Gesundheit um!«, erboste sich Anne Grice. »Und nun schauen Sie sich um. Das Gelände ist frei zugänglich. Dort hinten spielen sogar manchmal Kinder. Und dann unsere schrecklichste Sorge – die Mühle liegt nur 50 Meter über dem Grundwasserspiegel. Der Brunnen, aus dem Tausende von Menschen in dieser Region ihr Trinkwasser beziehen, ist nur anderthalb Kilometer entfernt.«
Grice faltete beschwörend ihre Hände. Ihre Augen wurden feucht. »Bitte, helfen Sie. uns! Wir leben in entsetzlicher Angst um unsere Gesundheit. Greenworld ist unsere letzte Hoffnung.«
Erneut donnerte eine Faust gegen die Glasscheibe der Fahrertür.
»Machen Sie endlich auf! Polizei!«, brüllte eine tiefe Stimme.
»Nun los! Wird's bald! Oder müssen wir Gewalt anwenden?«, drohte das weiße runde Gesicht am anderen Seitenfenster.
Der Fahrer drückte auf zwei Knöpfe und die Scheiben surrten beiderseits leise herunter. »Ja, ja, schon gut«, versuchte er den uniformierten Beamten zu besänftigen und hob demonstrativ wehrlos seine Hände. »Wir haben uns nur fürchterlich erschreckt.«
Der Polizist brummte: »Hm. Was machen Sie hier? Haben Sie die Schilder nicht gesehen? Sie befinden sich in einer erweiterten Sperrzone.«
»Doch, doch, haben wir gesehen. Wir warten hier.«
»So, Sie warten hier«, wiederholte der Polizist sarkastisch. »Und worauf, bitte schön?«
»Auf den Zug natürlich. Den Castor«, antwortete der Fahrer wie selbstverständlich.
»Natürlich. – Ihre Papiere! Aber ein bisschen flott!« Und als der Fahrer seine Hand zu flink in der Jackentasche verschwinden ließ: »Na, na, na! So flott auch nicht.«
Der Polizist schlug ein paar Mal als Warnung mit seinem Gummiknüppel gegen den Fensterrahmen. Der Fahrer erkannte selbst im schwachen Schein der Stablampe des Polizisten, dass es sich um keinen gewöhnlichen Schlagstock handelte, sondern um einen so genannten Tonfas, einen bruchfesten japanischen Kunststoffprügel mit zwei Griffen. Er konnte als Stoß- und Schlaggerät sowie für Rundumschläge verwendet werden, wurde in der Regel bei Straßenkrawallen benutzt und war Spezialeinheiten vorbehalten.
Ganz vorsichtig zog der Fahrer seine Hand mit dem Personalausweis und einem zweiten Dokument hervor. Mittlerweile hatte die Beifahrerin ihre Umhängetasche vom Boden aufgehoben und den Reißverschluss geöffnet.
Als sie hineinfassen wollte, erklang ein harter Befehl des zweiten Beamten. »Lassen Sie das! Geben Sie mir die Tasche!«
Die Frau überließ sie ihm bereitwillig. Der Polizist an der Fahrerseite richtete sich auf, betrachtete den Ausweis und leuchtete dem Fahrer mit dem grellen Lichtstrahl seiner Taschenlampe ins Gesicht, so dass dieser die Augen zukniff. Als er wieder richtig sehen konnte, nahm der Fahrer das Mitglied der Spezialeinheit genauer in Augenschein. Er schätzte ihn auf gut zwei Meter Größe. Selbst unter der weiten olivfarbenen Uniform zeichneten sich seine Muskelpakete deutlich ab.
»Guido Marschall. Hmhm.« Zu wem der Polizist das murmelte, blieb sein Geheimnis.
Sein Kollege rief ihm zu: »Du, Arndt, das ist eine Russin.« »Werfen Sie doch bitte mal einen Blick auf das zweite Dokument«, bat der Fahrer behutsam.
Der Polizist faltete den Zettel auseinander und las ihn laut vor: »Sonderausweis für die Begleitung des Gastor-Transportes. Ausgestellt für Guido Marschall, stellvertretender Geschäftsführer von Greenworld, Deutschland. Und für Galina Petrowna Vivarowa, Geschäftsführerin, Greenworld, Russland.«
»Mit Stempel des Innenministeriums und vom Staatssekretär persönlich unterschrieben«, fügte der Fahrer noch hinzu.
»Sehe ich«, erwiderte der Polizist kurz. »Eines versichere ich Ihnen – mit solchen Aktionen wie heute machen Sie sich eine Menge Feinde.« Er und auch sein Kollege gaben die Papiere zurück.
»Damit kann ich leben«, versetzte Guido Marschall kühl und nutzte die Gunst der Stunde zu einer Frage. »Ach, sagen Sie, Sie wissen nicht zufällig, weshalb der Castor-Zug seit fast einer halben Stunde überfällig ist?«
»Er ist nicht überfällig. Er ist längst da«, kam die überraschende Antwort.
»Längst da?«
»Nicht im Zwischenlager natürlich. Aber etwa einen Kilometer außerhalb. Er hat Order erhalten, dort zu warten, bis auch der letzte Demonstrant entfernt worden ist. Reine Sicherheitsmaßnahme.«
Die beiden Polizisten grüßten zackig und verschwanden in der Dunkelheit. Die Scheiben des Kombis schnurrten wieder hoch.
»Wichtigtuer!«, zischte Marschall erbost. »Kloppen auf dem Fensterrahmen rum, als wäre es eine alte Holzkiste. Idioten, ihr! Wenn da Lack abgeplatzt ist, schick ich euch die Rechnung!«, schimpfte er in die Dunkelheit hinter den beiden Beamten her.
»Ein Grund mehr, meinen Aufenthalt in Deutschland nicht so schnell zu vergessen«, meldete sich Galina Vivarowa viel sagend zu Wort.
»Was sind die anderen Gründe?«, fragte Marschall erwartungsvoll.
Sie lächelte ihn nur an.
Er fand, dass es Antwort genug war. Schon deutlich besser gelaunt griff er wieder nach dem Feldstecher. Unten am Zufahrtstor des Zwischenlagers blitzte an mehreren Stellen grelles, weißblaues Licht auf. Die Schweißgeräte taten mit einem gespenstischen Lichterspiel die letzte Arbeit. Der Hauptwiderstand war schon vor Stunden gewaltsam gebrochen worden, und der Rest an Gegenwehr durch eine Hand voll hartnäckiger Greenworld-Aktivisten würde in Kürze unter den Augen von Dutzenden Pressevertretern der Vergangenheit angehören.
DER AUFTAKT
1
Die hübschen kleinen Reihenhäuschen gehörten zu einer verkehrsberuhigten Zone und wiesen eine extravagante Architektur auf. Ihre runden roten Dächer wirkten im Sonnenlicht wie von glühender Lava überzogen, die aus dem Innern der Häuser hervorzuquellen schien und sich über die glasierten Dachpfannen ergoss wie über den Hang eines Vulkans.
Die Besitzerin von Nummer 108 war Bea Kemp, die das Haus zusammen mit ihrer 5-jährigen Tochter Samantha bewohnte.
An diesem Juni-Morgen lief nicht alles seinen gewohnten Gang. Die Haushälterin erschien zwar gegen 7:30 Uhr zur üblichen Zeit, wunderte sich jedoch, dass die Dame des Hauses keine Anstalten machte, wie sonst zur Arbeit zu fahren und ihr das Zubereiten von Samanthas Frühstück zu überlassen.
Die Kleine hüpfte im Nachthemd auf der Eckbank in der Küche herum und trällerte ausgelassen die Musik auf ihrer Kinderkassette mit. Ans Essen dachte sie dabei nur ab und zu, wenn gerade ein Lied zu Ende war.
»Trink auch bitte deine Milch, Sam!«, ermahnte Bea sie, während sie an der Arbeitsplatte stand und das Kindergartenbrot mit Nutella bestrich.
»M-a-m-a!«, kam es lang gezogen aus dem roten Marmeladenmund.
»Ja, mein Schatz?«
»Das ist ungerecht.« Samantha verschränkte die Arme und machte einen Schmollmund.
»Was ist ungerecht, Kleines?«
»Du hast mal gesagt, dass kleine Babys die Milch von ihrer Mami trinken.«
»Ist ja auch so.«
»Und warum brauchen Kuh-Babys die Milch von ihrer Mami nicht trinken? Die muss ich jetzt auch noch trinken«, empörte sich Sam und ließ sich verärgert aufs Polster fallen.
Bea schmunzelte, verpackte das fertige Brot in einer Frischhaltedose und wandte sich ihrer Tochter zu. »Kuh-Babys trinken auch brav die Milch ihrer Mamas. Aber die Kuh-Mamas haben so viel Milch, dass wir Menschen auch davon was abhaben können.«
»Will ich aber gar nicht. Kannst du ihnen das nicht sagen?« »Komm schon, Sam! Wenigstens ein paar Schluck.«
Widerwillig kniete sich die Kleine an den Tisch und nippte an ihrem buntbedruckten Becher. Als wäre dieser winzige Schluck in einer Sekunde schnurstracks durch ihren ganzen Körper geflossen, sprang sie plötzlich auf und piepste vorwurfsvoll: »Siehst du, jetzt muss ich Pippi.«
Als der Zeiger der Küchenuhr sich 8:30 Uhr näherte und Bea in aller Seelenruhe ihre Tochter für den Kindergarten anzog, konnte sich die irritierte Haushälterin nicht länger zurückhalten.
»Entschuldigen Sie meine Neugier, gnädige Frau, aber habe ich da was vergessen? Haben Sie Urlaub?«
»Urlaub? Das wäre schön. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis, Elfriede. Mich zieht es heute Morgen einfach überhaupt nicht ins Büro. Das ist alles.«
Die Haushälterin musterte sie besorgt.
»Nichts Ernstes, Elfriede. Heute ist ihr letzter Tag. Mit großem Tamtam und so. Und wenn man einem Elend aus dem Weg gehen kann, sollte man es tun.«
»Das stimmt«, antwortete Elfriede Sandmann, als wisse sie genau, wovon Bea Kemp sprach. Sie ging hinaus, um Samanthas Jacke zu holen.
Bea sah ihr lächelnd nach. Sie wusste, was sie an dieser Frau hatte, die sie aus der Nachbarschaft kannte, die ihr seit ihrer Scheidung im Haushalt half und die in dieser Zeit zu einer Art treuen Seele des Hauses geworden war. Nicht allein auf Grund von Elfriedes reifem Alter von 56 Jahren, sondern vor allem weil sie ein unaufdringliches, liebevolles und mütterliches Wesen besaß, traute Bea sich, an miesen Tagen etwas von ihrem Kummer bei ihr abzuladen. Elfriede konnte zuhören, gab sich nicht oberklug und hatte doch immer sehr greifbare Lebensweisheiten parat. Bea taten diese Gespräche gut, die oft eher ein Monolog ihrerseits waren.
Minuten später rollte ein roter Kleinwagen mit Greenworld-Aufkleber auf der Heckscheibe zum Kindergarten. Bea brachte ihre Tochter kurz hinein, dann fuhr sie weiter Richtung Innenstadt.
Zu Greenworld Deutschland gehörten 72 fest angestellte Mitarbeiter sowie einige Aushilfen mit Honorarverträgen. Dank eines guten Images und dem neu erwachten Bewusst-sein vieler Menschen, dass ihre Lebensgrundlage unaufhaltsam dahinschmolz, konnte die Umweltschutzorganisation einen Rekord Jahresetat von 21 Millionen Euro verbuchen.
Die Greenworld-Zentrale lag am Nordtorplatz, einem stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt mit bis zu acht Fahrspuren. Sie grenzte direkt an das Passageviertel und gehörte zu einem Gebäudekomplex, der 1993 im Zuge einer Stadtsanierung von zwei amerikanischen Architekten neu errichtet worden war, die für ihr ökologisches Meisterwerk in Cannes sogar eine Auszeichnung erhalten hatten. Der besondere Pfiff an dem Öko-Glashaus bestand darin, dass die doppelte Glasfassade als Klimapuffer wirkte, wodurch die Heizperiode auf vier Wochen im Jahr verkürzt werden konnte. Und selbst in dieser Zeit kam das Greenworld-Wahrzeichen völlig ohne Co2-Ausstoß aus, da es an das Fernwärmenetz angeschlossen war.
Die Büros befanden sich in vier teilweise terrassierten Geschossen über einem recht kleinen Garagenkomplex, der deshalb so bescheiden ausgefallen war, um die Mitarbeiter dazu zu ermuntern, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.
Bea stellte ihren Wagen in einer reservierten Parkbucht ab und fuhr mit dem Aufzug hinauf. Oben erwartete sie ein lichtdurchflutetes, kathedralengroßes Treppenhaus, in dem die einzelnen Büros rundherum wie Waben in einem Bienenstock angeordnet waren, jeweils durch schalldichte Glaswände getrennt, jedoch über die vier Ebenen durch ein ausgeklügeltes Treppensystem miteinander verbunden. Diese progressive Architektur ermöglichte es Bea nun, schon beim Verlassen des Fahrstuhls auf Grund der fast leeren Büros zu schlussfolgern, dass die Verabschiedung von ihr, wie sie die Person gegenüber Elfriede bezeichnet hatte, noch andauerte.
Zu Beas Überraschung saß Heidrun Faller, ihre Sekretärin, am Schreibtisch und arbeitete.
»Nanu? Was ist das denn? Keinen Appetit auf Krimsekt und Kaviar?«, begrüßte sie ihre Mitarbeiterin betont munter.
Heidrun Faller entging der leicht spöttische Unterton nicht. Und sie wusste auch einzuordnen, warum ihre Chefin ausgerechnet diese beiden russischen Spezialitäten nannte, die es mit Sicherheit gar nicht am Büfett gab.
Doch noch ehe sie reagieren konnte, setzte Bea hinzu: »Nein, ich weiß jetzt – du willst mir nicht in den Rücken fallen. Das ist zwar nett von dir, aber du verschwendest deine Loyalität an eine dumme Gans, die ihren Ex nicht beerdigen kann, obwohl er für sie gestorben sein sollte.«
Damit war sie auch schon in ihrem Büro nebenan verschwunden. Heidrun Faller drehte sich auf ihrem Schreibtischstuhl herum und beobachtete Bea durch die Glasscheibe. Ihre Chefin hatte die Tür nicht geschlossen, was sie selten tat.
Sie folgte ihr. »Na, das muss aber ein sehr kurzes Arbeitsfrühstück gewesen sein. Oder hat er kurzfristig abgesagt?«
»Wer? Was meinst du?«
»Deine Verabredung mit diesem Virologen, Jacobsen.«
Bea schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Nein! Das gibt es doch nicht!«
»Sag bloß, du hast den Termin vergessen?«
Bea nickte und wurde blass um die Nase. »Wie konnte ich nur! Dabei habe ich ihn doch extra auf heute früh verlegt, um dieser Abschiedsgala aus dem Weg zu gehen.« Wütend warf sie ihre Aktenmappe auf den Schreibtisch.
»Ich rufe am besten gleich mal beim Ernst-Adam-Institut an und versuche zu retten, was zu retten ist, okay?«, bot sich die Sekretärin sofort an, der Bea Leid tat.
»Das ist lieb von dir.« Bea lächelte sie untröstlich, aber dankbar an.
»Mieser Tag, was?«
Bea nickte merkwürdig erschöpft. »Dabei habe ich gar keinen Grund, mir von diesem Affentanz die Laune verderben zu lassen.« Instinktiv wanderte ihr Blick in die Ebene über ihr, wo die Verabschiedung stattfand. »Auch noch in seinem Büro«, stellte sie widerstrebend fest und rollte die Augen. Sie sah, wie sich alle mit Sektgläsern zuprosteten und dann offenbar Guido Marschall das Wort ergriff. »O nein! Sülz, sülz!«
Sie setzte sich auf ihren Balance-Stuhl ohne Rückenlehne und suchte links nach dem Schalter, um den Computer anzufahren. Als sie ihn nicht sofort fand, wurde sie fahrig. »Verdammt, wo ist denn der –«
»Rechts, Bea. Wo er immer ist«, sagte Heidrun ruhig und war verwundert, wie sehr die Verabschiedung ihre Chefin ganz offensichtlich durcheinander brachte. »Ich fürchte, der Tag wird noch mieser für dich, wenn du das hier gelesen hast«, fügte sie mit schmerzlicher Miene hinzu und übergab ein Fax. »Deshalb bin ich nicht hochgegangen. Es ist aus Brüssel. Vom Sekretariat des EU-Agrarkommissars.«
»Eine Antwort?«
Heidrun nickte. »Lies es selbst.«
Bea las die ersten Sätze gründlich. Die nächsten überflog sie. Den Rest schenkte sie sich ganz.
»Und dafür habe ich in England minutiös recherchiert?«, fragte sie enttäuscht und ließ das Fax geradewegs in den Papierkorb flattern. »Habe für diesen Wisch eine 60-seitige Expertise erstellt?« Ihre Stimme wurde schriller. »Dass sie sich höflich bei mir bedanken und keinen weiteren Handlungsbedarf sehen als den, den die britische Regierung bereits pflichtbewusst und gewissenhaft leistet? – Bei denen piept es doch wohl!«
»Ende Juni ist in London das nächste EU-Gipfeltreffen. Die wollen die Atmosphäre von so was nicht zusätzlich getrübt sehen. Ist doch logisch«, wandte Heidrun ein.
»Die ist ja auch wichtiger als Menschenleben. – Wann haben wir ihnen die Expertise geschickt?«
»Vor zwei Wochen etwa.«
»Und in so kurzer Zeit können sie zu einer abschließenden Beurteilung kommen?! Das ist eine Frechheit! Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, die Expertise zu prüfen! Diese elenden Eurokraten! Sie wischen unsere Bedenken weg, wie sie vor Wochen auch die Warnungen ihres eigenen wissenschaftlichen Ernährungsausschusses einfach ignoriert haben.«
Beas zornfunkelnde Augen suchten einen Fixpunkt. Sie fanden ihn in Guido Marschalls Büro, wo inzwischen Galina Vivarowa an der Reihe war, ein paar nette Worte zu ihrem Abschied zu sprechen.
Resigniert schüttelte Bea den Kopf. »Ich hätte heute besser zu Hause bleiben sollen.«
2
Nach drei Wochen Aufenthalt in Deutschland fiel Galina Petrowna Vivarowa der Abschied schwer. Sie hatte nicht nur das Land schätzen gelernt wegen seiner Weltoffenheit, seinem hohen Lebensstandard und den vielen guten Projekten für den Umweltschutz, sondern auch die Menschen. Und unter ihnen ganz besonders die Mitstreiter im Greenworld-Büro Deutschland, die sie herzlich aufgenommen und exzellent weiter geschult hatten. Galina kehrte mit einem lachenden und einem weinenden Auge nach Russland zurück, hatte sie ihren deutschen Kollegen versichert. Mit einem lachenden, weil sie sich selbstverständlich auf ihre Rodina freute, ihre russische Heimat, die sie liebte. Und mit einem weinenden, weil sie zurückkam in ein Land, das seit Jahrzehnten seine natürlichen Ressourcen systematisch für Macht und Rubel zerstörte, von einer ökologischen Katastrophe in die nächste schlitterte und in dem unzählige tickende Zeitbomben überall schlummerten.
Galina versank halb in dem schwarzen Ledersitz des Sportwagens und schaute aus dem Fenster. Grüne Sträucher und Bäume, Häuser und dann und wann Brückenpfeiler flogen vorbei, als das bordeauxrote Cabrio über die Autobahn raste.
»Deine Ex-Frau hat sich nicht mal von mir verabschiedet«, sprach Galina unvermittelt das aus, was sie seit ein paar Minuten bewegte.
Guido Marschall, der das Steuer lässig mit zwei Fingern hielt, sah sie verdutzt an. »Stört dich das? Nimm es nicht persönlich. Der Grund dafür bin ich, nicht du. Sie hat das Scheitern unserer Ehe nie recht verwunden.«
»Ich finde es nur schade. Wir hätten gute Freundinnen werden können.« Sie legte ihren Kopf schräg. »Dass ihr beiden überhaupt weiter zusammenarbeiten könnt …«
»Sie ist Profi. Ich bin Profi«, antwortete er bestimmt. »Wir können Privatleben und Beruf ganz gut voneinander trennen.«
Galina schwieg. Schließlich fragte sie direkt: »Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass deine Ex-Frau noch etwas für dich empfinden könnte?«
»Was ist das denn für Unsinn? Ich habe dir doch erzählt, sie hat sich von mir scheiden lassen, nicht umgekehrt.« Er zog eine widerwillige Grimasse. »Lass uns nicht kalten Kaffee aufwärmen, sondern von was Gescheitem reden, ja?«
Galina nickte.
»Gut. Sag, hast du schon eine Idee, was du drüben als Erstes in Angriff nehmen wirst?«, fragte er. »Ich denke da an Semskows Selbstmord.«
Als sie antwortete, konnte er wieder nur staunen, wie fließend sie die deutsche Sprache beherrschte.
»Ich meine, dass wir da nachhaken müssen«, sagte sie. »Es ist doch alarmierend, wenn sich der Leiter der russischen Delegation, die in Wien über den Tschernobyl-Unfall berichtete, plötzlich das Leben nimmt.«
»Und wenn niemand den Grund dafür kennt!«
»Eben. Vielleicht hat er private Gründe dafür gehabt. Aber vielleicht auch nicht; vielleicht sah er darin den einzigen Ausweg, weil er damals die anderen Konferenzteilnehmer bewusst belogen hat. Auf jeden Fall kommt es einer Bankrotterklärung gleich, wenn unser staatlicher Atomkonzern öffentlich eingesteht, dass die Störfälle jährlich um bis zu 20 Prozent zunehmen.«
»Dir schwebt eine Kampagne vor?«, fragte Guido ohne Umschweife.
Sie hob zögerlich die Schultern. »Ich bin unschlüssig. Was denkst du?«
Guido setzte den Blinker und nahm die Autobahnabfahrt zum Flughafen. Ein Airbus schob sich dröhnend im Steilflug über sie hinweg.
»Auf jeden Fall würde ich den Atomkonzernen gründlich auf die Finger schauen. So wie ich das hier tue. Die haben mehr Leichen im Keller, als wir ahnen, glaub mir.«
»Vielleicht wäre eine Kampagne sinnvoll«, meinte sie leise, um dann lauter anzufügen, »aber du weißt ja, wie das im Council abläuft.«
Marschall wusste es. Im Council, dem höchsten Entscheidungsgremium von Greenworld, saßen die Vertreter aller nationalen Büros. Und da der Umwelt-Multi weltweit über Niederlassungen in 21 Staaten verfügte, ließ es sich manchmal nicht vermeiden, dass die Meinungsvielfalt so groß war, wie es unterschiedliche Sprachen gab. Dann wurden harte, aber faire Kontroversen darüber geführt, welche Protestaktion Vorrang genießen sollte. Hinzu kam, dass im Council nicht alle Länder Stimmrecht besaßen. Neue Greenworld-Mitgliedsländer – zu denen Russland zählte – mussten sich erst vor den etablierten beweisen und im eigenen Land gefestigt sein, bevor sie diesen Status zugesprochen bekamen.
»Bei über 200 Störfällen im Jahr müssen wir einfach aktiver werden«, sagte Guido entschlossen. »Welches Gefahrenpotenzial das für uns im Westen beinhaltet, haben wir doch bei Tschernobyl erlebt. Ich denke, wir würden dich unterstützen. Und du weißt, unser Einfluss im Council ist beträchtlich gewachsen.«
Sie lachte. »Ich weiß. Euer Einfluss scheint generell keine Grenzen zu. kennen.«
»Schön wär's. Aber was ist daran so lustig?«
»Nun staple mal nicht zu tief. Er reicht immerhin bis ins Innenministerium deines Landes.«
»Du meinst den Sonderausweis für Ahaus? Das darfst du nicht überbewerten. In diesem Fall saß ich an der Quelle, weil mein Vater zufällig Staatssekretär im Innenministerium ist. Diese Connection funktioniert allerdings nicht immer.«
»Hat er da nicht eine Menge riskiert?«
»Es war völlig legal. Wie immer. Darauf achtet mein Vater schon.«
»Aber trotzdem. Wenn das rauskäme, dass der Staatssekretär seinen Sohn begünstigt, das wäre doch keine gute politische Publicity, oder?«
»Mag sein, dass er dann Probleme bekäme. Wahrscheinlich sogar. Aber mein Vater sagt, für die Umwelt lehnt er sich gerne auch mal etwas weiter aus dem Fenster. Er ist 58 Jahre alt und will ohnehin bald in Pension gehen.«
Das Flughafengebäude tauchte vor ihnen auf.
»Aber vielleicht hast du Recht, Galina«, sagte Guido plötzlich. »Vielleicht hat mein Vater viel riskiert. Und vielleicht sollte ich größere Sorge dafür tragen, dass es nicht rauskommt.«
Sie blickte ihn verständnislos von der Seite an.
Er schmunzelte verschmitzt zurück, während er etwas aus der Innentasche hervorzog und ihr hinhielt.
»Nimm ihn mit nach Moskau. Da ist er in Sicherheit.« »Was ist das? Doch nicht etwa …?«, fragte sie ahnungsvoll. »Ein kleines Souvenir.«
Sie nahm den Sonderausweis und hauchte Guido einen dankbaren Kuss auf die Wange.
3
Zwei Stunden später verließ Galina Vivarowa in einer Tupolew 154 der kasachischen Fluggesellschaft Kazakh Airways zusammen mit 121 anderen Passagieren deutschen Boden. Sie konnte es sich an ihrem Fensterplatz bequem machen, da der Sitz neben ihr frei blieb. Für Kurzweil der Passagiere sollte das Bordkino sorgen. Da es sich nur um einen Kurzstreckenflug handelte, wurde fair die Heimkehrer Informatives aus dem russischen Fernsehen gezeigt.
An erster Stelle stand der Bericht über die Vereidigung des neu gewählten russischen Präsidenten, den das populäre Nachrichtenmagazin Itogi tags zuvor ausgestrahlt hatte. Er stammte von einem freien Journalisten, mit dem Galina bei Greenworld-Aktionen schon öfter gut zusammengearbeitet hatte und den sie zu ihren Freunden zählte, Leonid Lezin. Die Kamera des Fernsehsenders NTW zog kurz über die 3.000 Besucher im Kreml-Palast, dann hielt sie auf die Bühne zu, wo sich sieben hochrangige Politiker Russlands in schwarzen Anzügen um drei Doppel-Mikrofone versammelt hatten.
Eine andere Sequenz zeigte den neuen Präsidenten, wie er seine rechte Hand auf ein in rotes Leder eingebundenes Exemplar der russischen Verfassung legte und den Amtseid sprach. Einer der sieben Männer in Schwarz hängte ihm die Präsidentenmedaille als Zeichen der Macht um den Hals, ein Verdienstorden, den als Erster Boris Jelzin erhalten hatte.
Der Patriarch von Moskau und ganz Russland, Alexeij Ü., gab dem neuen Präsidenten seinen Segen und hielt eine kurze Laudatio.
Trotz ihrer Loyalität und Liebe zu ihrem Vaterland mochte in Galina keine rechte Freude über diesen neuen Präsidenten aufkommen. Zu tief saß die Enttäuschung über seine Vorgänger und erst recht über die Sorte, die wie dieser aus den Sümpfen des Geheimdienstes KGB entsprungen waren.
Galina hatte genug gesehen. Aus ihrem Bordgepäck holte sie ihr Tagebuch hervor und vervollständigte es mit ihren letzten Eindrücken aus Deutschland.
Eine Stunde später landete die Tupolew auf dem Flughafen Scheremetjewo im Norden von Moskau, wo Galinas engste Mitarbeiterin sie im Namen aller Greenworlder mit einem kleinen Blumenstrauß herzlich willkommen hieß.
Als der alte rostige Mitsubishi mit seinen zusammengesuchten Radkappen anderer Fabrikate auf den Leningrad-Prospekt zuhielt, hatten sich Galinas Augen an ihrem geliebten Moskau wieder so richtig sattgesehen. Wie sehr hatte sie ihre Stadt vermisst! Es kam ihr so vor, als hätte sie die 9-Millionen-Metropole Jahre nicht gesehen. An ihrer guten Stimmung vermochte selbst der bleierne tiefhängende Himmel nichts zu ändern, der die Moskauer Tage so oft unendlich trübe und trostlos wirken ließ.
4
Der Fahrstuhl bremste langsam ab, glitt noch stockend ein Stück weiter und stoppte dann abrupt. Begleitet von einem leisen Klingelton schob sich die Tür auf und eröffnete Galina den Blick in eine wohlvertraute Welt: die Moskauer Greenworld-Zentrale.
Galina genoss den Gang durch ihre gewohnte Welt mit ihren verschiedenen Geräuschen. Hier ein klingelndes Telefon. Dort ein Kopierer im Dauerbetrieb. Da vorn das Rattern von Druckern. Weiter hinten das flinke Klacken von Fingern auf Tastaturen. Und über allem das vielstimmige Brummen intensiver Konversation.
Auf dem Weg zu ihrem Büro grüßte sie ihre Mitarbeiter je nach Situation mit einem kurzen Hallo, einem Winken, einem Lächeln oder einer herzlichen Umarmung.
Larissa Bondarewa, die ihr auf den Fersen folgte, sprach sie vor der Bürotür an: »Willst du das Briefing sofort oder lieber später?«
Den Türknopf in der Hand wandte Galina sich zu der 7 Jahre jüngeren Frau um, die in den Wochen ihrer Abwesenheit nicht nur den Kontakt zu ihr aufrechterhalten, sondern sie auch mit eingeschränkten Befugnissen als Geschäftsführerin vertreten hatte.
»Dauert es lange?«
»Nur ein paar Minuten. Das meiste habe ich als Interims-papier auf deinen Schreibtisch gelegt.«
»Dann lass uns anfangen«, entschied Galina spontan, ging aber immer noch nicht in ihr Büro, sondern lächelte Larissa an. »Danke, Larissa. Für alles.«
Das Büro war schlicht und funktionell eingerichtet. Eine Ecke des Zimmers zierte eine mächtige Avocadopflanze. An einer Wand hing eine große Weltkarte. Der Schreibtisch war aus Massivholz und mit Computer und Telefon bestückt. Direkt dahinter befand sich, an der Schreibtischkante angebracht, eine kleine Kamera für Videokonferenzen.
Bevor Galina sich an ihren Schreibtisch setzte, genoss sie erst einmal den Ausblick aus ihrem Fenster, auf den sie so lange hatte verzichten müssen. Sie sog das herrliche Panorama Moskaus und des Kreml in sich auf. Die Moskwa schlängelte sich wie ein gigantischer Aal an den Wahrzeichen der alten Moskauer Architektur vorbei, die längst nicht mehr die Stadt überragten wie früher. Doch ihre einzigartige Schönheit blieb unübertroffen. Pastellgelbe und cremefarbene Gebäude mit goldenen Zwiebeltürmen und Kuppeln, umgeben von roten Festungswällen mit ihren hohen Zinnen, davor das dunkle Grün der Tannen des Alexandergartens.
Galina schaltete ihren PC ein und klickte das E-Mail-Symbol an, um nachzuschauen, welche Nachrichten für sie persönlich eingegangen waren.
Auf dem Monitor erschien der Schriftzug: »Anzahl der privaten Mitteilungen: 2. – Jetzt lesen?«
Sie betätigte die entsprechende Taste und der Text erschien. Die Nachricht stammte von ihrem guten Bekannten Leonid Lezin. Er teilte ihr kurz mit, dass er für eine Reportage einige Tage nach Permsk reisen müsse. Er würde sich bei ihr melden, sobald er zurück war, vermutlich Donnerstag.
Galina wollte die zweite Mitteilung abrufen, als Larissa eintrat. »Wollen wir?«
»Klar.« Galina wandte sich von ihrem PC ab.
Larissa stellte ihr eine große Tasse Kaffee hin und nahm auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch Platz. Galina nahm mit dankbarem Lächeln einen vorsichtigen Schluck und hörte aufmerksam zu.
»Wie gesagt, das meiste habe ich in den Interimspapieren zusammengefasst. Einige Anfragen. Drei Verträge, die unterschriftsreif sind. Ein gutes Dutzend Termine, die ich aufschieben musste. Und ein paar Memos aus verschiedenen Abteilungen, die dich rasch wieder auf den aktuellen Stand der Dinge bringen sollen.«
Galinas Augenbrauen hoben sich, als sie den Papierstapel vor sich kurz durchblätterte. Ein Haufen Arbeit, aber sie war zufrieden. Nach einem »Lieb von dir, Larissa«, fuhr diese mit einem Blick auf ihre Notizen fort:
»Ganz wichtig sind hauptsächlich zwei Punkte. Die wollte ich dir auch lieber mündlich darlegen. Der eine Punkt: Das Atomenergieministerium hat uns seinen Bericht zugeleitet. Endlich.«
»Und?«
»Ein bisschen Schönfärberei. Einige getürkte Zahlen. Aber alles in allem ein erstaunlich offener Bericht.«
»Offen im Sinne eines Offenbarungseids, was?«
Larissa lächelte trübe. »Das Papier liest sich wie ein atomarer Albtraum. Es wird endlich offiziell bestätigt, dass die ehemalige Sowjetunion entgegen früheren Angaben in den Jahren 1966 bis 1991 18 Atomreaktoren einfach in der Kara- und Barentssee versenkt hat. Darunter mindestens 6, die noch Brennstäbe enthalten haben. 13.000 Atommüllcontainer wurden ebenfalls einfach ins Meer gekippt. Und der Atommüll der Nuklear-U-Boote wird bis auf weiteres auf See verklappt, bis genug Lager an Land bereitstehen.«
»Was am Sankt Nimmerleinstag der Fall sein dürfte«, warf Galina ironisch ein. »Na ja, aber immerhin scheint unser Druck im Ministerium was zu bewirken. Wenn auch kein Umdenken, so doch wenigstens ein gewisses Maß an Wahrheitsfindung.«
»Ein. Schmusekurs mit uns ist wohl auch nicht zu erwarten.«
»Ich will einfach nur Verfassungstreue von der Regierung. Mehr nicht.«
Larissa wusste, worauf ihre Vorgesetzte anspielte. Seit 1977 war der Naturschutz in der sowjetischen Verfassung festgeschrieben. Doch leider hatte das keinerlei praktische Auswirkungen. Es war der blanke Hohn!
Galina winkte mit trübseliger Miene ab. »Lassen wir das. Du sprachst von zwei Punkten. Was ist der nächste?«
Larissas Gesicht verdüsterte sich schlagartig. »Etwas sehr Unerfreuliches. Umweltschützer haben uns gestern angerufen und darüber informiert, dass es in Permsk zu einem Atomunfall gekommen ist.«
Galina schoss abrupt mit ihrem Oberkörper vor. »Wie bitte? Habt ihr die Angaben überprüfen können?«
»Man teilte uns mit, dass die Bewohner nahe der Anlage am Sonntag, also gestern, gegen 9 Uhr morgens einen Knall hörten und eine Rauchwolke am Himmel beobachteten, die nach Nord-Westen zog. Heute Vormittag kam die Bestätigung, sogar von oberster Stelle. Sie lautete, es sei zu einem schnellen Austritt von Energie gekommen.«
Galina rollte die Augen. »Wenn die Herren in der Atombehörde auch sonst nichts dazulernen, das internationale Vokabular kennen sie inzwischen! Also war's eine Explosion!«
Bondarewa nickte bedeutungsvoll.
»Ist schon etwas über Ausmaß und Art bekannt?«
Larissa schaute ihre Unterlagen durch, bevor sie antwortete. »Eigentlich widersprechen sich ja im Allgemeinen die Angaben der lokalen mit denen der Moskauer Behörden. Diesmal eigenartigerweise nicht. Es heißt einhellig: Keine Katastrophe, aber ein ernster Zwischenfall. Eine Explosion hat stattgefunden. Niemand wurde verletzt. Radioaktivität ist ausgetreten. Ein Unfall der Stufe 5.«
»Stufe 5?«, platzte Galina erstaunt hervor. »Das geben sie offen zu? Ich werd verrückt!« Sie holte tief Luft.
Stufe 5 der internationalen Bewertungsskala hieß, dass der Unfall Risiken außerhalb der Anlage mit sich brachte, dass Radioaktivität in größerem Umfang ausgetreten war und dass Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung veranlasst werden mussten.
Galina ging zu ihrer großen Weltkarte, in der je nach Art der Atomanlage ein unterschiedlich gefärbter Pin mit kleinem Totenkopf steckte. Ihr Finger kreiste kurz suchend über Südrussland und stach im Westen des Asowschen Meeres in die Millionen-Stadt Permsk.
»Permsk-« Sie brach den Satz ab, weil sie an die E-Mail denken musste, die sie eben gelesen hatte. Jetzt kannte sie auch den Grund, weshalb die Itogi-Redaktion ihren Freund Lezin nach Permsk geschickt hatte.
»Ist dir nicht gut?«, fragte Larissa besorgt.
»Alles in Ordnung. Mir kam da grade nur so ein Gedanke. – Also, Permsk-7. Eine nuklearchemische Verarbeitungsanlage mit 5 Atomreaktoren. Was wissen wir sonst noch darüber?«
Larissa zeigte sich gut vorbereitet, was Galina nicht anders erwartet hatte. »Es handelt sich um eine Plutoniumfabrik ähnlich Tscheljabinsk-70 und Krasnojarsk-26. Der erste Reaktor ging 1958 ans Netz. Zwei wurden in den vergangenen Jahren stillgelegt. Einer wird zu militärischen Zwecken genutzt. Er produziert Plutonium für Sprengköpfe; gleichzeitig lagern auf dem Gelände von Permsk-7 aber 23.000 Container mit Plutonium und hochangereichertem Uran –«
»– die wiederum von Sprengköpfen stammen, die im Zuge der atomaren Abrüstung demontiert wurden«, setzte Galina den Satz mit bissiger Stimme fort. »Oh Mann, was für eine schwachsinnige Politik!«