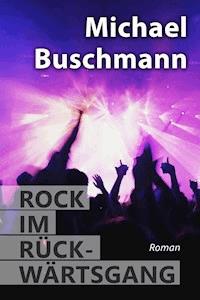Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folgen Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In einer deutschen Großstadt wird ein Afrikaner auf offener Straße angegriffen und brutal zusammengeschlagen. Kurze Zeit später steht ein Asylantenwohnheim in Flammen. Ist ein und dieselbe Person der Drahtzieher hinter diesen Gewalttaten? Zu gleichen Zeit wird der Lokalpolitiker Gernot Crohm, der als Christ ein engagierter Gegner von Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit ist, mit Morddrohungen tyrannisiert. Besonders bedrohlich ist, dass der anonyme Anrufer jeden Schritt Crohms im voraus zu kennen scheint. Ist der Unbekannte etwa im engsten Freundeskreis der Familie zu suchen? Während die Gneralbundesanwaltschaft noch erfolglos im Fall des brennenden Asylantenheims ermittelt, entdecken Beamte zufällig einen unterirdischen Bunker. Sie finden dort außer Nazi-Propagandamaterial auch Zeichnungen von sechs brennenden Häusern – und das Haus von Gernot Crohm ist eines davon … ---- Michael Buschmann wurde 1961 in Dortmund geboren, ist verheiratet und wohnt heute in einer Kleinstadt in Ostwestfalen. Nach seinem Abitur studierte er an der Universität Paderborn. Zur Zeit arbeitet er teilzeitlich in einem Altenheim. Dadurch bleibt ihm genügend Zeit für seine schriftstellerische Arbeit. Der Bestsellerautor Michael Buschmann ist ein Spezialist für spannende, sehr realitätsnahe Romane über brandheiße Themen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tatort Deutschland
Roman
Michael Buschmann
Impressum
© 2016 Folgen Verlag, Langerwehe
Autor: Michael Buschmann
ISBN: 978-3-95893-051-3
Verlags-Seite: www.folgenverlag.de
Kontakt: [email protected]
Dieses eBook darf ausschließlich auf einem Endgerät (Computer, eReader, etc.) des jeweiligen Kunden verwendet werden, der das eBook selbst, im von uns autorisierten eBook-Shop, gekauft hat. Jede Weitergabe an andere Personen entspricht nicht mehr der von uns erlaubten Nutzung, ist strafbar und schadet dem Autor und dem Verlagswesen.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Unsere Empfehlungen
Kapitel 1
Anthony Satom verließ den Supermarkt mit einer prall gefüllten Plastiktüte, aus der das Grün zweier Porree-Stangen herauslugte. Damit die Henkel unter dem Gewicht nicht abrissen, klemmte er sich die Tüte vor die Brust und marschierte federnden Schrittes den Bürgersteig entlang, der so viele Teerflicken aufwies, dass von der ursprünglichen Teerschicht nicht mehr viel zu sehen war. An einer Stelle hatte sich schon wieder ein Bagger tief in das Erdreich hineingegraben. Von einem rot-weißen Ab-sperrungsband umgrenzt, lag die Baustelle still da. Nach einigen Metern wich Anthony auf die Straße aus. Der Grund für diesen Schwenker war ein Haufen blutverschmierter Spritzbestecke, die Junkies hier hinterlassen hatten. Denn in dieser Straße hing einer von sieben Automaten, an dem die Drogenabhängigen für 1 Mark sauberes Spritzbesteck kaufen konnten. Die Anwohner beschwerten sich immer wieder heftig bei der Stadtverwaltung über die Anbringung des Automaten, weil er in ihren Augen Gesindel anlockte und gefährlichen Müll mit sich brachte, mit dem Kinder dann herumspielten und sich unter Umständen mit AIDS, Hepatitis und anderen Krankheiten infizieren konnten. Regelmäßig hatte die Stadtverwaltung ihr Tun mit einem freundlichen Rundbrief verteidigt, woraufhin in ebensolcher Regelmäßigkeit der Automat über Nacht aus seiner Verankerung in der Hauswand herausgerissen und mit Vorschlaghämmern zertrümmert wurde.
Auch an diesem Nachmittag des 20. Juli lag inmitten der schmutzigen Spritzen und Kanülen ein bis zur Unkenntlichkeit deformierter Blechkasten. Der Schwarz-afrikaner warf einen flüchtigen Blick auf den schrottreifen Automaten und ging unbeeindruckt weiter. Er nahm auch keine Notiz von den Passanten, die ihm auf der gegenüberliegenden Straßenseite kopfschüttelnd entgegenkamen.
Erst als plötzlich vom Kriegerdenkmal lauter Gesang zu hören war, sah Anthony Satom hinüber. Zwei glatzköpfige junge Männer in Bundeswehrkampfhosen, grünen Bomberjacken und schwarzen Handschuhen standen neben dem Gedenkstein, auf dem in moosbedeckten Buchstaben der heroische Spruch prangte: Ihr Tod – unser Leben, unter dem die Namen gefallener Soldaten des 2. Weltkriegs aufgelistet waren.
»Wir sind deutsch, wir sind deutsch, wir sind deutsch …«, sangen die beiden ausgelassen in einem fort.
Anthony Satom betrachtete den Vorgang mit gemischten Gefühlen. Er zog es vor, besser nicht stehenzubleiben wie der eine oder andere empörte Passant, sondern las im Gehen, was auf dem Transparent stand, das die zwei Männer am Sockel des Denkmals angebracht hatten: 20. Juli: Verräter kommen und gehen. Das Reich bleibt bestehen!
Plötzlich hoben die beiden Glatzköpfe die rechte Faust und skandierten: »Husch, husch, husch! Die Neger in den Busch! Husch, husch, husch! …«
Anthony Satom tat, als würde er diese Rufe nicht hören oder nicht verstehen, obgleich sie ihm einen heftigen Stich versetzten und ihm in tiefster Seele weh taten. Aber in den vier Jahren, die er in Deutschland lebte, hatte er sich an derartige Hässlichkeiten gewöhnt. Ihn hielt nicht viel in diesem Land, das für ihn ein Moloch von Egoismus und Materialismus war. Er würde hier nur sein Medizinstudium absolvieren und anschließend so schnell wie möglich in seine Heimat zurückkehren.
Er durchschritt eine Parfümwolke, die aus einer Drogerie auf den Bürgersteig wehte, und bog unter der Markise eines Blumengeschäfts nach rechts in eine Seitenstraße ein. Das Grölen der beiden Glatzköpfe verstummte schlagartig. In Gedanken versunken setzte Anthony seinen Weg unbeschwert fort, bis ihn ein monotones Geräusch wieder in die Wirklichkeit zurückholte. Es klang wie schwere Schritte in Stiefeln und kam rasch näher. Neugierig blickte er über die Schulter und erschrak: Die zwei Skinheads vom Kriegerdenkmal waren nur wenige Meter hinter ihm. Für Anthony Satom bestand kein Zweifel, dass sie ihn verfolgten. Das gehässige Grinsen, das sie ihm nun zuwarfen, bestätigte ihn in seiner Befürchtung. Der Abstand zwischen ihnen wurde immer geringer. Allmählich packte den Ghanaer die Angst.
An der nächsten Straßenecke war er für Sekunden den Blicken der beiden Verfolger entschwunden. Geistesgegenwärtig nutzte er diese Gelegenheit, drückte die Einkaufstüte ganz fest an sich und begann zu rennen. Er lief und lief, ohne sich auch nur einmal umzudrehen. Erst als die Seitenstiche unerträglich wurden, suchte er keuchend den Schutz einer Litfaßsäule auf. Noch zwei Parallelstraßen, dann war er zu Hause. Er würde es schaffen. Ein vorsichtiger Blick um die Säule herum bestärkte ihn in seiner Zuversicht. Von den Skins war nichts zu sehen; er hatte sie abgehängt. Erleichtert schaute er vier Kindern auf Fahrrädern zu, die zwei Teams gebildet hatten und nun mit viel Geschick und Balancegefühl verruchten, mit den Reifen einen auf der Straße liegenden Schellendeckel an die jeweilige Bordsteinkante des Gegners zu schießen. Plötzlich knallte es schräg vor Anthony in etwa 15 Metern Entfernung. Ein zweiter Knall folgte. Satom sah hin und zuckte innerlich zusammen. Lässig und mit einem triumphierenden Grinsen hob einer der Skins den Deckel einer Mülltonne an und schlug ihn mit Wucht wieder zu. Es knallte ein drittes Mal.
Im Kopf des jungen Ghanaers arbeitete es fieberhaft. Wie um alles in der Welt hatte der Skin ihn so schnell überholen können? Wohin sollte er jetzt flüchten? Der Weg nach Hause war ihm praktisch versperrt. Und wo steckte der zweite Skinhead? Sollte das Mülltonnengeklapper Anthony nur ablenken, damit dieser sich unbemerkt von hinten heranschleichen konnte? Anthony Satom durchrieselte es eiskalt bei dieser Vorstellung. Panik beschlich ihn. Schnell weg von hier! Sein Blick blieb an einer Gaststätte auf der gegenüberliegenden Straßenseite hängen. Durch die braunen Wabenfenster schimmerte Lampenlicht. Er überlegte nicht lange, sondern rannte sofort los. Etwa auf Höhe des Mittelstreifens traf ihn etwas Hartes am linken Außenknöchel. Er spürte einen stechenden Schmerz und strauchelte. Er taumelte kurz, dann verlor er das Gleichgewicht. Der Asphalt stürzte auf ihn zu, näher, näher. Er ließ die Plastiktüte los. Zu spät. Schutzlos prallte er mit dem Gesicht auf den Asphalt. Das qualvolle Brennen der aufgeschürften Haut bedeutete erst den Anfang.
Gleich darauf traf ihn der erste Tritt von stahlkappen-besetzten Springerstiefeln, dem viele weitere folgten …
*
… So hatte es sich zugetragen. Genau so. Udo Förster hatte der Schilderung des Tathergangs durch die vorsitzende Richterin aufmerksam zugehört und die Geschehnisse vor seinem geistigen Auge wie einen Film ablaufen lassen. Jetzt fixierte er wieder die in eine schwarze Robe gekleidete Richterin, die gerade zu ihrer Urteilsbegründung ansetzte. Die Betroffenheit über die Straftat war ihr deutlich anzumerken. Sie sprach laut und resolut, vor allem oft in Richtung der zwei angeklagten Skinheads, die hinter einer Plexiglaswand saßen. Mit gesenkten Köpfen und versteinerten Mienen hatten sie den Urteilsspruch entgegengenommen: Haftstrafen von sechs Jahren wegen versuchten Mordes und schwerer Köperverletzung.
Die Richterin befeuchtete ihre in dezentem Rot geschminkten Lippen, ehe sie fortfuhr: »Dass es an jenem 20. Juli nicht zu einem Mord kam, lag ganz gewiss nicht an der Rücksichtnahme der beiden Angeklagten, sondern einzig und allein an den vier mutigen Jungen, die die abscheuliche Menschenjagd beobachtet hatten und die Polizei riefen. Dem schnellen Eintreffen der Beamten ist es zu verdanken, dass Anthony Satom vor dem Tod bewahrt blieb, auch wenn er, wie der behandelnde Arzt Dr. Schiller hier bezeugte, Zeit seines Lebens unter den physischen und psychischen Folgen dieser gemeinen und brutalen Straftat zu leiden haben wird. Es kommt blankem Hohn gleich, wenn die Angeklagten auf die Frage ihres Verteidigers, ob sie ausländerfeindlich seien, mit Nein antworten.«
Sie wandte sich an den Rechtsanwalt zu ihrer Rechten. »In diesem Zusammenhang erlauben Sie mir ein persönliches Wort an Sie, Herr Anwalt. Es ist natürlich Ihre Pflicht, mit Engagement die Verteidigung Ihrer Mandanten zu betreiben. Doch will ich in Ihrem eigenen Interesse hoffen, dass manche Ihrer befremdlichen Äußerungen, um es milde zu formulieren, allein Ihrem Mandatseifer für diesen Fall zuzuschreiben sind.«
Der Verteidiger Theo van Gool schaute offen vom Staatsanwalt zur Richterin und machte eine Geste, als wollte er zum Ausdruck bringen: Was soll ich machen?
Die Vorsitzende quittierte die Gebärde mit einem zufriedenen Nicken und musterte die beiden Skinheads scharf.
»Die Angeklagten haben uns die ganze Verhandlung über ein braves Sonntagsgesicht präsentiert. Ihre lamm-frommen Mienen haben jedoch weder den Staatsanwalt noch mich beeindrucken können. Ja, sie können mir nicht einmal den Zweifel nehmen, dass die Angeklagten ihre Tat überhaupt bereuen. Das Gegenteil scheint vielmehr der Fall zu sein. Das Gericht empfindet es als eine beispiellose Frechheit, wenn der Angeklagte Arnulf Ridder aufsteht und höhnisch grinsend in den Saal ruft: ›Ich beantrage die Todesstrafe für mich.‹ Oder wenn der Mitangeklagte Runge einer Journalistin entgegentönt: ›Rudolf Hess hat 46 Jahre im Knast geschafft, dagegen werden meine paar Jährchen ein Husten sein.‹ Strafverschärfend kommt hinzu, dass die Staatsanwaltschaft Indizien vorbringen konnte, die den Schluss nahelegen, dass die beiden Angeklagten einer neonazistischen Vereinigung angehören oder zumindest damit sympathisieren. Das Gericht hat sich diesem begründeten Verdacht angeschlossen, obwohl beide übereinstimmend beteuert haben, dass dem nicht so sei und es auch keine Anstifter oder sonstigen Hintermänner gebe. Dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft wurde mit Abstrichen Rechnung getragen in der Hoffnung, dass die Schärfe des Urteils die Angeklagten zu Einsicht und Reue führt. – Die Verhandlung ist beendet.«
Sofort wurde es laut im Saal, da die über 100 Zuhörer sich angeregt in Diskussionen über Tat und Urteil stürzten.
Udo Förster blieb noch eine Weile in seiner Bankreihe sitzen und beobachtete, wie Polizeibeamte den Angeklagten hinter der Plexiglaswand Handschellen anlegten und sie durch eine separate Tür abführten. Erst danach verließ er als letzter den Gerichtssaal. Mit seinem 150 PS starken Motorrad, einer Suzuki GSX, jagte er wie auf einer Rakete zur Universität.
Udo Förster war 25 Jahre alt und studierte im 5. Semester Jura. Er hatte eine Vorliebe für Jeans, die in allen Variationen seinen Kleiderschrank füllten. Sehr zum Missfallen seiner Eltern trug er sein Haar nicht mehr seitlich gescheitelt, sondern hatte einen Stoppelschnitt mit langen Koteletten, die seine Mutter lieber heute als morgen eigenhändig abrasiert hätte. Die Mitte seines jugendlich anmutenden Gesichts zierte eine leicht nach rechts gekrümmte Nase; das bleibende Resultat einer Schlägerei, die seine Eltern noch heute für ein Missverständnis hielten, bei dem ihr Sohn zu einem unschuldigen Opfer wurde. Dass er kurz nach dem Vorfall seinen Haarstil verändert hatte, hatten sie zwar zur Kenntnis genommen, aber zwischen den Ereignissen keinerlei Zusammenhang hergestellt.
Im Gegensatz zu vielen seiner Kommilitonen hatte Udo Förster das große Glück, noch bei seinen Eltern wohnen zu können, die ein Haus mit separater Einliegerwohnung besaßen. Er genoss diesen Luxus ebenso sehr wie das Motorrad, das ihm sein Vater als Belohnung für den glänzenden Notendurchschnitt von 1,2 zum Abitur geschenkt hatte.
Die Parkplätze der Universität waren wie jeden Tag hoffnungslos überfüllt, so dass Udo Förster seine Suzuki auf den Steinplatten neben einer kleinen, wegen akutem Platzmangel provisorisch errichteten Raumzelle abstellte, in der ein Teil des Studentensekretariats untergebracht war. Obwohl der Eingang zu Trakt B nur einige Meter entfernt lag, ging er den Umweg außen herum zum Haupteingang, da er auch von dort zum Vorlesungssaal 5 gelangte, dem größten der gesamten Universität.
Schon von weitem konnte Udo Förster erkennen, dass vor dem Haupteingang eine Studentengruppe einen Info-Tisch aufgestellt hatte. Die acht jungen Leute hatten sich genau vor die Glaswand postiert, so dass sie die beiden Türen zur linken und rechten Seite mit ihrem Info-Material bedienen konnten. Ein Plakat an der Glaswand verriet das Anliegen der Gruppe, die aus Deutschen, Afrikanern und Asiaten gleichermaßen bestand: Deutschland – eine geschlossene Gesellschaft? Udo Förster nahm von einer Koreanerin nur den Sonderdruck des Städtischen Volksblatts entgegen, weil er den Autor des Leitartikels kannte: Gernot Crohm – ein guter Freund seines Vaters und über die Stadtgrenzen hinaus bekannt für sein Engagement gegen Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus. Des Öfteren hatte er nach den Anschlägen und Krawallen von Hoyerswerda, Mölln, Solingen und Rostock Aktionen organisiert wie Lichterketten oder Mahnwachen und durch Artikelveröffentlichungen in Tageszeitungen klar Stellung bezogen.
Als Udo Förster wenig später auf seinem Platz hoch oben im sich allmählich füllenden Hörsaal saß, konnte er nicht gleich mit dem Lesen des Leitartikels beginnen. Ein Mitstudent nahm gerade mit seiner Freundin in der Reihe direkt vor ihm Platz und wandte sich Udo mit einem spöttischen Grinsen zu: »Der Förster vom Silberwald! Welch seltener Anblick!«
»Tag, Herr Schlau-Meyer!« gab Udo Förster zurück. »Das nächste Mal bring‹ ich dir ein Foto von mir mit.«
Der Mitstudent wandte sich an die hübsche Rothaarige neben sich: »Das braucht der Dozent wohl bald. Ein Wunder, dass er den Weg hierher überhaupt gefunden hat.« Er lachte.
Udo Förster beugte sich vor, nahe an das Ohr der Rot-haarigen. »Hätte ich auch nicht. Ich bin einfach dem Geruch von Schlau-Meyers Schweißfüßen gefolgt.«
Sie warf ihm einen strafenden Blick zu.
Für Udo Förster war das Thema damit erledigt, und er widmete sich dem Leitartikel, den ein Zitat des Schweizer Erzählers und Dramatikers Max Frisch einleitete: Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kommen Menschen! Sodann folgte ein mehrspaltiger Text:
Im letzten Jahr hat sich die Zahl der bei uns lebenden Ausländer um etwa 600 000 auf fast 6,5 Millionen vermehrt. Drei Viertel von ihnen kommen aus Mittelmeerländern. Sie wurden von uns selbst nach 1955 ins Land geholt – als dringend benötigte Arbeitskräfte zu einer Zeit, als die deutsche Wirtschaft den ersten großen Boom erlebte. Millionen von ihnen sind unterdessen wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt.
Nach Meinung vieler stellen die Ausländer für Deutschland eine wirtschaftliche Belastung dar, weil sie Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen und hier bei uns nur eine gute Rente beziehen wollen. Stimmt das?
Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung in Essen hat errechnet, was die Zuwanderung in die alten Bundesländer – ohne Asylbewerber – von 1988 bis 1991 volkswirtschaftlich bedeutet hat. Das Ergebnis: Sie bedeutete für die öffentlichen Kassen ein Gewinn von 41 Milliarden Mark. Und das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln stellte fest, dass es für eine Verdrängung Einheimischer vom Arbeitsmarkt durch Zuwanderer keine Belege gibt.
Das Essener Zentrum für Türkeistudien veröffentlichte kürzlich eine Zahl, die kaum ein Deutscher kennt: Allein die Türken steuern durch den Solidaritätszuschlag im Jahr rund 450 Millionen Mark bei. Sie helfen also handfest beim »Aufbau Ost«.
Und zu guter Letzt werden wir es der Zuwanderung zu verdanken haben, wenn aufgrund der krankenden Altersstruktur der Deutschen im Jahr 2040 eben nicht fast jeder im Erwerbsleben Stehende für einen Rentner aufkommen muss.
Der Hörsaal hatte sich inzwischen bis auf den letzten Platz gefüllt. Mit den letzten Ankömmlingen betrat auch der Dozent den Saal, stieg an den Bankreihen vorbei die Stufen hinunter und trat an sein Pult. Es verging noch einige Zeit, bis der Professor seine Unterlagen geordnet hatte und Ruhe im Saal einkehrte. Udo Förster nutzte die Zeit und las weiter:
Was ist eigentlich »deutsch« an einem deutschen Alltag? – Ist es das Ergebnis deutscher Kultur, wenn ich morgens den Wasserhahn aufdrehe und mich dusche? Oder wenn ich eine Seidenbluse anziehe, Tee trinke und dabei die Rosen auf meinem Balkon betrachte? Ist es ein Ergebnis deutscher Kultur, wenn ich während meiner Kaffeepause einen leckeren Tomatensalat mit Zwiebeln esse und die Zeitung lese? – Alle genannten Produkte sind nicht deutschen Ursprungs. Die Wasserleitung brachten die Römer, Seide und Tee kamen aus Indien, Rosen aus dem Orient. Den Kaffee brachten die Türken. Tomaten sind ein Produkt aus Amerika. Zwiebeln kommen aus Asien. Das Papier aus Arabien.
Mittlerweile hatte der Professor mit seinem Vortrag begonnen. Das Licht, das in der Pultleiste angebracht war, spiegelte sich in seiner Brille wider und ließ seine Augen wie zwei Lämpchen erglühen, sobald er von seinen Unterlagen aufsah. Während er sich in eloquenten Ausführungen über das Zivilstrafrecht erging, glitt ganz unverhofft ein aus Zeitungspapier gefalteter Flieger langsam von hoch oben bis hinunter in eine der vorderen Ränge, wo er mit der Nase vornüber in ein Schreibetui abstürzte. Auf seinem eleganten Flug versetzte er jede Bankreihe, die er überflog, in entzücktes Gelächter.
*
Das Haus der Försters lag in einem noblen Vorort der Stadt, fernab von Industrie und Straßenverkehr. Am Eingang zu dem gepflegten Anwesen mit englischem Rasen und feinen Ziersträuchern stand ein etwa eineinhalb Meter hoher Baumstumpf, in ihn hineingeschnitzt ein klobiges, unwirkliches Gesicht. Der einzige Ast besaß die Form eines menschlichen Armes. An ihm baumelte an einer Kette ein Schild mit der Aufschrift Herzlich Willkommen. Dieser Baumgeist hatte dem Ehepaar Förster während eines Urlaubs in Kärnten so gut gefallen, dass sie ihn vom Fleck weg gekauft hatten. Auch das millionenteure Haus selbst wies allerlei Eigentümlichkeiten auf, die den Betrachter in Staunen versetzen konnten. Zu den auffälligsten gehörte das kunstvolle Fenster neben dem Hauseingang, aus dem sich jemand herauslehnte. Ein Fenster, das in Wirklichkeit gar keines war, sondern eine geschickt gemachte Attrappe. Und die Person, die sich hinauslehnte, wirkte zwar lebendig, stellte aber nur eine Nachbildung Ludwig van Beethovens dar.
Das automatische Rolltor der Garageneinfahrt war geöffnet, so dass Udo Förster sein Motorrad direkt in die breite Doppelgarage fahren konnte, in der bereits die 4türige Limousine seines Vaters parkte.
Udo Förster nahm nicht die Treppe zu seiner Einliegerwohnung im Keller, von der auch eine Tür nach oben zu seinen Eltern führte, sondern wählte den Eingang im Parterre. Im Flur schlug ihm ein herzhafter Geruch von Gulasch und Paprika entgegen, der ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.
Er begrüßte als erstes seine Mutter in der Küche, die gerade die Nudeln abgoss. Im Esszimmer stellte seine Schwester einen großen Topf Gulasch auf den gedeckten Mittagstisch.
»Schon zu Hause?« fragte er seine Schwester nicht wirklich interessiert, sondern eher beiläufig, wie man eben anstandshalber etwas fragte.
»Schon? Du bist drollig!« reagierte Sina Förster pikiert und rollte die runden Augen, die dadurch noch mehr Ähnlichkeit mit Murmeln bekamen. »Ich hab‹ eine fünfstündige Deutschklausur hinter mir.«
Sie marschierte zurück in die Küche, um die Nudeln zu holen. Während Udo sich auf seinen angestammten Platz am Fenster setzte, schaute er ihr wenig beeindruckt nach. Er konnte sich nicht helfen: Mit diesem unvorteilhaften Bubikopf und den ausladenden Hüften würde sie wohl nie einen Mann abbekommen. Aber egal. Was scherte es ihn, wie seine kleine Schwester herumlief.
Im gleichen Moment wurde am anderen Ende des Esszimmers eine Tür geöffnet. Udos Vater kam aus dem Arbeitszimmer, eine kleine Lesebrille auf der Nase, in der Hand einen dicken Aktenordner. Über den Brillenrand hinweg warf er einen Blick auf seinen Sohn.
»Hallo! Wie war's bei Gericht?«
»Lehrreich. Die zwei haben jeder sechs Jahre aufgebrummt gekriegt.«
»Und? Hält der Herr Anwalt in spe das Strafmaß für angemessen?« fragte sein Vater mit einem Lächeln.
»Ich bleibe bei meiner Meinung: In Deutschland werden zu milde Urteile gesprochen.« Er deutete mit dem Finger auf den Aktenordner. »Die Raumzellen-Geschichte?«
Sein Vater nickte.
»Ganz schön plemplem«, befand Udo wenig zimperlich. »Wie kann man nur diesem Kerl vertraglich die Logiskosten für 80 Asylbewerber auf die Dauer von zwei Jahren garantieren! Man muss doch damit rechnen, dass die Zahl der Asylbewerber mal rückläufig sein kann!«
Sina kam mit den Nudeln herein und mischte sich sofort in die Unterhaltung ein.
»Darüber stand heute morgen wieder ein dicker Artikel im Volksblatt. In selbstgezimmerten Spanplattenverschlägen hat der Typ zeitweilig fast 140 Leute untergebracht. Bis zu zehn Menschen mussten da auf mickrigen 20 Quadratmetern hausen. Aber kassiert hat er fürstlich. Sich 'ne goldene Nase mit Menschen in Not verdient. Abartig! Echt abartig!« Sie schüttelte sich.
»20 Mark pro Tag mal 80 Asylbewerber. Das macht pro Monat 48.000 Mark, ich weiß«, leierte ihr Vater die Zahlen ärgerlich herunter. »Aber damals standen die Leute auf der Straße. Wir wussten nicht, wo wir so viele so schnell unterbringen sollten. Da kam uns das Angebot dieses Tischlers sehr gelegen. Und wenn wir jetzt nur noch für maximal 50 Personen zahlen, dann kommt das den Asylbewerbern zugute. Schließlich sind die Zustände in den Raumzellen teilweise menschenunwürdig.«
Udo lachte laut auf. »Welch edles Motiv! Es gibt euch jedoch nicht das Recht, die garantierte Mindestquote einfach zu reduzieren. Der Kerl kann die Stadt deswegen verklagen.«
»Hat er schon.«
»Dann lass dir mal was einfallen.« Udo schmunzelte. Als zweiter stellvertretender Oberbürgermeister wirst du ja auch fürstlich bezahlt.«
»Udo!« rief seine Mutter schockiert, die mit einer Schale Salat aus der Küche kam.
»Mehr hast du als angehender Jurist nicht zu melden?« fragte Sina ihren Bruder ziemlich entrüstet und übergoss die dampfenden Nudeln mit einer Kelle Gulasch.
»Warum sollte ich?« entgegnete Udo und goss sich aus einer Karaffe Apfelsaft ins Glas. »Die Politiker sind nun mal unsere Hoffnungsträger.«
Sina starrte ihn verdutzt an. »Sag bloß, so 'n Blech lernst du an der Uni?«
»Das ist kein Blech, liebes Schwesterchen. Das ist die Wahrheit.« Mit dem Glas in der Hand wandte er sich an seinen Vater, als wollte er ihm zuprosten. »Die Politiker sind unsere Hoffnungsträger. Sie tragen mit Eifer unsere Hoffnung zu Grabe. Prost!« Er lächelte seinen Vater an und trank einen Schluck.
In das schallende Gelächter seiner Schwester fiel erneut ein empörter Mahnruf seiner Mutter. Heiner Förster, an die Sticheleien seines Sohnes gewöhnt, schüttelte nur milde schmunzelnd den Kopf.
Alle ließen sich das leckere Essen munden, so dass für einige Augenblicke Stille herrschte. Dann führte Sina das Thema mit halbvollem Mund fort: »Nimm's nicht persönlich, Paps! Aber ihr Politiker habt nun mal nicht das beste Image. Von der S-Bahn aus konnte ich in Rothenwerder haufenweise neue Schilder sehen, die die Leute dort aufgestellt haben.«
Sie nahm eine zweite Portion Salat. »Zum Teil echt harte Sprüche. Einer hieß so: Wenn Idioten fliegen könnten, wäre das Rathaus der größte Flugplatz Deutschlands. «
Ihre Mutter schnappte entsetzt nach Luft. Doch ehe sie etwas sagen konnte, kam Heiner Förster ihr zuvor.
»Ich kann die Verdrossenheit der Menschen dort verstehen. Rothenwerder hat schon eine dioxinverseuchte Deponie und soll nun noch eine Müllverbrennungsanlage vor die Nase gesetzt bekommen. Wer würde da nicht auf die Barrikaden gehen?«
»Wohl nur einer, der im Koma liegt«, meinte Sina und besann sich dann urplötzlich auf eine Frage, die sie unbedingt geklärt wissen wollte. »Du, Paps, weißt du zufällig was über den jüdischen Friedhof in Bergfeld?«
»Er ist meines Wissens völlig verwildert. Warum fragst du?«
»Unser Geschichtslehrer will mit uns da hinfahren. Wir nehmen doch momentan die Nazi-Zeit durch.«
»Ach komm! Gib's zu! Ihr wollt ihn schänden!« rief Udo lauthals dazwischen.
»Udo!« herrschte seine Mutter ihn erbost an. Während sie für ihre Familie eine Schüssel Vanillepudding und eine Flasche Himbeersirup serviert hatte, begnügte sie als Diabetikerin sich selbst mit einer Tasse Kaffee. Sie riss das Tütchen mit der Süßstoffhuischung aus Cyclamat und Saccharin auf und ließ eine der beiden Tabletten in die Tasse gleiten. Eine kleine weiße Pille tauchte kurz in dem undurchdringlichen Schwarz unter, schoss dann an die Oberfläche zurück und rotierte munter sprudelnd und zischend am Tassenrand umher, bis sie sich vollständig aufgelöst hatte.
,ja, was denn!« wehrte sich Udo heftig. »Wäre doch nicht das erste Mal, dass ein jüdischer Friedhof geschändet wird«, rechtfertigte er sich für seine Bemerkung. »Der angestaute Frust über die vielen Ausländer und Asylanten sucht sich eben ein Ventil.«
Sein Vater fasste ihn scharf ins Auge. »Ich kann auch nicht gutheißen, dass die pauschale Bestimmung im Artikel 16 des Grundgesetzes zu einer Eintritt –«
»Was steht denn da?« unterbrach ihn Sina.
»Nur der einfache Satz, dass politisch Verfolgte Asylrecht genießen. Mehr nicht«, antwortete ihr Bruder.
Sein Vater fuhr fort: »Dass also diese Bestimmung zu einer Eintrittskarte nach Deutschland für jedermann verkommt oder zu einem Blanko-Gutschein für allen Konsum. Aber ich rate dir, mein Sohn«, er hob warnend den Zeigefinger, »eine solche Bemerkung niemals vor deinen Dozenten zu machen. Sie könnten dich missverstehen oder missverstehen wollen.«
»Hören der Nazi-Spuk und der Judenhass denn nie auf?« klagte Eva Förster mit einem tiefen Seufzer.
»Ich war neulich dabei, als der Schriftsteller Ralph Giordano hier bei uns im Polizeipräsidium mit dem Dezernenten, dem Innenminister und etlichen Polizeibeamten über das Thema Fremdenfeindlich motivierte Gewalt diskutiert hat«, erwiderte ihr Mann sichtlich bewegt. »Giordano ist ein Überlebender des Holocaust. Er hat bislang über 200 Drohbriefe erhalten. Und einige Tage vor der schrecklichen Tat in Mölln wurde ihm brieflich mitgeteilt, dass für ihn eine Gaskammer im Bergischen Land eingerichtet und bereits erprobt worden sei, wobei das Hausschwein von 69 Kilo, Giordanos Gewicht, in wenigen Minuten gestorben sei.«
Eva Förster zog ein angewidertes Gesicht. »Was für gemeine Scheusale!«
»Gehirnamputierte, Mama. Die haben da oben ein Vakuum.« Sina tippte mit ihrem Finger gegen ihren Kopf. »Mit denen muss man leben. Leider.«
Nach dem Mittagessen verließ nicht nur Heinz Förster sofort das Haus, um an seinen Schreibtisch im Rathaus zurückzukehren. Auch Udo Förster suchte unverzüglich das Weite, sehr zum Leidwesen seiner Schwester, die sich dadurch wieder einmal allein um die Spülmaschine kümmern musste. Auf seinem Motorrad fuhr Udo in den Stadtteil Kerchen. Kerchen, berühmtberüchtigt für seine Hochhäuser und Wohnkästen, hatte sogar eine Eigernordwand vorzuweisen – einen besonders hässlichen Plattenbau. Er stellte das Ziel dar, auf das Udo Förster an diesem frühen Nachmittag mit seiner Suzuki zusteuerte. Ein Ziel, das ihm nicht unbekannt zu sein schien. Denn ihn beeindruckte weder die eingeschlagene Scheibe neben der Haustür noch das Treppenhaus, in dem es penetrant nach Urin stank und dessen Wände mit allerlei Graffiti beschmiert waren. Selbst der defekte Fahrstuhl, der ihn zum Treppensteigen zwang, schien für ihn nichts Unerwartetes zu sein. Gelassen begann er, die dreckigen Stufen emporzusteigen, über die offenbar lange kein Putzlappen bewegt worden war, vorbei an einer zynischen Parole an der Wand, die nicht einmal seine flüchtige Aufmerksamkeit zu erregen vermochte: Wenn die letzten Deutschen weg sind, wird's hier erst richtig schön.
Kapitel 2
Der über 100 Plätze fassende Saal des Stadtrates füllte sich nur langsam zu der für 20 Uhr angesetzten Sitzung. Heiner Förster, zweiter stellvertretender Oberbürgermeister, saß bereits auf seinem Platz und ließ seine Blicke durch den Ratssaal mit seiner kreisförmigen Sitzordnung schweifen, während er sich mit dem Stadtdirektor unterhielt, der sich mit den Armen auf sein Sitzpult gelehnt hatte.
»Gar kein Thema. Selbstverständlich unterstütze ich Ihren Verwaltungsantrag von gestern Abend im Planungsausschuss«, bestätigte Heiner Förster sehr zur Freude des Stadtdirektors. »Es ist gut, dass der erste Antrag auf Veränderungssperre revidiert werden konnte. Ich sehe das ganz genauso. Wir brauchen die Fläche unbedingt.«
Er begrüßte zwischendurch mit einem kräftigen Händedruck den Oberbürgermeister, der mit saurer Miene neben ihm seinen Platz einnahm und sogleich einen mehrseitigen, am oberen Rand zusammengehefteten Brief auf den Tisch donnerte. Mit beißender Ironie sagte er: »Rechtzeitig zu unserer Sitzung hab‹ ich noch Eilpost bekommen. Von unserem netten Tischler. Er klagt nicht nur vor dem Landgericht; in seiner übergroßen Liebe zu den Asylbewerbern droht er jetzt auch mit einer Schadensersatzklage.«
Heiner Förster nahm den Briefkopf zur Kenntnis, der als Absender eine renommierte Anwaltskanzlei auswies. Während er mit wachsendem Zorn die Seiten überflog, sprach der Oberbürgermeister weiter: »Wir hätten inzwischen auch anderswo Asylbewerber untergebracht, obwohl er eine Option darauf habe, dass die Leute zu ihm kommen. Schließlich habe er 350.000 Mark investiert. Jetzt sollten wir ihm gefälligst die Hütte auch vollmachen.«
»Ist der Kerl denn jetzt total übergeschnappt?« ereiferte sich der Stadtdirektor. ›Wir suchen händeringend mit dieser Sitzung einen gangbaren Weg, um ihm entgegenzukommen, und er torpediert alles.«
Heiner Förster zog die Mundwinkel herab. »Da haben wir uns ja eine schöne Laus –«
Lärm brach plötzlich los. Laute, erregte Stimmen hallten durch den Ratssaal.
»… in den Pelz gesetzt«, brachte Heiner Förster seinen Satz noch zu Ende, hatte sich aber bereits erhoben und seinen Blick auf den Eingang fixiert.
Eine Menschentraube aus Vertretern aller Fraktionen stand dort dicht gedrängt, die Gemüter sichtlich erhitzt. Einige Ratsmitglieder gestikulierten erregt mit ihren Armen in der Luft herum.
Der Stadtdirektor wandte sich fassungslos um. »Was ist denn da los?«
Heiner Förster rätselte nicht lange, sondern ging energischen Schrittes hinüber zu den heftig streitenden Ratsherren. Noch immer konnte er nicht erkennen, was den Tumult verursachte. Ein kleines Handgemenge entwickelte sich, in dessen Mittelpunkt er einen Parteigenossen ausmachen konnte. Er drängelte sich durch die Menschentraube direkt auf ihn zu und packte ihn an der Schulter.
»Meine Güte, Gernot! Was soll denn das?« fuhr er seinen Parteikollegen hart an und zerrte ihn beiseite. »Bist du von allen guten Geistern verlassen?«
Gernot Crohm rückte mit erhitztem Kopf seine verrutschte Krawatte zurecht und schwieg. Der Unmut der anderen Ratsmitglieder ebbte nicht ab. Aus ihren Vorwürfen hörte Heiner Förster heraus, was der Auslöser für diesen handfesten Streit war. An der Eingangstür stand der Chef der rechtsradikalen Fraktion, die fünf Sitze im Stadtrat innehatte, hinter sich ein Plakat an der Wand, vor das er sich schützend gestellt hatte.
Heiner Förster trat entschlossen auf den jungen Mann mit dem eckigen Gesicht und der runden Brille zu und bat ihn, zur Seite zu treten. Widerwillig kam dieser der Aufforderung nach, so dass Heiner Förster das Plakat lesen konnte:
VERMISSTENANZEIGE! – Wir vermissen den Solidaritätsappell von CDU, SPD, FDP und den Grünen an ihre Mitglieder, Asylanten bei sich zu Hause aufzunehmen. DEUTSCHE MIETER werden aus Gemeindewohnungen hinausgeworfen, damit Asylanten einziehen können! Deshalb fordern wir die Altparteien auf nicht nur ihre Herzen, sondern auch die Wohnungstüren für Asylanten zu öffnen!
Jetzt konnte Heiner Förster den Unmut seiner Kollegen verstehen. Diese Aktion bedeutete eine derbe Provokation. Verärgert wandte er sich an den Vorsitzenden.
»Das ist eine billige, infame Agitation. Und das im Ratssaal! Skandalös!« wies er den Mann zurecht. »Diese Propaganda verschwindet auf der Stelle. Haben Sie mich verstanden?«
Mit dieser deutlichen Anordnung war für Heiner Förster die Angelegenheit vorerst erledigt, und er wandte sich seinem Parteigenossen zu, dessen überzogene Reaktion er keineswegs billigen konnte. Er fasste ihn am Arm und schob ihn einige Meter vor sich her, damit niemand mitanhörte, was er zu sagen hatte. Er kannte Gernot Crohm seit Jahren als einen kompetenten, besonnenen Parteikollegen und als guten Freund. Um so weniger begriff er dessen Verhalten.
»Mensch, Gernot, was ist denn bloß in dich gefahren?« fragte er erschüttert und aufrichtig besorgt. »So habe ich dich ja noch nie erlebt.«
Gernot Crohm wich seinem Blick aus und sagte nichts.
»Das ist eine Diffamierung, ja. Eine miese, antidemokratische Hetze unter der Gürtellinie, auch das«, versuchte Förster, Verständnis aufzubringen. »Und ich kann mir gut vorstellen, dass so etwas gerade dich besonders trifft, wo du doch in der Öffentlichkeit immer wieder klar Stellung beziehst gegen Schmierparolen wie Deutschland den Deutschen. Auch deinen letzten Artikel fand ich sehr ausgewogen und treffend, das weißt du. Aber wenn ausgerechnet du den Ratssaal in einen Boxring verwandelst, ist es aus mit deiner Glaubwürdigkeit.«
Er bekam noch immer keine Antwort. So verschlossen hatte er seinen Freund noch nie erlebt, und deshalb gab er nicht auf.
»Ich bin auf deiner Seite«, versicherte er Crohm. »Ich hoffe, das weißt du. Betrachten wir das Ganze als einen bedauerlichen Ausrutscher. In Ordnung?«
Wieder erntete er nur Schweigen und einen Blick, der sich an ihm vorbei im Nirgendwo verlor. Er gab seinem Freund einen aufmunternden Klaps auf die Schulter. »Es stände dir gut, wenn du dich trotzdem formell entschuldigen würdest.« Damit ließ er Crohm allein und begab sich zurück an seinen Platz neben dem Oberbürgermeister, der inzwischen die 103 Ratsmitglieder durch sein Mikrofon zum Beginn der Sitzung um Ruhe gebeten hatte. Nach ein paar Minuten kehrte endlich Stille ein, so dass die einzelnen Fraktionen ihre Standpunkte vortragen konnten. Heiner Förster hatte Mühe, sich auf die einzelnen Wortmeldungen zu konzentrieren, da Gernot Crohm genau in seinem Blickfeld saß und er immer wieder an die Entgleisung seines Freundes denken musste. Dieser Ausraster passte einfach nicht zu ihm. Er kannte Gernot als einen besonnenen, friedliebenden Menschen. Es passte nicht zusammen, dass allein das Plakat ihn so provoziert hatte, zumal es in der Vergangenheit schon öfter zu ähnlich bissigen Angriffen durch das rechte Lager gekommen war. Und niemals hatte Crohm auch nur annähernd so aggressiv reagiert. Es musste folglich etwas anderes dahinterstecken. Das Plakat konnte nicht die Ursache, sondern nur das auslösende Moment gewesen sein. Aber was kam als Ursache in Frage? Förster fiel auf, dass sein Freund fahrig und unkonzentriert wirkte, mit seinen Gedanken offensichtlich ganz woanders war als bei der Debatte, in der inzwischen ein Vertreter der Republikaner das Wort ergriffen hatte: »… Millionen von Ausländern aus aller Welt überfluten unser jetzt schon zu dicht besiedeltes Land. Die unkontrollierte Masseneinwanderung und die damit verbundene Überbevölkerung zerstören unsere ökologischen und ökonomischen Lebensgrundlagen. Zu dichtes Aufeinanderwohnen zu unterschiedlicher Menschen aus zu unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Zivilisationsstufen führt nur auf dem Papier zum friedlichen Miteinander. Die Realität sieht anders aus! In der Endstufe: Raub, Mord, Totschlag, Rassenkrawalle!«
Erste vereinzelte Widerworte aus den anderen Fraktionen hallten durch den Saal. Der Ratsherr der Rechten, ein Realschullehrer, ließ sich davon nicht beirren und fuhr fort: »Die Jugendlichen in Rostock, Quedlinburg und anderswo, die da zur Gewalt greifen, die sind keine Neonazis. Es sind junge Deutsche, die Angst haben. Angst um ihre Zukunft und um ihre Heimat. Wie sollen sie sich sonst wehren?«
Ein Ratsherr der ökologischen Partei rief aus der letzten Reihe empört: »Als Skinheads einen jungen Türken erstachen, sagte IHR Landesvorsitzender: ›Eine Schlägerei unter Jugendlichen. Das kommt doch immer mal vor.‹«
Der Realschullehrer winkte geringschätzig ab und zeigte dann mit einem süffisanten Lächeln in Richtung der Öko-Fraktion. »SIE haben's gerade nötig! Sie fordern in Ihrem Wahlprogramm ja sogar, dass selbst derjenige als Asylant zu uns kommen darf, der als Homosexueller oder Lesbierin in seinem Heimatland irgendeinen Nachteil erleidet. Und was das Thema Gewalt angeht, sollten Sie lieber ganz still sein. Wer Angehörige der terroristischen, schwerkriminellen Rote-Armee-Fraktion als politische Gefangene bezeichnet – was Sie tun! –, verdreht selbst die Wahrheit, und das auf obszönste Weise. Denn politische Gefangene werden für ihre Meinung bestraft, die RAF dagegen wegen Mord und Terror! Aber warum wundern oder aufregen? Es passt ja glänzend ins Bild. Schließlich treffen sich autonome Antifaschisten regelmäßig in Ihrem Zentrum in Göttingen. Und sogar Ihr niedersächsischer Bundesratsminister wurde dort von Kameras des Landeskriminalamtes beim fröhlichen Plauderstündchen mit Autonomen erwischt. Ihr Anbiedern bei den Linken hat Methode. Als Ihr Bundesvorstandssprecher den Generalsekretär der kommunistischen Partei Spaniens – Herrn Anguita, einen überzeugten Leninisten – nach Deutschland einlud, betonte er, dass das Treffen mit der spanischen Vereinigten Linken wichtig sei, um den Sieg nationaler rechter Gruppierungen zu verhindern. – Merken Sie eigentlich nicht, wie lächerlich Sie sich mit Ihren Vorwürfen machen? Ich empfand schon früher im Kunstunterricht, dass Rot mit Grün vermischt keine freundlichere Farbe ist als Braun.«
Seine vier Parteikollegen klatschten begeistert über den gelungenen Seitenhieb ihres Redners, der den anhaltenden Applaus schweigend genoss. Schließlich hob er von neuem an: »Das Kindergeld wurde als staatlicher Beitrag zur Erhaltung der deutschen Familien und des deutschen Volkes eingeführt. Es kann daher nicht Finanzierungsinstrument zur planmäßigen Überfremdung unseres Volkes sein.«