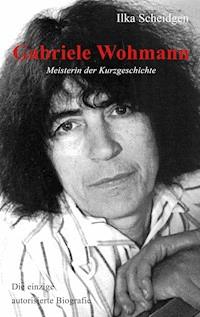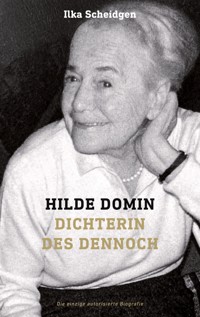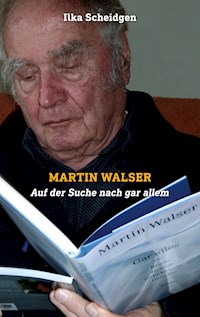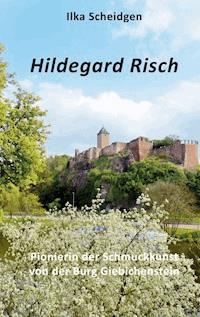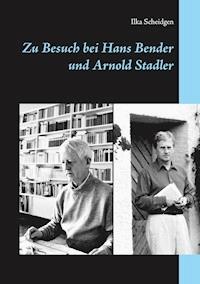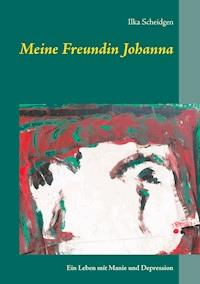Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer hat nicht schon einmal vom eigenen Haus am Meer geträumt? Andreas und Marita Zingler haben diesen Traum verwirklicht und sich ein Ferienhaus in der Bretagne gekauft, in einem noch weitgehend unentdeckten kleinen Ferienort, nur ein paar Schritte von einem weitläufigen Strand entfernt. Auch ihr ältester Sohn Cornelius folgt ihrem Beispiel. Sein Erspartes reicht allerdings nur für eine Ruine, Teil eines alten Bauernhofes, der nicht weit vom Ferienhaus der Eltern entfernt liegt. Hier will er seine Ideen als zukünftiger Architekt verwirklichen. In den Sommerferien ist eine große Runde beisammen: Andreas und Marita, ihre drei Kinder Cornelius, Leon und Gesa sowie deren Freunde. Sie alle erleben auf dem Hof in enger Nachbarschaft zu der alten Bäuerin Piclet etwas von der urwüchsigen Art des bretonischen Lebens. Das alte Bauernhaus ist Hauptschauplatz von Begegnungen zwischen Alt und Jung. Es wird gemeinsam gearbeitet und ausgiebig gefeiert, Kunst produziert und diskutiert. Andreas ist ein rechter Außenseiter, der es ablehnt, seine Bildwerke zu verkaufen. Umso mehr liebt er Gespräche über seine Ideen von Kunst, seine Vorstellungen von Welt und Zusammenleben. Der raue und melancholische Landstrich der Bretagne, die wechselvolle Unschärfe der Meeresküste sind wie ein Spiegel für die Erfahrungen der Protagonisten. Jeder von ihnen sucht auf seine Weise Erfahrung und Selbstfindung: Es ist bei den Jungen der Weg in die noch unsichere Zukunft. Für die Eltern das Loslassen der Kinder in ihre eigene Verantwortung. Die Bretagne: Land uralter Mythen mit ihren geheimnisvollen Dolmen und Menhiren und den in Granit gehauenen Kalvarienbergen ist auch heute noch ein urwüchsiger Landstrich mit seinen schroffen Felsküsten, den sie umtosenden Meeresgewalten und andererseits der Stille und Melancholie einsamer Dörfer. Diese Extreme sind es, die den Besucher faszinieren. Der Roman ist eine Entdeckungsreise in die raue, aber betörende Landschaft der Bretagne mit ihren reichen Schätzen an kulturellem Erbe. Wie bei einer großen Flut in der Natur wird im Verlaufe des Romans vieles durcheinander gewirbelt, zerstört und verändert. „Denn mit dem Warum der Dinge kommt niemand zu Ende. Die Ursachen allen Geschehens gleichen den Dünenkulissen am Meer: eine ist immer der anderen vorgelagert, und das Weil, bei dem sich ruhen ließe, liegt im Unendlichen.“ (Thomas Mann) Am Ende des Romans bekommt dieses Zitat aus Maritas Josephs-Lektüre eine ungeahnte Bedeutung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch: Wer hat nicht schon einmal vom eigenen Haus am Meer geträumt? Andreas und Marita Zingler haben diesen Traum verwirklicht und sich ein Ferienhaus in der Bretagne gekauft, nur ein paar Schritte von einem weitläufigen Strand entfernt. Auch ihr ältester Sohn Cornelius folgt ihrem Beispiel. Sein Erspartes reicht allerdings nur für eine Ruine, Teil eines alten Bauernhofes. Hier will er seine Ideen als zukünftiger Architekt verwirklichen. In den Sommerferien ist eine große Runde beisammen: Andreas und Marita, ihre drei Kinder Cornelius, Leon und Gesa sowie deren Freunde. Sie alle erleben auf dem Hof in enger Nachbarschaft zu der alten Bäuerin Piclet etwas von der urwüchsigen Art des bretonischen Lebens. Der raue und melancholische Landstrich der Bretagne, die wechselvolle Unschärfe der Meeresküste sind wie ein Spiegel für die Erfahrungen der Protagonisten. Jeder von ihnen sucht auf seine Weise Selbsterfahrung und Selbstfindung: Es ist bei den Jungen der Weg in die noch unsichere Zukunft. Für die Eltern das Loslassen der Kinder in ihre eigene Verantwortung.
Der Roman ist eine Entdeckungsreise in die raue, aber betörende Landschaft der Bretagne mit ihren reichen Schätzen an kulturellem Erbe.
Wie bei einer großen Flut in der Natur wird im Verlaufe des Romans vieles durcheinander gewirbelt, zerstört und verändert. „Denn mit dem Warum der Dinge kommt niemand zu Ende.“ (Thomas Mann) Am Ende des Romans bekommt dieses Zitat aus Maritas Josephs-Lektüre eine ungeahnte Bedeutung.
Die Autorin: Freie Schriftstellerin und Publizistin. In Berlin geboren und aufgewachsen. Ilka Scheidgen schreibt Lyrik, Erzählungen, Romane und Biografien. Sie hat bisher fünfzehn Bücher veröffentlicht.
Homepage der Autorin: www.ilka-scheidgen.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Haus am Meer
Feriengemeinschaft
Bretonische Nachbarn
Kunstgespräche
Neue Gäste
Arbeit und Spiel
Strand und Heilige
Chez Marie
Eliane und Joseph
Tändeleien
Auf und davon
Sprachverwirrung
Banges Warten
Alte Steine
Glück ist auch so eine Sache
L’existence un passage
Bretonische Handwerker und deutsche Nachbarn
Coq au Vin und andere Kunstwerke
Geisterhaus und Zauberwald
Das Warum der Dinge
Epilog
Pressestimmen zu Büchern von Ilka Scheidgen
L’être est éternel
l’existence un passage
la mémoire immortelle
en sera le message
bretonische Grabinschrift
Denn wir wandeln in Spuren, und alles Leben ist Ausfüllung mythischer Formen mit Gegenwart.
Thomas Mann: Joseph und seine Brüder
Prolog
Erst vor kurzem hatte Andreas beim Sortieren alter Unterlagen unter den Liebesbriefen, die Marita in ihrem Schreibtisch fein säuberlich aufbewahrt hatte, ein Konvolut von maschinebeschriebenen Blättern entdeckt. Er begann zu lesen und begriff, dass Marita die Geschichte ihres letzten gemeinsamen Sommers aufgeschrieben hatte, als hätte sie eine Ahnung von ihrem baldigen Tod gehabt. Ihn fröstelte bei diesem Gedanken. Was Andreas eigenartig fand, war, dass Marita das Erlebte wie in einem Roman schilderte. Und er fühlte wieder fast körperlich die Wellen, die Flut, die ihn in einen Strudel riss, von dem er nicht wusste, ob und wo er ihn wieder an Land spülen würde.
Haus am Meer
Die Werkstatt war das reinste Chaos. Gerade dieser Umstand nahm Andreas Zingler für das Haus ein. Denn in der scheinbar heillosen Unordnung hatte er sofort ein Prinzip entdeckt: dass hier jemand gewohnt hatte, der nichts weggeworfen hatte an Utensilien und Werkzeug, da sie irgendwann einmal Verwendung finden könnten. So hielt er es selbst. So hatte es sein Großvater getan, der gebrauchte Nägel nicht fortgeworfen, sondern säuberlich mit dem Hammer wieder gerade geklopft hatte.
Wie Marita ihn kannte, gekannt hatte, dachte Andreas, schon nach diesen wenigen Sätzen, viel besser wahrscheinlich, als er sie gekannt hatte. Man lebte heute in einer Zeit, in der alles fortgeworfen wurde. Aber er mit seiner Erfahrung von Flucht und Kriegsverlusten hatte noch immer das Gefühl, trainiert sein zu müssen auf den Tag hin, an dem ganz plötzlich, so wie es in seiner Kindheit gewesen war, alles zurückgelassen werden und mit dem Kärglichsten ein Leben gemeistert werden musste. Dieser eine Satz mit seinem Großvater ließ Vergangenes zur Gegenwart und diese zur Zukunft werden. So wie in seiner Kunst: die Durchbrüche, die verschiedenen Schichten und Löcher, Durchblicke auf etwas Anderes.
Und natürlich waren da das Haus selbst und der Garten, ein wenig oberhalb der Straße gelegen. Eine dicke Bruchsteinmauer fing das Grundstück auf und hinderte es gleichsam am Herunterrutschen. In die Mauer war eine schmale Passage mit einem verwitterten Gartentor eingelassen, über die ungezähmt eine wild wuchernde Hecke wuchs, so dass man sich ein wenig bücken musste, um die Stufen aufwärts in den Garten zu gelangen.
Es war, als träte man ein in eine längst vergangene Zeit.
Aufbruch in eine unbekannte Welt. Die Suche nach der blauen Blume. Diese romantische Vorstellung war ihnen beiden gemeinsam. Nicht um Besitz ging es, sondern um das Beflügeln der Phantasie. Die Welt hinter der Welt. Andreas verstand jetzt, dass es Marita war, die die Schiffe bereit hielt für den gemeinsamen Aufbruch zu neuen Kontinenten. Er selbst war im Grunde nicht wirklich frei. Nur in seiner Kunst war er es. Konnte er es sein, weil es keine Konsequenzen nach sich zog. Damals jedenfalls noch nicht. Da war nur ihre Liebe zueinander und zu den Kindern. Aber schon jetzt fühlte er etwas in sich wachsen, eine Kraft, die er früher nicht gespürt hatte. Er musste sich nichts mehr vormachen, wie toll er doch war.
Es war, als träte man in eine längst vergangene Zeit. Und in eine neue, noch unbegangene. Vieles verlor seinen Wert. Aber die Liebe trug.
Marita Zingler hatte Andreas die Wochenendzeitung wedelnd vors Gesicht gehalten, mit Schwung auf den Schreibtisch gelegt und, damit seine Aufmerksamkeit nicht wie meistens anderweitig in Anspruch genommen, mit für sie ungewöhnlich lauter Stimme die Annonce, auf die sie nun ihren Zeigefinger hielt, vorgelesen: „Bretagne, Haus am Meer, 120 qm, Nebengebäude, mit idyllischem Garten“. Sie nannte noch den Preis, der dort angegeben war. Als Andreas nicht reagierte, weil er sich offenbar in einen Artikel im Feuilleton oder Wirtschaftsteil festgebissen hatte, wiederholte Marita den Wortlaut der Anzeige und fügte an: „Dass es so was überhaupt gibt und dann für einen solchen Preis. Ich kann es gar nicht glauben“.
„Was kannst du nicht glauben“, fragte Andreas. Ein Zeichen, dass er auch beim zweiten Mal Vorlesen nicht zugehört hatte, aber immerhin jetzt Interesse bekam, womit sich seine Frau beschäftigte.
„Nun hör doch endlich“, sagte Marita, „ich habe hier etwas Unglaubliches gefunden. Haus am Meer. In der Bretagne. Und zu einem Preis, den man einfach nicht glauben kann!“
„Na, was die so Haus nennen! Kann sich wohl nur um eine Ruine handeln“, war sein Kommentar.
Dennoch hörte er plötzlich das Meer. Und sah sich als kleinen Jungen am Strand von Mecklenburg, schmeckte Salz auf seinen Lippen, spürte Sandkörner zwischen den Zehen, suchte den Horizont nach Schiffen ab.
„Du sagst ja gar nichts“, meinte Marita, die nicht sicher war, ob ihr Mann über einem Problem aus einem der gelesenen Artikel brütete oder tatsächlich in Gedanken auf das von ihr Vorgelesene eingeschwenkt war.
Kilometer feiner Sandstrand. Zwischen Meer und Himmel an diesigen Tagen keine Grenze. Grünes Meer, graues Meer, manchmal blau, wenn auch der Himmel blau war und dem Meer seine Farbe lieh. Haus am Meer, hinter der Düne, in dem er mit der Mutter wohnte. Und der Vater manchmal zu Besuch kam. Selten. Denn es war Krieg. Aber davon merkte man in dem verschlafenen kleinen Dorf an der Ostsee nichts, jedenfalls nicht viel.
„Nun sag doch mal was.“ Marita rüttelte Andreas am Arm. „Hat es dir die Sprache verschlagen?“
„Ich verspreche mir ja nicht viel davon, aber wenn du meinst, kannst du ruhig mal anrufen. Vielleicht haben sie ein Photo und ein paar nähere Informationen.“
Marita war erstaunt, dass Andreas nicht rundweg ablehnte, sich mit der Sache zu befassen. Sie kannte das aus den langen Jahren ihres Zusammenlebens. Am Anfang stand bei Andreas immer erst die Verneinung. Natürlich hatte auch sie im Laufe der Jahre ihre Taktik entwickelt, wenn es ihr galt, etwas durchsetzen zu wollen. Sie ließ ihm einfach ein wenig Zeit und versuchte dann, die Sache, die ihr wichtig war, von einer anderen Seite her anzugehen. Verfing auch das noch nicht, baute sie ein Argumentationsgebäude auf, vor dem er in den meisten Fällen kapitulierte mit dem Kommentar: Du machst ja doch, was du willst.
Eigentlich gestand sich Andreas erst jetzt ein, dass Marita die freiere von ihnen beiden war. Schon als Kind war sie in der Großstadt alleine weite Wege gegangen, hatte durch die Berufstätigkeit ihrer Eltern viel mehr Freiraum gehabt als er, der von der Mutter sehr behütet aufgewachsen war. Und das war sicher auch ein Aspekt, weshalb er sie liebte.
Natürlich machte auch Andreas, was er wollte. Es hatte während ihrer nun bald 25jährigen Ehe mancherlei Kämpfe gegeben. Jeder von ihnen war dabei ein Stück zurückgewichen und hatte dem anderen Terrain überlassen, bis es mittlerweile oft fast stillschweigende Übereinkunft in den meisten Fragen ihres gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens gab.
Es war Wochenende, und Marita nahm sich vor, gleich Montag in der Praxis, bevor der wöchentliche Alltag ihre Gedanken wieder vollständig in Anspruch genommen haben würde, bei dem Makler, der das vielversprechende, wenn nicht gar, wie ihr schien, geheimnisvolle Haus am Meer inseriert hatte, anzurufen.
Seit Jahren hatten Andreas und Marita, mal gemeinsam, mal abwechselnd sich diesem Spiel verschrieben, Anzeigen von Häusern, Grundstücken, Gutshöfen oder auch Schlössern anzusehen, manchmal nachzufragen, seltener sich Unterlagen schicken zu lassen. Eine Art zu träumen. In Gedanken aufzubrechen. Gewohntes hinter sich zu lassen. Neu anzufangen. Bis nach Australien hatte diese Form Träumerei sie bereits geführt. Das lag sechszehn Jahre zurück. Marita hatte damals noch keine eigene Zahnarztpraxis gehabt, und Andreas träumte den Traum eines freien Lebens mit eigenem Land, möglichst bis zum Horizont, als Selbstversorger. Ein bisschen hatte seine Vorstellung von Australien etwas vom Schlaraffenland an sich: sitzen auf der Veranda und die Schafherden auf den ausgedehnten Weideflächen beobachten, wie sie ganz von selbst wuchsen und Wolle produzierten und die Früchte aus dem Garten dank des immerwährenden Sonnenscheins prall und reif in die aufgestellten Körbe fielen und nur noch verzehrt werden müssten. Sogar beim australischen Konsulat waren sie damals bereits gewesen und hatten sich nach den Einwanderungsbedingungen erkundigt. Andreas als Künstler wäre als Einwanderer nicht in Frage gekommen. Aber Marita als Zahnärztin war willkommen, hätte als Ernährerin der Familie gegolten. Eine Bedingung als Voraussetzung war, dass sie zwei Jahre lang im Outback hätte arbeiten müssen. Selbst das hatte sie nicht abgeschreckt. Und so waren sie in das Land ihrer Träume geflogen, um sich vor Ort die Lebensumstände näher anzusehen. Der Traum platzte bereits nach drei Tagen, als sie erkannten, dass sie auf dem fremden Kontinent niemals würden Fuß fassen können. Fruchtbares Land war nicht zu erwerben, und in Katastrophengebieten, wo entweder Feuersbrünste oder Überschwemmungen in regelmäßigen Abständen die Lebensgrundlagen vernichteten, wollten sie sich doch lieber nicht ansiedeln. Mit ihren Vorstellungen wieder in der Wirklichkeit angekommen, hatten sie nicht versäumt, den Outback, dieses immer noch weitgehend unerforschte und unzugängliche Land im Herzen des Kontinents, zu bereisen. In elf Tagen hatten sie eine archaische Wüstenlandschaft kennen gelernt, den Uluru, den dreihundert Meter hohen Monolithen inmitten einer endlosen roterdenen Ebene mit dem unglaublichen Farbenspiel bei Sonnenauf- und untergang. Vor allem aber die Freundlichkeit der Ureinwohner, der Aborigines. Die unvorstellbare Einfachheit ihres Lebens. Einen neuen Traum nahmen sie mit zurück von der Reise auf die andere Seite des Globus: ein Leben führen zu wollen auf den Traumpfaden, ähnlich den Aborigines, die mit einem Minimum an Werkzeugen für ihr Überleben sorgten. Die die Erde kannten und die Wasserplätze in der Wüste und im Einklang mit sich und der Natur lebten.
Andreas hatte immer diese Sehnsucht nach dem ersten Paradies. Kindheit. Strand und Wellen. Die feine Linie. Horizont, das Wort kannte er damals noch nicht. Aber die Frage, was wohl dahinter ist, dort ganz weit, wo das Auge nicht hinreicht. hatte ihn im Grunde nie losgelassen.
Später hatten sie gemeinsam geträumt, Marita und er. Und nicht nur geträumt. Denn kurz nach ihrer Australienreise konnte Marita die Praxis einer Kollegin übernehmen, die sie mehrfach in Krankheitsfällen vertreten hatte und die sich jetzt in den Ruhestand begeben wollte. Das bedeutete vollen Einsatz und sah nicht nach einfachem Leben aus. Aber der Traum begleitete sie. Andreas schwärmte schon seit langem vom Leben auf dem Land. Viele Bauernhöfe in der näheren und weiteren Umgebung hatten sie sich bereits angesehen, aber das richtige war noch nicht darunter gewesen, wo sich ihre Arbeit in der Stadt und das Wohnen auf dem Land vernünftig miteinander verbinden lassen könnte. Bis eines Tages Andreas eine Anzeige vorlas, die auch Marita aufhorchen ließ: „Großes Gehöft in Alleinlage, Gesindehaus, Ställe, Nebengebäude, Wiesen, Wald, Teichanlage, renovierungsbedürftig“.
Andreas war nicht zu halten, und seine Phantasie schoss Purzelbäume.
„Da kann ich mir sicher ein geräumiges Atelier ausbauen. Und für die Kinder können wir ein Pony kaufen. Im Teich können wir Forellen züchten, und Schafe können wir sicher auch halten. Und, und, und...“
Marita dachte an das Gesindehaus und an ihren Plan, ihre Mutter zu sich zu holen. Das würde manches vereinfachen. Andreas hatte den Vorschlag gemacht, nachdem Maritas Mutter nach einer schweren Erkrankung im zweihundert Kilometer entfernten Ort sich nicht mehr so gut allein versorgen konnte. Ihr wäre geholfen, und sie hätten eine Hilfe, wenn die Omi, die von den Kindern sehr geliebt wurde, bei ihnen wäre und auch manche kleine Arbeiten übernehmen könnte.
Das wichtigste ist, hatte Andreas oft gesagt, dass sich jemand zugehörig fühlt und dass er das Gefühl hat, er wird gebraucht. Andreas schwärmte von der Großfamilie.
Und es war tatsächlich so gekommen, dass dieser Traum Wirklichkeit wurde. Seit fünfzehn Jahren lebten sie nun schon auf dem Hof. Das Gesindehaus war zwei Jahre lang während der Winterzeit nicht nur das Domizil von Maritas Mutter, sondern auch das ihre, da das eigentliche Wohnhaus so sehr heruntergekommen war, dass es in der kalten Jahreszeit nicht bewohnbar war. Da Andreas die meisten Renovierungsarbeiten selbst machte, dauerte es eine Zeit. Aber sie waren alle miteinander glücklich mit ihrem Land, dem inzwischen angelegten Gemüsegarten, den Schafen, Hühnern und Enten. Besonders ihre drei Kinder Cornelius, Leon und Gesa fühlten sich in ihrem neuen Zuhause außerordentlich wohl. Kein Nachbar, der sich über Lärm beschweren konnte, ausreichend Platz zum Spielen. Das Provisorische und Unperfekte empfanden sie als ein einziges Abenteuer. Neben Hamster, Papagei und Streifenhörnchen gesellten sich ein Hund und zwei Katzen zu ihrer Tierschar.
Da im Gelände immer ausreichend Arbeit anfiel, gewöhnten sie sich schnell daran, dass ihre Mithilfe vonnöten war. Dafür hatten sie ein Leben in großer Freiheit und konnten jederzeit ihre Freunde mitbringen.
Andreas hatte sich die ehemaligen Remisen zu einem geräumigen Atelier ausgebaut, in dem er nach Lust und Laune und zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten konnte.
Maritas Mutter kümmerte sich um den Hausgarten, hegte und pflegte Blumen und Rasen und kam durch das Arbeiten an der frischen Luft wieder richtig zu Kräften.
So waren die Jahre verflogen, immer geschäftig, niemals langweilig. Cornelius hatte durch die vielen Umbauten, bei denen er nach Zeit und Kräften fleißig mitgewirkt hatte, seine Liebe zum Bauen entwickelt und studierte seit zwei Jahren in Berlin an der Hochschule der Künste Architektur. Leon leistete nach dem Abitur gerade seinen Zivildienst in einem Altenheim. Gesa hatte ihr berufsorientiertes Praktikum an einem tierpsychologischen Institut der Universität Kiel gemacht, weil sie auf jeden Fall etwas studieren wollte, was mit Tieren zu tun hatte, am liebsten mit Schimpansen oder Gorillas.
Maritas Praxis florierte. Sie hatte eine Assistentin eingestellt, so dass sie ihre Praxiszeiten etwas reduzieren konnte und mehr Zeit für die Familie hatte. Auch die gemeinsamen Ferien ließen sich so problemlos durchführen.
Andreas schuf unermüdlich seine Kunstwerke: Bilder und Skulpturen. Zwei der ehemaligen Ställe dienten als Lager und waren fast restlos gefüllt. Aber er verkaufte keins seiner Werke. Sich in den Kunstbetrieb mit seinen Abhängigkeiten zu begeben, hatte er von Anfang an abgelehnt.
„Ich werde auch so berühmt“, sagte er immer wieder, wenn ihn jemand danach fragte, ob er denn keine Ausstellung machen wolle, ob er nicht nach einem Galeristen Ausschau halten wollte.
„Ihr werdet sehen, am Ende bin ich berühmt“, war seine wiederkehrende Antwort. „Ein solches Werk kann niemand übersehen. Eines Tages wird es einer entdecken. Und der kann dann richtig reich werden damit. Denn er hat ein geschlossenes Gesamtwerk zur Verfügung.“
In der Familie hatten längst alle aufgegeben, ihn zu ermuntern, es vielleicht doch mal zu versuchen, seine imponierenden und eigenständigen Bilder einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Das hätte er damals haben können, als der Direktor der Kunstakademie ihn an einen Kunstpotentaten vermitteln wollte. Aber dann hatte Andreas dieses Schlüsselerlebnis gehabt, als ein befreundeter Sänger einen Preis von einem großen Industrieunternehmen verliehen bekam. Die Preisverleihung hatte drei Minuten gedauert, und die Preissumme war auch eher bescheiden gewesen. Umso länger und wichtiger die Lobreden auf die Sponsoren des Preises.
Damals, zum Ende seines Kunststudiums, hatte Andreas sich geschworen: von denen machst du dich nicht abhängig. Und er hatte sich daran gehalten. Natürlich wusste er, dass er ohne Marita diesen Weg nicht hätte gehen können. Aber über ihren gemeinsamen Weg waren sie sich früh einig gewesen. Marita hatte einen Beruf, in dem sie gutes Geld verdiente und den sie liebte. Warum sollten sie nicht die üblichen Rollenklischees auf den Kopf stellen?
Wenn Andreas sich unter Künstlerkollegen mit seiner Unabhängigkeit brüstete, bekam er oft zu hören: „Ach, du sei doch still, du mit deiner Zahnärztin!“ Die meisten Freundschaften aus der Akademiezeit waren mit den Jahren sowieso zerbrochen. Viele hatten Karriere gemacht, als freie Künstler oder als Professoren. Manche von ihnen waren groß im internationalen Kunsthandel.
„Meine Zeit kommt“, war Andreas’ Kommentar, wenn große Museumsausstellungen von ehemaligen Mitstudenten irgendwo in der Welt veranstaltet wurden.
Die werden immer schlechter mit der Zeit, weil sie dem Zeitgeist und ihrer Berühmtheit Tribut zollen, pflegte er oft zu sagen, wenn er sich die Ausstellungen ansah. Mich kennt keiner. Das ist ein enormer Vorteil. So kann auch niemand bei mir Ideen klauen.
An Minderwertigkeitsgefühlen litt Andreas nicht.
Da hatte Marita ihn aber wohl doch überschätzt. War es nicht eigentlich mangelndes Vertrauen in sich und auch seine Kunst, dass er den Schritt hinaus nie getan, nie gewagt hatte. Dass er sich dem Urteil und der Konkurrenz nicht hatte stellen wollen. Natürlich, eins stimmte: er hatte unbeeinflusst von vorgegebenen Zwängen seine ureigene Bildsprache entwickeln können. Und wahrscheinlich war dies das Geheimnis seines späteren Erfolges. Aber Andreas wurde erst jetzt klar, dass Marita ihm dafür den Rücken frei gehalten hatte.
Dass er wegen seiner silbergrauen Mähne und der großen Hornbrille schon mal mit Andy Warhol verwechselt worden war, und weshalb er von manchen Freunden Andy genannt wurde, fand er nicht außergewöhnlich. Denn für so bedeutend wie diesen hielt er sich allemal. Wenn nicht für bedeutender.
Übrigens erzählte er in dem Zusammenhang, wenn er auf seine hippe Brille angesprochen wurde, gerne, dass es sich um das billigste Krankenkassenmodell handele und er dies nur aus dem Grunde immer noch habe, weil es einfach unverwüstlich sei. Das könne ihm beim Stallausmisten ruhig in den Dreck fallen. Ganz anders als die ultraleichten Designerbrillen, von denen er bei seinen Arbeiten im Atelier, weil er auf die auf dem Boden abgelegte Brille getreten war oder auf dem Hof, als der Schafbock ihn angerempelt hatte, schon etliche Exemplare eingebüßt hatte.
Mit eben dieser Andy-Brille besah sich Andreas die Altertümchen in der Werkstatt, die hinter dem Haus am Meer gegen den Hang gebaut stand. Spinnweben überspannten das Fenster in solcher Dichte, dass das Licht von außen kaum ins Innere drang. Andreas knipste die Beleuchtung an, damit er den hinteren Teil des Raumes besser untersuchen konnte. Eine Seitenwand war mit einem selbstgebauten, rohen Holzregal bestückt, in dem sich unzählig viel Gläser und ausrangierte Blechdosen befanden. Und hier erkannte Andreas die Ordnung in dem scheinbaren Chaos. Jeder Behälter war mit einem beschrifteten Etikett versehen. In einem befanden sich Nägel einer bestimmten Größe, in einem anderen Schrauben, in einem weiteren Metallringe, dort Schraubhaken, hier Muttern und so weiter. Andreas’ Handwerkerherz schlug höher. Der Mann mit dem unaussprechlichen Namen Kergaravat, der hier bis zu seinem Tod gelebt hatte, hatte nichts weggeworfen, so viel stand fest.
Jetzt hörte er Marita rufen, die zwischenzeitlich den Garten inspiziert hatte. Sie waren erst einmal ohne die Maklerin gekommen, um sich in Ruhe umzusehen. Das Haus, das sie von den Photos kannten, war nicht zu übersehen gewesen mit seinen gelben Fensterläden. In dem ganzen beschaulichen kleinen Ferienort am Meer gab es nur dieses eine mit gelben Fensterläden.
Es war Anfang Dezember. Die Sonne schien von einem makellos blauen Himmel. Der Strand war leer. Irgendwo hörte man Hundegebell. Die Wildhecke duftete betäubend. Und das im Winter.
So begeistert Andreas von der Werkstatt war, so entzückt zeigte sich Marita vom Garten. Er befand sich zwar in einem ziemlich verwilderten Zustand. Das Gras hüfthoch. Zwei Eibenbüsche ließen einen ehemaligen Schnitt gerade noch erahnen. Das Spalierobst bedurfte dingend eines fachgerechten Zuschnitts. Aber erinnerte das alles nicht an ihre Anfänge auf ihrem Hof in Deutschland? Auch dort waren Disteln und Brennnesseln meterhoch gewachsen. In ihnen flammte der Pioniergeist von damals auf. Die Grundsubstanz, soweit man dies von außen beurteilen konnte, stimmte. Das Haus hatte klare Proportionen. Fenster und Türen waren nicht, wie man es heute zu Andreas’ größtem Leidwesen bei viel zu vielen neuen Häusern findet, irgendwo, wo man gerade ein Fenster brauchte, in die Mauer eingelassen. Hier stimmte einfach alles: Die Eingangstür in der Mitte, rechts und links jeweils zwei Fenster, in der ersten Etage genau über der Tür ein Fenster und exakt über den unteren vier Fenstern die der oberen Etage. Höhe und Breite der Fenster standen in klarem Verhältnis zu den Maßen des Mauerwerks.
Die Blendläden im Obergeschoss waren nicht verschlossen, so dass Andreas und Marita die Einteilung der Fenster sehen konnten: die unteren zwei Drittel schmal und hoch, das obere Drittel zu einem Stichbogen gerundet Marita fühlte sich an die Wohnung in Berlin erinnert, in der sie ihre Kindheit verbracht hatte. Und auch bei Andreas lösten diese Fenster nostalgische Gefühle aus. Nicht nur das Meer, nein auch das Haus mit seinen Fenstern rückten seine Kinderjahre in Mecklenburg wieder vor seine Augen.
Marita und Andreas sahen sich an. Ohne etwas zu sagen, wussten sie, dass sie sich bereits entschieden hatten.
Mit Madame Bourgeois, der Korrespondenzmaklerin des deutschen Maklerbüros hatten sie für morgen einen Termin vereinbart, bei dem sie sich, wie diese es vorgeschlagen hatte, vielleicht noch zwei oder drei andere Häuser ansehen würden. Aber sie waren sich schon jetzt sicher, dass keins ihnen so gut gefallen würde wie dieses hier.
Im nahe gelegenen Hotel „Oasis“ nahmen Andreas und Marita ein mehrgängiges Menu, Vorspeise Crevetten, Hauptgang Fruits de Mer, Nachspeise Crème Caramel ein und ließen sich einen vorzüglichen Muscadet servieren. Ihr Blick ging über die weitgeschwungene Bucht, an deren Ende der kleine Ferienort mit „ihrem“ Haus sich an eine felsig aufragende Steilküste schmiegte. Sie fühlten sich beschwingt. Der bevorstehende Kauf eines Hauses, die bereits sich einstellenden Gedanken zu Gestaltung und Einrichtung ließen Frühlingsgefühle keimen, so dass ihnen ihre kleine Reise beinahe wie eine Hochzeitsreise vorkam. Zu Hause in Deutschland war im Prinzip alles fertig. Bis auf die Tochter waren die Kinder aus dem Haus. Und die Zeit, bis auch Gesa das Elternhaus verlassen würde zum Studium, war absehbar. Vielleicht waren diese Umstände uneingestandener Maßen und instinktiv der Grund, noch einmal etwas ganz Neues anzufangen. Viele ihrer Freunde hatten sich scheiden lassen, neu geheiratet, lebten in so genannten Patchwork Familien, hatten auf andere Weise ihre Neuanfänge gehabt.
Nach dem Essen gingen Marita und Andreas zum Strand. Bei Ebbe konnten sie auf dem festen Sand so weit hinausgehen, dass sie hinter den die Bucht begrenzenden Steilküsten in weitere kleine Buchten schauen konnten. Von dort entdeckten sie in dem Häusergewürfel am Hang auch wieder das Haus mit den gelben Fensterläden, dessen Anblick ihnen nun schon vertraut vorkam.
Im Hotel waren sie die einzigen Gäste. Sie genossen die Stille und das vom Meer heraufziehende Rauschen der sich nähernden Wellen. Die Sonne war in eine Nebelbank am fernen Horizont, dort wo zwei Landzungen von rechts und von links in die Bucht hineinragten, in zart abgestuften Lilatönen gesunken.
Marita stieß Andreas an: „Schau doch mal die Wellen. Sie springen zum Ufer wie eine galoppierende Schafherde!“
Andreas lachte und nahm Marita in den Arm. „Du vermisst doch nicht etwa unsere Schafe? Guck mal den Mond und den Glimmer auf dem Wasser. Es ist phantastisch. Ich habe nicht geglaubt, dass ich das noch einmal so erleben würde wie als kleiner Junge.“
Am nächsten Morgen trafen sie sich mit Madame Bourgeois in deren kleinen Maklerbüro im nächst größeren Departementstädtchen, zwanzig Kilometer landeinwärts gelegen. Die freundliche Mittvierzigerin begrüßte sie in französisch eingefärbtem Deutsch. „Guten Tag und herzlich willkommen in der schönen Bretagne!“, schob gleich noch die französische Version nach: „Bonjour et bienvenue en Bretagne! Haben Sie eine gute Fahrt gehabt?“
Andreas und Marita bejahten ihre Frage und berichteten, dass sie das Haus, dessen Unterlagen sie in Deutschland von Herrn Becker bekommen hatten, bereits entdeckt und von außen besichtigt hätten.
„N’est-ce pas, das ist wirklich etwas ganz Hübsches. Ein außerordentlich rares Angebot.“
Die Zinglers nickten zustimmend.
„Eh voilà, ich hätte da noch zwei andere interessante Offerten. Ich deutete es bei unserem Telefonat schon an. Wo Sie schon mal hier sind und so weit gefahren sind, sollten wir uns diese beiden Objekte ruhig auch noch ansehen. Je mehr man gesehen hat, desto eher weiß man, was man wirklich will.“
Anita und Andreas sahen sich an und lächelten verstohlen, weil sie der Maklerin nichts von ihrer bereits getroffenen Entscheidung sagen wollten. Und vielleicht hatte sie ja auch Recht, und es war wirklich sinnvoll, etwas zum Vergleichen zu haben.
Madame Bourgeois blätterte in ihren Aktenordnern mit Exposés und Farbbildern von Hunderten von Häusern.
Den erstaunten Blick ihrer Kunden bemerkend sagte sie: „Oh, Sie müssen nicht denken, dass das alles solche Objekte sind, wie Sie eins wollen. Die meisten sind auf dem Land gelegen, in Dörfern, selten schon mal eins darunter mit Meerblick, das heißt dann aber nicht am Meer gelegen, sondern, dass man das Meer sehen kann, vielleicht aus einem Kilometer Entfernung oder wenn man Glück hat aus weniger, dann aber nicht unverbaut, so wie es Ihnen vorschwebt.
Ich habe tatsächlich unter den vielen Angeboten nur drei Häuser in unmittelbarer Nähe zum Meer. Und ich kann Ihnen versichern, dass die nicht lange auf einen Käufer warten müssen.“
Madame Bourgeois machte mit der rechten Hand eine Bewegung, als fege sie einen Stapel Blätter vom Tisch, und machte dazu ein Geräusch wie „huiitt“, was unterstreichen sollte, dass derartige Objekte wie der Wind so schnell vom Verkaufstisch verschwunden seien.
„Hier“, sie zeigte auf ein weißes Haus mit blauen Blendläden, „habe ich ein Fischerhaus, ein ehemaliges Fischerhaus natürlich, das direkt am Strand steht. So nah ans Meer dürfte man heute gar nicht mehr bauen. Eine echte Perle! Erst vor einer Woche hereingekommen. Das sollten wir uns unbedingt ansehen.“
Sie blätterte weiter und holte eine Klarsichthülle mit einem anderen Photo heraus.
„Auch dies hier ist ein sehr schönes Objekt. Ein traditionell gebautes bretonisches Haus mit Granitsteineinfassungen, sehr solide. Und mit einem atemberaubenden Blick aufs Meer, da es auf einer Klippe liegt.“
Andreas und Marita mussten einräumen, dass die beiden Häuser ebenfalls nicht uninteressant waren. So stimmten sie zu, sich zunächst diese anzusehen.
„Die beiden Häuser liegen nur ein paar Kilometer voneinander entfernt“, sagte Frau Bourgeois. „Es ist nur eine knappe Autostunde von hier entfernt, weiter im Süden, an der Bucht von Audierne.“
Während der Autofahrt erzählte die rührige Maklerin, dass seit einigen Jahren die Bretagne bei Deutschen offenbar immer beliebter würde und sie schon viele Häuser an Deutsche verkauft habe. Auch schon einige Details über Kaufverträge in Frankreich. Dass man grundsätzlich einen Vorvertrag abschließe, den so genannten „Compromis de vente“, der aber bereits bindend sei. Bis das Notariat alle Formalitäten erledigt habe, vergingen etwa zwei Monate, dann würde der eigentliche Kaufvertrag unterzeichnet, der „acte authentique“.
Andreas rechnete im Stillen. Dann könnten sie also Ostern schon ihr Haus in Besitz nehmen.
„Wir sind da.“
Madame Bourgeois fuhr ihren weißen Peugeot links vom Asphaltweg auf den Sand und hielt vor einer weiß gekalkten mannshohen Bruchsteinmauer.
Sie befanden sich unmittelbar an einem mit dicken Kieseln übersäten endlos langen Strand, an den hohe Wellen wild aufschlugen.
„Und wo ist das liebliche kleine Fischerhaus?“
Die Maklerin bemerkte den suchenden Blick ihrer Kunden und lachte.
„Ja, hier können Sie sehen, dass in früheren Zeiten das Meer als eine Gefahr angesehen wurde. Man schütze sich davor mit hohen Mauern oder baute in sicherer Entfernung. Die Menschen heute betrachten das Meer immer nur aus ihrer Freizeitperspektive und möchten so nah dran sein wie möglich. Aber das ist wirklich nicht sinnvoll. Denn das Meer kann gefährlich und zerstörerisch sein.“
Hier an diesem wilden Strand am offenen Ozean bekamen auch Marita und Andreas eine Ahnung davon.
Frau Bourgeois hatte inzwischen das Tor, das in die Mauer eingelassen war, aufgeschlossen, und sie betraten einen durch die Mauern völlig abgeschirmten Hof.
Vor ihnen im Sonnenschein stand das nette Häuschen vom Photo. Tatsächlich ein Kleinod. Andreas fühlte sich schon wankelmütig werden. Es präsentierte sich wie ein Postkartenidyll.
„Dies hier ist wirklich etwas ganz Besonderes“, unterstrich Madame Bourgeois beim Betreten des Hauses. „Die Eigentümerin hat das Haus sehr liebevoll restauriert, wie Sie gleich sehen werden.“
Marita zeigte sich sehr angetan von der netten, in Blau und Weiß gehaltenen Küche mit den blitzenden Kupfertöpfen über dem Herd, während Andreas gleich weiter in den Wohnraum steuerte. Der Boden war weiß gefliest, zwei offene Kamine nahmen Kopf- und Stirnseite des Raumes ein. Eine offene Holztreppe führte ins Obergeschoss.
„Wirklich geschmackvoll gemacht“, sagte er zu Marita, die ihm gefolgt war und ebenfalls mit Wohlgefallen ihre Blicke in dem sehr hübsch mit alten bretonischen Möbeln ausgestatteten Zimmer umherwandern ließ.
Frau Bourgeois führte ihnen noch das Badezimmer und die beiden oben gelegenen Schlafzimmer vor und sah sie gespannt an.
„Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Etwas Derartiges haben wir nur äußerst selten im Programm.“
Die Zinglers mussten zugeben, dass das Haus ihnen sehr gefiel.
„Natürlich ist der Preis auch ein ganz anderer“, räumte die Maklerin ein. „Dafür ist hier alles schon komplett saniert, wie Sie feststellen können.“
„Warum will die Besitzerin das schöne Haus überhaupt verkaufen“, wollte Andreas wissen. „So etwas gibt man doch nicht wieder aus der Hand!“
Über die Beweggründe zum Verkauf konnte Madame Bourgeois nichts mitteilen, ließ aber durchblicken, dass es sich bei der Eigentümerin um jemanden handele, der schon mehrfach Häuser gekauft, renoviert und dann wieder verkauft habe.
Das schien Andreas und Marita doch ein wenig suspekt. Sie besahen sich daraufhin das Haus noch einmal mit kritischeren Augen. Seltsamerweise erschien ihnen jetzt die frische Farbe überall in einem anderen Licht. Was wenn damit zum Beispiel Feuchtigkeitsstellen übertüncht worden waren, damit man sie nicht erkennen konnte.
„Mensch Andy, hast du überhaupt das Meer vom Haus aus gesehen?“
Marita kniff vor Aufregung in Andreas’ Arm.
Auch Andreas fiel erst jetzt auf, dass sie beim Besichtigen des Hausinneren gar nicht darauf geachtet hatten, ob man aus einem der Fenster überhaupt auf das Meer sehen konnte.
„Aus dem Badezimmerfenster hat man einen sehr schönen Blick auf den Ozean“, beeilte sich Madame Bourgeois zu erklären. „Man könnte daneben zum Beispiel einen Wintergarten anbauen – eine eigentliche Hauserweiterung ist bei diesen alten strandnahen Häusern leider absolut ausgeschlossen – und hätte dann einen unverbaubaren Panoramablick.“
Mit einemmal bekam die Postkartenidylle Schieflage.
Erst jetzt fiel ihnen auch auf, dass der von der Mauer umschlossene Garten zwar windgeschützt war, was wahrscheinlich erklärte, dass ein Mimosenstrauch, der ja bekanntlich gegen jedes Lüftchen
„mimosenhaft“ empfindlich reagiert, prachtvoll blühte. Aber man hatte von hier keinerlei Blick aufs Meer.
„Oh, Sie werden den Schutz der Mauer zu schätzen wissen“, wandte Frau Bourgeois ein, die den unzufriedener werdenden Ausdruck auf den Gesichtern ihrer Kunden bemerkte. „Der offene Ozean kann schon sehr rau sein, besonders im Winter, aber auch im Frühjahr und Spätherbst. Dann wohnt man hier wie in einer kleinen Burg, sicher vor den Sturmgewalten.“
Marita dachte an den Obstgarten beim Haus mit den gelben Läden, an die duftende Hecke, die das Grundstück offenbar ausreichend gegen Wind und Wetter schützte und hakte das Fischerhaus schon mal ab.
Andreas musste an die Werkstatt denken und an den Blick auf die Meeresbucht zu Füßen des Hanges, an dem ihr Traum- und Wunschhaus lag. Nein, selbst wenn noch eine Menge Arbeit vor ihnen läge – den Zustand im Inneren des Hauses kannten sie ja noch nicht – einem Vergleich mit dem Haus mit den hohen Fenstern konnte dieses zwar auch recht hübsche und dem Anschein nach auch authentische ehemalige Fischerhaus nicht standhalten.
Die Maklerin schaute auf die Uhr und drängte zur Weiterfahrt.
„Das eine Haus auf der Klippe wollen wir uns schnell noch ansehen. Es liegt praktisch auf unserem Weg.“
Sie erzählte auf Maritas Frage hin, dass das Haus einer cleveren Bäuerin gehörte, die leider, was den Verkaufspreis anginge, etwas übertriebene Vorstellungen habe. Dennoch sei das Objekt nicht uninteressant.
„Da haben Sie garantiert einen für alle Zeiten unverbauten Meerblick.“
Sie fuhren eine schmale zwischen Heide und Ginster sich schlängelnde Straße bergan. Vereinzelt standen hier und dort, verstreut, neuere Häuser, alle in derselben Art und Weise gebaut: die Eingangstür mit einem Rundbogen, die Fenster mit Granitsteinen eingefasst, in den Dächern Veluxfenster oder bei den etwas aufwendigeren Dachgauben. Die an sich schöne Landschaft mit ihrem ausgedehnten Heidebewuchs wirkte etwas trostlos in ihrer Zersiedelung.
„Hier hat man keine sehr kluge Siedlungspolitik betrieben“, meinte Andreas zu Madame Bourgeois, die dem Gesagten durch ein Kopfnicken zustimmte, während sie mit der rechten Hand auf ein allein stehendes Haus auf dem Hügel, den sie gerade hochfuhren, zeigte.
„Da ist es. Wir können es uns von außen ansehen. Die Schlüssel müsste ich von der Bäuerin holen.“
Aber sie ahnte bereits, dass das Haus auch nicht das richtige für ihre, so schien es, etwas verwöhnten deutschen Klienten, sein würde.
Dennoch stieg sie aus, umrundete mit ihnen das etwas schmucklose Gebäude und ging mit ihnen die etwa dreißig Meter bis zur Klippe.
„Das ganze Gelände gehört dazu, bis runter zum Meer, insgesamt sind es ungefähr zwanzigtausend Quadratmeter Land. Da kann Ihnen keiner vor der Nase bauen. Außerdem ist im Bereich der Klippen bis dreihundert Meter landeinwärts striktes Bauverbot.“
Madame Bourgeois lächelte aufmunternd.
„Hier haben Sie Meer, Meer und nochmals Meer!“
In der Tat, mit ihrer Bemerkung hatte die Maklerin Recht. Das war schon faszinierend, wie das Meer gegen die Klippen toste und sich die Wellen in weißer, hoch aufsprühender Gischt am Felsgestein brachen, rückwärts strudelten, um sich in neuer Reihe aufzubäumen gegen die etwa zwanzig Meter steil abfallende Mauer aus Felsen.
So faszinierend der Ausblick aufs Meer war, so hatte doch der Bewuchs des Grundstücks etwas Abweisendes, dachte sie. Kein Baum, kein Strauch, nur bodendeckend und, wo sich nicht ein Pfad befand, ohne Stiefel nicht durchquerbares Dornengestrüpp. Auch um das Haus herum hatte man keinerlei Bepflanzung vorgenommen.
Andreas und Marita drängten bald zum Aufbruch, um endlich ihr Haus zu besichtigen.
Auf der Landstraße unterhalb eines sanften Höhenrückens sahen sie linkerhand die Bucht, an der sich der Ort mit ihrem Ferienhaus befand. Sie bogen von der Straße nach links ab und fuhren hinunter zum Meer. An einer Rechtskurve standen malerisch drei Pinien, zwischen denen das Meer tiefblau aufblitzte.
„Manche Leute halten diese Bucht für eine der schönsten in der südlichen Bretagne“, sagte Madame Bourgeois.
Diese Ansicht hielten Marita und Andreas für nicht übertrieben. Auch wenn sie noch nicht unbedingt Bretagnekenner waren. In den vergangenen Jahren hatten sie dreimal an verschiedenen Orten der Süd- und Nordbretagne Urlaub gemacht. Von ihren Ferienorten hatten sie Ausflüge unternommen und das abwechslungsreiche Land schätzen gelernt mit seiner Megalithkultur, seinen alten Kirchen in den Enclos paroissiaux, den eingefriedeten Pfarrbezirken, und seinen Calvaires, den in grauem Granit gehauenen szenischen Darstellungen der Passionsgeschichte, die es in ihrer anrührenden Schlichtheit besonders Andreas angetan hatten.
Gerade fuhren sie am Pfarrhof des Ortes vorbei, zu dem ihr Ferienort gehörte.
Dörfer wurden früher grundsätzlich in sicherer Entfernung zum Meer erbaut. Dass Häuser in unmittelbarer Nähe zu Stränden errichtet wurden, war eine Entwicklung, die erst Anfang des 20. Jahrhunderts mit einer veränderten Freizeitgestaltung begonnen hatte.
Madame Bourgeois lenkte ihren Wagen hinunter zur Strandpromenade, schwenkte in den kleinen Kreisverkehr ein und stellte das Fahrzeug vor der „Bar de la Mer“ ab.
„Da sind wir. Der Ort hat viel Charme, finden Sie nicht? Und da ist das Ferienhaus. Aber das kennen Sie ja bereits. Es ist übrigens eins der ältesten im Ort. So etwa von 1910.“
Marita griff nach Andreas’ Hand, als sie nun die wenigen Schritte auf das Haus zugingen. Es kam ihr vor, als kämen sie nach Hause, so vertraut kam ihr das Haus schon jetzt vor.
Wieder unter der Hecke hindurch in den märchenhaften Garten. Und nun standen sie vor der Eingangstür mit der abblätternden rötlichen Farbe, die ein wenig schief in den Angeln hing.
Die Anspannung stieg, als Madame Bourgeois den Schlüssel im Schloss drehte. Was würde sie im Innern erwarten?
„Darf ich vorgehen und die Fensterläden öffnen? Im Dunkeln gewinnen Sie sonst keinen rechten Eindruck“, sagte die Maklerin und ließ Marita mit Andreas draußen stehen.
Es knarrte und knarzte hinter ihnen, während sie die Blicke hinunter zum Strand richteten. Ein bisschen müsste die Hecke heruntergeschnitten werden, dann hätten sie die volle Sicht auf die kilometerlange Sandbucht zu ihren Füßen. Diese Überlegung stellte Andreas laut, zu Marita gewandt, an. Es schien schon alles klar zu sein. Noch immer hielten sie sich an den Händen wie ein frisch verliebtes Paar.
Frau Bourgeois erschien in der Tür und bat sie mit einladender Geste einzutreten.
Von dem kleinen Flur aus führte sie sie zuerst in das rechts liegende Zimmer, das von einem mit Bruchsteinen eingefassten Kamin dominiert wurde. Dahinter lagen Küche und Bad. Aus der Küche gelangte man in den Hof hinter dem Haus, an dem sich die von Andreas ausgiebig inspizierte Werkstatt befand.
„Wie Sie sehen, es muss schon noch eine Menge an dem Haus getan werden. Der alte Herr, der hier bis zu seinem Tod lebte, hat nicht mehr sehr viel angelegt.“
Der linksseitige Raum im Erdgeschoss war so etwas wie die gute Stube gewesen. Hier war der Fußboden aus Eichenparkett. Von dort ging es in einen weiteren Raum und ein zweites Badezimmer. „Die Tapeten sehen eigentlich noch recht ordentlich aus“, dachte Marita, die überlegte, dass es vielleicht mit einem weißen Anstrich der buntgeblümten Wände getan sein könnte.
Andreas sagte ungewöhnlicherweise gar nichts. Normalerweise bedachte er alles mit ausführlichen Kommentaren.
Sie stiegen die Treppe hinauf zur oberen Etage. Auch hier waren die Zimmer bunt tapeziert, das eine gelb, das andere blau. Zwischen beiden befand sich ein allerliebstes kleines Kabinett. Marita dachte sofort: das wird mein Lesezimmer. Ein Tischchen vors Fenster, Regale an den Wänden, einen bequemen Sessel, und dann lesend sich hinwegträumen. Die Räume waren infolge der hohen Fenster lichtdurchflutet. Und der Blick aufs Meer war von hier oben atemberaubend schön. Rechterhand eine alte Zypresse, die mit ihrem satten Grün einen herrlichen Kontrast zum Gelb des Sandstrandes und dem Blau von Himmel und Meer bildete.
Die schöne alte Holztreppe führte weiter hinauf ins Dachgeschoss. Madame Bourgeois riet zum Ausbau desselben. Hier könnte man ein oder zwei zusätzliche Zimmer schaffen, mit wenig Aufwand, wie sie meinte.
„Wir schauen uns noch die Garage an“, sagte sie im Hinuntergehen. „Die könnte man auch umgestalten zu einem Gartenpavillon oder einer kleinen Dependance für Gäste.“
Mit Vorschlägen geizte die Maklerin nicht. Sie hatte im Gespür, dass ihre Kunden sich an diesem Objekt festgebissen hatten und wollte mit zusätzlichen Anreizen zu einem zügigen Abschluss des Geschäfts beitragen.
„Wenn man bedenkt, was man aus der Sache machen kann, ist das Objekt bei dem Kaufpreis geradezu ein Schnäppchen. Wie gesagt, so etwas bleibt nicht lange im Angebot.“
Wieder machte sie diese Handbewegung mit dem begleitenden sssttt-Geräusch.
Die Garage bildete den Abschluss des Gartens zur Nordseite hin. Der rabattenbegrenzte Kiesweg dorthin zwischen hohen Lorbeerbäumen auf der einen, Obstbäumen auf der anderen Seite führte auf eine Tür mit einem Glasfenster zu. Wenn man sich dort umwandte, hatte man den ganzen Garten, das Haus und den Ausblick auf die Bucht aus einer anderen Perspektive.
„Diese Maklerin versteht ihr Geschäft“, dachte Marita. Als Garage war das lang gestreckte Gebäude in der Tat viel zu schade. Zumal nur wenige Schritte vom Grundstück entfernt an der Strandpromenade ausreichend Parkplätze vorhanden waren.
Andreas warf einen neugierigen Blick durch das Sprossenfenster der Garage, die sie bei ihrem ersten Rundgang ohne die Maklerin ganz außer Acht gelassen hatten. Allzu viel konnte man allerdings durch die stark verstaubten Glasscheiben nicht erkennen.
Beim Betreten des ungefähr fünf mal neun bis zehn Meter großen Raumes entfuhr ihm ein erstauntes „Ah“.
Hier sah es fast noch chaotischer aus als in der Werkstatt. Nur waren es hier keine Werkzeuge oder Handwerksutensilien, die sich in verstaubten Regalen türmten, sondern alte Jacken und Hosen auf Bügeln über eine quer durch die Garage reichende Eisenstange gehängt. Alte Gummistiefel zuhauf. Und jede Menge Angeln, Reusen, Muschelkörbe und Kisten mit Anglerzubehör.
Der Sohn des verstorbenen alten Mannes, der das Haus zum Verkauf anbot, hatte offenbar wirklich nicht eine Sekunde an Gedanken oder gar Arbeit aufgewendet, um die Hinterlassenschaften zu sichten und auszusortieren.
Die Besichtigung war abgeschlossen. Andreas hatte es auf einmal eilig, sich von Frau Bourgeois zu verabschieden. Aber erst mussten sie noch gemeinsam zu ihrem Büro, wo sie ihren Wagen stehen gelassen hatten.
Madame Bourgeois nutzte daher die verbleibende gemeinsame Zeit, um die drei Objekte, die sie sich angesehen hatten, noch einmal Revue passieren zu lassen. Sie verstand es geschickt, Vorzüge und Nachteile gegeneinander aufzurechnen, so dass bei allen drei am Ende die Vorzüge überwogen. Anscheinend wollte sie sich alle Optionen offen halten.
Am Büro angekommen, bat sie Marita und Andreas doch noch einzutreten, um ihnen einen genormten Vorvertrag in französischer Sprache und in deutscher Übersetzung auszuhändigen.
„So können Sie sich schon einmal mit den Formalien vertraut machen. Die sind bei jedem Hauskauf dieselben. Wir können diesen Teil des Vertrages bis zum eigentlichen Vertrag, dem ‚acte authentique’, ohne weiteres auf postalischem Weg erledigen. Und zögern Sie nicht zu lange mit Ihrer Entscheidung.“
Die Maklerin war sich ziemlich sicher, dass es zu einem Vertragsabschluß kommen würde. Sie lachte und machte die schon bekannte Wischbewegung.
„Sonst könnte am Ende das falsche Haus übrig bleiben.“
Jetzt zwinkerte sie wahrhaftig noch mit den Augen.
„Ich meine natürlich, das von Ihnen bevorzugte weg sein. Übrigens, sollte Ihre Wahl auf das letzte Objekt fallen“, Madame Bourgeois setzte ihr gewinnendstes Lächeln auf, „bin ich Ihnen gerne bei der Vermittlung von Handwerkern behilflich. Wie selbstverständlich auch bei der Anmeldung von Strom, Wasser, vielleicht der Einrichtung eines hiesigen Bankkontos und was alles mit dem Erwerb einer Immobilie im Ausland verbunden ist.“
„Natürlich alles kostenfrei. Das gehört zu unserem Service.“
Die agile und geschäftstüchtige Maklerin, die es gleichwohl verstand, dem Kunden durch ihre verbindliche Art Vertrauen einzuflößen, schob die letzte Erklärung eilfertig nach, als sich Marita und Andreas bereits der Tür zuwandten, das Couvert mit den Vertragsentwürfen unterm Arm.
„Haben Sie vielen Dank“, sagte Andreas. „Sie hören bestimmt von uns.“
Kaum ins Auto gestiegen, sprudelte Andreas los.
„Diese gute Madame ist mir mit ihrem vielen Gerede ganz schön auf den Geist gegangen. Und dann diese fürchterliche Armbewegung! Als wenn sie es mit Bekloppten zu tun hätte! Dass sich Häuser in solchen tollen Lagen gut verkaufen, muss man wohl nicht mal einem Blöden erklären...“
Andreas zog die Gänge ihres alten Audis hoch, als wollte er in einer Rallye den ersten Preis gewinnen. Sie fuhren die Strecke zurück, die sie gerade gekommen waren. Die Landschaft war hügelig und kurvenreich, und es machte ihm offensichtlich Spaß, mit hoher Geschwindigkeit dem Objekt seiner Sehnsucht wieder nahe zu kommen.
Auf der geraden Straße unterhalb des Bergkammes, von der aus man diesen wunderbaren Blick auf die Bucht hatte, sah er zu Marita herüber und sagte: „Der Würfel ist gefallen.“
Marita brauchte nicht zu fragen. Sie wusste, er meinte das Haus mit den gelben Fensterläden. Sie musste auch nicht widersprechen. Denn auch ihre Entscheidung stand schon fest.
Es kam in den letzten Jahren ihres Zusammenlebens immer häufiger vor, dass sie im gleichen Moment dasselbe dachten. Das war beileibe nicht von Anfang an so gewesen. Andreas war in seinen Meinungen sehr dominierend. Und Marita hatte eher auf eine stille Art opponiert, hatte manchmal auf verschlungenen Pfaden und mit einiger Zeitverschiebung doch das erreicht, was sie gerne durchsetzen wollte. Sei es in der Kindererziehung, sei es in Fragen der Anschaffung von Gegenständen. Oft hatte es lautstarke Auseinandersetzungen gegeben, nach denen sie sich zu ihrer Rettung in ihre Arbeit hatte stürzen können. Aber das viele, das sie nun schon gemeinsam in Angriff genommen und bewältigt hatten, die Pläne auszuwandern, den Kauf und Ausbau ihres Hofes, hatten die gemeinsame Basis verbreitert und gestärkt. Und oft schwärmte Andreas bei Freunden über seine Frau und betonte, dass keine andere das alles mitgemacht hätte.
Am kleinen Kreisel, von dem aus sie ihr Haus sehen konnten, bog Andreas auf die Uferstraße. Die Flut ließ die Wellenkämme gegen die Steinquader der Uferbefestigung klatschen.
„Lass uns noch ein wenig am Strand spazieren gehen“, sagte Marita, „und dann trinken wir im Hotel einen Champagner auf unser Sommerhaus in der Bretagne.“
Zwei Monate später waren sie stolze Besitzer eines Hauses am Meer.
Feriengemeinschaft
Sie saßen zu acht an den zusammengestellten Biertischen, einer Eroberung aus der Nachwendezeit, als Cornelius mit einem Handkarren durch Ostberliner Bezirke gepirscht war und vom reichlich auf den Straßen abgestellten Sperrmüll alles Brauchbare gesammelt hatte. Den dazugehörigen Klappstühlen fehlte hier und da eine Holzlatte, ansonsten waren sie noch gut zu gebrauchen.
Auf dem Tisch standen ein großer Topf mit Spagetti, daneben ein kleinerer mit Tomatensoße, die Bettina, Cornelius’ Freundin, zubereitet hatte. Es duftete nach frischen Kräutern. Salbei, Majoran, Thymian und Zitronenkresse, alle aus dem kleinen Beet vorm Haus.
„Greift zu, Leute“, ermunterte Cornelius die Runde.
Nach einem Vormittag, den alle mit den verschiedensten Arbeiten verbracht hatten, ließen sie sich nicht lange bitten und luden ordentliche Portionen auf ihre Teller.
Es war schon verrückt, dass sie nun alle gemeinsam hier in Frankreich am Meer ihre Ferien verbrachten: Für Stefan war Cornelius’ Familie schon seit langem so etwas wie eine Ersatzfamilie geworden. Bei Cornelius zu Hause war einfach alles größer, schöner, großzügiger, freier… Stefan und Italo kannten sich seit Kindertagen aus dem Dorf, in dem sie beide aufgewachsen waren. Italo, den Stefan zu den Zinglers mitgebracht hatte und der sich in Gesa verliebt hatte, Udo, der Schulfreund aus Cornelius’ Grundschulzeit und Bettina.
Bettina war unter ihnen, die sich seit langem kannten und befreundet waren, eher die Außenseiterin. Sie kannte und liebte nur ihren Cornelius. Natürlich kannte sie inzwischen auch die anderen ein wenig, vor allem durch gemeinsame Ferienaufenthalte. Aber es war nur zu offensichtlich, dass sie ihren Cornelius nur ungern mit anderen teilte. In größeren Runden beteiligte sie sich selten am Gespräch. Oft verschwand sie auch ganz, setzte sich in eine andere Ecke des Gartens, zeichnete mit zarten Bleistiftstrichen Skizzen in ihren Block, die sie dann manchmal Andreas zeigte, um zu hören, was er davon halte. Nur in Fragen der Kunst schätzte sie sein Urteil. Ansonsten hielt sie ihn für einen Menschen, der vor allem seine Familie tyrannisierte.
Durch die Toreinfahrt sah man das Meer.
Andreas nahm den Gesprächsfaden wieder auf und sagte zu Stefan:
„Das ist doch toll, dass wir alle hier zusammen arbeiten. Eine prima Erfahrung. Eine Erfahrung fürs Leben. Und dann noch in der Gemeinschaft. Das halte ich für enorm wichtig, etwas zu tun, ohne einen Vorteil davon zu haben. Denken und Tun müssen übereinstimmen. Etwas realisieren, wovon man vorher nur geträumt hat...“
Unerträglich, was er für Kommentare abgibt, dauernd seine Sentenzen anbringt. Unmöglich so ein Typ. Immer hat er gute Ratschläge bereit. Kein Wunder, dass seine Kinder flüchten. Das ist ja krankhaft, wie er sich immer ins Gespräch bringt, den anderen seine Erfahrungen überstülpt und dann auch noch dafür gelobt werden will. Andreas’ Defizite müssen beachtlich gewesen sein, dass er sich durch moralisierende Ratschläge oder Provokationen bei den Jungen Beachtung verschafft.
„Das habt ihr ja gemacht, Du und Marita“, sagte Stefan, „und Cornelius auch. Er hat einfach Glück mit seinen Eltern. Ich habe zu Hause auch immer alles Mögliche machen wollen. Das Haus verschönern zum Beispiel. Aber sie haben mich nicht gelassen. Alles sollte immer so bleiben, wie es war. Dieser Tatendrang und dann die Umsetzung haben mich bei Cornelius immer fasziniert. Deshalb macht es mir jetzt auch solchen Spaß, hier mitzuhelfen.“
Auf ein solches Lob hatte es Andreas instinktiv angelegt. Seine Provokationen dienten dazu, dass er beachtet wurde. Was ihm ja auch gelang.
Bettina räumte gerade den Tisch ab. Udo ließ Wasser aus dem Schlauch in die Plastikschüssel und gab reichlich Spüli hinzu, so dass sich ein dicker Schaumberg bildete, in den er die Teller und Töpfe gleiten ließ.
„Gesa, hilfst du mir beim Abtrocknen?“, fragte Udo.
Im Aufgabenverteilen war die hier versammelte Mannschaft insgesamt sehr solidarisch. Bis auf Andreas und Marita alles junge Leute, die ihre Ferien hier auf dem Hof in der Bretagne verbrachten.
Den Hof, Teil einer alten Hofanlage, ein sogenannter „corps du ferme“, hatte Cornelius sich von seinem ersparten Geld gekauft. Innerhalb seines Architekturstudiums musste er ein Projekt durchführen mit einer praktischen Arbeit Als seine Eltern sich das Haus in der Bretagne gekauft hatten, und als er bei einem Besuch dort die Gegend kennen gelernt hatte, bekam er Lust, sich nach einem Objekt, das seinen Zwecken und seinem Geldbeutel angemessen war, umzusehen. Das konnte nur eine Ruine sein. Erstens gab es für ihn als Architekturstudenten dabei etwas zu gestalten - und darauf kam es bei dem Studienprojekt an – und zweitens war eine Ruine das einzig Erschwingliche für ihn. Nachdem er sich im Umkreis von dreißig Kilometern so ziemlich jedes leerstehende Haus, jeden verfallenen Bauernhof angesehen hatte, wollte er bereits mit der Suche aufgeben. Denn entweder waren die Gebäude so stark beschädigt, dass man sie gar nicht wieder aufbauen konnte, oder es war nicht genügend gestalterische Möglichkeit vorhanden. Von der Lage variierten die Häuser stark. Mal lagen sie inmitten eines trostlosen Dorfes, mal in der Nähe einer riesigen wilden Müllkippe. Von Meernähe konnte man nur träumen, was bei seiner Kaufpreiskapazität auch nicht weiter verwunderlich war. Ein eigentlich ganz hübsches altes Bruchsteinhaus lag direkt an einer Straße zu einem der bekanntesten Ausflugsziele in der Gegend mit entsprechend starkem Verkehr.
Doch so leicht ließ sich Cornelius nicht entmutigen. Im Allgemeinen ging er etwas zielstrebig an. Seine Eltern rieten ihm, es ruhig einmal bei Madame Bourgeois zu versuchen, was er bisher nicht getan hatte in der Sorge, dass ihre Angebote überteuert wären. Außerdem hielt er es für wenig wahrscheinlich, dass sie eine Ruine im Angebot hatte.
Die Maklerin zeigte Cornelius das Photo eines mausgrauen, unansehnlichen Hauses. Es sollte hunderttausend Francs kosten, was ziemlich genau seinen Ersparnissen entsprach. Ein halb verfallener Stall gehörte auch noch dazu.
„Stellen Sie sich vor“, sagte Madame Bourgeois, „das Haus liegt keine zwei Kilometer vom Haus Ihrer Eltern entfernt.“
Das ließ Cornelius aufhorchen. Er wunderte sich, dass er bei seinen Erkundungstouren dieses hässliche Entlein nicht entdeckt hatte.
„Das können Sie auch gar nicht gesehen haben“, erklärte ihm die Maklerin. Es ist nämlich von der Straße aus durch ein davor liegendes Gebäude verdeckt.“
Sie beschrieb Cornelius die Lage und sagte, dass er sich den Schlüssel bei der Bäuerin, die gleich nebenan wohne, holen könne.
Und sie meinte noch, dass das bestimmt das richtige Objekt für ihn sei.
Sie sollte wieder einmal Recht behalten.
Wenig später unterzeichnete Cornelius ziemlich aufgeregt den ersten Kaufvertrag seines Lebens. Mit vierundzwanzig Jahren besaß er ein eigenes Haus. Auch wenn es noch mehr Ruine als Haus war. Aber sein Gestaltungsdrang konnte sich hier nach Kräften austoben.
Das unwahrscheinlichste aber war gewesen, dass sein Haus nur vierhundert Meter von demselben herrlichen Strand entfernt lag wie das „Kergaravat-Haus“, wie seine Eltern immer häufiger ihr Ferienhaus nannten.
Cornelius verbrachte seit zwei Jahren sämtliche Semesterferien in seinem Haus in der Bretagne. Er hatte schon eine Menge geschafft, aber trotzdem waren und blieben das Haus und der Hof eine riesige Baustelle. Die räumliche Nähe zum Haus der Eltern hatte eine Menge Vorteile. Da noch kein fließendes Wasser in seinem Haus war, konnte er zum Duschen mal eben dorthin fahren. Auch die vielen Freunde, die er einlud zum Ferienmachen, machten eifrig Gebrauch von dieser Möglichkeit.
Cornelius hatte immer eine Menge Leute bei sich wohnen. In dem großen Raum mit den zwei Kaminen hatten sie ein richtiges Schlaflager. Auf gestapelten Holzdielen, die er günstig vom Sohn der Bäuerin gekauft hatte, lagen Matratzen mit Schlafsäcken dicht an dicht.
Immer mit dabei war Bettina. Auch Udo, sein Kinderfreund aus der Grundschulzeit, den er erst vor einigen Jahren wiedergetroffen hatte, als dieser nach einem Motorradunfall in der Rehaklinik in der Nähe seines Wohnortes war und ihn besucht hatte. Udo war ein prima Kumpel, mit dem man Pferde stehlen konnte und der immer zu Scherzen aufgelegt war. Er hatte nach einer Elektrikerlehre seine Fachhochschulreife nachgeholt und gerade mit einem Designstudium angefangen. Die zwei verstanden sich noch genau so gut wie in Kindertagen, als sie immer zu allerlei Blödsinn aufgelegt waren.
Alle, die Cornelius kannte, waren neugierig auf sein Haus. Und alle lud er ein zu kommen. Beate, die er auf dem Weihnachtsmarkt kennen gelernt hatte, als er Schaffelle verkaufte und mit dem Verkaufserlös ein stattliches Sümmchen zusammenbekam, was er zum Ausbau seines Hauses gut gebrauchen konnte. Ulli, die Schwester seines Schulfreundes Stefan. Monika, die Schwester seines Freundes Florian aus Berlin. Elba, eine Kommilitonin seines Bruders Leon. Es waren überwiegend Frauen, die darauf brannten, ihm bei der Arbeit zu helfen. Denn darin bestand unter anderem ein Teil ihrer Ferien. Und sie taten es nicht einmal ungern. Cornelius zu gefallen ließ selbst die lahmsten von ihnen zu einer Höchstform an Fleiß auflaufen.
Andreas spottete oft über Cornelius’ Harem. Aber es war nicht nur Spott, sondern auch Ärger und Unverständnis. Und er wunderte sich darüber, dass Bettina sich das so einfach gefallen ließ.
„Mit mir würde man so was nicht machen“, sagte Andreas des Öfteren zu Marita, die ebenfalls nicht gerade begeistert war darüber, dass ihr Sohn allem Anschein nach mehrere Freundinnen gleichzeitig hatte, die aber immer noch gerne glauben wollte, dass alles ganz harmlos sei, auch wenn Andreas ihr Naivität in dieser Hinsicht vorwarf.
Das Thema Frauen war ein einziges Reizthema zwischen Andreas und Cornelius und war oft genug Grund zu handfesten Auseinandersetzungen. Warum ihn der Punkt so aufbrachte – schließlich war sein Ältester erwachsen und musste selbst über sein Leben entscheiden – darüber konnte und wollte sich Andreas keine Rechenschaft ablegen. Sein Zorn grenzte oft an Hysterie, so dass der Gedanke, er wäre vielleicht insgeheim neidisch auf die viel größere Freiheit der Jugend, ihm in seltenen Momenten der Klarsicht dämmerte.
Andreas ging ganz einfach davon aus, dass seine Söhne es genau so handhaben sollten wie er, als er seine Marita heiratete. Immer wieder gab er zum Besten, dass er sie aus zehn Meter Entfernung gesehen und sofort gewusst habe, das sei die Frau, die er heiraten wolle. Diese kühn erfundene Geschichte war ihm inzwischen durch Wiederholung derart vertraut, dass er selbst daran glaubte. Ansonsten hatten Andreas und Marita ein gutes und offenes Verhältnis zu ihren drei Kindern, und in ihrem gastfreundlichen Haus fühlten sich auch deren Freunde, die jederzeit willkommen waren, wohl. So war es auch selbstverständlich, dass diese bei ihnen oder bei Cornelius die Ferien verbrachten. Marita und Andreas genossen es, viel Leben um sich zu haben und in Gesprächen in die Gedankenwelt der Jungen mit einbezogen zu werden. Wie auch umgekehrt viele Freunde der Kinder die Unterhaltung besonders mit Andreas schätzten, die anregenden Diskussionen über Kunst und Philosophie, Religion und Politik. Ganze Nächte redeten sie sich die Köpfe heiß, wobei der Weinkonsum und die Ideen, die verfochten wurden, oft in proportionalem Verhältnis zueinander standen.
Übrigens waren bei diesen stundenlangen Gesprächen, die doch größtenteils mehr aus Monologen von Andreas bestanden, die Kinder meistens abwesend, da sie die meisten der Geschichten und Ideen natürlich längst kannten. Und auch Marita war manchmal froh darüber, wenn ihr Andreas ein anderes Opfer als sie für seine Redeexzesse hatte. Aber Reden war für ihn eine Notwendigkeit wie auch die Kunst oder das Bauen, damit er spürte, dass er lebte. Was war er denn schon als Hausmann? Manchmal kam er sich wie ein Asozialer vor. Und dieses Gefühl musste er überdecken und verscheuchen mit lautstarken Reden, selbst wenn er merkte, dass es für die Anwesenden unangenehm war.
Der Abwasch und die anschließende Siesta waren beendet, und es ging wieder an die Arbeit. Cornelius turnte auf dem Dachfirst des ehemaligen Stalles. Bettina reichte ihm die Firstpfannen. Udo hatte die Betonmischmaschine angeworfen und rührte den Speis an. Andreas hatte den losen Putz von dem großen Kamin abgeklopft und wollte heute die erste Schicht neu verputzen. Er hatte Cornelius versprochen, in diesen Ferien den Kamin und die Wände im Haupthaus zu verputzen. Auch zu Hause hatte Andreas schon viele Wände verputzt, eine Fertigkeit, die er sich während seiner Arbeiten am Bau als Student erworben hatte. Das war etwas, was er wirklich gut beherrschte, fast wie ein Profi. Und es war nicht nur Hilfsbereitschaft und Selbstlosigkeit, die ihn hier tätig sein ließ, sondern auch eine Portion Egoismus: als Alter den Jungen etwas vormachen zu können und dafür Bewunderung einzuheimsen.
Gesa, Stefan und Italo waren im Stall tätig. Sie kratzten dort Lehm aus den Fugen zwischen den Bruchsteinen.
Marita begab sich auf den Rückweg zu ihrem Haus. Sie freute sich auf einen ruhigen Lektürenachmittag. Abends würde es wahrscheinlich wieder hoch hergehen bei ihnen. Mindestens Stefan und Gesa mit ihrem Freund Italo, die bei ihnen im Haus schliefen, wären dann wieder da. Und natürlich Andreas. Und dann wäre an Lesen nicht mehr zu denken. Dafür brauchte sie einfach Ruhe um sich herum. Lesen im Urlaub war Maritas größte Erholung. Sie hatte sich für die vier Wochen Sommerferien die vier Joseph-Bände von Thomas Mann vorgenommen. Im vorigen Jahr hatte sie endlich einmal die „Brüder Karamasow“ von Anfang bis zum Ende gelesen.