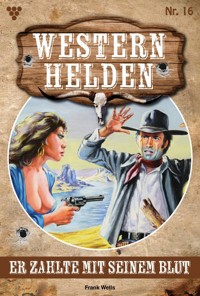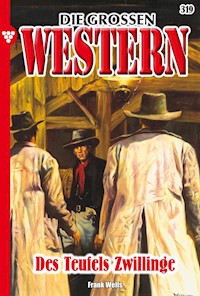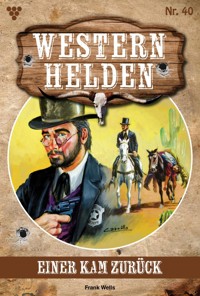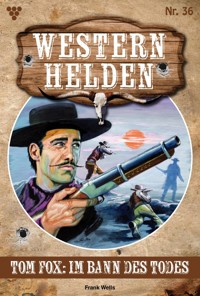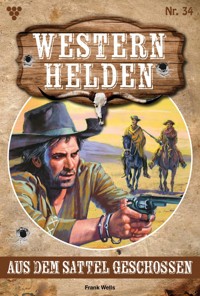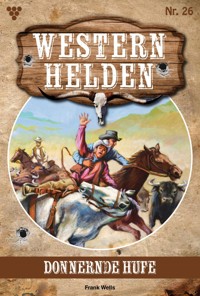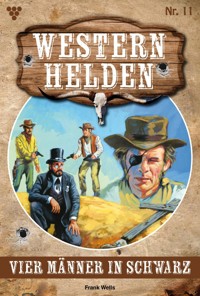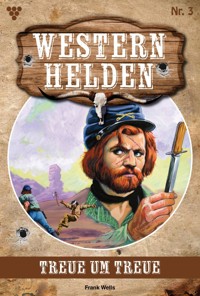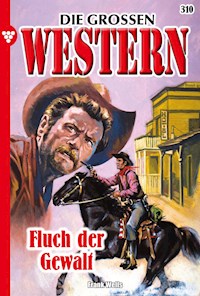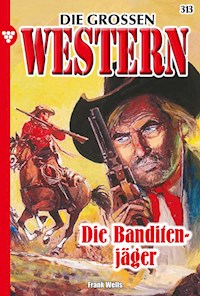
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die großen Western
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Sie nannten ihn »Blanco« wegen der weißen Haarsträhne, die sich mitten durch seinen Schopf dunkelblonden Haares zog. Kaum jemand wußte seinen vollständigen Namen. Niemand interessierte sich auch hier im Grenzland des Indianergebietes dafür. Blanco – das war ein Begriff. Dieser Name wurde von vielen nur im Flüsterton genannt, von anderen mit scheuer Ehrfurcht, von den meisten mit offener Bewunderung. Blanco, der Armee-Scout, der beste Kenner des Indianerlandes. Von weitem sah er aus wie ein Indianer, wie eine der wilden Rothäute des nördlichen Felsengebirges. Nur war er größer als fast alle Indianer, die es in weitem Umkreis gab. Plötzlich stutzte Blanco. Wenn ein einsamer Mann in der Ferne einen Rauchpilz sah, schlug er besser einen Bogen. Dann war es nämlich ein Präriebrand, vielleicht durch eine achtlos weggeworfene Zigarette entzündet oder durch die grelle Sonne. Sah ein Reiter aschgrauen Rauch, von orangefarbenen Flammen durchzüngelt, dann wußte er, daß Sagebüsche und Dornensträucher in Brand geraten waren. Wenn aber wie jetzt fetter, schwarzer Rauch über einen Hügel in den Himmel kletterte, dann war das ganz anders. Dann bedeutete das Gefahr für den, der es sah. Und Tod für die, die wahrscheinlich schon steif neben dem Feuer lagen. Niemand kannte dieses Zeichen besser als Blanco Holm. Er schaute düster auf die Rauchspirale, ein stiller, regloser Mann im Sattel, dessen Sinne geschärft wie die eines Raubtieres auf dem Sprung waren. »Stecken wir die Nase hinein«, murmelte Blanco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 313 –Die Banditenjäger
Frank Wells
Sie nannten ihn »Blanco« wegen der weißen Haarsträhne, die sich mitten durch seinen Schopf dunkelblonden Haares zog. Kaum jemand wußte seinen vollständigen Namen. Niemand interessierte sich auch hier im Grenzland des Indianergebietes dafür. Blanco – das war ein Begriff. Dieser Name wurde von vielen nur im Flüsterton genannt, von anderen mit scheuer Ehrfurcht, von den meisten mit offener Bewunderung. Blanco, der Armee-Scout, der beste Kenner des Indianerlandes.
Von weitem sah er aus wie ein Indianer, wie eine der wilden Rothäute des nördlichen Felsengebirges. Nur war er größer als fast alle Indianer, die es in weitem Umkreis gab.
Plötzlich stutzte Blanco.
Wenn ein einsamer Mann in der Ferne einen Rauchpilz sah, schlug er besser einen Bogen. Dann war es nämlich ein Präriebrand, vielleicht durch eine achtlos weggeworfene Zigarette entzündet oder durch die grelle Sonne. Sah ein Reiter aschgrauen Rauch, von orangefarbenen Flammen durchzüngelt, dann wußte er, daß Sagebüsche und Dornensträucher in Brand geraten waren.
Wenn aber wie jetzt fetter, schwarzer Rauch über einen Hügel in den Himmel kletterte, dann war das ganz anders. Dann bedeutete das Gefahr für den, der es sah. Und Tod für die, die wahrscheinlich schon steif neben dem Feuer lagen.
Niemand kannte dieses Zeichen besser als Blanco Holm. Er schaute düster auf die Rauchspirale, ein stiller, regloser Mann im Sattel, dessen Sinne geschärft wie die eines Raubtieres auf dem Sprung waren.
»Stecken wir die Nase hinein«, murmelte Blanco.
Er ritt hart um den Fels herum und einen steilen Geröllhang hinab. Die Hufe des Broncos machten für seine Begriffe einen höllischen Lärm, aber es würde die Toten nicht stören. Auf halber Höhe der Hügel trabte er zwischen Tal und Höhe dahin, mit allen Sinnen witternd, die Hand am Kolben der Waffe. Er saß erst ab, als der Rauch ihm schon in die Nase biß.
Reglos lag er wohl zehn Minuten über dem Tal, in dem es geschehen war. Drei Wagen standen dort, Planwagen, die jetzt zu schwarzen Skeletten ausgebrannt waren. Es mußte im Morgengrauen geschehen sein oder auch etwas später. Und das so dicht am Fort.
Niemand hatte es überlebt. Er sah die Toten neben den Wagen. Sechs Männer zählte er, gespickt von Pfeilen.
Also hatte »Zahmer Bison«, der Stammeshäuptling der Sioux, die Wahrheit gesagt. Er wollte den Frieden, denn der Krieg hatte seinen Stamm an den Rand des Unterganges gebracht. Aber »Großer Grisly«, der Häuptling der Oglalas, hatte noch nicht genug Blut getrunken. Sie hatten ihn, so sagte »Zahmer Bison«, aus dem Stammesverband ausgestoßen. Auch die Pawnees und Sheyennes wollten nichts mehr von des Oglalas verrückten Plänen wissen.
Es ist still wie in der Kirche, dachte Blanco. Viel zu still. Die Geier hätten längst dort unten sein müssen. Sie sind nicht vor mir davongeflogen. Sie saßen schon vorher dort oben. Die Luft stinkt.
Dennoch schwang er sich auf das Pferd und jagte im Galopp den Hang hinab. Manchmal war es besser, die Gefahr direkt herauszufordern. Er parierte unmittelbar neben dem ersten Wagen und glitt aus dem Sattel. Das Gewehr in seiner Hand war schußbereit, und er schaute nur flüchtig auf den toten Mann direkt zu seinen Füßen, ehe er unter der Hutkrempe hinweg die Kämme der Hügel musterte.
Die Feindschaft zwischen ihm und »Großer Grisly« war uralt. Vielleicht wußte der schlaue Indianer um Blancos Ritt zu den Tipis der Sioux. Vielleicht war dies eine Falle, die er ihm, Blanco, zugedacht hatte. Es war schwer, in die Hirnwindungen einer Rothaut zu schauen. Doppelt schwer bei »Großer Grisly«.
Zwei Dinge fielen Blanco an dem Toten zu seinen Füßen auf. Die Pfeile in seinem Körper trugen nicht die Federn der Oglalas, sondern die typische Anordnung, wie sie die Sheyennes gebrauchten.
Und das zweite Auffällige war, daß die Mörder dem Mann den linken Arm abgeschnitten hatten. Auch das taten nur die Sheyennes.
Er will die Soldaten im Fort auf eine falsche Fährte locken, dachte Blanco.
Das war typisch für den Oglala. Er dachte nie geradlinig wie die meisten Indianer. Er arbeitete zu gern mit Tricks und Winkelzügen. Vielleicht auch jetzt, denn immer noch blieb alles still. Aber da war ein Vogel, eine Lerche anscheinend, die aufgeregt flatternd über dem Hügel in der Luft hing.
Blanco lächelte mit engen Lippen und ging gesenkten Kopfes am brennenden Wagen entlang. Es war schwer, den Hügel unauffällig im Auge zu behalten. Er stieg über den zweiten Toten hinweg, und dann ließ er sich blitzschnell fallen.
Nichts warnte ihn. Der Indianer stieg völlig lautlos direkt aus dem Boden empor, so wie es nur eine Rothaut konnte. Es mochten hundert Schritte bis zu jenem Punkt seitlich des Hügels sein, an dem er unvermittelt auftauchte und den Pfeil von der Sehne schwirren ließ.
»Pfeile«, lachte Blanco spöttisch. »Warum nicht Kieselsteine, Freund?«
Er schoß, kaum daß er lag. Der Pfeil schwirrte noch durch die Luft, als die Kugel den Körper des Roten traf. Harmlos zischte der Pfeil in die verzuckenden Flammen des Wagens.
Und nun wurde es ernst. Ohrenbetäubend stieg der Angriffsschrei der Roten in die Luft: »Hiii yeee haaa!« Es war der Kriegsschrei, der Mark und Bein durchschnitt und das Herz eines ängstlichen Mannes in die Hosen treiben konnte. Hufe donnerten heran, viele Hufe.
Blanco Holm tauchte zwischen die brennenden Wagen und warf sich neben ein Rad. Er lud mit der Routine eines Mannes, der Hunderte solcher Situationen mitgemacht hatte, die Revolver nach. Er legte sie neben sich und hob das Gewehr an die Wange. Mit dem ersten Schuß warf er einen hünenhaften Indianer ins Gras, mit dem zweiten wurde wieder ein Sattel leer. Dann schrillte die Stimme des »Großen Grisly« über den Platz, und binnen weniger Sekunden lag das Tal wieder still und leer.
»Ich habe ihn also erwischt«, murmelte Blanco und wischte salzigen Schweiß von der Stirn. Ihm war heiß geworden. Mehr als heiß. Selbst in der Hölle konnte es nicht schlimmer sein.
»Ich habe ihn erwischt, und das ist für einen Indianer eine schlechte Medizin.«
Oh, er kannte die Brüder. Heute noch würde »Großer Grisly« seinen Medizinmann befragen, ob es kein Mittel gab, diesen Höllenkerl Blanco von der Erde verschwinden zu lassen.
Blanco stieß die Revolver in die Halfter und das Gewehr in den Scabbard. Da erst sah er, daß sein Wallach auf drei Beinen stand, daß dicht über der linken Hinterhand ein Pfeil steckte.
Er knurrte grimmig und machte sich an die Operation.
Der Wallach bäumte sich und wieherte schrill. Blanco mußte sich mit aller Macht gegen den zuckenden Pferdeleib stemmen. Immer noch hielt er die Hinterhand des Tieres eisern fest. Erst als der erste wütende Schmerz verrauscht war, ließ er das Bein langsam zur Erde nieder und trat zurück. Er tätschelte Greyhounds verschwitzten Hals und drückte die Nüstern gegen seine Brust.
»Wir beide wollen doch noch länger zusammenbleiben, was?« murmelte er. »Wirst schon sehen, daß ich dich durchkriege.«
Erst als der Bronco ganz ruhig stand, behandelte er die Wunde weiter. Er führte stets Heilkräuter mit sich in der Satteltasche, denn ein Mann allein in der weiten Wildnis des Westens konnte nicht auf die Hilfe eines Arztes rechnen.
»Well«, murmelte er nachdenklich, »marschieren wir weiter. Es werden noch ein paar harte Meilen.«
Er nahm den Zügel auf und ging mit schwingenden Schritten vor dem lahmenden Tier in die Hügel hinein.
*
Seit Belle Carrigan in Rock Springs den Zug verlassen hatte und in die Postkutsche umgestiegen war, fühlte sie sich glücklich wie selten in ihrem Leben. Endlich ging es der Heimat entgegen, der unendlichen Prärie Oregons mit den gewaltigen Rinderherden, dem blühenden Sage, dem stetigen reinen Wind und der klaren Luft, die nicht ihresgleichen auf der Welt hatte. Sie hatte es nicht glauben wollen, nicht glauben können, als sie den Brief ihres Vaters in den Händen gehalten und immer wieder gelesen hatte. Aber jetzt gab es keinen Zweifel mehr!
Ja, der letzte Zweifel war verschwunden, als sie auf dem Bahnhof in Rock Springs von den strahlenden Cowboys empfangen wurde, die nun im Galopp hinter der Postkutsche herpreschten und ihr das Ehrengeleit gaben. Es war typisch für Willis R. Carrigan, daß er seine Tochter auf diese Weise in die Heimat holte. Er pflegte jedes Ding, das er anpackte, genau zu organisieren. Nicht umsonst nannte man ihn den Rinderkönig, und nicht von ungefähr war er einer der wenigen, die ihren Besitz unbeschadet über die Wirren der Indianerkriege gerettet hatten.
Diese vergangenen drei Jahre waren für Belle Carrigan eine Strafe gewesen, vielleicht gerade deswegen, weil sie allen Luxus der großen Städte hatte genießen können, während ihre Gedanken stetig in der gefahrenumwitterten Heimat weilten. Viel lieber hätte sie auf die Sendungen der Zivilisation verzichtet und die Notzeit mit ihrem Vater und seinen Männern geteilt.
Nun lag auch dieses Kapitel ihres Lebens hinter ihr. Sie hatte die hohe Schule besucht und war zu einer Dame herangereift. So sehr war sie Dame geworden, daß ihr Vormann Tob Meredith kaum gewagt hatte, ihre Hand zu drücken.
Dafür legten sich die beiden Mitpassagiere in der Postkutsche um so mehr ins Geschirr, ihr den Hof zu machen. Vor allem der Kapitän der Lanzenreiter, Oliver Gaxton, unterhielt sie aufs beste mit allen möglichen Storys aus seinem bewegten Militärleben. Die Reihe von Orden auf seiner breiten Brust unterstrich seine Worte.
Der andere, der sich als Kaufmann unter dem Namen Red Green vorgestellt hatte, konnte natürlich nicht so interessant erzählen, doch steuerte er mit einer sanften, klingenden Stimme manches zur Unterhaltung bei.
Plötzlich beugte sie sich ein wenig weiter vor. Am Rande des Weges stand ein Mann mit einem grauen Pferd am Zügel.
Ein großer Mann in staubigem und fleckigem Leder. Er hob die Hand, und der Kutscher bremste und hielt.
»Hallo, Bobo«, hörte Belle eine tiefe, ruhige Stimme. »Hast du noch Platz für mich?«
»Immer, Blanco!« krähte der Kutscher. »Stimmt etwas nicht mit Greyhound? Huf vertreten?«
»Es war ein Pfeil, Bobo. Wenn ich’s nicht so eilig hätte, würde ich zu Fuß weiterlaufen. Kannst du Jock entbehren?«
»Klar. Soll er den Wallach ins Fort bringen?«
»Bitte.«
Jock, der bewaffnete Begleiter der Postkutsche, sprang vom Bock. Der große Mann, der Blanco hieß, legte seinem Bronco die Hand auf die Nüstern und sprach leise mit dem Tier. Dann nahm er seine Satteltasche vom Rücken des Pferdes, zog das Gewehr aus dem Scabbard und drückte Jock die Zügel in die Hand.
Der Kapitän Oliver Gaxton riß das Fenster auf.
»He, was ist los, zum Teufel? Warum stehen wir hier mitten in dieser gottverlassenen Gegend? Ich hab’s verdammt eilig!«
»Ich auch«, sagte der große Mann ruhig und öffnete die Tür.
Er schien immer größer zu werden, während er einstieg. Tatsächlich hatte Belle Carrigan selten einen so riesigen Mann mit so gewaltigen Schultern gesehen. Der Name Blanco kam ihr irgendwie bekannt vor.
Bobo knallte mit der Peitsche und brüllte die Pferde an. Ruckend setzte sich die Kutsche in Bewegung.
Blanco sagte: »Guten Abend!« und ließ sich auf dem Platz nieder, den bisher der Offizier innegehabt hatte, Belle genau gegenüber. Ein kurzer, scharfer Blick aus rauchgrauen Augen flog über Belle hin, dann über den Kaufmann Red Green, und dort blieb er hängen.
»Hallo – Gigolo!« sagte Blanco. »Wieder im Lande?«
Der rothaarige Kaufmann rutschte verlegen auf seinem Sitz hin und her und versuchte sich kleiner zu machen, als er war. Belle betrachtete ihn mit einem verwunderten Seitenblick. Gigolo…!
Der Name paßte nicht schlecht, denn der schlanke Mann war so geschniegelt und gebügelt, als käme er direkt aus einem Konfektionsladen. Dazu paßte auch die goldene Uhrkette auf seiner Weste.
»Ach – Mr. Holm, ich bin auf der Durchreise, sozusagen«, antwortete er stockend.
»So? Freut mich. Schlechte Zeiten für Geschäfte, was?«
»Ich will nicht klagen. Lebensmittel werden immer gebraucht.«
»Yeah. Hoffentlich ist das Mehl nicht zu eisenhaltig.«
»Was – was soll das heißen?«
Blanco lächelte mit engen Lippen. Seine rauchblauen Augen, Augen von unheimlicher Schärfe und Tiefe, wie Belle Carrigan bei sich feststellte, ließen Gigolo nicht aus der Klammer. Er sagte leichthin: »Nichts Besonderes. Es ist ja kein Krieg mehr. Ich habe da mal ein paar Frachtwagen mit Mehlfässern untersucht, kurz bevor Crazy Horse sich die Kriegsfarbe ins Gesicht malte. War nicht viel Mehl in den Dingern drin, aber um so mehr Gewehre, Revolver und Patronen. Komischerweise war der Eigentümer der Wagen nicht aufzufinden.«
Red Green schüttelte energisch den Kopf.
»Das ist eine Riesenschweinerei! Sie wissen, Blanco, daß ich so was nie mitmachen würde!«
»Crazy Horse hat gut gezahlt, in purem Gold. Yeah, Nuggets haben schon manchen um den Verstand gebracht und ums Leben.«
Blanco setzte sich bequem zurück, lehnte den Kopf an, zog den Hut über die Augen und war eine Sekunde später eingeschlafen.
Er schlief tief und fest, bis das breite Tor des Forts quietschend vor der Kutsche geöffnet wurde. Da richtete sich Blanco auf, schob den Hut in den Nacken und sprang aus der Tür, ehe die Kutsche hielt.
Belle Carrigan sah ihn mit langen schwingenden Schritten quer über das Geviert des Hofes gehen und in einem langgestreckten Gebäude verschwinden.
*
Colonel Ray Clanton leitete das Fort seit jenem Tage, da die wilde Horde der Sioux das Land mit Krieg überzogen hatte. Er war ein wortkarger, harter Mann mit eisgrauem Haar, der geborene Soldat.
Er empfing Blanco sofort, als die Ordonnanz ihm dessen Ankunft meldete. Blanco betrat das Zimmer in seiner lässigen Art mit dem Hut in der Hand. Er grüßte knapp, schaute in des Colonels harte Augen und überflog dann die Reihe der Offiziere vor dem Schreibtisch.
Nur ein Mann ohne Uniform war im Raum außer ihm, der zweite Scout des Forts: Sherokee. Es schien, als bringe Blanco nicht die einzige Hiobsbotschaft.
»Ich warte auf Sie wie auf den ersten Sonnenstrahl nach dem Winter, Blanco«, sagte der Colonel. »Wie sind Ihre Nachrichten?«
Blanco hängte den Hut über den Gewehrlauf und drehte sich eine Zigarette. Alle warteten geduldig, bis er sie angezündet hatte und zu sprechen begann.
»Wie man’s nimmt, Colonel«, sagte er. »Gute und auch schlechte. Ich habe mit ›Zahmer Bison‹ die Friedenspfeife geraucht und ein langes Palaver gehalten. Er hat die Häupter seiner übriggebliebenen Krieger gezählt und ist zu dem Schluß gekommen, daß weiteres Blutvergießen seine Nation ausrotten würde. Er sagte, daß auch die Sheyennes und Nez Perce so denken. Die Zeiten eines Crazy Horse sind vorüber.«
»Sie halten die Worte des Häuptlings für ehrlich?«
»Sie sind ehrlich, Colonel. ›Zahmer Bison‹ redet nicht in zwei Zungen. Er hat mich auf seine Art sogar gewarnt.«
»Vor wem?«
Blanco sog an der Zigarette, stieß den Rauch aus und entgegnete: »Ich will es mit den Worten des Häuptlings sagen. Er drückte sich ungefähr so aus: ›Es herrscht Zwietracht in den Tipis der Sioux. Einer hat die Hand gegen den obersten Häuptling erhoben, weil er immer noch Blut trinken möchte. Die Oglalas sitzen nicht mehr an unserem Lagerfeuer.‹ Das waren seine Worte, Colonel.«
»Und was schließen Sie daraus?« Blanco zuckte die Schultern.
»Ich kenne die Oglalas, besonders Großer Grisly. Er fühlt sich als Nachfolger von Crazy Horse, der einmal oberster Kriegshäuptling aller Sioux-Stämme war. Weil ich ihn kenne, bin ich vierzehn Stunden durch die Wind River Mounts geritten und doch zu spät gekommen.«
»Was heißt das?«
»Ich habe verbrannte Wagen und tote Männer gefunden. Ich habe eine Menge Pfeile gesehen und einige schwirren hören. Ich habe ziemlich viel Blei spucken müssen, weil ich meinen Skalp noch eine Weile behalten wollte.«
Die Offiziere standen wie eine Wand. Der Colonel ließ die Faust auf den Schreibtisch krachen.
»Also geht die Schweinerei wieder los! Ausgerechnet die Oglalas! Wie viele waren es, Blanco?«
»Ein rundes Dutzend. Drei habe ich erwischt und den Großen Grisly zumindest angekratzt. Dafür mußte ich meinem Wallach einen Pfeil aus der Hinterhand schneiden.«
»Gut, daß Sie Ihre Kopfhaut heil wieder mitgebracht haben! Sie sind also überzeugt, daß es nur die Oglalas sind?«
»Sicher.«
»Okay. Sherokee, berichten Sie!«
Der andere Scout mochte etwa zehn Jahre älter als Blanco sein und war in vielem das genaue Gegenteil von ihm. Während Blanco groß, geradezu riesig wirkte, war Sherokee kaum einen Zoll länger als fünf Fuß. Seine doppelläufige Flinte ragte über seinen Kopf hinaus. Aber es gab kaum einen flinkeren und geschickteren Mann als ihn.
Er zwinkerte Blanco zu und krächzte heiser: »Yeah, ich habe die Postkutsche auf dem Oregonweg gefunden. Knapp zwanzig Meilen von hier. Fünf Tote. Aber es waren keine Oglalas-Pfeile, und den Toten fehlte der linke Arm.«
»Also Sheyennes!« rief der Colonel. »Ihr ›Zahmer Bison‹ hat Ihnen ein schönes Lügengebräu zu schlucken gegeben, Blanco!«
Der schüttelte den Kopf.
»Ich glaube nicht, Colonel. Auch den Männern, die ich gefunden habe, fehlte der linke Arm. Auch sie waren mit Sheyennes-Pfeilen gespickt. Und der Pfeil, den ich aus dem Bein meines Pferdes gezogen habe, trug ebenfalls nicht die Merkmale der Oglalas.«
»Das ist doch verrückt.«
»Vielleicht auch nicht. Der ›Große Grisly‹ ist ein raffinierter Kerl. Ich schätze, er verfolgt besondere Pläne. Er möchte uns auf die Indianer hetzen, auf alles, was rote Haut trägt. So ganz durchschaue ich das allerdings auch noch nicht.«
Der Colonel schien die Auffassung nicht zu teilen. Ehe er aber seine Meinung äußern konnte, wurde von der Ordonnanz der Kapitän Oliver Gaxton gemeldet.
Der Offizier meldete sich zackig und wurde vom Colonel mit kurzen Worten willkommen geheißen. Ihm wurden die anderen Offiziere vorgestellt und dann auch die beiden Scouts. Bei Blancos Anblick umwölkte sich seine Stirn, aber er schüttelte dem Riesen doch die Hand.
»Gut, daß Sie schon heute kommen«, sagte der Colonel anschließend, »es sind einige Dinge geschehen, die für Sie besonders interessant sein dürften.«