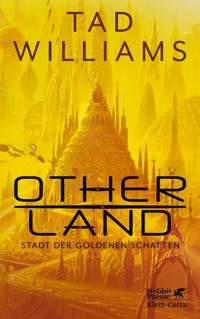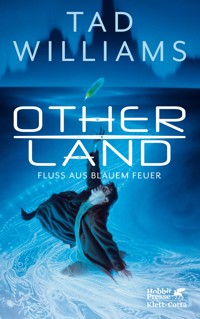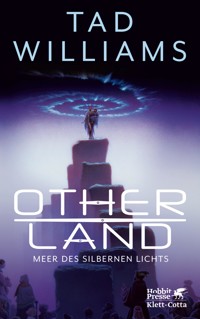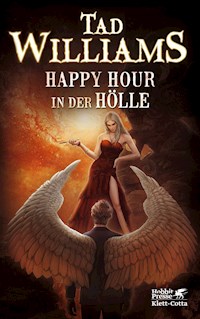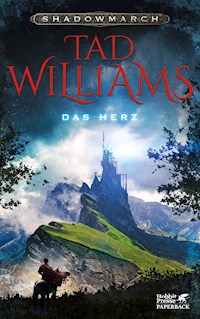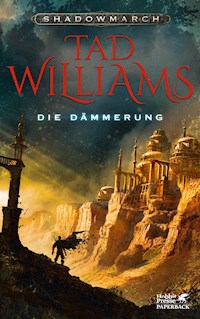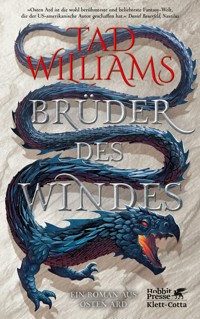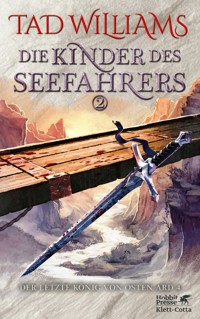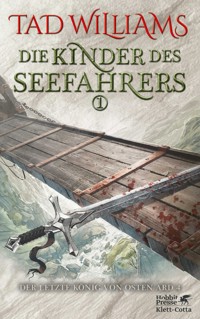10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Der letzte König von Osten Ard
- Sprache: Deutsch
- Die Fortsetzung des Weltbestsellers »Das Geheimnis der großen Schwerter« Der Norden erhebt sich, und es heißt die alte Kriegsgöttin Morriga habe sich geregt. König Simon und Königin Miriamele müssen ihren einzigen Thronerben, Prinz Morgan, auf eine Mission zu dem uralten Volk der Sithi schicken. Lässt sich der Frieden noch retten? »Dieses Werk hat mich inspiriert ›Game of Thrones‹ zu schreiben.« George R. R. Martin über »Das Geheimnis der Großen Schwerter« Die Nornenkönigin streckt ihre Hand nach der sagenumwobenen Hexenholzkrone aus und der Schatten eines aufziehenden Krieges legt sich über Osten Ard. Da wird eine Gesandte der Sithi, die mit einer Nachricht für König Simon und Königin Miriamele unterwegs war, schwer verwundet im Wald nahe dem Palast gefunden. Und ein Attentat auf einen alten Gefährten innerhalb der Palastmauern sorgt für noch größere Unruhe. Der Angreifer erwähnt immer wieder die Morriga, eine uralte Kriegsgöttin. Um mehr über die Bedrohung durch die Nornen herauszufinden, schickt das Thronpaar schweren Herzens Prinz Morgan zu dem Volk der Sithi. Wird er wohlbehalten zurückkehren von seiner Mission? Ist ein Krieg gegen die Nornen noch abzuwenden? Und was hat es mit den Gerüchten um das Erwachen der Morriga auf sich? Und nicht zuletzt ist da noch das Versprechen, das Simon und Miriamele ihrem alten Freund Herzog Isgrimnur auf dem Sterbebett gegeben haben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Tad Williams
Die Hexenholzkrone 2
Der letzte König von Osten Ard 1
Aus dem Amerikanischen von Cornelia Holfelder-von der Tann und Wolfram Ströle
Klett-Cotta
Wegen des großen Textumfangs erscheint Die Hexenholzkrone. Der letzte König von Osten Ard 1 in zwei Teilbänden.
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Hobbit Presse
www.hobbitpresse.de
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »The Witchwood Crown. The Last King of Osten Ard Volume 1« im Verlag DAW Books, New York
© 2017 by Tad Williams
© Karten by Isaac Stewart. Dragonsteel
Für die deutsche Ausgabe
© 2017, 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Umschlaggestaltung: Birgit Gitschier, Augsburg
Illustration: Melanie Korte, Inkcraft
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98478-1
E-Book: ISBN 978-3-608-10085-3
Inhalt
32
Rosenwasser und Balsam
33
Geheimnisse und Versprechen
34
Der Vertraute als Vorkoster
35
Der Mann mit dem seltsamen Lächeln
36
Ein törichter Traum
37
Zwei Schlafzimmergespräche
38
Das Schiff des Faktoristen
39
Eine Hochzeit im Grasland
40
Mit den Augen Gottes
Dritter Teil
In der Fremde
41
Herns wilde Jagd
42
Der Klang des Waldes
43
Vorbereitungen zur Flucht
44
Talismane und Zeichen
45
Eine nächtliche Sonne
46
Mann im Fluss
47
Verborgene Kammern
48
Die kleinen Boote
49
Blut, schwarz wie die Nacht
50
Wichtige Staatsangelegenheiten
51
Gestohlene Schuppen
52
Heimkehr
53
Der Irrsinn ihrer Führer
54
Stimmen
Nachspiel
Glossar
Personen
Orte
Geschöpfe
Sonstige Begriffe
Sternbilder
Wurfknöchel
Nornenorden
Die Clans der Thrithinge (und ihr Thrithing)
Die Feiertage
Die Wochentage
Die Monate
Wörter und Sätze
Das letzte Kapitel von Teil 1 endete mit den Abschnitten:
Morgan belastete die Kuppel vorsichtig mit seinem Gewicht. Sie wirkte stabiler als die Wände. Trotz der Nacht war der Stein noch von der Hitze des Tages warm. Morgan kletterte auf die offene Luke zu. Warum sollte Snenneq sie aufbrechen und in den berüchtigten Turm eindringen? Hat der Troll wirklich so wenig Angst vor den Gespenstern anderer Leute?
Und wenn er sie gar nicht geöffnet hat?, dachte Morgan plötzlich. Wenn es jemand anderes gewesen war? Wenn er dagestanden hatte und sie hinter ihm aufgegangen war wie der Deckel eines Höllenschlunds … und jemand herausgekommen war und ihn gepackt hatte?
Das Grauen dieser Vorstellung war unerträglich. Morgan schob sich weiter hinauf, den Bauch an das Blei gedrückt wie zuvor an die Turmmauer, ohne dass es ihm bewusst war. Er erreichte die offene Luke. Aber nach drinnen sehen wollte er nun wirklich auf gar keinen Fall.
Er ist wegen dir hier, sagte eine Stimme, als spreche ihm jemand ins Ohr – jemand anders, ein ehrenhafter Mensch. Er ist wegen dir hier. Wenn er hier drin ist, musst du ihn suchen.
Aber Morgan wollte nicht durch die Luke blicken und erst recht nicht hindurchsteigen. Wer wusste schon, was für ein gefährliches Chaos dahinter lauerte? Schließlich war der Turm über zwanzig Jahre abgeschlossen gewesen und hatte leer gestanden.
Und wenn er gar nicht leer ist? Wieder stellte Morgan sich vor, wie die Luke lautlos hinter dem Troll aufging und eine schattenhafte Gestalt daraus auftauchte …
Er streckte den Kopf über den Rand der Luke. Das oberste Zimmer des Turms war mit Steinschutt angefüllt, wie er es erwartet hatte. Allerdings entdeckte er zwischen den Steinen dunkle Stellen, die aussahen, als hätte ein riesiger Maulwurf oder eine Ratte Tunnel durch das Geröll gegraben. Morgan wünschte sich stärker als je in seinem Leben, dass er eine Fackel mitgenommen hätte, nein, eine Fackel und ein Schwert und drei oder vier kräftige Freunde. Im selben Moment sah er eine Bewegung. In dem Raum unter ihm, im dunklen obersten Geschoss des Turms, bewegte sich etwas Lebendiges.
»Snenneq?«, rief er leise. Das Blut rauschte ihm in den Ohren und die Stimme, die aus seinem Mund kam, klang nicht wie seine eigene. Da drehte sich die schattenhafte Gestalt um und blickte zu ihm auf. Nur einen kurzen Augenblick fiel das Mondlicht auf ein unbehaartes Gesicht, zwei leere schwarze Augen und eine zerlumpte Kapuze, die einmal rot gewesen sein mochte. Sein Puls dröhnte wie mit Hammerschlägen durch seinen Kopf und er wich entsetzt von der Luke zurück. Hastig sprang er auf, stolperte dabei, fiel nach vorn und schlug mit dem Kinn auf den Rand der Luke. Ein Regen von Sternen leuchtete vor ihm auf, dann wurde es Nacht um ihn.
32
Rosenwasser und Balsam
Die Kanzlei war in einem langgestreckten Gebäude im Mittleren Zwinger untergebracht. Unter König Johan hatten sich dort die Stallungen befunden, doch die waren beim Einsturz des Engelsturms zerstört worden und man hatte die neuen Stallungen im Äußeren Zwinger errichtet. Was nicht bedeutete, dass Pferde und Kutschen unwichtiger geworden wären, dachte Pasevalles. Vielmehr hatten Buchhaltung und die Aufbewahrung des Geldes an Bedeutung gewonnen.
Das Kanzleigebäude war wie ein langgezogener Knochen geformt, ein Knochen, um den sich zwei Hunde streiten mochten, die jeder an einem Ende zogen. Was auch insofern ein passender Vergleich war, als das eine Ende Pasevalles als dem Großkanzler gehörte und das andere Erzbischof Gervis, dem Schatzkämmerer. Das Verhältnis der beiden erinnerte manchmal tatsächlich an zwei sich unter der königlichen Abendtafel streitende Doggen.
Und doch war es eine Erleichterung für den Großkanzler, sich wieder auf seine Arbeit konzentrieren zu können, ohne auch noch die wichtigen Aufgaben Graf Eolairs wahrnehmen zu müssen. Viele Dinge, die ihm besonders am Herzen lagen, waren während der Reise des königlichen Paars mehr oder weniger liegengeblieben, und jetzt war er damit beschäftigt, Versäumtes nachzuholen.
Kanzleibedienstete eilten emsig wie Bienen in einem Kleefeld die langen Gänge auf und ab, in den Händen Stapel von Dokumenten, jedes mit einer eigenen, komplizierten Vorgeschichte – Schriftrollen der Buchhaltung, Bittbriefe und Steuerunterlagen. Die falsche Vorstellung, die die meisten Untertanen des Königreichs von der Macht hatten, rang Pasevalles nur ein müdes Lächeln ab – dass nämlich der König und die Königin nur auf ihren Thronen saßen und bestimmten, was als Nächstes zu tun sei, und ihre Helfer sich dann eifrig bemühten, ihre Launen in die Tat umzusetzen. In Wirklichkeit musste jeder Herrscher, vom Herrscher über das größte Königreich der Geschichte Osten Ards ganz zu schweigen, sich ständig mit Hunderten von Problemen herumschlagen, und das so lange, bis sie gelöst oder wenigstens auf ein erträgliches Maß reduziert waren. Denn einige Probleme hatten, wenn man sie nicht löste, die Eigenschaft, sich rasch zu größeren Problemen auszuwachsen. Und zur Lösung eines Problems standen dem Herrscher auch nicht Scharen treuergebener Untertanen zur Verfügung, die nur darauf warteten, zu tun, was man ihnen sagte, sondern Tausende von Individuen mit eigenen Plänen und Wünschen, zu deren Erfüllung die meisten davon durchaus bereit waren, gegen Gesetze zu verstoßen, solange sie dies ungestraft tun konnten, während sie zugleich hell empört waren bei der leisesten Andeutung, ihre eigenen Rechte könnten in irgendeiner Weise beschnitten werden. Und von diesen rechthaberischen Menschen waren die Adligen mit ihrer Empfindlichkeit und Selbstgerechtigkeit die Schlimmsten.
Pasevalles war der Neffe eines wichtigen nabbanaischen Grenzfürsten, des Barons Seriddan von Metessa, und hatte seine Kindheit in der Burg des Barons verbracht. Damals war er noch mit seinem Schicksal zufrieden gewesen. Während sein Vater Brindalles eher das zurückgezogene Leben eines Gelehrten führte, gelüstete es den jungen Pasevalles nach Heldentum. Er nahm sich sogar der familieneigenen Sammlung von Waffen und Rüstungen an, weil sich niemand sonst in Metessa für die Größe der Vergangenheit zu interessieren schien – oder wenigstens nicht so, wie Pasevalles es für angemessen hielt. In den Jahren seiner Kindheit waren der große Waffensaal und die Gießerei, in der Rüstungen angefertigt und repariert wurden, sein eigentliches Zuhause. In der Studierstube seines Vaters fühlte er sich dagegen eher fremd. Natürlich lernte er Lesen, Schreiben und Rechnen, wie es von einem jungen Mann aus adligem Hause erwartet wurde, doch jede Stunde unter dem wachsamen Blick seiner Lehrer war für ihn verschwendete Zeit, in der er lieber den Soldaten bei ihren Übungen zugesehen oder im Waffensaal einer selbsterteilten Aufgabe nachgegangen wäre. Schließlich musste das Andenken an die kriegerischen Heldentaten der Vorfahren erhalten werden und er selbst träumte davon, dass auch ihm eines Tages ein solcher Ruhm zuteilwürde.
Aber Träume ändern sich, dachte er. Vor allem die von Kindern.
Seine Träume hatten sich an dem Tag einschneidend geändert, an dem Prinz Josua, der Bruder von König Elias und Sohn des Priesters Johan, nach Metessa gekommen war, um dort Hilfe für den Kampf gegen seinen Bruder und dessen schrecklichen Verbündeten, den Sturmkönig Ineluki, zu finden. Pasevalles war damals natürlich noch zu klein gewesen, um die Zusammenhänge zu begreifen – er war ja erst acht –, aber er hatte es mit Begeisterung aufgenommen, als er erfuhr, dass der legendäre Ritter Camaris, der größte Krieger seiner Zeit, noch lebte und für Josua kämpfte. Und als Josua den Hochhorst belagerte, hatte sogar sein gelehrter Vater an den Kämpfen teilgenommen, was Pasevalles noch mehr begeistert hatte. Brindalles hatte sich freiwillig als Doppelgänger Josuas zur Verfügung gestellt, während der Prinz mit einer Gruppe von Männern und Sithi auf anderem Weg in die Burg eindrang.
Doch Pasevalles war nicht dabei gewesen. Er hatte nicht miterlebt, wie sein Vater auf dem Pferd des Prinzen den glorreichen Angriff geführt und durch das Tor des Hochhorst gesprengt war. Auch das schreckliche Ende hatte er nicht mitbekommen, als König Elias’ List aufgedeckt und sein Vater von den Verteidigern im Burghof niedergeschlagen und in Stücke gehackt wurde.
Pasevalles hatte das alles nur von Boten erfahren, die zwei Wochen später in Metessa eingetroffen waren, nur einen Tag vor den Leichen seines Vaters und seines Onkels Seriddan, der seinen Wunden wenige Tage nach der Schlacht erlegen war.
An die Wochen und Monate danach erinnerte er sich kaum noch, an die endlose Folge von Tagen und Nächten, in denen er nur Schmerz und Verzweiflung empfunden hatte. Die Zeit hatte den schwarzen Mantel des Vergessens darüber gebreitet. Erst als im Jahr darauf seine Tante beschlossen hatte, erneut zu heiraten, hatte Pasevalles angefangen, seine Umgebung wieder wahrzunehmen.
Zum Tod des Vaters kamen weitere Schicksalsschläge. Seine Mutter starb an einem Fieber, das nach dem Sturmkönigskrieg in Nabban wütete. Auch seine Tante, die den verwitweten Besitzer des benachbarten Landguts geheiratet hatte, starb an diesem Fieber. Und ihr neuer Mann setzte Pasevalles prompt vor die Tür und schickte ihn zu armen Verwandten an der Nordküste Nabbans, deren Haus so kalt und feucht war, dass er genauso gut in den Sümpfen hätte leben können. Es war eine bittere Zeit gewesen …
Nein, Zorn lenkt nur ab, ermahnte er sich. Der Zorn ist der Feind des Erfolgs. Er, Pasevalles, hatte Pläne, Ziele, Verantwortung und durfte sich nicht von bösen Erinnerungen lähmen lassen. In diesem Moment wartete ein ganzer Stapel von Rechnungen darauf, genehmigt und dem Königspaar vorgelegt zu werden. Dazu kamen Dutzende weiterer Zahlungen an die verschiedenen Gläubiger der Krone, die er ein letztes Mal prüfen musste, bevor sie getätigt wurden. Der Wiederaufbau der Burgen war teuer. Obwohl so viele Jahre vergangen waren, zahlte Erkynland immer noch für die Folgen des Sturmkönigskriegs. Und da kam auch noch Vater Wibert mit einem weiteren Stapel von Bittschriften, ein Grund mehr, nicht in Erinnerungen an die Vergangenheit zu versinken.
»Wo soll ich die ablegen?«, fragte Wibert. »Auf dem Boden? Auf Eurem Schoß?« Sein Sekretär war nicht mehr jung und wurde mit zunehmendem Alter statt dicker immer dünner. Er hatte Anflüge von Humor, aber nicht mehr – Anflüge eben. Sein herausragendster Charakterzug war sein ausschließliches Interesse für sich selbst. Für Pasevalles war er äußerst nützlich, bei den anderen Bewohnern der Burg eher unbeliebt.
»Am besten wohl auf dem Boden.« Auf dem Stapel lag ein Brief, der sich im Aussehen von den anderen Dokumenten unterschied. »Was liegt da obendrauf?«
»Ein Brief von Prinzessin Idela«, sagte Wibert mit einem freudlosen Grinsen. »Parfümiert. Bestimmt bittet sie um einen Gefallen.« Er setzte den Stapel ab, der zu kippen drohte, begradigte ihn mit einer flüchtigen Handbewegung, nahm das zusammengefaltete oberste Blatt und reichte es Pasevalles. »Der Herr gebe uns Geduld. Warum er Frauen erschaffen hat, übersteigt mein Verständnis.«
Daran habe ich keinen Zweifel, dachte Pasevalles. Von den Bewohnern des Hochhorst war manchmal zu hören, Wibert sei als Priester geboren worden. Was auch fast stimmte, wie Pasevalles wusste: Wibert war schon als kleiner Junge aus dem Waisenhaus von St. Sutrin als Novize an die Kathedrale gekommen. Der Großkanzler bezweifelte stark, dass es im Leben des Mönchs überhaupt einen Moment gegeben hatte, in dem Mutter Kirche ihm nicht über die Schulter geblickt hatte.
»Werdet Ihr ihn gleich öffnen?«
Pasevalles wollte Wibert schon zurechtweisen, aber er beherrschte sich. Sein Sekretär benahm sich zwar manchmal wie ein Ackergaul in der königlichen Kapelle, aber er war ein nützlicher Mensch, arbeitsam, nicht neugierig und vor allem vollkommen vorhersehbar.
»Ich sehe ihn mir später an, danke. Legt ihn da auf den Tisch.«
Vater Wibert blieb noch einige Augenblicke stehen, ganz offensichtlich in der Hoffnung, der Großkanzler würde es sich anders überlegen und den Brief der Prinzessinwitwe doch gleich lesen – Pasevalles hatte festgestellt, dass Wibert wie so viele Geistliche vom Klatsch lebte –, doch schließlich gab er auf und ging. Pasevalles fand, dass sein Sekretär mit den knochigen Ellbogen und Knien eher aussah wie eine Marionette als ein Gottesmann.
Genau das ist mein Fluch, dachte er. Dass ich sehe, was da wirklich ist, und nicht, was ich nach der Meinung anderer sehen soll. Es war zweifellos ein Fluch, aber manchmal erschien es ihm auch als Gnade, nicht so blind zu sein wie andere, die vor dem, was sie nicht wissen wollten, die Augen verschlossen.
Er nahm den Brief der Prinzessin vorsichtig in die Hände, als könnte das zusammengefaltete Blatt messerscharfe Ränder haben. Daran dachte er manchmal, wenn er die Prinzessin sah – an ein Messer, das lange Zeit unbenutzt und unbemerkt irgendwo lag, um dann plötzlich aufzutauchen und in einem schrecklichen Moment alles zu verändern. Er fragte sich allerdings, ob der Vergleich mit einem Messer wirklich zutraf oder ob er sich ausnahmsweise einmal selbst zum Narren hielt. Jedenfalls fürchtete er die Schwierigkeiten, in die die Prinzessin ihn bringen konnte, war aber auch nicht blind für die Vorteile, die ihre Freundschaft ihm bot. Er schnupperte an dem Brief. Parfümiert, wie Wibert bemerkt hatte, mit Rosenwasser und Balsam, einer Mischung von Weltlichem und Heiligem, Erde und Geist. Eine Botschaft? Oder der Duft, den sie immer verwendete? Pasevalles betrachtete das Siegel und vergewisserte sich, dass es intakt war. Erst dann öffnete er es und faltete den Brief auf.
Liebster Fürst,
ich weiß, dass Ihr aufgrund der Abwesenheit unseres geliebten Königspaars in den vergangenen Monaten überaus beschäftigt wart. Wir sind Euch für Eure unermüdliche, selbstlose Arbeit wirklich alle zu Dank verpflichtet. Ich glaube fest, dass das, was Ihr für das Königreich leistet, eines Tages anerkannt werden wird und Ihr Euren verdienten Lohn erhaltet.
So feinsinnig wie der Hammer eines Schlachters, dachte er. Nein, werte Herrin, das könnt Ihr besser.
Trotzdem muss ich Euch ein wenig schelten, lieber Pasevalles. Es war zwar überaus freundlich von Euch, mir zur Durchsicht der Bücher des armen Johan Josua den lieben Bruder Etan zu schicken, doch muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich gehofft hatte, Ihr würdet selbst kommen, nicht nur weil ich Euch und Eurem Urteil vertraue, sondern weil ich selbstsüchtig gehofft hatte, ein wenig Zeit in Eurer Gesellschaft verbringen zu können.
Auch noch »lieber Pasevalles«. Die Prinzessin kam recht unvermittelt zur Sache. Er fragte sich, warum sie ihn so unbedingt zu ihrem Verbündeten machen wollte. War auf der königlichen Reise nach Norden etwas vorgefallen, von dem er nichts wusste und das sie um ihre Stellung bei Hof fürchten ließ? Allerdings war das nur schwer vorstellbar. Immerhin war sie die Witwe des Prinzen und die Mutter des Thronfolgers. Diese beiden Tatsachen standen doch gewiss unverrückbar fest.
Vielleicht könnten wir uns zu diesem Zweck einen Abend nach dem Essen vornehmen, an dem Ihr die schwere Bürde Eures hohen Amtes beiseitelegt und mir auf ein Glas Comis Gesellschaft leistet. Meine Zofen werden anwesend sein, Ihr braucht also weder um Euren Ruf noch um meinen zu fürchten.
Er musste unwillkürlich lächeln. Sie war eine kluge Frau, die Prinzessin. Ganz anders als ihr polternder, pragmatischer Vater.
Es gibt vieles, über das ich mit Euch reden möchte, darunter natürlich auch die Bibliothek, die den Namen meines Mannes tragen wird, und diejenigen seiner Bücher, die noch in meinem Besitz sind. Vielleicht können wir uns nach dem Gottesdienst am Sankt-Dinanstag treffen. Sagt, dass Ihr kommen werdet.
Ein bloßer Großkanzler konnte eine solche Bitte natürlich nicht abschlagen, und das wäre Pasevalles auch gar nicht eingefallen. Er war der Prinzessin so lange wie möglich aus dem Weg gegangen, weil er dringlichere Dinge zu tun gehabt hatte und überzeugt war, dass sie vor allem seine Zeit und Aufmerksamkeit wollte. Doch die Beharrlichkeit, mit der sie ihn drängte, weckte allmählich seine Neugier. Was wollte sie wirklich? Doch bestimmt nicht etwas so Banales wie die Aufmerksamkeit eines ledigen Mannes? Für so einfach gestrickt hatte er Prinzessin Idela noch nie gehalten.
Er schrieb eine angemessen schmeichelhafte Antwort, bestreute sie mit Löschsand, faltete das Blatt und drückte sein Siegel darauf – sein privates Siegel, nicht das Siegel des Hochthrons, das er als Großkanzler führen durfte, wenn er im Namen des Königs und der Königin schrieb. Was auch immer Idela von ihm wollte, er würde alle Sorgfalt darauf verwenden, es so lange wie möglich von seiner hart erarbeiteten Stellung getrennt zu halten. Denn im Unterschied zu denen, die in eine solche Stellung hineingeboren wurden oder einheirateten, hatte er sich seine Erfolge ausschließlich durch harte Arbeit und kluge Entscheidungen erworben. Das bedeutete freilich auch, dass er ohne Familie oder adlige Frau wenige Mittel hatte, seine Stellung zu sichern. Das Glück war ein Rad, wie er besser als viele wusste, das sich jederzeit ohne Vorwarnung drehen konnte. Die einen hob es empor, die anderen warf es in den Staub.
◆
Die Bienen, die Bruder Etan durch seine Arbeit zwischen den Rosmarinsträuchern vertrieben hatte, kehrten zufrieden summend zurück. Der junge Mönch machte dagegen einen weniger glücklichen Eindruck, dachte Tiamak. Er sah aus, als habe er am Morgen beim Aufwachen festgestellt, dass der Himmel sich unter ihm befand und die Erde über ihm. »Ihr seid so bleich«, sagte er. »Geht es Euch nicht gut, Bruder? Habe ich Euch nicht eine gute Nachricht überbracht?«
»Eine gute Nachricht?« Etan starrte ihn an, als hätte er ihn nicht verstanden. »Ich bitte um Verzeihung, Herr – aber wie könnte das eine gute Nachricht sein? Ich soll mein Zuhause und meine Arbeit aufgeben und in die Welt hinausziehen – in fremde Länder, zu Barbaren! Und nach Kindern suchen, die seit mehr als zwanzig Jahren vermisst sind. Das ist doch gewiss eine vergebliche Mühe.«
Tiamak schürzte die Lippen, unzufrieden mit sich selbst. »Ah, jetzt verstehe ich. Er-der-stets-auf-Sand-tritt verzeihe mir, ich bin zu überstürzt vorgegangen.« Er legte seine schlanke Hand auf Etans Ärmel. »Kommt, setzt Euch zu mir und lasst mich alles erklären.«
Etan folgte ihm aus dem Kräutergarten der Kathedrale zu einer Bank an dem Weg, der daneben verlief. Abwesend wischte er die Hände an seiner Kutte ab, doch statt das Rosmarinöl loszuwerden, bewirkte er nur, dass die Fusseln des Stoffs an seinen Handflächen und Fingern kleben blieben.
»Ich wurde im Sumpf geboren, müsst Ihr wissen«, begann Tiamak. »Als Kind des Wran hatte ich keine Vorstellung davon, dass es überhaupt noch andere Orte gab, ganz zu schweigen davon, wie verschieden sie sind. Als ich zum ersten Mal nach Kwanitupul am Meer kam, konnte ich nicht fassen, dass ein solcher Ort existierte. Mit so vielen Menschen! Von denen keiner festen Boden unter den Füßen hatte. Denn fast ganz Kwanitupul steht auf Plattformen.«
»Das weiß ich, Fürst Tiamak. Ihr habt es mir schon erzählt.«
Tiamak lächelte. »Ja, aber jetzt spreche ich nicht über Kwanitupul, sondern darüber, wie es ist, wenn man sein Zuhause und seine vertraute Umgebung verlässt. Denn Kwanitupul hat mich nur kurze Zeit so überwältigt und eingeschüchtert. Anschließend bin ich nach Perdruin gereist, eine Insel, die mir so groß vorkam wie das ganze Wran, und deren größter Teil von einer lebhaften Stadt eingenommen wurde. Und dann lernte ich erst Nabban kennen …!« Tiamak schüttelte den Kopf. »Ich bin froh, dass ich nach meinem Aufbruch aus dem Sumpf nicht gleich nach Nabban kam. Angesichts seiner Größe und des vielen Lärms und hektischen Treibens wäre mir wahrscheinlich das Herz stehengeblieben.«
»Aber mit Verlaub, Herr, ich bin kein Wranna«, sagte Etan. »Ich lebe in einer der größten Städte Osten Ards und kenne hier Leute aus aller Welt. Das ist nicht dasselbe wie … also, wie in einem Sumpf zu leben.«
»Nein, natürlich nicht. Ich weise Euch ja auch nur darauf hin, dass nichts den Horizont so sehr erweitert, wie Neues zu sehen.« Langsam, ermahnte Tiamak sich, langsam, damit du ihn nur lockst, nicht überwältigst. »Ihr seid ein gescheiter junger Mann, Etan, aber auch sehr behütet aufgewachsen. Jetzt eröffnet sich Euch die Gelegenheit, Gegenden der Welt kennenzulernen, die nicht einmal Erzbischof Gervis kennt oder je kennenlernen wird.«
»Aber warum? Das frage ich mich. Und warum ich? Warum diese sonderbare Aufgabe, wenn ich mich doch bei so vielen anderen Dingen nützlich machen könnte?«
»Vor allem, weil ich glaube, dass Ihr dafür die beste Wahl seid.« Tiamak gab seiner Stimme einen etwas entschiedeneren Klang. »Ich verfüge über einige Menschenkenntnis und auch sonstiges Wissen, und ich sage nicht oft: ›Hier ist ein Mensch, der zwar schon klug ist, aber noch klüger werden kann, ein wahrhaftiger Denker, wie es sie nur selten gibt.‹ Aber Euch halte ich für so jemanden.«
Etan war ganz offensichtlich wieder verwirrt. »Aber wäre nicht jemand anderes besser dafür geeignet als ich, Herr? Ein Ritter, oder noch besser ein Adliger, der die Menschen zwingen kann, seine Fragen zu beantworten?«
»Gegen Lügen wäre auch er nicht gefeit, Bruder. Die Leute sagen den Mächtigen, was die ihrer Meinung nach hören wollen. Oder sie sagen ihnen gar nichts, weil sie vor ihnen Angst haben. Wenn wir im Namen des Königs eine große Gruppe mit Ritter Zakiel oder Graf Eolair an der Spitze entsenden, werden die Menschen Schlange stehen, um ihnen in der Hoffnung auf ihre Gunst Halbwahrheiten und Gerüchte zu erzählen, von deren Richtigkeit sie überzeugt sind. Auf diese Weise erfährt man nichts wirklich Nützliches – während umgekehrt alle Welt erfährt, was man wissen will.«
»Es soll geheim bleiben?«
»Natürlich. Sollen wir in einer Zeit, in der ein Krieg mit den Nornen wieder eine furchtbare Möglichkeit zu sein scheint, hinausposaunen, dass König Johans einziger Sohn, der nach Ansicht der meisten in der letzten Schlacht gegen den Sturmkönig gefallen ist, in Wahrheit noch lebt, aber dass wir ihn mitsamt seiner Frau und seinen beiden Kindern aus den Augen verloren haben? Wir wären jahrelang damit beschäftigt, die wahren und falschen Geschichten voneinander zu trennen, die man uns auf diese Enthüllung hin erzählen würde, ganz zu schweigen von den vielen Hochstaplern, die Anspruch auf den Thron erheben würden, weil sie angeblich die verschollenen Kinder Josuas sind. Und meint Ihr nicht, die Nachricht seines Verschwindens würde auch in der Sturmspitze mit größter Aufmerksamkeit aufgenommen werden? Wir müssten Josua dann nicht nur suchen, sondern auch möglichst noch vor den Nornen finden.«
»Ich verstehe allmählich, was Ihr meint.« Etan überlegte mit gerunzelter Stirn. »Aber warum ausgerechnet jetzt? Wie Ihr sagt, gibt es vielleicht bald Krieg – obwohl ich gestehen muss, dass ich die Lage nicht für so ernst gehalten habe. Warum jetzt diese Angelegenheit ausgraben, nachdem sie zwanzig Jahre und länger geruht hat?«
Tiamak musste unwillkürlich seufzen. »Weil sie eben nicht zwanzig Jahre lang geruht hat. Nein, wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten Nachforschungen nach dem Verbleib Josuas angestellt, aber immer vergeblich. Doch aus zwei Gründen ist das Problem jetzt besonders dringend. Einmal haben unser König und die Königin Herzog Isgrimnur auf dem Totenbett versprochen, die Suche nach Josuas Kindern wieder aufzunehmen – also nach Isgrimnurs Patenkindern. Der Seelenfrieden dieses braven Mannes wäre allein schon Grund genug, glaubt mir. Aber es gibt einen weiteren Grund, den noch nicht einmal der König und die Königin in vollem Umfang erkannt haben.« Er hob die Hand, um Etans Frage zuvorzukommen. »Nein, fragt mich nicht, alles zu seiner Zeit. Lass uns in meine Gemächer gehen. Meine Frau ist mit der Pflege der vergifteten Sitha beschäftigt, deshalb sind wir dort eine Weile ungestört wie nirgends sonst in dieser lärmenden Stadt oder auch der Burg. Kommt.«
Bruder Etan wirkte immer noch niedergedrückt und Tiamak war voller Mitgefühl. Er hatte ihm sehr viel auf einmal zugemutet. »Wie seid Ihr zu Eurer Arbeit in der Burg gekommen?«, fragte er, während er ihnen Wein einschenkte.
»In der Burg? Fürst Pasevalles hat mich angefordert und der Erzbischof meinte, ich solle ihm in der Kanzlei helfen.«
Tiamak musste lächeln. »Na, ganz so war es nicht. Ich hatte ein Auge auf Euch geworfen, und als Pasevalles nach Hilfe suchte, schlug ich Euch vor. Offenbar fand er meinen Vorschlag nützlich. Und ich war so egoistisch, Euch selbst für einige Aufgaben anzustellen, wie Ihr wisst. Aber das braucht Euch nicht weiter zu interessieren. Warum, glaubt Ihr, seid Ihr mir aufgefallen?«
Etan breitete ein wenig ungeduldig die Hände aus. »Ich habe keine Ahnung, Fürst Tiamak. Und Eure Fragen zu beantworten ermüdet mich offen gesagt ein wenig, da sowieso alles falsch zu sein scheint, was ich weiß.«
»Sehr gut. Es gefällt mir, dass Ihr Eure Gedanken so offen aussprecht. Jemand, der viel denkt, muss auf seine Gedanken vertrauen, zumindest so weit, dass er ihnen folgt, um zu sehen, wohin sie führen. Ihr seid mir aufgefallen, weil Ihr ehrgeizig wart.« Er hob die Hand. »Nein, nein, ich meine das überhaupt nicht als Vorwurf. Ihr strebt nicht nach Ruhm oder Belohnung. Aber Ihr habt einen ruhelosen Geist, wie ich es nennen würde. Ihr gebt Euch nicht damit zufrieden, Dinge auf althergebrachte Weise zu tun, nur weil man sie immer so getan hat. Für Euch ist ein Problem etwas, das man lösen muss, nicht etwas, dem man am besten ausweicht. Das ist eine Art Ehrgeiz. Und Ihr habt Ideen. Auch das hängt mit Eurem Ehrgeiz zusammen. Erinnert Ihr Euch, wie Ihr Pasevalles vorgeschlagen habt, Dokumente und andere Dinge in Körben an Seilen zwischen Schatzkammer und Kanzlei hin- und herzubefördern, weil das schneller geht als mit Boten?«
»Jetzt, wo Ihr es erwähnt, erinnere ich mich«, sagte Etan. »Aber woher wisst Ihr davon?«
»Weil ich mir vorgenommen habe, Euch im Auge zu behalten, Bruder. Ich interessiere mich für Menschen, die selbständig denken, denen Wissen um seiner selbst willen wichtig ist, aber auch wegen des Nutzens für ihre Mitmenschen.« Tiamak nippte an seinem Becher. »Der Wein schmeckt leider nicht besonders gut. Thelía und ich trinken nur selten welchen, deshalb wissen wir auch nicht, was wir unseren Gästen vorsetzen sollen.«
Etan machte eine Handbewegung zum Zeichen, dass es ihm nichts ausmachte.
»Also«, fuhr Tiamak fort, »hört mir gut zu, denn was ich Euch jetzt sage, hat direkt mit Eurer Aufgabe zu tun. Einer Aufgabe, die Ihr übrigens auch jederzeit ablehnen könnt, wie ich gleich am Anfang hätte klarstellen sollen.«
Der Mönch sah ihn mit vor Überraschung großen Augen an. »Das kann ich? Ich muss gestehen, das war mir nicht klar.«
»Aber natürlich. Solange es nicht um Leben oder Tod geht, zwinge ich niemanden gegen seinen Willen dazu, sein Zuhause und seine Arbeit aufzugeben, wie Ihr es ausdrückt. Doch werdet Ihr, wenn unser Gespräch zu Ende ist, vermutlich erkennen, wie vorteilhaft dieser Auftrag für Euch ist, und nicht zögern, ihn anzunehmen.«
Etan sah ihn mit neuerwachtem Interesse an. »Wirklich? Ihr lasst es darauf ankommen, Herr?«
»Gewissermaßen. Lasst es mich so sagen – wenn Ihr nach unserem Gespräch immer noch meint, dass der Auftrag Euch keine Vorteile bringt, und Ihr ihn deshalb nicht freiwillig übernehmen wollt, seid Ihr entschuldigt und wir werden nie wieder davon sprechen. Ihr werdet keinen Makel davontragen und Euer Ruf wird nicht darunter leiden. Seid Ihr damit einverstanden?«
»Mehr als das.«
»Gut, dann hört mir zu. Ich beginne mit Ealhstan, dem Fischerkönig, wie viele ihn nennen, dem ersten eigentlichen König von Erkynland. Er war übrigens auch König Simons Vorfahre.«
»Davon habe ich gehört.«
»Aber vermutlich nichts Genaues. Der König schämt sich seines Blutes – nein, nicht seines Blutes, sondern des Rechts zu herrschen, das ihm aufgrund seines Blutes zufiel. Aber dem werdet Ihr im weiteren Verlauf unseres Gesprächs noch oft begegnen – dass große Männer und Frauen in mancher Hinsicht genauso unnötig kompliziert sind wie wir anderen Menschen.«
»Also gut.« Etan gab Wasser in seinen dritten Becher Wein, denn er hatte Durst, wollte aber einen klaren Kopf behalten. »Dann fasse ich noch einmal zusammen, wie ich es verstanden habe.« Die Liste der Namen und Ereignisse hatte im Lauf des Nachmittags schwindelnde Ausmaße angenommen, obwohl Tiamak immer wieder geduldig die Zusammenhänge erklärt hatte. »Der Bund der Schriftrolle wurde hier auf dem Hochhorst von König Ealhstan gegründet, um das Wissen zu bewahren und zu mehren. Er hatte über die Jahre viele Mitglieder, meist sieben gleichzeitig, doch in der jüngeren Vergangenheit wurden es weniger.«
»Was daran lag«, sagte Tiamak, »dass wir die Mitglieder nicht ersetzt haben, die im Krieg ums Leben gekommen sind oder … Ihr wisst selbst, was mit Pryrates geschehen ist.«
Etan nickte. Vom roten Priester wurde in der Mutter Kirche offiziell zwar nicht gesprochen, doch privat waren die Gottesmänner durchaus willens, von ihm zu erzählen, wenn sich die Gelegenheit dazu bot. Pryrates war ein Dämon, der immer noch entsetzte und faszinierte. »Ich verstehe. Aber auch Prinz Josua war ein Schriftrollenträger! Das wusste ich nicht.«
»Nach dem Einsturz des Turms und nachdem der Krieg vorbei war, ja«, sagte Tiamak. »Es war die ideale Aufgabe für jemanden mit einem wachen, auf das Nützliche gerichteten Geist wie Josua, dem das Königreich seines Vaters zwar sehr am Herzen lag, der aber nicht darüber herrschen wollte. Leider war er nur einige wenige Jahre bei uns im Bund, dann verschwand er.«
»Und ließ seine Kinder bei ihrer Mutter zurück … wie hieß sie noch gleich? Varsa?«
»Vara, die Tochter eines Clanführers der Thrithinge. Ja, die Zwillinge Derra und Deornoth. Aber ob er verschwand und seine Frau allein ließ, wissen wir nicht.«
»Weil nach seinen letzten Briefen niemand mehr von ihnen hörte.«
»Richtig. Ich zeige Euch diese Briefe später noch, weil sie der Ausgangspunkt jeder Suche sind. Aber missversteht mich nicht, Bruder. Der König und die Königin haben die Sache nicht einfach auf sich beruhen lassen – Josua war schließlich der Onkel der Königin und hat Simon zum Ritter geschlagen, als der noch ein Küchenjunge war. Er bedeutete ihnen beiden sehr viel.«
»Verstehe. Verzeiht mir, wenn ich die Reihenfolge durcheinanderbringe, Herr, aber Herzog Isgrimnur und Graf Eolair reisten also beide in den Süden nach Kwanitupul, um Josua und die Kinder zu suchen. Und Ihr habt sie begleitet.«
»Ich habe Eolair begleitet, als wir sie zum ersten Mal suchten.« Tiamak lächelte. »Damals kannte ich ihn noch nicht so gut. Ich bin dankbar für die gemeinsame Reise.«
»Aber Ihr sagtet, Ihr hättet nichts gefunden. Das Wirtshaus, dessen Besitzer Josua war, sei verkauft worden und die neuen Eigentümer hätten nicht gewusst, wohin die Familie gegangen sei. Wer hat es verkauft? Josua oder seine Frau?«
»Das Geld wurde an eine schwarzhaarige Frau gezahlt, bei der es sich womöglich um Vara gehandelt hat. Der Preis war nicht hoch, offenbar wollte sie aus irgendeinem Grund nicht auf ein besseres Angebot warten.«
»Und Vara kehrte in ihre Heimat zurück? Ihr sagtet, sie stamme aus dem Hoch-Thrithing.«
»Sie verabscheute das Grasland und sie verabscheute ihren Vater, einen Clanführer. Das ist alles, was ich sicher weiß. Selbst wenn sie zurückkehrte, Eolair konnte unter den Thrithingleuten niemanden finden, der etwas über sie wusste. Mit ihrem Vater haben wir nicht gesprochen, aber jemand anderes hat es für uns getan und er sagte offenbar, wenn seine Tochter mit Josuas Kindern zurückgekehrt wäre, hätte er sie allesamt getötet.«
»Was für ein Barbar und Ungeheuer.«
»Ja, aber solche Leute gibt es nicht nur im Grasland und in den Sümpfen von Osten Ard, sondern überall. Sogar in der Kirche.«
Etan wollte protestieren, beherrschte sich aber. Fürst Tiamak mochte als Heide seine Vorurteile haben, aber er war ein ehrlicher Mann, der es gut meinte, und das war entscheidend. »Sie blieben also spurlos verschwunden. Hat denn ein anderer Schriftrollenträger vor Josuas Verschwinden noch von ihm gehört? Was ist mit dieser Frau in Perdruin?«
»Faiera. Wir wissen nichts mit Sicherheit, weil sie um etwa dieselbe Zeit verschwand oder zumindest aufhörte, die Briefe anderer Schriftrollenträger zu beantworten.«
»Könnte ihr Verschwinden mit dem von Josua zusammenhängen?«, fragte Etan. »Ich möchte nichts Ungebührliches unterstellen, aber könnte es nicht sein, dass Prinz Josua und diese Frau … also …«
»Miteinander durchgebrannt sind? Fragt nur ohne Angst, Bruder. Ich bin froh, dass Ihr diese Frage gestellt habt, denn natürlich kam uns dieser Gedanke auch. Eolair und ich haben Faiera gesucht. Habe ich Euch nicht gesagt, was wir fanden?«
»Nein. Es sei denn, ich hätte es in der Fülle von Namen und anderen Dingen überhört.«
Tiamak lächelte. »Möglich, aber wahrscheinlich habe ich es vergessen. Eolair und ich wollten sie in Perdruin aufsuchen und befragen, weil Josua in einem seiner letzten Briefe schrieb, er hätte selbst Fragen an sie – wichtige Fragen, wie er meinte.« Tiamak schüttelte den Kopf. »Doch stellt Euch vor, was wir entdeckten: Nicht nur war sie verschwunden, auch ihr Haus war abgebrannt.«
»Abgebrannt? War sie keine Adlige?«
»Von ihrer Abstammung her ja, aber nicht von ihren Lebensumständen. Sie wohnte in einem Haus in einer besonders dicht bevölkerten Gegend von Perdruin, einem ›Kessel‹ genannten Viertel unten am Hafen im ältesten Teil der Stadt. Ihr Haus gehörte zu einer Reihe von Häusern, die alle so alt und heruntergekommen waren wie das ganze Viertel. Es sieht dort mehr aus wie in Kwanitupul als in Perdruin. Aber Kwanitupul kennt Ihr ja auch nicht. Jedenfalls war ein Jahr vor unserem Eintreffen, etwa zu der Zeit von Josuas Verschwinden, in dieser Häuserreihe ein Feuer ausgebrochen. Die Häuser in der Mitte waren vollkommen ausgebrannt und auch einige Häuser in angrenzenden Straßen wurden vom Feuer erfasst. Es gab viele Tote, von denen allerdings nur verkohlte Knochen übrig blieben. Wir wissen nicht, ob auch Faiera unter ihnen war. Oder Josua.«
»Aber es könnte das Ende gewesen sein? Ein schreckliches Feuer, in dem der Prinz und diese Faiera umkamen?«
»Es könnte natürlich der Grund sein, warum wir von beiden nie wieder gehört haben. Aber selbst dann wüssten wir immer noch nicht, wohin Vara mit den Kindern gegangen ist, nach denen wir eigentlich suchen.« Er legte Etan die Hand auf den Arm. »Wohin sind die Kinder verschwunden?«
Etan lehnte sich zurück, überwältigt von der Zahl der Probleme. »Ich muss das alles erst verarbeiten, Herr. Was macht Euch glauben, ich hätte Lust auf ein so schwieriges oder gar hoffnungsloses Unternehmen, das zwanzig Jahre zu spät kommt? Ihr meintet doch, ich würde mich freiwillig dazu bereit erklären.«
»Weil es nicht nur dem König und der Königin am Herzen liegt – sie stehen mit ihrem Versprechen bei einem Freund in der Pflicht –, sondern auch eine Gelegenheit ist, wie Ihr sie vielleicht nie wieder geboten bekommt. Eine wunderbare Gelegenheit.«
»Nach Leuten zu suchen, die seit zwanzig Jahren vermisst werden?«
Der kleine Wranna drückte Etans Hand. »Ich sagte doch, dass Ihr Euch freiwillig dafür entscheiden sollt, Bruder, und ich meinte es ernst. Aber zieht noch einen letzten wichtigen Grund in Betracht.« Tiamak senkte die Stimme ein wenig. »Ihr seid ein Mann mit einem tiefverwurzelten Bedürfnis nach Wissen, ob es Euch bewusst ist oder nicht. Was für eine bessere Gelegenheit werdet Ihr je finden, etwas von der Welt zu sehen, als diese Reise in den Süden im Auftrag des Hochthrons mit allen damit verbundenen Privilegien? Wolltet Ihr nie die Sancellanische Ädonitis sehen, den Sitz Eurer Kirche? Oder die Ruinen der alten Städte, die einst die Inseln im Süden bedeckten? Und Perdruin, auf dem jede Brise mit dem Duft von Waren aus ganz Osten Ard gewürzt ist? Wie könnt Ihr eine solche Gelegenheit ablehnen, zumal wenn Ihr wisst, dass auch der König und die Königin Euch dankbar wären?«
Etan kam sich vor wie der heilige Sutrin, der von dem verkleideten Engel versucht wurde. »Ihr führt starke Gründe an, Herr. Ich darf mich wirklich frei entscheiden?«
»Ja, natürlich. Und wenn Ihr Euch zu diesem Unternehmen bereit erklärt, gebe ich Euch alle Briefe Josuas, die ich habe, und auch die von Faiera. Ihr werdet Dinge über den Bund der Schriftrolle erfahren, die sonst nur die Schriftrollenträger wissen. Was meint Ihr, Bruder? Braucht Ihr noch Bedenkzeit?«
Bevor Etan antworten konnte, näherten sich draußen im Gang hastige Schritte. Etan hob erschrocken den Kopf. Übersättigt mit Geheimnissen, wie er war, erwartete er schon fast, dass gleich jemand hereinstürmen und ihn verhaften würde.
Tiamak ging hinkend zur Tür, noch bevor es klopfte. Er machte auf, und davor stand keuchend und schweißüberströmt ein korpulenter Priester, Tiamaks Sekretär.
»Vater Avner!«, rief Tiamak. »Ist etwas passiert?«
»Fürst Tiamak, Eure Frau Thelía bittet Euch, sofort zu kommen! In die königliche Kapelle! So schnell wie möglich!«
»Kommt erst einmal wieder zu Atem, Vater«, sagte Tiamak. Etan mochte nicht glauben, dass er wirklich so ruhig war, wie er klang. »Und dann erzählt alles der Reihe nach. Natürlich komme ich. Was ist passiert? Etwas mit der Sitha-Frau?«
Vater Avner schüttelte wie betäubt den geschorenen Schädel. »Sitha-Frau? Davon weiß ich nichts, Herr. Aber der Prinz ist vom Turm gestürzt.«
Bruder Etan schlug erschrocken das Zeichen des Baums. »Gott schütze ihn!«, rief er. »Und uns!«
»Ist Prinz Morgan schwer verletzt?«, fragte Tiamak. »Tot?«
»Ich weiß es nicht – Eure Frau hat nur gesagt, ich solle Euch holen«, antwortete Avner. »Aber er ist angeblich vom Hjeldinsturm gefallen, und der ist wirklich sehr hoch …«
Tiamak eilte hinaus. Etan sprang auf und folgte ihm. Tiamaks Sekretär, der seinen Auftrag ausgeführt hatte, beugte sich vor, stützte die Hände auf die Knie und rang nach Luft.
33
Geheimnisse und Versprechen
Jedes Mal, wenn die Königin sich Morgan auf dem provisorischen Lager nähern wollte, das man ihm eilig in der königlichen Kapelle bereitet hatte, runzelte Thelía die Stirn und bat sie höflich, wieder zurückzutreten. Weggescheucht zu werden wie ein Kind, passte Miriamel zwar gar nicht, aber sie versuchte sich zu beherrschen.
Endlich richtete Thelía sich auf. »Jetzt könnt Ihr zu ihm, Majestät. Ich kann Euch beruhigen – er ist nur auf dem Turm gestürzt, nicht vom Turm, dem Herrn sei Dank. Abgesehen von einer mächtigen Beule am Kinn und einem blutigen Fuß habe ich nichts Schlimmeres gefunden als ein paar Schnitte und Schürfwunden und Prellungen.«
»Elysia sei gepriesen!« Miri kniete sich neben Morgan und betupfte seine Stirn mit einem feuchten Tuch. »Dank dem Allmächtigen bist du nicht schlimmer verletzt. Mein armer Junge!«
»Armer Junge?« Der König war bleich und seine Stimme klang belegt, allerdings nicht nur vor Zorn, sondern auch vor Angst, wie Miriamel wusste. »Auf den Hjeldinsturm zu klettern, dieses von bösen Geistern erfüllte Gemäuer, obwohl es verboten ist!«
Morgan stöhnte und öffnete die Augen. Das königliche Paar und die anderen in der Kapelle – Diener, zwei Küster und der Kaplan Vater Nulles – seufzten erleichtert. Der Prinz sah sich benommen um. »Wo ist Snenneq?«, fragte er schließlich. Seine Augen weiteten sich angstvoll. »Es geht ihm doch gut? Ist er abgestürzt?«
»Nein, er ist nicht abgestürzt«, erwiderte sein Großvater. »Es geht ihm gut, dem Herrn und seinen Engeln sei Dank. Er ist den Turm hinuntergeklettert und hat Hilfe geholt. Binabik war schon zu euch unterwegs, seine Tochter hatte ihn verständigt.« Der König holte tief Luft, bevor er weitersprach, aber seine Stimme zitterte trotzdem vor Empörung. »Was hast du dir dabei eigentlich gedacht, Junge? Hast du überhaupt etwas gedacht?«
»Schrei ihn nicht so an«, sagte Miriamel und betupfte wieder Morgans Stirn. Sie hatte sich zu Tode erschreckt, als die Diener sie geholt hatten. Die Zeit, die sie brauchte, um aus ihren Gemächern zur Kapelle zu gelangen, in die die Wachen ihren Enkel gebracht hatten, war ihr wie ein böser Traum vorgekommen. Sie hatte sich an die Albträume erinnert gefühlt, die sie im ersten Jahr nach Johan Josuas Tod fast jede Nacht gequält hatten. Immer war sie in Eile gewesen, hatte sie gewusst, dass er sie brauchte, und doch war sie immer zu spät gekommen. Die Träume hatten unweigerlich vor einer geschlossenen Tür, einem leeren Bett oder Fußabdrücken auf einer Wiese geendet. Ihren geliebten verlorenen Sohn hatte sie nicht gesehen. Sie konnte Gott nur immer wieder danken, dass es diesmal glimpflich ausgegangen war.
»Ich muss mit Snenneq sprechen«, sagte Morgan. Er wirkte immer noch verängstigt. »Kann ihn jemand holen?«
»Nein, Ihr müsst schlafen, Hoheit«, sagte Thelía. »Das braucht Ihr jetzt am dringendsten. Schlaf ist das beste Heilmittel für fast jede nicht tödliche Verletzung. Und Usires sei gepriesen, Euer Sturz scheint keine dauerhaften Schäden angerichtet zu haben, so übel er auch war.«
Tiamak und der junge Bruder Etan erschienen in der Tür der Kapelle. Ihren Mienen nach zu schließen, wussten sie noch nicht, dass der Prinz gar nicht wirklich vom Turm gefallen war und sich auch nicht übermäßig schwer verletzt hatte. Der Kaplan ging ihnen entgegen und sprach mit ihnen. Miriamel sah ihm nach.
»Ich habe immer noch Herzklopfen«, sagte sie zu Simon. »Ich habe mir solche Sorgen gemacht.«
»Unser Enkel scheint uns nichts anderes zu bereiten«, sagte Simon. »Aber das ist die Höhe.«
»Schimpf ihn nicht aus, nicht vor all den Leuten.« Miriamel hatte die Stimme gesenkt. »Warte damit, bis er wieder in seinem eigenen Zimmer ist.«
»Das wird er bald sein«, erklärte Simon. »Er kann nicht hier in der Kapelle liegen bleiben. Schließlich ist er nicht öffentlich aufgebahrt, er hat sich nur das Kinn angeschlagen. Wir tragen ihn einfach nach oben, mitsamt der Decke, auf der er liegt.« Noch bevor Miriamel Einwände erheben konnte, erteilte er den Dienern entsprechende Befehle.
»Vorsichtig, bitte!«, sagte Thelía, als zwei Diener und zwei Erkynwachen je eine Ecke der Decke packten und Morgan hochhoben. »Wir wissen nicht sicher, ob er sich nicht doch eine Rippe gebrochen hat.«
»Alle«, stöhnte Morgan, als die Männer ihn von den Stufen des Altars hochhoben und dabei ein wenig durchschüttelten. »Ich bin sicher, alle Rippen sind gebrochen.«
»Das geschieht dir auch ganz recht, du … Mondkalb«, sagte der König, allerdings so leise, dass nur Miriamel ihn hörte. Zwar konnte sie vor Anspannung nicht lächeln, aber sie musste daran denken, wie oft Simon selbst in seiner Jugend so genannt worden war.
Lillia hatte die Neuigkeit auch gehört und wartete schon atemlos darauf, ihren Bruder zu sehen. Sie durfte kurz mit ihm sprechen, bevor er hinausgetragen wurde, nur um sich zu überzeugen, dass er nicht schlimm verletzt war. Sie schimpfte ihn allerdings so streng aus, dass er Miriamel unwillkürlich etwas leidtat, so sehr er es auch verdient hatte.
Auch Großkanzler Pasevalles war eingetroffen, bleich vor Schreck und Sorge wie alle anderen. »Wie geht es ihm, Majestät?«, fragte er, als die Prozession die Tür passiert hatte und er die Kapelle betreten konnte. »Ich habe soeben davon erfahren. Möge Gott geben, dass er sich nichts Schlimmes getan hat …«
»Das Kinn hat er sich angeschlagen, mehr nicht«, brummte Simon, obwohl Pasevalles sich an Miriamel gewandt hatte. »Das ist ihm hoffentlich eine Lehre. Weiß Gott, was die anderen denken werden – schließlich ist allgemein bekannt, dass niemand in den Turm darf!« Er schüttelte den Kopf, aber es war mehr ein Erschaudern als eine Verneinung. »Was hatte er an diesem verwünschten Ort zu suchen? Ich habe ihn oft genug davor gewarnt.«
»Vielleicht zu oft«, sagte Miriamel. »Für ihn ist das nur ein Märchen, wie deine Hans-Mundwald-Geschichten.«
»Gott sei gelobt, mir fällt ein Stein vom Herzen, Majestäten«, sagte der Großkanzler lächelnd. »Er wird also wieder gesund werden?«
»Er hat nur einige Schürfwunden und Prellungen, meint Thelía.« Miriamel zitterten immer noch die Hände. »Und eine violette Beule am Kinn. Dank unserer barmherzigen Mutter ist nichts Schlimmeres passiert.« Sie erzählte rasch, was passiert war, wenigstens soweit sie es wusste: dass Klein-Snenneq Hilfe geholt hatte und einige Arbeiter mit Werkzeugen und Geschirren zum Dach des Turms hinaufgeklettert waren und den bewusstlosen Morgan heruntergeholt hatten.
»Er hat den Turm doch hoffentlich nicht betreten«, sagte Pasevalles.
»Offenbar nicht«, antwortete Simon. »Er ist nur auf dem Dach ausgerutscht und hat sich den Kopf angeschlagen. Zumindest dafür müssen wir dankbar sein. Was für ein furchtbarer, schlimmer Ort. Ich war selbst einmal drin, müsst Ihr wissen, im Krieg. Ich träume immer noch davon …« Der König brach ab und starrte ins Leere.
»Dann werde ich in die Kanzlei zurückkehren, wenn Ihr mich entschuldigt, Majestäten«, sagte Pasevalles. »Ich war gerade mit etwas Wichtigem beschäftigt, bin aber natürlich sofort hierhergeeilt, als ich von dem Unfall hörte.«
»Geht ruhig«, sagte der König. »Warum soll niemand arbeiten können, nur weil unser Enkel so dumm ist, dass er …«
»Ja, geht, Pasevalles«, fiel Miriamel ihm ins Wort. »Sprecht ein Gebet für seine rasche Genesung.«
»Ich werde heute Abend bei der Mansa eine Kerze für ihn anzünden.«
Tiamak, seine Frau und Bruder Etan hatten sich den Männern angeschlossen, die Morgan zu seinem Bett brachten. Nachdem auch Pasevalles gegangen war, blieben nur Vater Nulles und die Küster zurück. Nulles sprach dem Königspaar sein aufrichtiges Beileid aus und Miriamel brachte ein dankbares Lächeln zustande, obwohl sie eigentlich gehen und nach ihrem Enkel sehen wollte. Selbst Simons Empörung kam ihr sinnlos vor. Der Unfall war passiert und es hatte keinen Zweck mehr, sich darüber aufzuregen und zu fluchen. Doch als sie zu Simon sagte, sie sollten nachsehen, ob der Prinz in seinem Zimmer alles habe, was er brauche, sperrte er sich.
»Geh du, wenn du willst. Ich kann seinen Anblick jetzt nicht ertragen.«
Ärger flammte in Miriamel auf. »Du hast schlimmere Sachen angestellt, als du in seinem Alter warst.«
»Das ist etwas anderes, Miri. Ich war nicht der Thronfolger. Ich war kein Prinz, sondern nur ein Küchenjunge. Ob ich lebte oder starb, hat niemanden gekümmert.«
»Einige schon«, erwiderte sie, durch die Erinnerung besänftigt. »Ich fand immer, du siehst interessant aus.«
»Ha.« Simon hatte sich ein wenig beruhigt und lachte kurz auf. »Interessant. Beim Anblick des schlaksigen, rothaarigen Küchenjungen, der über seine eigenen Füße gestolpert ist, hast du bestimmt gedacht: ›Mit diesem netten Kerl möchte ich mich mal länger unterhalten.‹«
»Nein, das habe ich nicht gedacht.« Sie erinnerte sich plötzlich genau an den Tag, an dem sie Simon zum ersten Mal durch den Inneren Zwinger hatte rennen sehen wie ein tolpatschiges junges Fohlen, das zum ersten Mal galoppierte und dessen Glieder in alle möglichen Richtungen schlenkerten, nur nicht dahin, wo sie sollten. »Ich dachte: ›Der sieht so frei aus! Als hätte er nicht die geringste Sorge in der Welt. Wie sich das wohl anfühlt?‹ Das habe ich gedacht.«
»Gut, wenigstens tust du nicht so, als hätte mein schönes Gesicht dich verführt.«
»Ich habe mein ganzes Leben unter schönen Gesichtern verbracht, zuerst in Meremund und dann hier. Aber ich bin nie jemandem begegnet, dem die Meinung anderer Leute so offensichtlich egal war wie dir.«
Simon lachte wieder und diesmal klang es entspannter. »Ganz egal war sie mir nicht, ich habe sie nur immer wieder vergessen, meine Liebe. Wie Rachel immer gesagt hat – ›Du bist nicht dumm, Junge, aber du benützt deinen Verstand erst, wenn du einer Strafe entgehen willst.‹«
»Ich weiß, dass du sie vermisst«, sagte Miriamel. »Aber mir hat sie Angst gemacht. Sie hat mich immer so böse angesehen, als hätte ich irgendwo eine Schweinerei angerichtet, die sie aufputzen musste.«
»Rachel der Drache, die Kammerfrau, die unordentliche Prinzessinnen böse angesehen hat.« Simon nickte. »Ja, so hätte sie in Erinnerung bleiben wollen.«
»Begleitest du mich jetzt zu Morgan?«
Simon schüttelte den Kopf. »Ich habe ihn ja eben gesehen. Sprich du mit ihm. Aber wir beide müssen auch noch miteinander reden, das weißt du, nicht wahr?«
Miriamel seufzte. »Ja, und ich finde ja auch, dass er eine Strafe verdient. Aber ich werde nicht zulassen, dass du ihn unnötig quälst.«
»Er braucht keine Strafe, Miri. Er muss anfangen, sich wie ein Erwachsener zu benehmen statt wie ein Kind.«
»Mach kein so finsteres Gesicht, damit siehst du selbst wie ein Kind aus. Oder nein, wie Morgan.« Was auch stimmte, dachte sie. Von der Haarfarbe und den fehlenden Sommersprossen des Prinzen abgesehen, war die Ähnlichkeit bemerkenswert, vor allem wenn sie an Simon im selben Alter dachte. Kein Wunder, dass es ihr schwerfiel, längere Zeit auf ihren Taugenichts von Enkel wütend zu sein.
Sie trennten sich vor der königlichen Kapelle. Der König wollte mit Graf Eolair den nächsten Termin für das Schwurgericht festlegen. Im letzten Moment drückte er ihr noch beruhigend die Hand, eine kleine Geste zwischen ihnen, ein privater Moment, selbst wenn der gesamte Hof sie umringte.
◆
Die Wachen und Diener hatten Morgan aus der Kapelle und über den Hof zu einer breiten Treppe getragen, weil Morgan wiederholt über Schmerzen geklagt hatte, die die Erschütterungen ihm verursachten. Aber selbst auf den breiten Stufen hatten die vorausgehenden Männer Schwierigkeiten, rückwärts die Treppe hinaufzusteigen und zugleich das Gewicht des erwachsenen Prinzen zu halten.
Während Pasevalles ihnen zusah, tauchten zwei gefesselte Gefangene in Begleitung einiger Erkynwachen aus dem Wachraum am Fuß der Treppe auf. Als die beiden Gefangenen sahen, was auf der Treppe vorging, drängten sie darauf zu, ohne auf den Protest ihrer Wächter zu achten, die ihrer Pflicht allerdings nur sehr halbherzig nachkamen. Als der Großkanzler die Gefangenen erkannte, verstand er auch, warum.
»He, Ihr!«, rief er dem Anführer der Wache zu. »Wie ich sehe, habt ihr unsere Freunde Ritter Astrian und Ritter Olveris in Gewahrsam genommen.«
»Einen schönen Tag Euch, Fürst Pasevalles!«, rief Astrian vergnügt. »Ja, man hat uns wegen des schrecklichen Verbrechens festgenommen, den Freuden des Alkohols zugesprochen zu haben, und jetzt werden wir zu Hauptmann Zakiel gebracht, um von ihm gemaßregelt zu werden.«
»Aber davor wollten wir noch dem Prinzen eine rasche Genesung wünschen«, sagte Olveris. Seine mürrisch-ernste Stimme ließ das fast klingen, als meinte er es ernst.
»Habt ihr gehört, Freunde? Ich bin vom Hjeldinsturm gefallen!«, rief Morgan aus den Tiefen der Tragedecke. »Ich habe mir das Kinn angeschlagen und sämtliche Rippen gebrochen und leide schreckliche Schmerzen!« Er lachte ein wenig atemlos, als habe er tatsächlich Schmerzen. »Richtet Porto aus, ich bin ab jetzt genauso morsch wie er.«
Die Gefangenen riefen ihm einige aufmunternde Wort nach, während er zum nächsten Treppenabsatz hinaufgetragen wurde und durch eine Tür im Wohngebäude verschwand.
»Das wäre erledigt«, sagte der Wachtmeister. »Ihr habt dem Prinzen Eure Aufwartung gemacht. Ich schlage vor, wir gehen weiter.«
»Einen Augenblick, Wachtmeister«, sagte Pasevalles.
»Jawohl, Großkanzler?« Der Wachtmeister blickte rasch an sich hinunter, vielleicht auf der Suche nach Essensflecken oder einem anderen Makel, an dem Pasevalles Anstoß nehmen konnte.
»Ich nehme diese beiden Männer mit. Ich muss mit ihnen reden.«
»Aber Hauptmann Zakiel hat sie zu sich bestellt.«
»Aha. Dann richtet ihm aus, dass ich die Übeltäter seiner Rechtsprechung überstelle, wenn ich mit ihnen fertig bin. Aber zuerst muss ich etwas Dringendes mit ihnen besprechen.«
Der Wachtmeister zögerte, sichtlich unglücklich darüber, die Gefangenen abzugeben. Noch weniger wollte er es sich freilich mit dem Großkanzler verderben, einem der mächtigsten Männer des Königreichs. Das eigene Interesse siegte über die strenge Befolgung der Vorschriften. »Sehr wohl, mein Herr. Wenn Ihr die Verantwortung dafür übernehmt.«
»Das tue ich und das könnt Ihr Zakiel auch gerne ausrichten. Wenn er dafür eine schriftliche Bestätigung braucht, schickt jemanden in meine Amtsstube in der Kanzlei und mein Sekretär Wibert wird sie ihm ausstellen. Ich werde dafür sorgen, dass die Häftlinge genau in dem Zustand an Euren Vorgesetzten übergeben werden, in dem sie jetzt sind – noch nicht ganz nüchtern und ziemlich wirr im Kopf –, dann mag er nach Belieben mit ihnen verfahren. Von mir aus kann er sie hängen.«
»Ich glaube nicht, dass er das vorhat, Herr.«
»Nein, wohl nicht, aber eigentlich ist das schade.«
»Wollt Ihr uns vielleicht eine Freude machen?«, fragte Astrian. »Und mit uns zum Markt gehen und jedem eine Fleischpastete kaufen?«
»Ihr könnt Euch glücklich schätzen, wenn ich Euch nicht zu einer Fleischpastete verarbeiten lasse«, erwiderte Pasevalles. Der Wachtmeister übergab ihm die beiden Gefangenen. »Und jetzt marsch in die Kanzlei! Aber bitte nicht trödeln.«
»Wollt Ihr uns nicht die Fesseln abnehmen?«, fragte Astrian.
»Ihr scherzt gewiss«, sagte Pasevalles. »Ich wünschte, sie wären schwerer.«
In der Kanzlei angekommen, schickte Pasevalles Vater Wibert und die anderen Schreiber und Geistlichen in die vorderen Zimmer, um mit den beiden Soldaten allein zu sein. Astrian kannte er schon lange, seit seiner Zeit in Nabban, und Olveris fast genauso lange. Er hatte sie von ihren besten und ihren schlechtesten Seiten erlebt, aber so wütend wie jetzt war er noch nie gewesen.
»Beim heiligen Cornellis und den anderen Heiligen, was fällt Euch ein?« Er hatte Mühe, so leise zu sprechen, dass er nicht im ganzen Kanzleigebäude zu hören war. »Ihr wisst, dass Ihr Morgan nicht allein lassen dürft, vor allem nicht, wenn er so verrückte Einfälle hat. Er hätte ums Leben kommen können! Nur der barmherzige Gott hat das verhindert!«
Astrian wirkte ein wenig zerknirscht, aber nur ein wenig. »Ihr sagtet, er würde zu viel trinken, Herr. Wir haben ihm zugeredet, mit uns zu Zakiels Ordensverleihung zu kommen, aber als er nicht wollte …« Er zuckte mit den Schultern. »Was hätten wir tun sollen?«
»Was Ihr hättet tun sollen? Ihn begleiten! Bei ihm bleiben! Und wenn er sagt, dass er auf diesen gottverdammten Turm hinaufsteigen und hinunterfallen will, sagt Ihr gefälligst: ›Nein, bitte nicht, Hoheit, Ihr bleibt hier bei uns.‹ Das sollt Ihr tun. Was glaubt Ihr denn, wofür ich Euch Trottel bezahle?«
»Er ist sehr stur«, gab Olveris zu bedenken.
»Stur? Natürlich ist er das. Er ist ein verwöhnter, noch kaum erwachsener junger Mann und seine engsten Gefährten sind zwei Vollidioten im Dauerrausch. Junge Männer in seinem Alter machen Dummheiten. Es ist Eure Aufgabe, ihn daran zu hindern.«
»Aber wir …«, begann Astrian gekränkt.
»Bitte nicht. Ich will keine Ausflüchte hören!« Pasevalles ging neben dem Tisch auf und ab, auf dem die Arbeit von einigen Monaten auf ihn wartete, während er sich um einen solchen Unsinn kümmern musste. »Kapiert Ihr denn nicht, wie wichtig dieser Junge ist? Er ist der Erbe von Priester Johans Königreich – des ganzen Hochbanns. Nach dem König und der Königin ist er die wichtigste Person auf dieser Welt, wichtiger noch als Seine Heiligkeit der Lektor der Mutter Kirche!« Er musterte die beiden finster. Wehe, sie sagten jetzt etwas. Aber sie hatten den Ernst der Lage offenbar begriffen und schwiegen. »Was, glaubt Ihr, würde passieren, wenn die Reiter der Wache des Lektors zulassen würden, dass der Lektor nachts auf das Dach der Sancellanischen Ädonitis steigt und hinunterfällt? Glaubt Ihr, sie würden ihre Posten behalten? Oder würde man sie auf dem Galdingsplatz vor den Augen einer kreischenden Menge ausweiden und vierteilen? Ja? Was glaubt Ihr?«
»Er ist doch nicht wirklich vom Turm gefallen«, sagte Astrian leise. »Nicht bis ganz nach unten. Dort unten ist alles gepflastert. Er wäre aufgeplatzt wie ein Ei.«
»Das versteht Ihr also unter dem Schutz des Thronfolgers? Dass er sich nur die Rippen prellt und fast den Kiefer bricht, aber nicht aufplatzt wie ein Ei?«
»So habe ich es nicht gemeint«, murmelte Astrian.
»Wir verstehen ja, warum Ihr wütend seid, Herr«, sagte Olveris.
»Nein, diesen Eindruck habe ich überhaupt nicht«, erwiderte Pasevalles. »Weil Ihr offenbar findet, Ihr wärt die Einzigen, denen ich eine solche Aufgabe anvertrauen kann. Aber glaubt mir, ich könnte ein paar Hundert Leute finden, die es besser machen würden als Ihr. Seid versichert, ich könnte schon in der kurzen Zeit einen besseren Ersatz finden, die es dauern würde, Euch zum Henkersblock abführen zu lassen.«
Zumindest Olveris wirkte auf einmal ungewöhnlich bleich und seine olivfarbene Haut glänzte schweißnass. »Jawohl, Herr.«
»Jawohl, Herr«, echote Astrian. »Aber …«
»Genug! Ich schicke Euch jetzt zu Zakiel. Wibert bringt Euch hin, ich kann Euren Anblick nicht mehr ertragen. Aber wenn Ihr auch nur einem der beiden Ärger macht oder unhöfliche Worte gebraucht, werde ich dafür sorgen, dass Hauptmann Zakiel Euch in das tiefste Verlies der Burg wirft, die Tür mit dem größten Schloss absperrt, das er auftreiben kann, und Euch dort verrotten lässt. Habt Ihr mich verstanden?«
»Jawohl, Herr«, sagte Astrian.
»Jawohl, Herr«, sagte Olveris.
Pasevalles ging ins Vorzimmer und rief seinen Sekretär. »Geht jetzt«, sagte er bei seiner Rückkehr. »Und egal, wie Zakiel Euch bestraft, Ihr werdet ihm danken und Euch entschuldigen. Nein, ich will nichts hören, keinen Ton, so satt habe ich Euch.«
◆
Die anderen Bediensteten waren gegangen und Thelía und Tiamak ebenfalls, überzeugt, dass sie alles ihnen Mögliche getan hatten und Morgans Verletzungen nicht ernst waren. Morgan blieb allein zurück, nur in Gesellschaft seines Knappen Melkin, zweier Diener und seiner Großmutter.
»Ich werde nie verstehen, warum du so etwas tust, Morgan.« Die Königin war nicht nur enttäuscht, sondern regelrecht wütend. Nachdem sie zu der Auffassung gelangt war, dass er nicht schlimm verletzt war, hatte ihr Mitgefühl sich verflüchtigt und man konnte dabei zusehen, wie sie allmählich in Rage geriet wie ein Topf, der anfängt zu kochen. Morgan wollte gar nicht daran denken, was erst sein Großvater sagen würde, und überlegte, wie lange er ihm ausweichen konnte. »Was hast du dir dabei gedacht? Sprich mit mir!«
»Keine Ahnung.« Er wollte sich auf die Seite drehen, um ihr vor Empörung gerötetes Gesicht nicht sehen zu müssen, aber seine Rippen schmerzten zu sehr. »Ich weiß es nicht. Ich … es ist einfach passiert.«
»Wir müssen miteinander reden. Morgen, wenn du eine Nacht geschlafen hast.«
»Es ist noch nicht einmal Nachmittag.«
»Dann, wenn du einen Nachmittag und eine Nacht geschlafen hast. Dein Großvater ist sehr ungehalten.«
»Das ist ja eine Überraschung.«
»Du brauchst nicht frech zu werden, Morgan, und bitte mach auch keine Witze. Das ist im Moment wirklich unpassend.« Sie stützte sich mit der Hand auf sein Bett und stand auf. Manchmal vergaß der Prinz, dass seine Großmutter schon über fünfzig war, weil sie immer schnell lächelte und ein mädchenhaftes Lachen hatte. Er wusste, er hätte ein schlechtes Gewissen haben sollen, weil er ihr Sorgen bereitete, aber aus irgendeinem Grund fühlte er sich noch viel schlechter, als er sie so langsam aufstehen sah, nachdem sie längere Zeit gesessen hatte. Und was noch merkwürdiger war, es machte ihn sogar wütend, als hätte sie ihm einen Kinnhaken verpasst. Manchmal kam es ihm so vor, als sorgten sich die Leute nur deshalb um ihn, damit sie eine Entschuldigung hatten, um mit ihm unzufrieden sein zu können. »Gehst du jetzt, Großmutter?«
»Ja. Das Leben in der Burg und in der Hauptstadt muss weitergehen, egal was passiert.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich bete darum, dass du das eines Tages auch noch lernst, Morgan – dass alle für den Erhalt des Königreichs arbeiten müssen, das du als selbstverständlich betrachtest. Für den Erhalt deines Geburtsrechts.«
»Ich betrachte das nicht als selbstverständlich.« Aber er konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als die Zeit so zu verbringen wie seine Großeltern, und den ganzen Tag Bischöfen, Kaufleuten und Adligen dabei zuzuhören, wenn sie ihre Beschwerden und Bittgesuche vorbrachten, Egoisten allesamt. Lieber war er der geringste Bauer von ganz Erkynland und mähte den ganzen Tag im Schweiß seines Angesichts Gras. Dann brauchte er sich wenigstens nicht mit lauter Dummköpfen zu unterhalten und undankbaren Menschen keinen Gefallen zu tun. Aber genau das wollten seine Großeltern und seine Mutter für ihn und dann wunderten sie sich, warum er sich nicht mehr darüber freute.
»Wo ist deine Mutter?«, fragte die Königin, die in der Tür stehen geblieben war. »Warum ist sie nicht hier? Weiß sie es denn nicht?«
Morgan wusste, dass die Frage nicht ihm galt – er wusste von allen Bewohnern des Hochhorst am wenigsten, wo seine Mutter sich gerade aufhielt –, also zuckte er nicht einmal mit den Schultern.
»Sie sollte jedenfalls hier sein.« Seine Großmutter schickte einen Diener zur Prinzessinwitwe, um sicherzustellen, dass sie informiert war. Dann blieb sie noch einmal stehen, diesmal, weil unmittelbar vor der Tür eine untersetzte, stämmige Gestalt wartete.
»Ich komme, um den Prinzen zu besuchen«, sagte Klein-Snenneq. »Ich frage mich nach seiner Gesundheit. Ob es ihm gut geht.«
»Es geht ihm gut, dank Euch«, sagte die Königin. »Aber später wollen der König und ich noch einmal ganz genau von Euch hören, was ihr zwei da oben zu suchen hattet.«