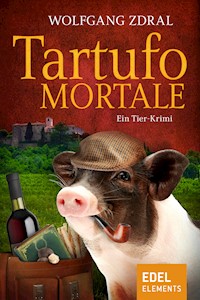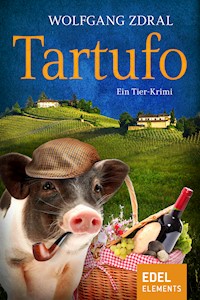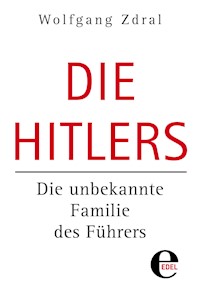
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Adolf Hitler schuf den Mythos des Führers, der allein dem Volk angehört. Mit großem Aufwand verheimlichte er seine Verwandtschaft. Bis heute wissen die wenigsten, wie die Angehörigen Hitlers vor, während und nach der Nazi-Herrschaft lebten. Wolfgang Zdral zeichnet erstmals die Chronik der ganzen Familie Hitler nach.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Wolfgang Zdral
Die Hitlers
Die unbekannte Familie des Führers
Edel eBooks
Inhalt
Einleitung
1 Familiengeheimnisse
Dubiose Herkunft des Stammvaters Alois
Clanchef Alois und die Frauen
Mutter Klara und ihre Kinder
Bruder Adolf, das Muttersöhnchen
Auflösung der Familie
Absetzbewegungen von Zuhause
2 Versteckte Heimat
Familie aus dem Gedächtnis gestrichen
Die Verwandten im »Ahnengau«
Politische Heimat der Familie
Hitlers Hass-Vorbild
Ungeliebte Erinnerungsstätten
3 Private Bande
Geli: umschwärmtes Mädel aus der Heimat
Mutter Angela: Adolfs resolute Schwester
Streit der Frauen
Eva Braun: Die Sucht, zu den Hitlers zu gehören
4 Das schwarze Schaf der Familie
Konkurrenz der Geschwister
Unstetes Leben
Neuer Startversuch
Ein Fall für die Justiz
Der Glanz des Familiennamens
Kontakt mit dem Untergrund
Fluchtstation Hamburg
5 Hitler gegen Hitler
Unangenehme Entdeckung
Abenteuer in Deutschland
Suche nach der Identität
Druck auf den Onkel
Leben als Halbprominenter
Mission Amerika
Hello, Mr. President
Das FBI ermittelt
Arbeit für den Geheimdienst
Kampf an der Front
6 Die Schattenschwester
Das überforderte Mädchen
Streit ums Geld
Liebesersatz
Der Schatten des Bruders
Die neue Rolle
7 Die Hitlers heute
Der Kampf um Hitlers Erbe
Anmerkungen
Literatur
Impressum
Einleitung
Adolf Hitler macht zeitlebens ein Geheimnis um seine Herkunft. Viele Spuren seiner Vergangenheit lässt er systematisch tilgen. »Von Familiengeschichte hab’ ich gar keine Ahnung. Auf dem Gebiet bin ich der allerbeschränkteste«, sagt der Diktator einmal. »Ich bin ein vollkommen unfamiliäres Wesen, ein unsippisch veranlagtes Wesen.« Hinter der von Propaganda modellierten Fassade als entrückter Führer einer »Volksgemeinschaft« bleiben Herkunft und Abstammung verborgen.
»Die eigene Person zu verhüllen wie zu verklären, war eine der Grundanstrengungen seines Lebens. Kaum eine Erscheinung der Geschichte hat sich so gewaltsam, mit so pedantisch anmutender Konsequenz stilisiert und im Persönlichen unauffindbar gemacht«, schreibt der Historiker Joachim Fest. »Immer war er darauf bedacht, Spuren zu verwirren, Identitäten unkenntlich zu machen, den schwer durchsichtigen Hintergrund von Herkunft und Familie weiter zu trüben.« Der britische Historiker Ian Kershaw moniert die »außerordentlich begrenzten Quellen zur Rekonstruktion der Lebensgeschichte des deutschen Diktators«.
Thomas Mann näherte sich im März 1939 im Exil in einem Aufsatz an den »Bruder Hitler«: »Der Bursche ist eine Katastrophe, das ist kein Grund, ihn als Charakter und Schicksal nicht interessant zu finden ... Ein Bruder ... Ein etwas unangenehmer und beschämender Bruder; er geht einem auf die Nerven, es ist eine reichlich peinliche Verwandtschaft.« Der Schriftsteller hatte das im übertragenen Sinn gemeint – doch seine Gedanken wecken zugleich naheliegende Fragen: Wie war Adolf Hitler in Wirklichkeit, als leibhaftiger Bruder? Wie verhielt er sich gegenüber seinen Verwandten? Profitierten die von dem prominenten Diktator? Aus welcher Familie stammt er? Welche Nachkommen gibt es heute noch?
Seltsamerweise wird das Thema in der historischen Fachliteratur stiefmütterlich behandelt: Die Familie der Hitlers, die Geschwister und Verwandten und deren Lebenswege sind bis zur Gegenwart ein nahezu unbeschriebenes Blatt.
Diese Lücke versucht das vorliegende Buch zu füllen. Zugleich bilden die Verwandten ein Medium, um ein unbekanntes Bild des Diktators zu zeichnen, sie liefern eine ungewohnte Perspektive, das Phänomen Hitler zu beleuchten.
Als Grundlage für Die Hitlers dienen die Forschungsergebnisse nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Unveröffentlichte Dokumente aus den Archiven des FBI und des US-Geheimdienstes OSS, aus Privatsammlungen und aus deutschen und österreichischen Archiven sowie Aussagen von Zeitzeugen ergänzen die Biografien.
Die Verwandten zeichnen ein unbekanntes Bild des Diktators. Sie beleuchten das Phänomen des Jahrhundertverbrechers aus einer ungewohnten, menschlichen Perspektive und ergänzen die bisherige Wahrnehmung und Einordnung des privaten Hitler.
Da sind die zerrütteten Familienverhältnisse, die dubiose Herkunft, das pathologische Verhältnis zur Mutter. Und die verqueren Schicksale. Etwa der Halbbruder als Bigamist. Der Neffe, ein Erpresser, der später im Krieg mit den Amerikanern gegen Hitler kämpft. Die Schwester, zeitlebens vom großen Bruder in den Hintergrund gedrängt, muss selbst nach seinem Tod noch unter ihm leiden und in bitterer Armut leben, glaubt aber dennoch bis zum Ende an ihn und greift nach dem Krieg zum Nachlass. Der letzte lebende Nachfahre, der noch den Geburtsnamen Hitler trägt und nun unter falschem Namen lebt. Das erotische Verhältnis Adolf Hitlers zu seiner Nichte. Die Neffen, die ahnungslos dem Feind in die Hände fielen und in der Haft umkamen. Oder der Streit der Nachkommen um das Hitler-Erbe, der bis heute andauert und durch die Unterstützung des Historikers Professor Werner Maser neue Aktualität erhält.
1 Familiengeheimnisse
Es klingt wie eine abstruse Vorlage für einen Film. Da treten ein Mann und eine Frau vor den Traualtar und stellen plötzlich fest, dass sie gar nicht heiraten können. Der Grund ist besonders peinlich: Die beiden sind miteinander verwandt. Ein legitimiertes Verhältnis würde also Inzucht bedeuten, Blutschande. Was der Sache besondere Würze verleiht, ist die Tatsache, dass der Bräutigam nicht genau weiß, wer sein Vater ist – seine Mutter hat den Namen mit ins Grab genommen. Um das Ganze zusätzlich zu dramatisieren, könnte ein Regisseur auf die Idee kommen, die Vermählung als Zwangsehe darzustellen, weil die Frau bereits hochschwanger ist. Damit noch immer nicht zufrieden, spitzt er die Geschichte mit einer anderen Frau zu, der Noch-Ehefrau. Die ringt mit dem Tode, während sich die beiden Liebenden im Nebenzimmer im Bett vergnügen ... Weit hergeholt? Nicht im Geringsten – willkommen mitten in der Familiengeschichte der Hitlers! Die beiden Hauptdarsteller heißen Alois Hitler und Klara Pölzl. Sie werden später traurige Berühmtheit erlangen als Eltern eines Jahrhundertverbrechers.
Nachbarn, die der großen, adretten Klara auf der Straße begegnen, vermuten hinter dem freundlichen Gesicht, den blaugrauen Augen, dem schlichten Kleid, den sorgsam zurückgekämmten Haaren kaum die Mutter eines Bösewichts. Klara ist eine stille Frau, Verwandte und Freunde beschreiben sie als höflich, zurückhaltend, im Haushalt penibel auf Ordnung bedacht. Für den jungen Adolf ist sie der einzige Bezugspunkt in der Familie. Später wird er einen Kult um seine tote Mutter pflegen. Das überlieferte Fotoporträt hat Hitler überall hängen, im Schützengraben während des Ersten Weltkrieges trägt er es in seiner Brusttasche bei sich. Er lässt eine Reihe Ölgemälde anfertigen, die das Bildnis ikonenhaft verklären. Klara Hitlers Geburtstag am 12. August adelt der Diktator zum »Ehrentag der deutschen Mutter«. Eine ganze Nation soll auf diesem Weg an Hitlers persönlicher Erinnerung teilnehmen. In Mein Kampf stilisiert er Klara zur »Mutter im Haushalt aufgehend und vor allem uns Kindern in ewig gleicher liebevoller Sorge zugetan« und bekennt dramatisch: »Ich hatte den Vater verehrt, die Mutter jedoch geliebt.«1 Bei einem der Tischgespräche im Führerhauptquartier begründet er seinen Mutterkult später auch mit dem abseitigen Argument: »Sie hat dem deutschen Volk einen großen Sohn geschenkt.«2
Klara Hitler ist zugleich die biografische Gelenkstelle der Hitlers. Nicht nur, weil sie einen Adolf Hitler hervorbrachte. Sondern auch, weil mit ihr ein Licht auf die dunklen Seiten der Familiengeschichte fällt und die Wurzeln des späteren Reichskanzlers erkennbar werden. Klara wuchs im Waldviertel auf, einem armen Landstrich im Nordwesten Österreichs nahe der böhmischen Grenze, der zur Wiege der ganzen Hitler-Sippe wurde. Dort lernte sie ihren späteren Gatten Alois kennen. Am 7. Januar 1885 heiratete Klara Pölzl den Mann, der zu diesem Zeitpunkt bereits eine bewegte Vergangenheit hinter sich hatte.
Dubiose Herkunft des Stammvaters Alois
Alois kam im Juni 1837 in Strones bei Döllersheim als uneheliches Kind zur Welt. Das war in ländlichen Gegenden wie dem Waldviertel damals durchaus keine Seltenheit, auch wenn die das bäuerliche Leben bestimmende katholische Kirche solcherlei Sündhaftigkeit verdammte. Die Mutter Maria Anna Schicklgruber, Tochter eines mittellosen Kleinbauern, war mit ihren 42 Jahren für die damalige Zeit außergewöhnlich alt für eine Erstgeburt und außerdem allein stehend. Sie weigerte sich, den Namen des Erzeugers preiszugeben, so blieb die entsprechende Spalte des Taufbuches leer.
Adolf Hitlers Vater verbrachte die ersten Jahre am Hof der Schicklgrubers. Mit fünf Jahren bekam sein Leben eine neue Richtung: Die Mutter heiratete den 50-jährigen Johann Georg Hiedler, einen herumziehenden Müllergesellen. War es Geldnot oder die Ablehnung des Stiefvaters – jedenfalls schickte Maria Anna ihren Alois zum Bruder des Ehemanns, einen wohlhabenden Landwirt namens Johann Nepomuk Hüttler, der nur wenige Kilometer entfernt in Spital wohnte. Wie sich zeigte, sollte der Bub dort nun ein neues Heim finden. Schon bald wandelte sich das Provisorium in ein Ersatz-Elternhaus, und als Alois zehn Jahre alt war, starb seine Mutter. Nepomuk kümmerte sich um Alois wie um einen Sohn, sorgte für seinen Lebensunterhalt, schickte ihn zur Schule und ermöglichte ihm eine Lehre bei einem Schuhmacher in Wien.
Eigentlich schien das Leben des jungen Alois vorgezeichnet, so wie es in seiner Generation für Tausende junger Menschen üblich war: Einen Beruf erlernen, in die Heimat zurückkehren, heiraten, Kinder bekommen und versuchen, sein Leben ruhig und behaglich einzurichten. In der Regel blieben die Menschen innerhalb ihres sozialen Umfeldes, ein Ausbrechen aus den Schranken der Unterschicht oder unteren Mittelschicht war nur in Ausnahmefällen möglich. Mangelnde Bildung, fehlendes Kapital und das ausgeprägte Standesdenken jener Zeit legten jedem enge Fesseln an. Alois jedoch nutzte in Wien eine Karrierechance: Die Zollbehörden rekrutierten Nachwuchskräfte auch aus ländlichen Gebieten; Alois, voller Entschlossenheit und Durchsetzungswillen, wohl auch durchtränkt von Abenteuerlust und Risikofreude, griff sofort zu. Als 19-Jähriger begann er seine Ausbildung bei der österreichischen Finanzbehörde. Mit seinem Volksschulabschluss und dem bescheidenen sozialen Hintergrund war der junge Mann damals sicher nicht der Idealkandidat für die Beamtenlaufbahn, sein Risiko zu scheitern hoch. Aber Alois biss sich durch, bildete sich in Eigenregie weiter und war unerwartet erfolgreich. Genau 40 Jahre sollte er als Zöllner arbeiten, bis er im Jahr 1895 vorzeitig pensioniert wurde, gesundheitlich angeschlagen, »wegen der durch das staatsärztlich bestätigte Zeugnis nachgewiesenen Untauglichkeit zur ferneren Dienstleistung«, wie es in der amtlichen Mitteilung zu seinen Ruhestandsbezügen heißt.
Eines der wenigen erhaltenen handschriftlichen Dokumente Alois’ ist eine Eingabe an die Finanzdirektion Linz, in der er kurz nach der Pensionierung um die Rückgabe seiner Dienstkaution bittet. Das Schriftstück spiegelt in seinem devoten Tonfall und der gestelzten Wortwahl den typischen Beamten der Donaumonarchie wider. Darin heißt es:
»Hohe k.k. Finanz-Direktion!
Der ehrfurchtsvoll Gefertigte wurde mit dem hohen Dekrete vom 25. Juni 1895 in den dauernden Ruhestand versetzt.
Nachdem derselbe nicht verantwortlicher Rechnungsleger war, erlaubt er sich, um gnädige Erfolgslassung, beziehungsweise Devinkulierungsbewilligung seiner Dienstkaution, welche Eigentum des Johann Murauer, Hausbesitzer in der Theatergasse Nr. 7 zu Braunau a. Inn ist, ehrfurchtsvoll zu bitten.
Zu diesem Behufe überreicht derselbe in der Anlage ehrfurchtsvoll die auf dessen Namen als Dienstkaution vinkulierte Silberrente-Obligation per 900 Gulden neben I Stück Zinsenzahlungsbogen, sowie die Kassenquittung über die erlegte Barkaution per 200 Gulden.«3
Die Berufsjahre begleiten regelmäßige Beförderungen, die sonst nur Kollegen mit höherer Schulbildung erhalten. Alois dient sich als Amtsassistent hoch, später als Kontrolleur und wird schließlich Zollamtsoffizial. Sein Gehalt liegt am Ende der Dienstzeit bei 1100 Gulden jährlich, dazu addieren sich Ortszuschläge von 220 bis 250 Gulden. Selbst Schuldirektoren verdienen damals erheblich weniger. Mit einem Wort, Alois darf sich als Mitglied der Mittelschicht begreifen, sein Beruf verschafft ihm Autorität und Ansehen. Was der Emporkömmling mit seinem militärisch kurzen Haarschnitt, den buschigen Augenbrauen, dem sorgsam gepflegten Backenbart nach der Mode des Kaisers und durch seine Dienstuniform noch optisch unterstreicht. An eine Verwandte seiner Mutter schreibt er voller Stolz: »Seit Du mich vor 16 Jahren zuletzt gesehen hast, bin ich sehr hoch aufgestiegen.«4
Das neue Standesbewusstsein hat noch andere Konsequenzen: Im Jahr 1877 bricht Alois den Briefkontakt zur Schicklgruber-Sippe ab. »Der Vater hat sich um die Verwandtschaft nicht gekümmert«, berichtet später seine Tochter Paula. »Ich habe niemand von den Verwandten meines Vaters gekannt, so dass wir, meine Schwester Angela und ich, öfter gesagt haben: Wir wissen gar nicht, der Vater muss doch auch Verwandte gehabt haben.«5 Das Abkoppeln von der Schicklgruber-Linie setzte sich später fort: Die offiziellen Ahnenforscher des Nazi-Reiches ließen diese Verwandtschaftslinie des »Führers« völlig außen vor, selbst die Historiker beschäftigten sich lieber mit den Verwandtschaftsbeziehungen der Hiedlers, Pölzls und Koppensteiners. So verlieren sich die Nachfahren der Schicklgrubers bis heute im Nebel der Geschichte.
Mit der Abkehr von den eigenen Ursprüngen verschafft sich der Zollbeamte eine standesgemäßere Herkunft. Seinen alten Familiennamen legt er wie einen zu klein gewordenen Mantel ab und nimmt den Namen an, der durch seinen Sohn zum Inbegriff des Schreckens werden sollte: Hitler. Die Umstände dieser Namensänderung sind eines der merkwürdigsten Kapitel im Leben von Adolf Hitlers Vater.
Am 6. Juni 1876 erscheinen laut Legalisierungsprotokoll drei Zeugen und Alois Schicklgruber vor dem Notar Josef Penkner in Weitra und beurkunden, dass Alois der Sohn von Johann Georg »Hitler« sei. Am nächsten Tag wiederholt sich die Zeremonie vor Josef Zahnschirm, dem Pfarrer der Gemeinde Döllersheim. In das Geburtsbuch notierte der Geistliche, »dass der als Vater eingetragene Georg Hitler, welcher den gefertigten Zeugen wohl bekannt, sich als der von der Kindesmutter Anna Schicklgruber angegebene Vater des Kindes Alois bekannt und um die Eintragung seines Namens in das hiesige Taufbuch nachgesucht habe, wird durch die Gefertigten bestätigt: Josef Romeder, Zeuge, Johann Breiteneder, Zeuge, Engelbert Paukh, Zeuge.«6 Wahrscheinlich sind die drei Zeugen bei diesem zweiten Termin gar nicht mehr persönlich anwesend. Es reicht das Dokument des Notars, statt ihrer Unterschriften finden sich drei Kreuze auf dem Papier. Der Geistliche selbst unterlässt es, was unüblich ist, gegenzuzeichnen.
Fortan nennt sich Alois Schicklgruber also Alois Hitler. Die ungewohnte Schreibweise fällt sofort auf. Denn der Ehemann seiner Mutter nannte sich Hiedler und nicht Hitler. Sein Ziehvater Nepomuk trug den Namen Hüttler. All diese Namen entspringen demselben Wortstamm und bedeuten so viel wie Häusler oder Kleinbauer. Nun könnte schlicht ein phonetisches Missverständnis vorliegen, Notar Penkner hätte demnach den Namen nach der mündlichen Aussprache aufgeschrieben. Das geschah gar nicht selten: Die Brüder Georg und Nepomuk schrieben ihren Nachnamen ebenfalls unterschiedlich. Und auch Alois, wie er seinen Vornamen selbst notierte, war im Geburtsregister als »Aloys« eingetragen.
Aber »Hitler« war eine bewusste Wahl, denn Alois hat die falsche Schreibweise nie korrigieren lassen, was leicht möglich gewesen wäre. Wahrscheinlich gefiel ihm die Idee, sich mit dieser Namensversion für alle sichtbar noch weiter von seiner Herkunft zu distanzieren. Als »Hitler« eröffnet er eine neue Linie des Stammbaumes, wie ein dynastischer Stammvater begründet er seinen eigenen Clan. Darin schwingt eine große Portion Eitelkeit mit, gepaart mit einer betonierten Überzeugtheit von der eigenen Person.
Was sich Alois damals nicht vorstellen konnte: Seine Idee einer eigenen Hitlerschen Linie sollte sich später in der ganzen Welt manifestieren – allerdings als Synonym für Verbrechen und Schreckensherrschaft. Das »Hitler« spricht sich auch anders aus, viel zackiger als das weiche Hiedler oder das bäurisch-bodenständige Schicklgruber – das als obligatorischer Gruß des Führers völlig undenkbar gewesen wäre. Dem Jugendfreund Kubizek gegenüber äußerte Adolf Hitler jedenfalls, wie froh er sei, dass sein Vater die hart klingende Namensversion gewählt hatte.
Das Ganze hat nur einen Haken: Die Namensänderung war illegal. Denn nach den damaligen Gesetzesvorschriften hätte entweder der Kindsvater selbst die Erklärung vor Notar und Pfarrer abgeben oder zumindest ein schriftliches Dokument hinterlassen haben müssen. Schließlich war der angebliche Vater Georg Hiedler zum Zeitpunkt der Namensänderung bereits 19 Jahre tot, die Mutter Maria Anna, die die Rechtmäßigkeit des Vorgangs ebenfalls hätte bezeugen können, lag schon 29 Jahre unter der Erde. Doch den Behörden schien die Angelegenheit nicht weiter wichtig, eine genauere Untersuchung unterblieb, die Änderung wurde einfach zu den Akten genommen – das notarielle Dokument war für die Obrigkeit Beweis genug.
Was bewegt einen 39-Jährigen, nach so langer Zeit in eine neue Identität zu schlüpfen? Dass er plötzlich seinen Familiensinn entdeckte und den letzten Wunsch von Georg Hiedler erfüllen wollte, ist auszuschließen. Dazu wäre bereits nach dessen Tod reichlich Gelegenheit gewesen, und die lange Wartezeit machte keinen Sinn. Auch der »Makel« seiner unehelichen Geburt hatte Alois all die Jahre weder gestört noch behindert. Für den Beruf war die Namensänderung ohne Belang, denn Alois war zu jener Zeit bereits unkündbar und hatte die ersten Stufen seiner Karriereleiter erklommen. Die Antwort liegt bei seinem Ziehvater Nepomuk. Der wollte sein Erbe regeln und Alois zum Hauptnutznießer bestimmen. Nepomuk hatte nur drei Töchter und keinen offiziellen männlichen Nachkommen. Deshalb war nach dem Tod seiner Ehefrau die Zeit reif, den Zögling Alois, auf den er so stolz sein konnte, als Erben für das Gros des Vermögens zu wählen und diesen Pakt mit der Namensänderung zu besiegeln.
Zwar fehlen aussagekräftige Dokumente über diese Erbschaftsregelung, aber nach dem Tode Nepomuks im Jahre 1888 fanden die anderen Kinder kein Vermögen mehr vor, während sich Alois, der selbst nur über ein bescheidenes Sparguthaben verfügt hatte, im selben Jahr plötzlich ein Bauernanwesen in Wörnharts bei Spital leisten konnte, das die stattliche Summe von über 4000 Gulden kostete. Es liegt also nahe anzunehmen, dass Nepomuk die finanziellen Dinge schon im Vorfeld geregelt hatte, wohl auch, um lästige Steuern zu umgehen – ein Verhalten, das auch in der heutigen modernen Zeit noch recht beliebt ist. Dazu passt der Schwindel, mit dem Nepomuk die Namensänderung von Alois in die Wege leitete, ganz gut. Die drei Zeugen, die Nepomuk auftrieb, waren nämlich alles Kumpel aus dem eigenen Umkreis: Josef Romeder war sein Schwiegersohn, Breiteneder und Paukh Verwandte. Es liegt auf der Hand, dass sich die vier vorher absprachen, um die überraschende Gedächtnisleistung glaubhaft zu machen, sich nach so vielen Jahren an die Aussage eines Verstorbenen zu erinnern, den die Zeugen allenfalls flüchtig kannten.
Mit großer Wahrscheinlichkeit hatte Nepomuk noch bessere Gründe als diese, eine Namensänderung seines Ziehsohnes zu wünschen: Alles deutet nämlich darauf hin, dass in Wirklichkeit Nepomuk der Vater von Alois war, und nicht, wie vor Notar und Pfarrer angegeben, sein Bruder Georg. Die Indizien dafür sind zahlreich: Georg Hiedler heiratete Alois’ Mutter erst fünf Jahre nach dessen Geburt, es existieren keinerlei Hinweise darauf, dass der vagabundierende Müllergeselle bereits Jahre zuvor ein Verhältnis mit Maria Anna gehabt, geschweige denn, sich überhaupt im gleichen Dorf aufgehalten hatte. Wichtigstes Argument gegen die Vaterschaft Georgs: Er selbst hat Alois auch nach der Heirat mit Maria Anna nie nachträglich als Sohn legitimieren lassen, obwohl das üblich war. Selbst die Mutter, die bei der Geburt Alois’ den Erzeuger verschwiegen hatte, änderte daran nach der Hochzeit nichts, obwohl es das Natürlichste der Welt gewesen wäre, den gemeinsamen Sohn vor dem Gesetz in den Familienverbund aufzunehmen. Und schließlich kümmerte sich Georg Hiedler nach der Eheschließung auch nicht um seinen angeblichen leiblichen Sohn. Stattdessen gab die Mutter ihr einziges Kind zu – Nepomuk. Dort wuchs der Bub wohl behütet auf, angenommen wie der eigene Sohn und am Ende als Haupterbe begünstigt. Mangels eindeutiger Quellen kann die Frage nach dem Vater nicht mit letzter Sicherheit geklärt werden. Viele Historiker halten die Vaterschaft Nepomuks jedoch für die wahrscheinlichste Variante.7
Das hätte allerdings eine fatale Konsequenz: »Adolf Hitler war das Produkt einer dichten Inzucht«,8 schreibt der Historiker Werner Maser. Denn Nepomuk Hüttler war demnach nicht nur Großvater von Adolfs Mutter Klara, die eine Tochter von Nepomuks Tochter Johanna war, sondern zugleich auch der Großvater Adolfs. Alois hätte also nicht nur, wie nach der offiziellen Lage der Dinge, eine Cousine zweiten Grades geheiratet, sondern sogar eine Enkelin seines Vaters. Derart enge verwandtschaftliche Beziehungen stehen nicht ohne Grund in den meisten Kulturen unter Inzesttabu und waren – bei aller Umdeutung, die der Begriff der Blutschande durch Hitlers Rassentheorien erfuhr – auch im späteren Nazideutschland verboten. Die Tatsache, dass vier der sechs Kinder Klaras offenbar eine schwächliche Konstitution hatten und früh verstarben, spricht für diese Inzestthese.
Hätte Alois seinen Namen nicht geändert und wäre es bei dem ursprünglichen »Vater unbekannt« geblieben, dann hätte Adolf Hitler pikanterweise selbst keinen Ariernachweis erbringen können, denn in seiner Geburtsurkunde hätte die Spalte für den Großvater väterlicherseits frei bleiben müssen. Adolf hatte also doppelt gute Gründe, seinem Vater für die Namenstrickserei dankbar zu sein und ebenso gute Gründe, allzu neugierige Nasen nicht in seiner Herkunft schnüffeln zu lassen. Sein Pech war nur, dass seine Heimlichtuerei um die Familie reichlich Nahrung für Mutmaßungen darüber gab, was er denn wohl zu verbergen hätte. Hitler-Gegner spekulierten immer wieder über angeblich »jüdisches Blut« in seinen Adern. Das Gerücht machte die Runde, ein jüdischer Kaufmann mit Namen Frankenberger sei der wirkliche Großvater Adolfs gewesen. Die Geschichtsschreibung hat diese These mittlerweile widerlegt. Immerhin nahm der NS-Herrscher die Spekulationen so ernst, dass er in den vierziger Jahren die Gestapo heimlich Nachforschungen über seinen Stammbaum anstellen ließ, doch die Recherchen brachten kein Ergebnis. Peinlich genau achtete Adolf Hitler daher darauf, dass die offizielle Propaganda immer Georg Hiedler als seinen Großvater nannte.
Clanchef Alois und die Frauen
Alois Schicklgruber/Hitler pflegte ein Triebleben, das im 19. Jahrhundert sicher nicht die gesellschaftliche Norm darstellte und auch mit den Sitten auf dem Lande kaum zu erklären ist. Er wird im Alter von 30 Jahren als Vater eines unehelichen Kindes ausgemacht, eines Mädchens Therese oder Theresia, entstanden aus einem Verhältnis mit einer gewissen Thekla P., ohne dass die Erstgeborene bislang von den Historikern genau identifiziert werden konnte. Im Jahre 1873 ehelicht er Anna Glassl, eine wohlhabende Beamtentochter aus Braunau am Inn. Bräutigam Alois ist 36 Jahre alt, hat sich also erst relativ spät entschlossen, vor den Traualtar zu treten. Seine Frau Anna jedoch ist noch weit älter, nämlich bereits 50 und nicht mehr bei bester Gesundheit. Anna ist so wohlhabend, dass sich die beiden ein Dienstmädchen leisten können. Das Vermögen der Braut scheint für ihn denn auch der Heiratsgrund zu sein: Der Altersunterschied von 14 Jahren zwischen den Eheleuten spricht gegen eine romantische, feurige Liebe. Wegen Annas Alter entfällt selbst das Motiv, eine Familie zu gründen. Zudem beweist Alois später, wann er wirklich schwach wird: bei jungen Frauen, die seine Töchter sein könnten.
Das soll Anna schon bald klar werden. Während sie immer mehr kränkelt, beginnt Alois ein Verhältnis mit der 24 Jahre jüngeren Franziska Matzelsberger, genannt Fanni, einem Mädchen aus dem Ort Weng im Innkreis. Fanni arbeitet als Magd im Gasthaus Streif in Braunau, dem Wohnsitz der Hitlers. Zu Beginn der Affäre ist das Mädchen 17, höchstens 18 Jahre alt – genau ist das nicht mehr feststellbar. Nach damaliger Rechtslage ist sie in jedem Fall eindeutig minderjährig. Um die Situation zusätzlich zu komplizieren, gehört zu der Zeit auch bereits die ebenfalls minderjährige Klara Pölzl dem Hitlerhaushalt an. Die 16-Jährige ist 1876 aus Spital gekommen, um bei der Pflege der kranken Ehefrau Anna zu helfen. Wobei unklar ist, ob Alois parallel zur Affäre mit Fanni auch schon etwas mit Klara anfängt.
Die am 12. August 1860 in Spital geborene Klara Pölzl ist die älteste Tochter des Kleinbauern Johann Baptist Pölzl und seiner Frau Johanna. Mutter Johanna wiederum ist eine Tochter von Nepomuk Hüttler, dem Ziehvater oder tatsächlichen Erzeuger von Alois. Der, mit Johanna wie ein Bruder aufgewachsen, ist offiziell Klaras Cousin, aber mit 23 Jahren Altersunterschied um so viel älter, dass sie ihn stets nur unterwürfig »Onkel« nennt. Dem Ruf des »Onkels« in die vergleichsweise große Stadt Braunau mag Klara gern gefolgt sein, versprach es doch eine erste Anstellung und eine aufregende Abwechslung zur Enge des Waldviertler Bauernhofes. Zweifellos verfehlten Alois und sein Respektsberuf seine Wirkung auf das unerfahrene, verschüchterte Mädchen nicht.
Die Bettgeschichte mit Fanni konnte in dem rund 3000 Einwohner zählenden Grenzort Braunau nicht lange verborgen bleiben. Die hintergangene Ehefrau Anna verlangt die Scheidung, im November 1880 erfolgt »die Trennung von Tisch und Bett«, wie der Vorgang damals in der österreichischen Doppelmonarchie hieß. Im Hitlerschen Ehebett liegt statt Anna nun Fanni. Die Beziehung ist das, was man später »wilde Ehe« nennen wird. Ihrem Instinkt folgend, verlangt Fanni, die neue Herrin, dass Klara Pölzl das Haus verlässt. Denn Fanni muss zu Recht befürchten, in der nur ein Jahr älteren Klara könne ihr eine Konkurrentin um die gute Partie Alois erwachsen. Klara kehrt nach Spital zurück, und Fanni bringt zwei Jahre später einen unehelichen Sohn zur Welt. Alois gibt ihm seinen eigenen Namen und legitimiert Alois junior nach der Hochzeit mit Fanni im Jahr 1883 – nur sechs Wochen nach dem Tod seiner ersten Frau Anna. Vor dem Traualtar ist die 22-jährige Fanni, für jeden unübersehbar, wieder hochschwanger. Trauzeugen spielen zwei Zollbeamte aus Simbach, dem bayerischen Ort auf der anderen Seite des Inns. Schon zwei Wochen später gebärt Fanni Tochter Angela. Gatte Alois ist 46 Jahre, als er zum ersten Mal legitimen Nachwuchs hat und sich an dessen Erziehung beteiligt.
Fanni Hitler erkrankt noch im selben Jahr schwer an Tuberkulose. Trotz ihres Widerstandes holt sich Alois wieder Klara Pölzl ins Haus: vordergründig, weil Klara bereits Erfahrung mit der Pflege von kranken Personen hat und ihm überdies den Haushalt führen kann. Doch dabei bleibt es natürlich nicht. Alois und Klara beginnen ein Verhältnis – die todgeweihte Fanni kümmert die beiden nicht. Fanni stirbt mit 23 Jahren im August 1884, etwa zur gleichen Zeit, als Klara von Alois schwanger wird. Die Erde auf dem Grab ist noch frisch, doch die beiden zögern nicht länger und beschließen sofort zu heiraten – Trauerfall hin oder her. Was nicht gerade von besonderer Feinfühligkeit des heimlichen Liebespaares zeugt. Doch so einfach funktioniert der Plan nicht.
Die verwandtschaftliche Beziehung macht ihnen nämlich einen Strich durch die Rechnung. Auf dem Papier sind Alois Hitler und Klara Pölzl Vetter beziehungsweise Cousine zweiten Grades. Da dürfen sie nur mit kirchlicher Sondergenehmigung heiraten. Wobei sie das Glück haben, dass niemand um die mögliche Vaterschaft Nepomuks weiß – unter solchen Voraussetzungen wäre eine Ehe überhaupt nicht möglich gewesen. Die Heiratswilligen müssen deshalb offiziell bei der Kirche um Dispens nachsuchen. Sie schreiben an die kirchlichen Stellen in Linz:
»Die in tiefster Ehrfurcht Gefertigten sind entschlossen, sich zu ehelichen. Es steht aber denselben laut beiliegendem Stammbuch das kanonische Hindernis der Seitenverwandtschaft im dritten Grad berührend den zweiten entgegen. Deshalb stellen dieselben die demütige Bitte, das Hochwürdige Ordinariat wolle ihnen gnädigst die Dispens erwirken, und zwar aus folgenden Gründen:
Der Bräutigam ist laut Totenschein seit 10. August dieses Jahres Witwer und Vater von zwei unmündigen Kindern, eines Knaben von zweieinhalb Jahren (Alois) und eines Mädchens von einem Jahre und zwei Monaten (Angela), für welche er notwendig einer Pflegerin bedarf, um so mehr, da er als Zollbeamter den ganzen Tag, oft auch nachts, vom Hause abwesend ist und daher die Erziehung und Pflege der Kinder nur wenig überwachen kann. Die Braut hat die Pflege der Kinder bereits nach dem Tode der Mutter übernommen und sind ihr selbe sehr zugetan, so dass sich mit Grund voraussetzen lässt, es würde die Erziehung derselben gedeihen und die Ehe eine glückliche werden. Überdies hat die Braut kein Vermögen und es dürfte ihr deshalb nicht so leicht eine andere Gelegenheit zu einer anständigen Verehelichung geboten werden.
Auf diese Bitte gestützt, wiederholen die Gefertigten ihre demütige Bitte um gnädige Erwirkung der Dispens vom genannten Hindernis der Verwandtschaft.«9
Die Stelle in Linz leitet das Gesuch nach Rom weiter – und die Wochen bis zur schriftlichen Erlaubnis vergehen. Erst am 7. Januar 1885 können Alois und Klara den Bund der Ehe schließen, sie ist 24, er 47 Jahre alt. Die Trauung entspricht so gar nicht den romantischen Vorstellungen Klaras: »Um sechs Uhr früh haben wir in der Stadtpfarrkirche von Braunau geheiratet, und um sieben Uhr ging mein Mann schon wieder in den Dienst.«10 Keine Feier, kein fröhliches Essen, kein Umtrunk mit Freunden – nichts. Nicht einmal einen Tag Urlaub gönnt sich der Gemahl für diesen Festtag. Für ihn ist es bloß eine Formalie, er und Klara sind schon längst zusammen und haben intime Beziehungen, was die Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes Gustav fünf Monate später bezeugt.
Für Klara ist die neue Rolle als Ehefrau ungewohnt. Noch lange nennt sie ihren Ehemann »Onkel«, so wie sie es als Kind zu tun pflegte. Was findet sie an dem Mann, der ihr Vater sein könnte? Sicher spielt die materielle Sicherheit eine Rolle, die Alois mit seinem Einkommen bietet. Auch das Ansehen, das die Gattin eines Zollbeamten gerade auf dem Lande genießt, hat seine Reize. Doch andererseits weiß Klara durch die Erfahrungen der zurückliegenden Jahre, auf wen sie sich da einlässt. Klara ist im Gegensatz zu ihrem Mann eine gläubige Katholikin, geht regelmäßig in die Kirche. Ihr Tagesablauf ist eine immer wiederkehrende Abfolge von Putzen, Kochen, Einkaufen und Kinderversorgen. Treffen mit Nachbarn oder Freundinnen bleiben selten, meist entzieht sie sich dem mit dem Satz »Hab’ leider keine Zeit, die Arbeit wartet«. Ihr unterwürfiges Wesen akzeptiert alle Kränkungen, die sie still hinunterschluckt. Sie wagt es kaum, ihrem Partner zu widersprechen und lässt sich nur äußerst selten auf eine offene Konfrontation ein.
Das hatte seine Gründe. Alois war herrisch, jähzornig und gewalttätig, wie später seine Kinder berichteten. Prügel waren an der Tagesordnung. Ob Klara auch darunter leiden musste, ist unklar. Geradezu wie ein Hinweis darauf und wie eine verdeckte Schilderung der eigenen häuslichen Verhältnisse lesen sich zwei Passagen Adolf Hitlers aus Mein Kampf: »Wenn dieser Kampf unter den Eltern selber ausgefochten wird, und zwar fast jeden Tag, in Formen, die an innerer Rohheit oft wirklich nichts zu wünschen übriglassen, dann müssen sich, wenn auch noch so langsam, endlich die Resultate eines solchen Anschauungsunterrichtes bei den Kleinen zeigen. Welcher Art sie sein müssen, wenn dieser gegenseitige Zwist die Form roher Ausschreitungen des Vaters gegen die Mutter annimmt, zu Misshandlungen in betrunkenem Zustande führt, kann sich der eben ein solches Milieu nicht Kennende nur schwer vorstellen.«
Adolf Hitler konnte es offenbar, er schreibt weiter: »Übel aber endet es, wenn der Mann von Anfang an seine eigenen Wege geht und das Weib, den Kindern zuliebe, dagegen auftritt. Dann gibt es Streit und Hader, und in dem Maße, in dem der Mann der Frau nun fremder wird, kommt er dem Alkohol näher.«11
Alois’ Vorliebe für Bier und Wein ist bekannt. Praktisch jeden Tag, nach der Arbeit im Büro, genehmigte er sich mehrere Gläser in einem Gasthaus, rauchte ununterbrochen seine Pfeife und führte Stammtischgespräche mit Kollegen, vorzugsweise über landwirtschaftliche Fragen. Ob und wie stark Alois danach betrunken war, berichten Zeugen von damals unterschiedlich. Sein Sohn Adolf jedenfalls, der ihn bisweilen dort abholte, schilderte Jahre später die Szenerie – wenn auch sicherlich bewusst dramatisierend – folgendermaßen: »Da mußt’ ich als zehn- bis zwölfjähriger Bub immer spätabends in diese stinkende, rauchige Kneipe gehen. Ich trat dann immer ohne jede Schonung auf, trat an den Tisch, wo mein Vater saß und mich stier anschaute, und rüttelte ihn. Dann sagte ich: ›Vater, du mußt jetzt heim! Komm jetzt, wir müssen gehn!‹ Und oft mußte ich gleich eine viertel oder halbe Stunde betteln, schimpfen, bis ich ihn endlich so weit hatte. Dann stützte ich ihn und brachte ihn heim. Das war die grässlichste Scham, die ich je empfunden habe.«12
Wohl schon aus dieser Zeit speiste sich Adolf Hitlers lebenslange Ablehnung des Alkohols.
Auch an den übrigen Tagen hatte es Alois nicht eilig mit der Rückkehr in den Kreis seiner Familie. Viel lieber machte er nach der Arbeit einen Spaziergang, schaute noch nach seinen Bienenstöcken, seinem einzigen Hobby. Einmal zog er gar für mehrere Monate in eine Wohnung in der Braunauer Altstadt, weil er von dort aus schneller bei seinen Bienenstöcken war. Freunde hatte er keine. Die einzigen, mit denen er nähere Kontakte pflegte, waren seine Kollegen Emanuel Lugert, der spätere Firmpate von Adolf, und Carl Wessely, den er seit 1878 kannte und regelmäßig zu Kneipenabenden traf. Kein Wunder: »Alois Hitler war uns allen unsympathisch. Er war sehr streng, genau, ja sogar Pedant im Dienst und ein sehr unzugänglicher Mensch«, beschreibt ihn ein Kollege.13
Belastend für die Familie sind die vielen Umzüge. In seinen 21 Dienstjahren in Braunau zieht der Hausherr mit seiner Familie vergleichsweise bescheidene viermal um, danach folgen innerhalb von sieben Jahren sechs Umzüge. Diese lassen sich nicht gänzlich mit den Pflichten seines Berufes erklären, darin reflektiert sich auch Rastlosigkeit und Getriebenheit, wohl auch innere Unzufriedenheit, »er war ein unruhiger Geist«, wie ein Kollege es nannte.
Die Unfähigkeit, sesshaft zu werden und zur Ruhe zu kommen, manifestiert sich zudem in den Immobilientransaktionen Alois’. Das Gehöft und Grundstück in Wörnharts, das er nach dem Tode Nepomuks kauft, veräußert er drei Jahre später schon wieder. Die Tradition der Waldviertler, sich auf eigenem Grund und Boden niederzulassen, lässt Alois kalt. Der Begriff Heimat hat für ihn keine Bedeutung, so etwas wie geographische Wurzeln kennt er nicht. Genauso wenig, wie ihm die eigene Familie eine Heimat ist. Als er 1895 in Pension geht, zieht es Alois weder zurück zu den Orten seiner Kindheit im Waldviertel noch in die Großstadt Wien, zu den Plätzen seiner Jugend. Auch den Grenzort Braunau hat er nicht ins Herz geschlossen, wo er mehr als 24 Jahre gelebt hat und der noch am ehesten als Heimat zu bezeichnen wäre – immerhin ließen sich von dort aus seine früheren Lebensstationen und Verwandten bequem aufsuchen. Stattdessen kauft Alois ein umfangreiches landwirtschaftliches Anwesen in Hafeld bei Lambach an der Traun. Dort versucht er nochmals, das Landleben zu genießen. Alois probiert eine Existenz als Hobby-Landwirt, im Prinzip die gleiche Idee, die moderne Aussteiger mit dem Bauernhof im Chiemgau oder dem Rustico in der Toskana verfolgen. Das Resultat war für Alois genauso verheerend wie für viele Quereinsteiger heutiger Zeit: Die Arbeit mit den 38 000 Quadratmetern Acker und Wiesen überforderte ihn, zudem fraß der Besitz mehr Geld als er brachte. Zwei Jahre später muss Alois das Abenteuer Landwirtschaft wieder aufgeben, er verkauft den Besitz und erwirbt stattdessen ein Wohnhaus mit kleinem Garten in der Michaelsbergstraße 16 in Leonding bei Linz – im Vergleich zu den einsamen Weilern zuvor ist das wie der Wechsel in eine Großstadt. Dies sollte Alois’ letzter Umzug bleiben.
Mutter Klara und ihre Kinder
Die dunklen Seiten ihres Mannes waren Klara Hitler wohl bewusst. Sie kannte ihn schließlich schon von klein auf, erlebte seine Verhältnisse mit Frauen aus nächster Nähe. Und doch fügte sie sich ohne Klagen in ihr Los. Ihre Leidensfähigkeit wirkt geradezu übermenschlich, besonders, was ihre Rolle als Mutter betrifft. Denn viel mehr noch als die Stellung der Ehefrau beherrschte die Mutterschaft das Leben der Klara Hitler. Im Haushalt lebten bereits die zwei Kinder Alois junior und Angela aus der zweiten Ehe ihres Gatten. Sie selbst brachte sechs Kinder zur Welt – und ein tragisches Schicksal lag über allen.
Das erste Kind Gustav wird im Mai 1885 geboren, die Hochzeit im Januar hat gerade noch rechtzeitig den Makel der Unehelichkeit verhindert. Bereits ein Jahr später, im September 1886, bekommt Klara ihre Tochter Ida. Das ungetrübte Mutterglück dauert ein Jahr. Im Spätherbst 1887 erkrankt Gustav an Diphtherie. Klara ist zu der Zeit bereits wieder schwanger. Ihr Neugeborenes, Sohn Otto, steckt sich höchstwahrscheinlich ebenfalls mit der heimtückischen Krankheit an und lebt nur ein paar Tage. Die Familie hat kaum das Baby zu Grabe getragen, da stirbt am 8. Dezember der Erstgeborene Gustav. Nicht allein der Trauerfall überschattet das Weihnachtsfest, zudem muss sich Klara Sorgen um ihre Tochter Ida machen, die ständig hustet – ein Zeichen für Diphtherie. Am 2. Januar scheidet auch die Kleine aus dem Leben. Klara hat also innerhalb weniger Wochen eine Geburt und drei Todesfälle zu verkraften. Auch wenn damals die Kindersterblichkeit höher war als heute – für eine Mutter gibt es nichts Schlimmeres als den Tod des eigenen Kindes. Und von diesem Schlag gleich dreimal getroffen zu werden, zeichnet einen Menschen für sein Leben.
Sechs Monate nach Idas Ableben wird Klara wieder schwanger. Am 20. April 1889 ist es soweit: An diesem Karsamstag um halb sieben Uhr abends, bei sieben Grad Außentemperatur, wird in Braunau in der Wohnung der Hitlers im »Gasthof zu Pommer« Klaras Sohn geboren. Am Ostermontag um Viertel nach drei Uhr sprenkelt der katholische Pfarrer Ignaz Probst Weihwasser auf das Kind, tauft es auf den Namen Adolf Hitler und gibt ihm Gottes Segen. Mit dabei sind Klaras Schwester Johanna Pölzl und die Hebamme Franziska Pointecker. Als Paten stehen im Taufbuch »Johann und Johanna Prinz, Privat in Wien III, Löwengasse 28«. Die Mutter ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt, der Vater 51 Jahre.
Die Vermutung drängt sich auf, dass Klara nach diesen Dramen mit ihren früh verstorbenen Kleinen genug hat vom Kinderkriegen. Als strenggläubige Katholikin sind für sie Verhütungsmittel und -techniken, wenn nicht überhaupt unbekannt, so doch gegen die Religion. Es fällt auf, dass die Mutter nach Adolfs Geburt über vier Jahre nicht mehr schwanger wird. Doch im März 1894 steht die Taufe von Adolfs jüngerem Bruder Edmund an. Und noch einmal ruft Klara die Hebamme: Ende Januar 1896 nimmt sie ihre neugeborene Tochter Paula in die Arme. Vater Alois ist da bereits ein 58-Jähriger im Ruhestand.
Edmund entwickelt sich die ersten Jahre normal. Als er jedoch mit fast sechs Jahren an Masern erkrankt, bedeutet dies ein weiteres plötzliches Ende: Edmund stirbt Ende Februar 1900. Damit bleiben von den sechs eigenen Kindern Klara Hitlers nur zwei am Leben – Adolf und seine um sieben Jahre jüngere Schwester Paula.
Wichtigste Stütze in diesen Jahren ist ihr ihre jüngere Schwester Johanna Pölzl, die mit in der Hitlerschen Wohnung lebt. Von gelegentlichen Haushaltshilfen abgesehen, ist die ledige Johanna die einzige zusätzliche Arbeitskraft, die Klara etwas Luft verschafft. Schließlich hat Klara neben ihren Schwangerschaften und Tragödien auch die Belastung eines recht großen Haushalts zu bewältigen. Die beiden Kinder aus Alois’ zweiter Ehe, Alois junior und Angela, leben mit unter ihrem Dach; so hat Klara zeitweise bis zu fünf Kinder gleichzeitig zu versorgen. Obwohl Adolfs Tante seit der Heirat Klaras ein Teil der Familie ist, bleibt ihr Anteil an der Familiengeschichte merkwürdig nebulös. Einige Historiker erwähnen sie gar nicht oder nur am Rande, die Nazi-Geschichtsschreiber, die sonst alle Mitglieder der Hitler-Familie beweihräucherten, ließen sie ganz außen vor. Ebenso fehlt ein Hinweis in Mein Kampf. Das hat auch einen triftigen Grund: Die »Hanni-Tante« scheint nicht vorzeigbar gewesen zu sein. Sie hatte einen Buckel. Schlimmer noch: Aussagen von Zeitgenossen legen nahe, dass Johanna geistige Aussetzer hatte. So kündigte etwa das Dienstmädchen Franziska Hörl, die zur Adolfs Geburt bei den Hitlers arbeitete, mit der Begründung: »Bei dieser spinnerten Buckligen bleibe ich nicht mehr!«, woraufhin der Arzt Dr. Kriechbaum aus Braunau die Verdachtsdiagnose Schizophrenie für die Tante stellte.14 Der Hausarzt der Hitlers erzählt davon, dass Johanna Pölzl »von der Familie versteckt wurde, weil sie geistig krank war. Sie war wahrscheinlich debil.«15 Ende März 1911 starb Johanna 48-jährig an Koma diabeticum. Die Verschwiegenheit der NS-Parteigenossen über Adolfs Tante ist nachvollziehbar, mussten Menschen wie sie doch befürchten, der Ideologie der »Rassenreinheit« zum Opfer zu fallen. An die 275 000 Behinderte und geistig Kranke wurden zu Hitlers Zeiten vor allem im Euthanasieprogramm »Aktion T 4« als »unwertes Leben« umgebracht16 – undenkbar, dass so jemand auch in Hitlers Familie zu finden war.
Bruder Adolf, das Muttersöhnchen
Die ersten Jahre mit Jung-Adolf bleiben für die Familie ohne aufregende Ereignisse, Routine kehrt ein. Die Mutter arbeitet – mehr oder weniger von Johanna unterstützt – in der Wohnung; der Ehemann und Vater kehrt spät und mit Alkoholfahne nach Hause, raucht eine seiner Porzellanpfeifen, die er in einem Ständer in der Küche stehen hat, und verschwindet danach ins Bett. Um seinen Nachwuchs kümmert er sich kaum. Adolf ist nun nach Gustavs und Idas Tod Klaras Ältester. Ängstlich um das Wohlergehen des Buben bemüht, verhätschelt und verwöhnt sie ihn, auch aus Angst, wieder ein Kind durch Krankheit zu verlieren. Schon jetzt fällt auf, dass Klara ihre Zuneigung sehr einseitig verteilt: Adolf ist der Darling, die Stiefkinder Alois und Angela dagegen fühlen sich vernachlässigt. Schon früh zeigt Adolf Aversion gegen Zärtlichkeiten, wie seine Schwester Paula berichtet: »Von der Mutter ließ er sich, wenn keine Fremden in der Nähe waren, an die Brust drücken, aber wenn ich meinen Arm um ihn legte, stieß er mich weg. Er hat es nie gemocht, wenn Frauen ihn küssten.«17
Im August 1892 gibt es Aufregung: Ein Umzug steht bevor. Alois senior wird befördert und zur Dienststelle nach Passau versetzt, die auf der deutschen Seite liegt. Für die Familie eine schöne Zeit. Der junge Adolf lernt den typischen niederbayerischen Dialekt, dessen Färbung auch in späteren Jahren immer wieder durchschlägt, viel deutlicher als etwa die oberösterreichische oder Wiener Mundart. Seine Zeit verbringt er mit Herumstreunern und Indianerspielen.
Schon im April 1894 wird Alois wieder versetzt und geht allein, ohne Familie, nach Linz. Klara sieht ihren Mann nur bei gelegentlichen Besuchen, die übrige Zeit ist sie ganz auf sich allein gestellt. Die Geburt von Adolfs jüngerem Bruder Edmund mag zuerst ein Hemmnis für einen Umzug gewesen sein, aber warum Alois seine Familie ein ganzes Jahr lang nicht nachholt, ist ungeklärt. Klara schluckt die lange Trennungszeit klaglos. Sie ist vielleicht sogar froh, die stille Zeit ohne den Haustyrannen verbringen zu können – Söhnchen Adolf jedenfalls will die Abwesenheit des strengen Vaters in vollen Zügen genossen haben: »Das viele Herumtollen im Freien, der weite Weg zur Schule sowie ein besonders die Mutter manchmal mit bitterer Sorge erfüllender Umgang mit äußerst robusten Jungen ließ mich zu allem anderen eher werden als zu einem Stubenhocker.«18
Mitte 1895 ist diese unbeschwerte Zeit vorbei. Alois ist nach 40 Jahren Dienstzeit pensioniert worden und hat das abgelegene Hafelder Anwesen gekauft, wohin die Familie jetzt zieht. Neben Bienenzucht und Landwirtschaft hat der befehlsgewohnte Pensionär jetzt reichlich Zeit zur Verfügung, um seiner Präsenz zu Hause unangenehmen Nachdruck zu verleihen.
Zumindest braucht Klara nun nicht mehr ständig nachzusehen, was ihr Sohn Adolf treibt. Der muss nämlich vom 1. Mai an in die Schule. Er besucht den Unterricht in Fischlham bei Lambach, eine halbe Stunde Fußweg entfernt. Es ist ein einfaches Gebäude, der Unterricht findet für mehrere Klassen und Jahrgangsstufen in einem gemeinsamen Raum statt. Sein Bruder Alois begleitet ihn eine Zeit lang, bevor der ältere Bruder nach einem heftigen Streit mit seinem Vater das Elternhaus für immer verlässt.