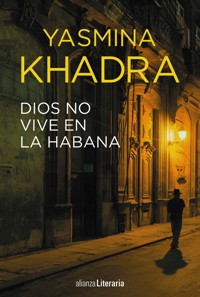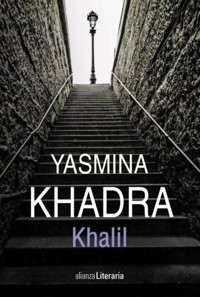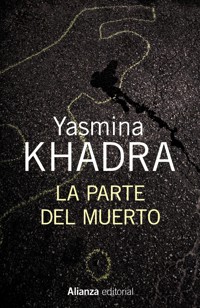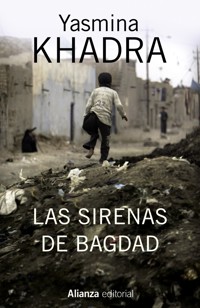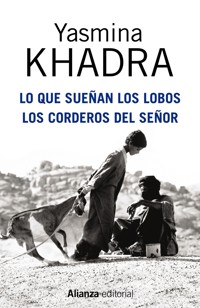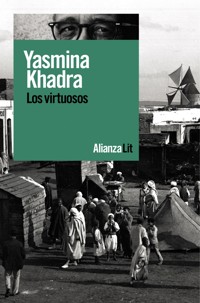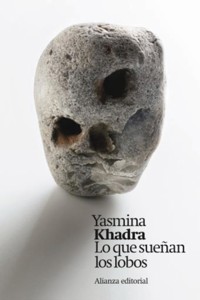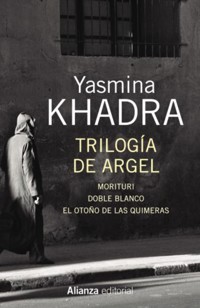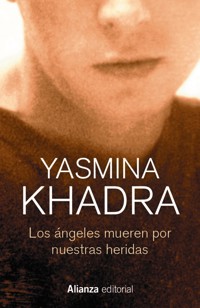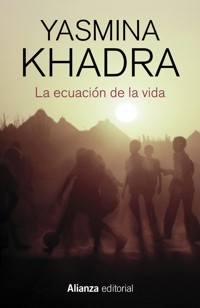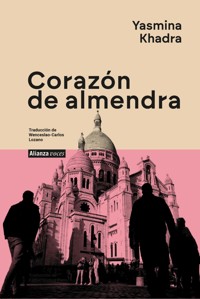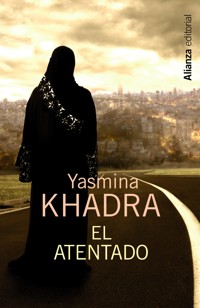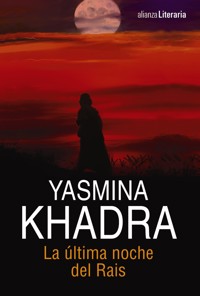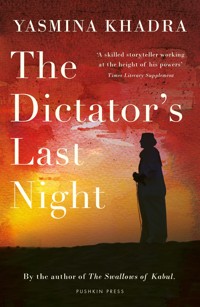Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Osburg Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
2011 wurde der ehemalige Diktator Libyens von einem rebellischen Mob auf bisher unbekannte Weise ermordet. Ein Meilenstein des Arabischen Frühlings! Dass mit seinem Sturz alles andere als Ruhe im Land eingekehrt ist, beweisen uns tagtäglich die Flüchtlingsströme und der Terror konkurrierender Milizen. In der vorliegenden Romanbiografie erzählt Yasmina Khadra seine Version der Lebensgeschichte des Muammar al-Gaddafi, in der historische Fakten und Fiktion miteinander verwoben sind. Khadra zeichnet das Bild eines größenwahnsinnigen, aber charismatischen Herrschers, der am Ende seines Lebens vor den Trümmern eines Landes steht, das er einst aus der verrotteten libyschen Monarchie befreit hatte. Warum verfasst ein algerischer Schriftsteller, der ein aufgeklärter und überzeugter Regimekritiker ist, einen Abgesang auf einen der größten Diktatoren der jüngsten Geschichte? Dies ist keine Solidaritätsbekundung mit einem Tyrannen, kein Versuch einer historischen Rehabilitierung, aber auch keine Verurteilung. Es ist das Ausloten einer umstrittenen Persönlichkeit und zugleich ein Buch, das uns an die Grenzen unseres Demokratiebegriffs führt. Mit seinem neuen Werk schließt Yasmina Khadra eine Lücke in der Berichterstattung über die Neuordnung der nordafrikanischen Welt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
YASMINA KHADRA
Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi
Roman
Aus dem Französischen
von
Regina Keil-Sagawe
Osburg Verlag
Titel der französischen Originalausgabe:
La dernière nuit du Raïs
© Éditions Julliard, Paris, 2015
Erste Auflage 2015
© Osburg Verlag Hamburg 2015
www.osburgverlag.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des
öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk
und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie,
Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Bernd Henninger, Heidelberg
Umschlaggestaltung: Judith Hilgenstöhler, Hamburg
Satz: Kaltërina Latifi, Heidelberg
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-95510-097-1
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Fußnote
Willst du am Ende
zum Frieden gelangen
So lächle dem Schicksal, das dich schlägt
Und schlage niemanden
Omar Khayyam
Sirte, Distrikt 2
Nacht vom 19. auf den 20. Oktober 2011
Als ich klein war, nahm der Bruder meiner Mutter mich manchmal mit in die Wüste. Für ihn war es mehr als nur die Rückkehr zu den Wurzeln, es war wie eine geistige Grundreinigung.
Ich war zu jung, um zu verstehen, was er mir beibringen wollte, aber ich hörte ihm gern zu, wenn er erzählte.
Mein Onkel war auf seine Art ein Dichter – einer, der nicht dem Ruhm nachhing, sondern zeitlebens ein bescheidener Beduine blieb, der nichts lieber tat, als sein Zelt im Schatten irgendeines Felsens aufzuschlagen und dem Wind, wie er über den Sand surfte, zu lauschen, flüchtiger als ein Schatten.
Er nannte eine prachtvolle Stute, einen Braunfuchs, sein Eigen, dazu zwei lebhafte Sloughis und einen alten Hinterlader, mit dem er auf Mufflonjagd ging, und verstand sich besser als jeder andere darauf, die Wüstenspringmaus in die Falle zu locken, der man medizinische Heilkräfte nachsagte, und die Dornschwanzagame zu fangen, um sie ausgestopft und lackiert auf dem Souk feilzubieten.
Wenn die Nacht anbrach, entfachte er ein Lagerfeuer und gab sich seinen Träumereien hin, nachdem er ein frugales Mahl genossen und ein Glas stark gesüßten Tees geschlürft hatte. Ihn zu betrachten, wie er mit der Stille und der Kargheit der Geröllwüste ringsum verschmolz, war für mich ein Moment purer Gnade.
Doch manchmal, da kam es mir so vor, als löse sein Geist sich jäh aus seinem Körper und ließe eine bloße Vogelscheuche zurück, leblos wie der ziegenlederne Wasserschlauch am Eingang des Nomadenzelts. Jäh fühlte ich mich allein auf der Welt, und Angst überfiel mich vor den Geheimnissen der Sahara, die mich umschwirrten wie ein Dschinnenheer, und ich stieß ihn mit den Fingerspitzen an, damit er zurückkäme zu mir.MitfunkelndemBlicktauchteerdannaustieferBewusstlosigkeit auf und schenkte mir ein Lächeln. Nirgends sollte ich ein schöneres Lächeln als das seine erblicken, weder auf den Gesichtern der Frauen, die ich beehrte, noch auf denen derHöflinge,denenichmeineGunsterwies.MeinOnkelwarein zurückhaltender Mensch, nahezu unscheinbar, seine Bewegungen waren langsam, seine Gefühlsäußerungen spärlich. Seine Stimme war kaum zu hören, und doch hallte sie, wenn er das Wort an mich richtete, in mir nach wie eine Melodie. Er bemerkte, während sein Blick sich am funkelnden Firmament verlor, dass dort oben für jeden anständigen Erdenbürger ein Stern leuchte. Ich hatte ihn gebeten, mir den meinen zu zeigen. Sein Finger hatte, ohne zu zögern, auf den Mond gedeutet, als verstehe sich das von selbst. Seitdem sah ich jedes Mal, wenn ich die Augen zum Himmel hob, einen strahlenden Vollmond vor mir. Nacht für Nacht. Meinen persönlichen Vollmond. Nie angenagt. Niemals verhüllt. Der mir den Weg erhellte. So schön, dass ihm kein Feenmärchen gleichkam. So strahlend, dass er alles Gestirn ringsum in den Schatten stellte. So gewaltig, dass selbst die Unendlichkeit ihn noch zu beengen schien.
Mein Onkel schwor hoch und heilig, dass ich derjenige Spross aus dem Clan der Ghous sei, auf dem der Segen ruhe, derjenige,derdemGaddafi-StammdenverflossenenGlanzundseineepochalen,längstvergessenenHeldentatenzurückbringen würde.
Doch an diesem Abend, dreiundsechzig Jahre später, kommt es mir so vor, als glänzten weniger Sterne am Himmel über Sirte. Von meinem Vollmond ist nur ein grau schimmernder Kratzer geblieben, kaum größer als ein abgebissener Fingernagel. Die Schönheit der Welt erstickt im Rauch, der aus den brennenden Häusern aufsteigt, während die Luft, geschwängert von Staub und Pulverqualm, im heißen Atem der Raketen erbärmlich knapp wird. Der Stille, die einst meine Seele beschirmte, haftet etwas Apokalyptisches an, und die Geschosse, die hier und da diese Stille durchbrechen, setzen alles daran, den Mythos des Unangreifbaren zu zerschlagen – mit anderen Worten mich, den »Bruder Führer«, den unfehlbaren Visionär, Inkarnation eines Wunders, den man für einen Spinner hielt und der doch wie ein Leuchtturm aus der tobenden See aufragt, der mit seinem lichtvollen Arm die Finsternis mit ihren Tücken verscheucht und die wütend aufschäumende Brandung glättet.
Ich habe einen meiner Bodyguards im Schutz der Dunkelheit sagen hören, dass wir die »Nacht des Zweifels« durchlebten, und dass er sich fragt, ob der Morgen uns ins Rampenlicht der Öffentlichkeit befördern oder den Flammen des Scheiterhaufens überantworten würde.
Seine Bemerkung hat mich deprimiert, aber ich habe ihn nicht zur Ordnung gerufen. Das war nicht nötig. Hätte er nur einen Funken Verstand besessen, er hätte sich gehütet, so ketzerischdaherzureden.EsgibtkeinenschlimmerenAffront,als in meiner Gegenwart Zweifel zu äußern. Dass ich überhaupt noch lebe, ist Beweis genug, dass noch alles möglich ist.
Ich bin Muammar al-Gaddafi. Das allein müsste genügen, um nicht vom Glauben abzufallen.
Ich bin der Heilsbringer.
Ich fürchte weder Stürme noch Meutereien. Wer mir ans Herz fasst, der spürt, dass es schon jetzt im Takt des vorprogrammierten Auseinanderstiebens der ruchlosen Verräter schlägt.
Gott ist mit mir!
Hat Er mich nicht auserwählt unter den Menschen, damit ich der hegemonialen Gier der Großmächte Einhalt gebiete? Wer war ich denn? Ein junger Offizier ohne Illusionen, dessen Protest kaum über den Rand seiner Lippen hinausreichte, doch der den Mut aufbrachte, die Dinge in Frage zu stellen und dem geballten Machtmissbrauch ein lautstarkes ›Es reicht!‹ entgegenzuschleudern. Und ich habe den Lauf des Schicksals korrigiert wie man Spielkarten zurückgibt, die man nicht aufnehmen will. Es war die Epoche, da jeder Kopf, der die Menge überragte, ohne Wenn und Aber dem gezückten Schwert zum Opfer fiel. Ich war mir sämtlicher Risiken bewusst und nahm sie achselzuckend in Kauf, wohl wissend, dass die gerechte Sache verteidigt sein will, weil der, der sich nicht engagiert, es nicht wert ist, auf dieser Welt zu leben.
Weil mein Zorn ein gerechter war und mein Beschluss legitim, hat Gott der Herr mich über sämtliche Hymnen und Standarten erhoben, auf dass alle Welt mich sähe und vernähme.
Ich weigere mich zu glauben, dass die Kreuzfahrer nunmehr meine letzte Stunde einläuten, dass dies mir, dem aufgeklärten Muslim, widerfährt, der noch stets über jede Infamie, jede Intrige triumphierte und der auch dieses Komplott überdauern wird. Die Provokation, der ich heute gegenüberstehe–dieserPseudo-Aufstand,dieserverpfuschteKrieg,den man gegen den Mythos Gaddafi führt – ist nur die nächste Bewährungsprobe auf meiner Marschroute. Und sind’s nicht die Götter, die man auf dem Amboss härtester Proben schmiedet?
Ich werde gefestigter denn je aus diesem Chaos hervorgehen, mich wie Phönix aus der Asche erheben. Die Reichweite meiner Stimme wird die jeder strategischen Rakete übertreffen, und wenn ich mit dem bloßen Finger aufs Rednerpult klopfe, wird jeder Donner verstummen.
Ich bin Muammar al-Gaddafi, menschgewordener Mythos. Wenn heute Abend weniger Sterne am Himmel über Sirte stehen und mir mein Mond so schmal wie ein abgebissener Fingernagel vorkommt, dann nur, damit meine Konstellation auch in Zukunft als einzige etwas zählt.
Lasst sie mir sämtliche Bomben, die sie haben, schicken, ich sähe darin doch nur ein Feuerwerk, das sie mir zu Ehren abbrennen. Lasst sie ganze Berge versetzen, ich vernähme im Getöse ihrer Trümmer doch nur den Applaus meines Bades in der Menge. Lasst sie das Heer ihrer alten Dämonen auf meine Schutzengel hetzen, mich würde doch keine Macht des Bösen von meiner »Mission« abbringen, zumal es geschrieben stand, lange bevor Qasr Abu Hadi mich in seinem Schoß aufnahm, dass ich derjenige wäre, der alles Leid und Unrecht rächte, das man den unterdrückten Völkern antat, indem ich den Teufel und seine Handlanger in die Knie zwingen würde.
»Bruder Führer …«
Gerade eben ist eine Sternschnuppe durch den Himmel gerast. Und diese Stimme? Woher kommt sie?
Ein Schauer durchfährt mich von Kopf bis Fuß. Ein Tumult der Gefühle erhebt sich in mir. Diese Stimme …
»Bruder Führer …«
Ich drehe mich um.
Es ist nur die Ordonnanz, die in stocksteifer Ergebenheit im Rahmen dessen steht, was in glücklicheren Zeiten einmal eine Wohnzimmertür war.
»Ja?«
»Ihr Abendessen ist bereit, Herr Präsident.«
»Bring’s mir hierher.«
»Mit Verlaub, es wäre besser, wenn Sie es im Nebenzimmer einnehmen würden. Wir haben die Fenster verdunkelt und Kerzen angezündet. Hier würde das geringste Licht Ihre Anwesenheit verraten. Es ist nicht auszuschließen, dass im Gebäude gegenüber Scharfschützen postiert sind.«
1
Die Ordonnanz geht mir voran in den Nebenraum. Im düster flackernden Kerzenschein, dem die zugezogenen Fenstervorhänge etwas Beklemmendes verleihen, wirkt der Ort noch deprimierender auf mich. Ein Schrank liegt umgestürzt mit zersplittertem Spiegel am Boden. Aus einer aufgeschlitzten Polsterbank quellen die Eingeweide hervor. Überall liegen aufgebrochene Schubladen herum, und von der Wand blickt das demolierte, von Kugeln zersiebte Porträt eines Familienvaters.
Mein Sohn Mutassim, dem das Oberkommando für die Verteidigung von Sirte obliegt, hat als Hauptquartier für meine Soldaten eine verlassene Schule im Herzen des 2. Distrikts gewählt. Der Feind wähnt mich garantiert in einer meiner befestigten Palastanlagen verschanzt, weil er mich für unfähig hält, mich in einer derart rudimentären Umgebung zurechtzufinden. Er käme nie auf den Gedanken, mich an einem derart tristen Ort zu suchen. Hat er vergessen, dass ich Beduine bin, der Herrscher der Genügsamen und der genügsamste aller Herrscher, der den Charme des kargen Lebens zu schätzen weiß und den Komfort einer schlichten Sandbank? Als ich ein Junge war, war der Hunger mein ständiger Begleiter; ich lief in geflickten Hosen und löchrigen Sandalen umher oder gleich barfuß im Staub, auf vor Hitze glühendem Geröll. Die Armut war mein Element. Ich aß nur ein über das andere Mal, und immer war es die gleiche Speise aus Erdmandeln, wenn es keinen Reis mehr gab. Nachts lag ich oft mit angewinkelten Knien unter meiner Decke und träumte so lange von einem Hähnchenschenkel, bis mir das Wasser im Mund zusammenlief. Zwar schwelgte ich später im Luxus, aber doch nur, um mich über ihn zu erheben und demonstrativ zu beweisen, dass Dinge, die etwas kosten, es nicht wert sind, verherrlicht zu werden, dass der heiligste Gral aus einem Schluck Wein noch lange keinen Zaubertrank macht und man immer nur man selber ist, egal ob in Lumpen oder im seidenen Gewand … Und ich bin Gaddafi und im Vollbesitz meiner Macht, unabhängig davon, ob ich auf einem Thron oder einem Kilometerstein sitze.
Ich habe keine Ahnung, wem dieses Anwesen einmal gehörte, das unmittelbar an die Schule angrenzt und in dem ich seit einigen Tagen nun residiere – vermutlich einem meiner mir treu ergebenen Landsleute, wie sonst wäre es zu erklären, dass es derart verwüstet ist. Die Spuren der Gewalt sind frisch, aber das Gebäude wirkt bereits wie eine Ruine. Vandalen sind des Weges gekommen, haben alles Wertvolle geplündert und zerstört, was sie nicht mitnehmen konnten.
Die Ordonnanz hat sich gewaltig angestrengt, einen Sessel vom Staub zu befreien und einen Tisch so herzurichten, dass er meiner würdig ist. Über beide sind Laken gebreitet, um die »Blessuren« zu kaschieren. Auf einem Tablett, das von wer weiß woher stammt, erwartet mich ein Porzellanteller mit einer Art Mahlzeit: Corned Beef in Gelee, sorgfältig aufgeschnitten, ein Viertel Schmelzkäse, Feldzwieback, Tomatenscheiben, dazu ein Schälchen mit saftigen Orangenschnitzen. Die Logistik kommt nicht mehr nach, und die Alltagskost reicht mit knapper Not für meine Prätorianergarde.
Die Ordonnanz bittet mich, im Sessel Platz zu nehmen, und baut sich mir gegenüber auf. Kerzengerade. Der steife Ernst des jungen Mannes könnte lächerlich wirken angesichts der Zerstörung ringsum, käme der Ausdruck, der auf seinen sonnenverbrannten Zügen liegt, nicht schon für sich allein den unantastbaren Klauseln eines Treueschwurs gleich. Dieser Mann liebt mich mehr als alles auf der Welt – er gäbe sein Leben für das meine dahin.
»Sag, wie heißt du?«
Meine Frage überrascht ihn. Sein Adamsapfel hüpft in seinem bartstoppligen Hals auf und ab.
»Mostefa, Bruder Führer.«
»Und wie alt bist du?«
»Dreiunddreißig.«
»Dreiunddreißig«, wiederhole ich, gerührt von seiner Jugend. »Vor einer Ewigkeit war ich auch einmal so alt wie du. Das ist so lange her, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann.«
Unschlüssig, ob er antworten oder lieber schweigen soll, macht er sich daran, rings um das Tablett den Tisch abzuwischen.
»Seit wann stehst du in meinen Diensten, Mostefa?«
»Seit dreizehn Jahren, Bruder Führer.«
»Mir scheint nicht, dass ich dich schon einmal gesehen habe.«
»Ich bin ein Ersatzmann … Ich war früher für den Fuhrpark zuständig.«
»Und was ist aus dem anderen geworden, dem Rotschopf? Wie hieß er doch gleich?«
»Maher.«
»Nein, nicht Maher. Der große Rothaarige, der seine Mutter bei einem Flugzeugabsturz verloren hat.«
»Saber?«
»Ja, Sabri. Ich sehe ihn gar nicht mehr.«
»Er ist tot, Bruder Führer. Vor einem Monat ist er in einen Hinterhalt geraten. Er hat gekämpft wie ein Löwe. Er hat sogar mehrere seiner Angreifer getötet, bevor er gefallen ist. Sein Fahrzeug wurde von einer Rakete getroffen. Wir haben seine Leiche nicht bergen können.«
»Und Maher?«
Die Ordonnanz senkt den Kopf.
»Ist er auch tot?«
»Übergelaufen ist er. Freiwillig hat er sich dem Feind gestellt, vor drei Tagen, als wir im Rahmen einer Versorgungsoperation unterwegs waren.«
»Er war doch ein tapferer Junge, immer gut aufgelegt und nicht kleinzukriegen. Wir meinen bestimmt nicht dieselbe Person.«
»Ich war bei ihm, Bruder Führer. Als unser LKW vor einer Straßensperre der Rebellen abdrehte, sprang Maher aus der Fahrerkabine und ist mit hocherhobenen Händen zu den Verrätern übergelaufen. Der Unteroffizier hat noch auf ihn geschossen, aber er hat ihn verfehlt. Maher ist erledigt. Die Rebellen machen keine Gefangenen. Sie foltern sie, und dann exekutieren sie sie. Maher dürfte zur Stunde schon im Massengrab vermodern.«
Er wagt noch immer nicht, wieder aufzusehen.
»Aus welchem Stamm bist du, mein Junge?«
»Geboren bin ich in … Bengasi, Bruder Führer.«
Bengasi! Wenn ich den Namen nur höre, wird mir derart speiübel, dass ich auf der Stelle loskotzen könnte, aber so heftig, dass es einen Tsunami auslöste, der diese gottverdammte Stadt mit sämtlichen Vororten ein für allemal hinwegschwemmte mit sich. Alles ist von dort ausgegangen, als wär’s eine sich rasant ausbreitende Pandemie. Hat sich wie ein Dämon aller Seelen bemächtigt. Ich hätte Bengasi gleich am ersten Tag ausradieren sollen, hätte die Aufständischen in jedem Haus, jeder Gasse aufspüren und den räudigen Hunden vor aller Augen das Fell abziehen sollen, damit jeder, der sich mit bösen Absichten trägt, nachdenklich wird und sich umbesinnt.
Der junge Mann spürt die Wut, die in mir gärt. Täte sich jetzt die Erde zu seinen Füßen auf, er würde sich ohne zu zögern in den Abgrund stürzen.
»Ich bin untröstlich, Bruder Führer. Ich wünschte, ich wäre im Straßengraben zur Welt gekommen, oder auf einer Feluke. Es ist eine Schande, dass ich in dieser Unglücksstadt geborenwurde,undmitdiesenUndankbarenimCaféamselben Tisch gesessen habe.«
»Dafür kannst du doch nichts. Was macht denn dein Vater?«
»Heute ist er im Ruhestand. Früher war er Briefträger.«
»Hast du Nachrichten von ihm?«
»Nein, Bruder Führer. Ich weiß nur, dass er aus der Stadt geflohen ist.«
»Brüder?«
»Einen einzigen. Er ist Adjutant bei der Luftwaffe. Ich habe gehört, dass er bei einem Luftangriff der NATO verletzt worden ist.«
Sein Kinn ist zwei Fingerbreit davor, in seiner Halskuhle zu verschwinden.
»Bist du verheiratet?«, frage ich, um ihn auf andere Gedanken zu bringen.
»Ja, Bruder Führer.«
Mein Blick fällt auf das Lederarmband an seinem Handgelenk; eilends versteckt er es im Ärmel: »Was ist denn das?«
»Ein Amulett von den Suaheli, Bruder Führer. Ich habe es auf dem afrikanischen Souk gekauft.«
»Wegen seiner Zauberkräfte?«
»Nein, Bruder Führer. Es hat mir einfach gut gefallen mit seinen grünroten geflochtenen Bändern. Ich wollte es meiner Ältesten schenken. Sie mochte es aber nicht.«
»Man lehnt doch kein Geschenk ab.«
»Meine Tochter sieht mich nicht oft, deshalb verschmäht sie meine Mitbringsel.«
»Und wie viele Kinder hast du?«
»Drei Töchter. Die Älteste ist dreizehn.«
»Und wie heißt sie?«
»Karam.«
»Ein hübscher Name … Wann hast du deine Kinder das letzte Mal gesehen?«
»Vielleicht vor sechs oder acht Monaten.«
»Und fehlen deine Töchter dir?«
»Ebenso sehr wie Sie unserem Volk fehlen, Bruder Führer.«
»Ich bin aber nicht nach irgendwohin verschwunden.«
»Das wollte ich damit doch gar nicht sagen.«
Er zittert. Nicht aus Furcht. Dieser Mann verehrt mich. Sein ganzes Wesen erbebt in Verehrung.
»Ich werde Hassan Order geben, dich nach Hause zu schicken.«
»Warum, Bruder Führer?«
»Deine Töchter verlangen nach dir.«
»Nach Ihnen verlangt ein ganzes Volk, Bruder Führer. Meine Familie ist nur ein Tropfen im Ozean. Und in dieser Stunde an Ihrer Seite zu sein, ist ein enormes Glück und Privileg für mich.«
»Du bist ein guter Junge, Mostefa. Du hast es verdient, deine Töchter wiederzusehen.«
»Ich würde Ihrem Befehl zum ersten Mal im Leben nicht Folge leisten, Bruder Führer, und mir das so zu Herzen nehmen, dass ich es nicht überlebte.«
Mostefa meint es aufrichtig. In seinen Augen schimmern Tränen jener Art, wie man sie nur bei wahrhaft lauteren Seelen antrifft.
»Es muss aber sein.«
»Mein Platz ist an Ihrer Seite, Bruder Führer. Ich würde ihn nicht einmal gegen einen Platz im Paradies eintauschen. Ohne Sie gibt es für niemanden Rettung, und am wenigsten für meine Töchter.«
»Setz dich mal da hin«, sage ich und zeige auf meinen Sessel.
»Das würde ich mir nie erlauben.«
»Das ist ein Befehl.«
Mostefa tritt genierlich von einem Bein aufs andere, bevor er sich entschließt, auf dem Sessel Platz zu nehmen. Ein Ausdruck fürchterlicher Verlegenheit macht sich auf seinen Zügen breit.
»Zeig mal deine Zunge her.«
»Ich habe Sie noch niemals angelogen, Bruder Führer.«
»Nun zeig schon deine Zunge.«
Der Bursche schluckt und schluckt, blickt betreten zu Boden, hält den Kopf leicht schief. Seine Lippen öffnen sich widerstrebend und geben den Blick auf ein kreideweißes Stück Zunge frei.
»Seit wie vielen Tagen hast du schon nichts mehr gegessen, Mostefa?«
»Wie bitte?«
»Deine Zunge ist milchig. Was beweist, dass du seit einer gewissen Zeit nichts mehr zu dir genommen hast.«
»Bruder …«
»Ich weiß, dass meine Mahlzeiten von euren Rationen abgeknapst werden, und dass viele meiner Soldaten fasten, damit ich etwas zu beißen habe.«
Er senkt den Kopf.
»Iss!«, befehle ich ihm.
»Das würde ich mir nie erlauben.«
»Iss jetzt! Ich bin darauf angewiesen, dass meine Anhänger sich auf den Beinen halten können.«
»Die Kraft kommt aus dem Herzen, nicht aus dem Bauch, Bruder Führer. Selbst halb verdurstend, mit knurrendem Magen und beinamputiert fände ich noch die Kraft, Sie zu verteidigen. Für Sie würde ich sogar in die Hölle hinabsteigen, um dort die Flamme zu holen, die jede Hand zu Asche verbrennt, die sich gegen Sie erhebt.«
»Iss endlich!«
Die Ordonnanz möchte aufs Neue protestieren, aber mein Blick bremst ihn aus.
»Ich warte …«
Er schnäuzt sich kräftig, um sich Mut zu machen, presst die Kiefer zusammen, streift mit bebender Hand einen Feldzwieback. Ich spüre, dass er seinen ganzen Mut zusammennimmt, um seine Finger um den Zwieback zu schließen. Stoßweise trifft mich sein Atem.
»Was ist geschehen, Mostefa?«
Er würgt an dem Bissen, an dem er gerade kaut.
Meine Frage versteht er nicht.
»Warum tun sie das?«
Jetzt begreift er, was ich meine, und legt den Zwieback wieder hin.
»Sie haben den Verstand verloren.«
»Das ist keine Antwort.«
»Eine andere weiß ich nicht, Bruder Führer.«
»War ich ungerecht zu meinem Volk?«
»Nein!«, ruft die Ordonnanz. »Niemals! Unser Land könnte doch gar keinen liebevolleren Vater, keinen erleuchteteren Führer finden als Sie. Wir waren arme Nomaden im Wüstenstaub, von einem faulen Sack von König versklavt, da kamen Sie und haben aus uns ein freies Volk gemacht, das den Neid der anderen erregt.«
»Soll ich vielleicht glauben, dass die Raketen, die draußen explodieren, nur Böllerschüsse eines Freudenfestes sind, dessen tieferer Sinn sich mir nicht erschließt?«
Mostefa zieht jäh den Hals zwischen die Schultern, so als laste mit einem Mal die gesamte Schmach des Verrats auf ihm.
»Sie haben doch bestimmt irgendeinen Grund, meinst du nicht?«
»Ich wüsste nicht welchen, Bruder Führer.«
»Du warst doch ab und zu auf Heimaturlaub. Und zwar nirgends anders als in Bengasi, von wo die Rebellion ausgegangen ist. Du hast Kaffeehäuser, Parks, Moscheen besucht. Da hast du doch sicher den einen oder anderen reden hören, der mich schlecht gemacht hat, oder etwa nicht?«
»Die Leute haben Sie nie in aller Öffentlichkeit kritisiert, Bruder Führer. Unsere Geheimdienste hatten ja überall ihre Ohren. Ich habe immer nur Gutes über Sie gehört. Außerdem hätte ich auch niemandem erlaubt, es Ihnen gegenüber an Respekt fehlen zu lassen.«
»Meine Geheimdienste waren blind und taub. Sie haben absolut nichts kommen sehen.«
Ratlos knetet er seine Finger.
»Einverstanden«, komme ich ihm entgegen. »Die Leute schweigen in der Öffentlichkeit. Das ist normal. Aber im Privaten lösen die Zungen sich doch. Wenn du nicht gerade unter Autismus leidest, hast du doch, und wäre es nur ein einziges Mal im Leben, einen Angehörigen, einen Cousin, einen Onkel etwas Negatives über mich sagen hören müssen.«
»Meine ganze Familie vergöttert Sie.«
»Ich vergöttere meine Söhne. Was mich nicht davon abhält, sie ab und zu mal zu kritisieren. In deiner Familie liebt man mich, das will ich nicht bestreiten. Aber der eine oder andere hat mir doch sicher mal irgendetwas Belangloses zum Vorwurf gemacht, eine voreilige Entscheidung, ein alltägliches Versehen …«
»Ich habe keinen meiner Angehörigen jemals etwas kritisieren hören, das von Ihnen ausging, Bruder Führer.«
»Das glaube ich dir nicht.«
»Ich schwöre es, Bruder Führer. Niemand in meiner Familie hat Sie je kritisiert.«
»Das ist nicht möglich. Sogar der Prophet Mohammed wird kritisiert.«
»Sie aber nicht … jedenfalls nicht in meiner Familie.«
Ich verschränke die Arme vor der Brust und mustere ihn schweigend, ziemlich lange.
Dann lege ich nach:
»Warum rebellieren sie gegen mich?«
»Ich weiß es nicht, Bruder Führer.«
»Ja, läufst du denn mit Scheuklappen durch die Welt?«
»Ich bin nur ein einfacher Fuhrparkwärter.«
»Das ist kein Hinderungsgrund, eine eigene Meinung zu haben.«
Er beginnt zu schwitzen und nach Luft zu ringen.
»Antworte mir. Warum rebellieren sie gegen mich?«
Er sucht nach Worten, wie man im Bombenhagel nach einem Schutzraum sucht. Er hat sich die Finger fast wundgekratzt, und sein Adamsapfel wippt hektisch auf und ab. Er hat das Gefühl, in der Falle zu sitzen, und dass jetzt sein ganzes Schicksal von seiner Antwort abhängt.
Er sagt aufs Geratewohl:
»Wenn es allzu ruhig zugeht, wird es manchen langweilig, und dann brechen sie vielleicht Streit vom Zaun, damit mal wieder was los ist.«
»Indem sie mich angreifen?«
»Sie denken, um erwachsen zu werden, muss man erst mal den Vater töten.«
»Sprich nur weiter.«
»Sie erkennen das Recht des Älteren nicht an …«
»Nein, komm auf den Vater zurück … Man müsse ihn töten, hast du gesagt. Ich möchte, dass du deinen Gedanken weiter ausführst.«
»Dazu fehlt es mir an Bildung.«
»Man muss doch kein Genie sein, um zu begreifen, dass manseinenVaternichttötet,egal,wasertut!«,brülleich,außer mir. »Bei uns ist der Vater ebenso heilig wie der Prophet.«
Eine Explosion lässt die wenigen Glasscheiben klirren, die noch in ihren Fensterkarrees sitzen. Vermutlich eine Bombe. Es hört sich an, als drehe in der Ferne ein Kampfjet ab. Gleich danach die Grabesstille der Ruinen.
Im Raum nebenan nimmt das Leben langsam wieder Fahrt auf. Ich höre, wie ein Offizier Anweisungen gibt, eine Tür quietscht, Geräusche hier und dort …
»Jetzt iss endlich!«, befehle ich dem Burschen.
Diesmal schiebt er den Zwieback weit von sich weg und schüttelt entschieden den Kopf.
»Ich bekomme nichts herunter, Bruder Führer.«
»Dann geh nach Hause zurück, zurück zu deinen Töchtern. Ich will dich hier nicht mehr sehen.«
»Habe ich irgendetwas gesagt, dass Ihr Missfallen erregt hat?«
»Geh jetzt. Ich muss beten.«
Der Bursche schickt sich an zu gehen.
»Aber vorher räumst du noch den Tisch ab«, herrsche ich ihn an. »Nimm dieses elende Essen da weg und teil es mit denen, die glauben, sie müssten erst ihren Vater töten, um erwachsen zu werden.«
»Ich wollte Sie nicht beleidigen.«
»Geh mir aus den Augen!«
»Ich …«
»Verschwinde!«