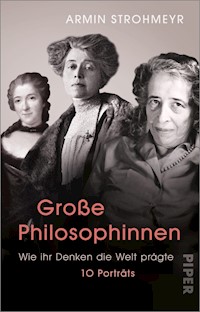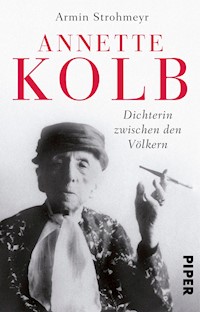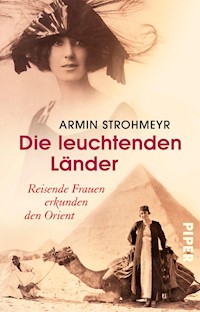
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Während sich im Europa des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Oberschicht in pulsierenden Metropolen wie Paris, London oder Berlin verlustierte, war den hier porträtierten Frauen ein Leben zwischen Boudoir und Salon nicht genug. Abenteurerinnen wie Isabel Burton, Vita Sackville-West und Freya Stark bereisten in Männerkleidern den Orient, ritten auf Maultieren durch Wüsten und über Gebirge, verteidigten sich gegen Wegelagerer und erforschten als Archäologinnen und Ethnologinnen alte Kulturen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
für Marianne Gesemann
ISBN 978-3-492-97599-5
© Piper Verlag GmbH, München 2017
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: bibelotslondon und Hulton Collection/Getty Images
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Zitat
1 Elizabeth Marsh-Crisp (1735 –1785)
2 Hester Stanhope (1776 –1839)
3 Mary Nisbet Bruce Elgin (1778 –1855)
4 Louise Colet (1810 –1876)
5 Amelia Edwards (1831 –1892)
6 Isabel Burton (1831 –1896)
7 Vita Sackville-West (1892 –1962)
8 Freya Stark (1893 –1993)
9 Ella Maillart (1903 –1997)
Auswahlbibliografie
»Wir müssen uns auf eine Exkursion ins Unbekannte einlassen: in Regionen vordringen, die nicht unsere eigenen sind. Wir müssen bereit sein, uns ständig überraschen zu lassen. Der Stubenhocker weiß, dass Pfauen in Indien ebenso frei herumfliegen wie Spatzen in England, er sieht keinen Grund, darüber in Begeisterung auszubrechen. In Wahrheit jedoch ist es ein überraschend schöner Anblick, wilde Pfauen im Licht des östlichen Sonnenaufgangs ihre Räder schlagen zu sehen.«
Vita Sackville-West, Eine Frau unterwegs nach Teheran
1 Elizabeth Marsh-Crisp (1735 –1785)
Gefangene des Sultans, Kaufmannsfrau in Indien
Menorca, Mitte April 1756. Auf der von den Briten besetzten Insel herrscht Aufregung. Frankreich hat dem Vereinigten Königreich den Krieg erklärt. Einhundertzwanzig Schiffe der französischen Kriegsmarine sind auf dem Weg zu den Balearen. Die britische Kommandantur entschließt sich, Menorca aufzugeben und sich mit den wichtigsten Kräften ins stark befestigte Gibraltar, das seit 1704 britisch ist, abzusetzen. Am 22. April, die Franzosen haben bereits Fuß auf der Insel gefasst, verlassen die englischen Schiffe den Hafen. Mit an Bord sind der Marinebeamte Milbourne Marsh, seine Frau Elizabeth und seine zwanzigjährige Tochter, die ebenfalls Elizabeth heißt. Doch die eigentliche Odyssee steht der jungen Frau erst noch bevor …
Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts ist nicht nur eine Zeit erster transkontinentaler Kriege, sondern auch des wachsenden globalen Handels. Rohstoffe und Handelsgüter aller Art, aber auch menschliche Arbeitskräfte – Auswanderer und Sklaven – werden zwischen Europa, Afrika, Amerika und Asien transportiert.
Elizabeth Marsh war in gewisser Weise wie ihre Zeit: getrieben, zwischen Kontinenten und Lebensschicksalen, teils Opfer, teils Mitgestalterin. Ihr Schicksal war nicht nur beispielhaft, sondern auch außergewöhnlich. Sie war eine Frau, die trotz aller Konventionen ihr eigenes, emanzipiertes Leben führte. Ein Leben, das Gefangenschaft ebenso kannte wie Unternehmertum, schriftstellerische Ambition, Reiselust und amouröse Abenteuer. Von sich selbst sagte Elizabeth Marsh treffend: »Ich gehöre zu den rastlosen Wesen.«
Eine Liebe auf Jamaika
Die Geschichte von Elizabeth Marsh beginnt nicht in Europa, sondern im damals britischen Jamaika in der Karibik. Zuckerrohr ist das Gold der Insel. Schwarze Sklaven schuften auf den Plantagen. 1732 lernt der junge Schiffszimmermann Milbourne Marsh in der jamaikanischen Hafenstadt Port Royal die verheiratete Elizabeth Evans, eine Mulattin, kennen. Deren Mann betreibt einen gutgehenden Ausschank. James Evans weiß von der Affäre seiner Frau. Doch bevor es zum öffentlichen Skandal kommt, stirbt er und hinterlässt Elizabeth ein hübsches Vermögen.
Im Dezember 1734 heiraten Milbourne Marsh und Elizabeth Evans. Marsh will nach England zurück. Im Juni 1735 besteigt die junge Familie ein Schiff. Es ist höchste Zeit, denn Mrs. Marsh ist im sechsten Monat schwanger. Am 20. August erreichen sie Portsmouth. Einen Monat später kommt das Kind zur Welt, das auf den Namen Elizabeth getauft wird.
In Portsmouth und Chatham bei London wächst Elizabeth auf. Milbourne Marsh findet als leitender Zimmermann in der Werft ein gutes Auskommen. Zwei Söhne kommen zur Welt. Langsam steigt die Familie sozial auf. Sie beziehen ein Haus in bürgerlicher Gegend. Damit sind die Marshs Nutznießer der industriellen Revolution, die in jenen Jahren in England beginnt. Mit Fleiß und Findigkeit können die gesellschaftlichen Schranken durchbrochen werden.
Die Tochter Elizabeth lernt Französisch, Rechnen und Buchführung. Sie soll einmal gut verheiratet werden, das Haushaltsbuch führen und gepflegte Konversation betreiben können. Und sie erhält Unterricht in Klavier und Gesang. London ist damals neben Wien das wichtigste musikalische Zentrum Europas. Aber so bruchlos vollzieht sich der gesellschaftliche Aufstieg nicht. Die junge Elizabeth Marsh hat etwas Unangepasstes, Selbstständiges. Vielleicht spielt das afrokaribische Erbe mit hinein. Jedenfalls erscheint ihr die Aussicht auf eine brave bürgerliche Ehe wenig verheißungsvoll.
Da erhält Milbourne Marsh im Jahre 1755 eine hochbezahlte Stelle auf Menorca und zieht mit seiner Familie dorthin. Das Klima ist mild, das Leben lockerer als im zugeknöpften England.
Doch im Jahr darauf bricht Krieg aus. Die Familie flieht nach Gibraltar. Die zwanzigjährige Elizabeth jedoch will zurück nach England – allein. Endlich gibt der Vater dem Drängen der Tochter nach. Am 27. Juli 1756 besteigt sie das Handelsschiff »Ann«, einen recht abgetakelten, unbewaffneten Kutter. Elizabeth ist die einzige Frau an Bord. Ansonsten: zehn Mann Besatzung und eine Ladung Branntweinfässer.
Gekapert
Auf der Flucht nach Gibraltar, entlang der spanischen Küste, fiel den Engländern bereits auf, dass die meisten Fischerdörfer nicht direkt am Wasser liegen, sondern sich ein Stück landeinwärts an die Hänge schmiegen. Die Passagiere wundern sich. Der zeitgenössische britische Marineoffizier Boscawen jedoch hat in Briefen an seine Frau eine Erklärung bereit: »Der Grund, dass ihre Häuser so liegen, ist die Angst vor den Mauren, die, wenn ihre Häuser zugänglich wären, landen und ganze Dörfer in die Sklaverei verschleppen würden, was trotz aller Vorsicht dennoch häufig geschieht, vor allem in jenem Teil Spaniens, der an der Mittelmeerküste liegt.« Die Sklaverei ist damals – und noch weit ins 19. Jahrhundert hinein – ein wichtiger Wirtschaftszweig in der arabischen und osmanischen Welt. Schätzungen gehen davon aus, dass vom Ende des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts rund 1,25 Millionen Europäer in Gefangenschaft oder Sklaverei durch Araber und Osmanen gerieten. Allein beim osmanischen Vorstoß auf Wien im Jahre 1683 sollen etwa achtzigtausend Europäer – Männer, Frauen und Kinder – versklavt worden sein.
Elizabeth Marsh ist an Bord der »Ann« auf dem Weg nach England. Doch kurz hinter Gibraltar kommt dichter Nebel auf. Die »Ann« driftet orientierungslos im Ozean. Elizabeth Marsh erinnert sich: »Wir waren in völliger Unkenntnis der Gefahr, in der wir uns befunden hatten, bis es vorüber war.« Vorüber ist die Fahrt sehr bald, aber nicht das Abenteuer: Ein marokkanisches Korsarenschiff, mit zwanzig Kanonen und hundertdreißig Mann, bringt die kleine, wehrlose »Ann« auf. Elizabeth Marsh blickt voller Entsetzen zurück: »Wir sahen ein Segel windwärts hinter uns herjagen, und um halb acht kam es in Reichweite eines Pistolenschusses an uns heran.« Die Korsaren kapern das englische Handelsschiff und bringen die Gefangenen an Bord, darunter auch die Kaufleute James Crisp und Joseph Popham. Über die Existenz einer jungen, schönen Frau an Bord freuen sich die Piraten natürlich besonders. Sie sperren die Gefangenen in eine Kajüte. Elizabeth Marsh: »Sie war so eng, dass wir nicht aufrecht darin stehen konnten. An diesem elenden Ort sollten vier Menschen wohnen.« Die junge Frau trainiert sich in jenen Tagen eine gewisse Härte an. Ihr Mitgefangener Joseph Popham schreibt später voller Respekt: »Miss Marsh hielt sich in ihrer unglücklichen Lage besser, als man es von ihrem zarten Geschlecht erwarten durfte.« Freilich ist der Mitgefangene wenig Trost und Hilfe, erzählt er doch der jungen Elizabeth »Geschichten von den Grausamkeiten der Mauren«, wie sie selbst schreibt, »denen mein Geschlecht in der Berberei ausgesetzt sei«.
Nach ein paar Tagen landen die Korsaren in der marokkanischen Hafenstadt Salé, bringen die Gefangenen in einem von Schmutz und Ungeziefer starrenden Haus unter und melden ihren Fang dem Sultan in Marrakesch. Der Herrscher von Marokko Sidi Muhammad ist eine schillernde Gestalt: Gebildet, der Welt gegenüber aufgeschlossen, ein vordergründig aufgeklärter Mann. Aber er gefällt sich trotz seiner höfischen Manieren auch in seiner Allgewalt. Das macht ihn unberechenbar. Im Jahr zuvor hat er ein grausames Exempel an europäischen Kaufleuten statuiert, die aufrührerische Stämme unterstützt haben sollen. Ein Zeitgenosse, Jaime Arvona, selbst ein Sklave, der später freikam, berichtet: »Seine Hoheit nahm alle christlichen Kaufleute und Mönche gefangen; aber da Mr. Mounteney Engländer war, legte er ihm eine schwere Kette um den Hals und Eisen um die Beine und verabreichte ihm so viele Schläge, dass man ihn als tot liegen ließ; allerdings starb er hinterher in seinem eigenen Haus, nachdem er verstanden hatte, dass der Prinz ihm einen langsamen Tod zugedacht hatte, weil er Engländer war; er verlor den Verstand und erhängte sich.«
Zu Sidi Muhammads althergebrachten Vorrechten gehört die Vielehe. Arabische Frauen hat er schon genug. Aber eine Engländerin? Noch dazu mit karibischem Einschlag? Er schickt eine seiner Frauen in das Haus der Gefangenen, um die Fremde zu begutachten. Elizabeth Marsh erinnert sich: »Sie war überraschend groß und kräftig, hatte ein breites, flächiges Gesicht, sehr dunkle Haut und langes schwarzes Haar. Sie trug ein Musselinkleid, das an ein Priestergewand erinnerte, am Hals geknöpft war wie ein Hemdkragen und bis zu ihren Füßen reichte. An Armen und Beinen hatte sie Armbänder, war aufdringlich neugierig, mich und mein Kleid zu untersuchen, und war höchst amüsiert über meine Erscheinung.«
Elizabeth Marsh wird des Harems für würdig befunden. Eine Karawane bringt die Gefangenen fünfhundert Kilometer weit durchs karge Gebirge in die Hauptstadt Marrakesch. Unterwegs macht sich Elizabeth Marsh erste Notizen. Später wird sie die für ihr Buch The Female Captive, Die weibliche Gefangene, verwenden. In der Wüste erst wird sie sich der eigenen Verlorenheit bewusst: »Es war kein Haus oder Baum mehr zu sehen, nur weites Land voller hoher Berge […]. Wenn vorüberziehende Beduinen zu Grobheiten neigten, riefen meine Bewacher ihnen zu, ich ginge als Geschenk an Sidi Muhammad.«
Die Karawane zieht nur des Nachts, wenn es kühl ist, durch die Wüste. Tagsüber campieren sie irgendwo im Schatten eines Felsens und warten darauf, dass die brandheiße Sonne im Westen untergeht. Bereits nach kurzer Zeit ist Elizabeth Marsh erschöpft, dehydriert und steif. Sie ist das lange Reiten nicht gewohnt, alle Glieder tun ihr weh. Wenn sie reitet, sitzt sie auf einem Gestell, auf dem eine Art Matratze liegt. »Die maurischen Frauen«, so weiß sie, »legen sich darauf, da sie sich dicht abschließen lässt; aber ich setzte mich mit den Füßen auf eine Seite des Maultierhalses und fand es sehr geeignet, mich vor den Arabern abzuschirmen.«
Gefangene des Sultans
Nach einer Woche erreicht die Karawane Marrakesch. Ein paar Kilometer vor der Stadt machen sie halt. Die Bewacher fordern Elizabeth auf, sich fein zu machen. Sie zieht frische Kleider an und setzt, »da man mir sagte, dass sie mich meinen Hut nicht tragen lassen wollten«, eine Nachtmütze zum Schutz gegen die Sonne auf. Dann setzt man sie nicht mehr auf ihr niederes Maultier, sondern auf James Crisps Pferd. Ratlos notiert sie: »Gleichzeitig zog einer der Wachen ihm [Crisp] seinen Hut vom Kopf und nahm ihn mit; diese Behandlung verwunderte uns zutiefst. Aber unsere Verwunderung nahm noch zu, als unsere Leidensgenossen absteigen und mit bloßem Kopf zu zweit nebeneinander gehen mussten, obwohl die Sonne heißer brannte, als ich es je erlebt hatte, und der Weg so beschwerlich war, dass die Maultiere knietief einsanken.«
Als sie durch Marrakesch geführt werden, stehen Hunderte Gaffer an den Straßenrändern, johlen und lachen. Es ist ein Schandumzug, der bewusst in die Länge gezogen wird, um die Gefangenen zu demütigen und ihnen Angst einzujagen. Elizabeth Marsh und James Crisp werden von den Kameraden getrennt und in das Obergeschoss einer alten Burg gesperrt. Schließlich werden sie in den Palast des Sultans gebracht, müssen stundenlang stehen, bis sie endlich in einem Hof des Palastes zu Sidi Muhammad vorgelassen werden. Elizabeth ist eingeschüchtert und fasziniert gleichermaßen: »Er saß auf einem prachtvollen Pferd, zu beiden Seiten umgeben von Sklaven, die mit Fächern Fliegen abwehrten, und bewacht von einem Trupp des schwarzen Regiments.« Sie beobachtet, wie andere Bittsteller, selbst hochrangige Offiziere und Gesandte, sich dem Herrscher nähern, indem sie sich zu Boden werfen und den Staub küssen. Elizabeth Marsh wird dem Sultan vorgeführt. Sie ist von dem dreißigjährigen, hochgewachsenen Mann mit kastanienbraunem Haar und einem leicht schielenden rechten Auge durchaus angetan: »Er war groß, schön gebaut, von gutem Teint. Gekleidet in ein lockeres Gewand aus feinem Musselin […]. Alles in allem war seine Gestalt recht ansehnlich und sein Auftreten höflich und gewandt.«
Wäre es wirklich ein Opfer, Haremsdame dieses Mannes zu werden? Sidi Muhammad ist ein kluger Herrscher, der keineswegs Krieg mit dem mächtigen Vereinigten Königreich haben will. Im Gegenteil: Er will diplomatischen Austausch, auch um die Briten als Schutzschild gegen die Franzosen und Spanier zu haben, die koloniale Interessen in Nordafrika hegen. Also macht er der Gefangenen deutlich, dass sie nicht versklavt werden, sondern als Geisel im Land bleiben solle, bis die Briten einwilligen, einen Konsul nach Marokko zu entsenden. Nach dieser Erklärung lässt der Sultan die Gefangene wieder abführen, sie und die anderen Geiseln werden in ein streng bewachtes, halb verfallenes Haus im jüdischen Viertel Marrakeschs gebracht. Elizabeth ist über ihr neues Domizil entsetzt. Ein normales, aber halbwegs sauberes Gefängnis wäre ihr lieber gewesen als diese Form eines Arrests in einem verwahrlosten ruinösen Gebäude, »dessen Mauern voller Käfer und schwarz wie Ruß« sind, wie sie angeekelt konstatiert.
Jaime Arvona, der hochrangige Sultanssklave, der selbst von Menorca stammt, kommt nach einiger Zeit zu Elizabeth und befiehlt, sie solle ihm folgen, Sidi Muhammad wolle sie erneut sehen – allein. Elizabeth ist verängstigt. Was steht ihr bevor? Sie hat bemerkt, dass der allgewaltige Sultan sie durchaus mit Wohlgefallen betrachtet hat. Sie wird zum Palast gebracht, muss am Eingang die Schuhe ausziehen, dann wird sie in die Privatgemächer des Sultans geführt. Sidi Muhammad sitzt in nachlässiger Haltung auf einem Diwan, neben sich vier seiner Frauen, die, so Elizabeth Marsh, »ebenso erfreut wirkten wie er selbst, mich zu sehen. Nicht, dass meine Erscheinung sie hätte für mich einnehmen können.« Sie schämt sich ihres zerknitterten, staubigen Kleids, ihres sonnengebräunten Gesichts (im 18. Jahrhundert für eine Dame eine Schande, denn nur Bauernmägde lieferten sich der Sonne aus). Eine der Frauen bemerkt Elizabeths Scham und bietet ihr an, ihr saubere marokkanische Gewänder geben zu wollen. Elizabeth lehnt aus Trotz ab. Die Marokkanerin streift daraufhin ihre Armreife ab und »schob sie an meinen Arm und erklärte, ich solle sie um ihretwillen tragen«. Sie tauschen ein paar Höflichkeitsfloskeln. In Elizabeth steigt Angst empor. Will der Sultan sie zu einer seiner Frauen machen? Sie will ihre jungfräuliche Ehre bewahren und greift zu einer List – doch legt sie sich damit beinahe eine Schlinge um den Hals. Bislang hat sie zu ihrem Schutz behauptet, der Mitgefangene James Crisp sei ihr Bruder. Jetzt beteuert sie vor Sidi Muhammad, sie sei Crisps Ehefrau. Plötzlich gibt der Sultan den Wachen einen Wink. Sie führen Elizabeth ab. »Aber statt mich zurück in unser Quartier zu bringen, geleitete mein Führer mich in ein anderes Gemach, wohin mir kurz darauf der Prinz folgte, der sich, nachdem er auf einem Kissen Platz genommen hatte, erkundigte, ob meine Ehe mit meinem Freund [James Crisp] tatsächlich bestünde? Diese Frage kam ganz unerwartet; aber obwohl ich bejahte, ich sei wahrhaftig verheiratet, konnte ich spüren, wie sehr er daran zweifelte. Er stellte auch fest, dass es bei englischen Ehefrauen Sitte sei, einen Ehering zu tragen, und ich antwortete, er sei sicher verwahrt, da ich nicht damit reise.«
Der Sultan gibt sich mit dieser wenig überzeugenden Antwort zufrieden – so scheint es. Jedenfalls lässt er Elizabeth Marsh mit »Versicherungen seiner Wertschätzung und seines Schutzes« gehen. Sie wird in das verdreckte Arresthaus zurückgebracht. Dort harrt sie tagelang der Dinge. Immerhin darf sie Besuch empfangen, etwa einen aus London stammenden Kaufmann, der seit Längerem im marokkanischen Agadir lebt und Handel mit den Gegenden südlich der Sahara betreibt. Ihm erzählt Elizabeth von ihrem Gespräch mit dem Sultan und von ihrer fingierten Ehe mit James Crisp. Sie handelt höchst unvorsichtig, denn sie kann nicht wissen, ob der Kaufmann nicht als Spitzel tätig ist.
Wenige Tage später bringt ihr Jaime Arvona einen Blumenstrauß und einen Obstkorb und übermittelt ihr den Befehl des Sultans, erneut in den Palast zu kommen. Elizabeth macht sich fein, so gut sie kann, und lässt ihr Haar »nach spanischer Art aufstecken«. Dann wird sie in den Palast geführt. Die Begegnung mit dem jungen, gut aussehenden Sultan lässt sie erneut nicht kalt. Wieder ist sie von seiner Schönheit und seinen guten Manieren angezogen. Er trägt eine »rosa Satinweste mit Diamantknöpfen« und eine »kleine Kappe aus dem gleichen Satin wie die Weste mit einem Diamantknopf. Er trug Reifen an den Knöcheln und golddurchwirkte Pantoffeln.« Der Sultan ist darauf bedacht, der Engländerin zu imponieren, ohne aufdringlich zu erscheinen. Er lässt ihr Tee kredenzen, aus »Tassen mit Untertellern, die ebenso leicht wie dünn und eigentümlich mit grünem und goldenem Japanlack überzogen waren«, erinnert sich Elizabeth Marsh. »Wie man mir sagte, waren sie ein Geschenk der Niederländer.« Der Sultan winkt einen Diener heran, der vor ihr wie vor einer Prinzessin allerlei Luxusgüter »aus verschiedenen Ländern« ausbreitet: »Ich bewunderte alles, was ich sah, ausgiebig, was dem Prinzen sehr gefiel; und er sagte mir durch den Dolmetscher, er hege keinen Zweifel daran, dass ich mit der Zeit den Palast meinen jetzigen beschränkten Lebensumständen vorziehen werde; dass ich mich immer auf seine Gunst und seinen Schutz verlassen könne, und dass die Kostbarkeiten, die ich gesehen hatte, mir gehören sollten.«
Elizabeth fällt es sichtlich schwer, dem verlockenden Ansinnen standzuhalten. Wieder versichert sie, sie sei mit James Crisp verheiratet. Sie würde gern gehen, »wenn es ihm genehm sei«. Doch diesmal lässt sich Sidi Muhammad nicht so schnell abspeisen. Man übergibt Elizabeth einer der Haremsdamen. Elizabeth erinnert sich der Fremdartigkeit dieser Frau: »Sie hatte ein großes Musselintuch mit Silberbordüre um den Kopf, oben hochgesteckt; ihre Ohrringe waren ungemein groß, und der Teil, der durch die Ohren ging, war ausgehöhlt, um sie leichter zu machen. Sie trug ein lockeres Gewand […] aus feinstem Musselin, ihre Pantoffeln waren aus blauem Satin, mit Silber durchwirkt.«
Die Haremsdame redet freundlich auf Elizabeth Marsh ein – in arabischer Sprache. Elizabeth versteht nicht und formt doch aus Höflichkeit ein paar Worte unbeholfen nach: »La ilaha illa Allah wa-Muhammad rasul Allah.« Was Elizabeth nicht weiß: Es handelt sich um den ersten Satz des muslimischen Glaubensbekenntnisses. Rasch verbreitet sich die Nachricht im ganzen Palast. Sidi Muhammad lässt Elizabeth wieder zu sich bringen, jedoch nicht in einen der Empfangsräume, sondern in ein privates Gemach. Der Sultan hat es sich dort bequem gemacht, wie Elizabeth Marsh beobachtet: »Er saß unter einem roten, reich mit Gold verzierten Samtbaldachin. Der Raum war groß, fein ausgeschmückt und mit Pfeilern voller Mosaikarbeiten versehen; am anderen Ende waren eine Reihe Kissen mit goldenen Troddeln und ein Perserteppich auf dem Boden.«
Sidi Muhammad, in der Pracht seines Herrscherglanzes, fragt die Engländerin unumwunden: »Wollen Sie Muslimin werden? Wollen Sie die Vorteile ernstlich in Betracht ziehen, die es hat, meinen Wünschen zu folgen?«
Elizabeth Marsh antwortet: »Es ist mir unmöglich, meine Haltung in religiösen Dingen zu ändern, aber ich werde mir immer in höchstem Maße der Ehre bewusst bleiben, die Sie mir erwiesen haben, und hoffe auf den weiteren Schutz Eurer Hoheit.«
Sidi Muhammad entgegnet: »Sie haben heute Morgen dem christlichen Glauben entsagt und sind Muslimin geworden. Und unsere Gesetze sehen die Todesstrafe durch Verbrennen für alle vor, die konvertieren und dann widerrufen.«
Da fällt Elizabeth Marsh voller Verzweiflung auf die Knie: »Ich appelliere an Ihr Mitleid, und flehe Sie an, lassen Sie mich zum Beweis der Achtung, die zu erwarten Sie mir Anlass gegeben haben, für immer gehen.«
Sidi Muhammad bedeckt sein Gesicht mit den Händen. Dann schickt er Elizabeth Marsh, die es gewagt hat, ihn in seiner Würde eines großzügigen Herrschers und eines liebenden Mannes zu verletzen, fort. Der Dolmetscher nimmt Elizabeth bei der Hand und führt sie hinaus. Vor den Gemächern ist die höfische Gesellschaft zusammengeströmt, um die Fremde, an der der Sultan so großes Gefallen gefunden hat, zu begaffen. Elizabeth Marsh wird zu den Palasttoren gebracht. Auch vor den Toren hat sich eine Menschenmenge versammelt. Elizabeth sieht auf der anderen Straßenseite James Crisp, der versucht, zu ihr vorzudringen. Doch die Palastwachen schlagen ihn nieder. Die Haremsdamen sind aufgebracht, voller Eifersucht und Häme. Sie haben erfahren, dass Elizabeth Marsh das muslimische Glaubensbekenntnis gesprochen hat, und dass Sidi Muhammad sie aus seinen Gemächern gewiesen hat, und schreien: »Keine Christin, sondern eine Maurin!« Dann zerfetzen sie ihr die Kleider, reißen an ihren Haaren. Elizabeth fürchtet um ihr Leben, verbissen setzt sie sich gegen den weiblichen Mob zur Wehr. Endlich wird sie zum Tor hinausgedrängt, wo der ebenfalls verletzte Crisp sie in Empfang nimmt. Gemeinsam werden sie zurück in ihren Arrest gebracht.
Tags darauf unterzeichnet der Sultan einen Brief an den britischen Gouverneur Gibraltars, worin er erklärt, die Gefangenen der »Ann« freilassen zu wollen, die Royal Navy könne sie an der marokkanischen Küste abholen. Am 7. Oktober 1756 gibt Admiral Sir Edward Hawke in Gibraltar Befehl, das Kriegsschiff »Portland« loszuschicken, um die Geiseln in Empfang zu nehmen. Die »Portland« erreicht zwei Wochen später Salé. Die Engländer ankern in sicherem Abstand zur Küste. Durchs Fernrohr erkennen sie im Hafen die skelettierten Überreste der »Ann«, denn das Schiff wurde von den Marokkanern geplündert und demontiert. Doch ganz so einfach gestaltet sich die Übergabe der Geiseln nicht. Es gehen noch mehrere Briefe zwischen dem Kapitän der »Portland« und dem Sultanspalast hin und her, denn Sidi Muhammad will einen politischen Vorteil herausschlagen. Endlich sichern die Briten zu, ein Konsulat in Marokko zu eröffnen (und damit das Land gegen die alten Gegner Spanien und Frankreich diplomatisch zu stärken). Endlich, am 17. November 1756, dürfen Elizabeth Marsh, James Crisp und die anderen Passagiere und Besatzungsmitglieder der »Ann« Marokko verlassen. In einem Boot werden sie zur »Portland« gerudert. Noch bis zuletzt geht in Elizabeth Marsh »ungeheure Angst« um, »bis wir das Kriegsschiff erreichten«. Sie »fürchtete ein Signal vom Ufer, das unsere Rückkehr befahl«. Doch der Sultan hält Wort. Ungehindert können die Geiseln an Bord der »Portland« gehen. Nach über drei Monaten in Gefangenschaft ist Elizabeth endlich wieder frei.
Zehn Tage später erreichen sie Gibraltar und kehren von dort nach England zurück. Und wiederum einige Wochen später – das genaue Datum ist nicht bekannt – gehen Elizabeth Marsh und James Crisp tatsächlich den Bund der Ehe ein, den sie ja wenige Wochen zuvor dem Sultan gegenüber vortäuschten. Elizabeth selbst gesteht später in ihren Memoiren etwas unklar, die »Dankbarkeit, die ich ihm schuldete, und der Wunsch meines Vaters überwogen jede andere Überlegung«. Ob sie tatsächlich nur diesen Pflichtgefühlen folgte, bleibt im Dunkeln. Vielleicht war auch die Angst ausschlaggebend, als Frau, die im Harem des Sultans von Marokko gefangen gehalten worden war (wenn auch nur für Stunden), in England ihren guten Ruf und damit jegliche gesellschaftliche Zukunft zu verlieren. Insofern war ein Ehebündnis mit Crisp das kleinere Übel, es war eine Ehrenrettung. Für Crisp hatte die Heirat auch einen Vorteil: Er erhielt Elizabeths erkleckliche Mitgift.
Spekulationsgeschäfte und eine literarische Rechtfertigung
Man sollte meinen, Elizabeth Marsh, verheiratete Crisp, hätte nach dem marokkanischen Ausflug wider Willen genug von Abenteuern. Doch weit gefehlt. In ihr sind das Fernweh und der Drang nach emanzipatorischer Freiheit erwacht. Nach außen verläuft in den nächsten Jahren ihr Leben eher konventionell: 1762 kommt der Sohn Burrish zur Welt, zwei Jahre später die Tochter Elizabeth Maria. Elizabeth Crisp hat als Hausfrau und Mutter zu tun. James Crisp geht mit dem Geld seiner Frau und mit ihrer beratenden Beteiligung internationalen Handelsgeschäften nach, die er gerne über die Häfen der autonomen Insel Man abwickelt, um so den Zoll zu umgehen.
Doch im Jahre 1765 unterstellt das englische Unterhaus die Insel Man der direkten Steuerhoheit und trocknet so den Finanzsumpf aus. Zudem hat der Siebenjährige Krieg die europäischen Staaten in eine erste globale Finanzkrise gestürzt. Auch ein vermeintliches Schnäppchen der Eheleute Crisp – der Erwerb von achttausend Hektar Land in Florida mit dem Ziel, irische Auswanderer in mehreren zu errichtenden Dörfern anzusiedeln, die Wein anbauen und Seidenraupen züchten sollen – erweist sich als Fehlspekulation: Das ungesunde Klima und der Krieg machen dem Kolonialprojekt ein Ende, noch bevor es überhaupt begonnen hat. Übrig bleibt nur ein Loch in der Kasse. Ein Onkel Elizabeths, George Marsh, der eine hohe Stellung im Marineamt bekleidet, prangert in seinem Tagebuch das etwas großtuerische, glamouröse Leben des Ehepaars Crisp an, wenn er bemerkt, die beiden seien »allzu geneigt, in Unterhaltungen aller Art und ruinösen Narreteien die Mode und den Aufwand von höchst vermögenden Leuten nachzuäffen«. George Marsh sollte recht behalten: Im Jahre 1769 ist die Firma Crisp bankrott. James Crisp setzt sich ins ferne Indien ab und lässt seine Frau und die beiden Kinder verarmt in England zurück.
Elizabeth Crisp steht vor dem Nichts. Ihr Vater sieht sich in seinen Vorurteilen gegenüber dem Schwiegersohn bestätigt. Sie selbst ist damals dreiunddreißig Jahre alt, hat zwei Kinder – und sieht sich vom Vater abhängig. Ob ihr Ehemann, der die Familie recht gewissenlos in England zurückgelassen hat, um in Indien mit Geschäften und Geschäftchen sein Glück zu suchen, sie wird nachkommen lassen, ist höchst ungewiss. Verbittert schreibt Elizabeth: »Ich […] darf mit Fug und Recht sagen, dass dem Unglück, das mich in der Berberei [Marokko] ereilte, ein mehr als gleich großes folgte, das ich seither in diesem Land bürgerlicher und religiöser Freiheit erlebte.«
Um sich abzulenken und die eigene, sicherlich gefärbte Sicht der Dinge darzustellen (auch als Rechtfertigung vor der Mitwelt), schreibt Elizabeth Crisp in jenen Monaten ihre Memoiren, die ihre Gefangenschaft in Marokko in den Mittelpunkt stellen. Sie erscheinen 1769 in London unter dem Titel The Female Captive. Obwohl das Buch anonym publiziert wird, ist Insidern der Gesellschaft klar, wer die Autorin ist: Ein solch außergewöhnliches Lebensschicksal wie das Elizabeth Crisps war einzigartig und ohnehin seit Jahren Anlass von Klatsch und Tratsch. Aber mit der Anonymität ihrer Autorschaft will Elizabeth zumindest offiziell ihren Ruf wahren, denn es geziemt sich für eine anständige Frau nicht, als Autorin in Erscheinung zu treten. Dennoch – seltsames Paradoxon – nimmt die Zahl schreibender Frauen, die Romane, aber auch Memoiren und Reiseberichte veröffentlichen, damals enorm zu. Aber noch immer gebietet der weibliche Anstand Bescheidenheit und Diskretion im Umgang mit der Publizität.
Nachdem sie den Bericht über ihre marokkanische Gefangenschaft veröffentlicht und vergeblich auf ein Zeichen von James Crisp, ihm nach Indien zu folgen, gewartet hat, fällt Elizabeth im Jahre 1770 einen weitreichenden Entschluss: Sie will ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, nicht länger ihren Eltern auf der Tasche liegen – ihre Mitgift ist verloren –, nicht mehr dem Geschwätz der Londoner Gesellschaft ausgeliefert sein, ihren Kindern eine Perspektive bieten – und endlich all der geistigen, moralischen und ökonomischen Enge entfliehen. Sie hat nichts zu verlieren.
Neubeginn in Madras
Also schifft sie sich im Herbst 1770 mit ihrer Tochter Elizabeth Maria ein – der Sohn Burrish bleibt zunächst bei den Großeltern – und wagt die gefährliche Seereise nach Indien. Die Direktion der East India Company hat ihr zuvor die Erlaubnis erteilt, »sich zu ihrem Mann zu begeben, der in Bengalen im Militärdienst der Gesellschaft steht«. Und da sie mittellos ist, hat man ihr sogar die übliche Gebühr für diese Genehmigung erlassen.
So steht sie also an Bord der dreimastigen Schaluppe »Dolphin«, eines sehr schnellen Schiffes, konzipiert für weite Überseefahrten, und hört den Matrosen zu, die aus rauen Kehlen ihre Seemannslieder singen.
Nach mehrmonatiger, strapaziöser Fahrt, die zunächst nach Brasilien, dann quer über den Südatlantik und ums Kap der Guten Hoffnung herum führt und mehrere Matrosen das Leben kostet (Skorbut ist damals noch die Geißel aller langen Seefahrten), landen sie am 20. Februar 1771 im britischen Handelsstützpunkt Madras an der südostindischen Küste.
James Crisp besitzt ein Exportgeschäft, er handelt mit Baumwolle. Bald hat die Familie in der kleinen englischen Diaspora einen passablen Ruf. Doch das Leben dort ist von Einschränkungen und Schwierigkeiten geprägt. Nach kurzer Zeit schon schicken die Crisps ihre siebenjährige Tochter Elizabeth Maria wieder nach England zurück, zu den Großeltern nach Chatham. Hingegen holen sie den neunjährigen Sohn Burrish nach Madras. Das Ticket bezahlt Großvater Marsh, denn die Crisps müssen noch immer jeden Penny umdrehen. Die Fahrt des Jungen ist mit Komplikationen verbunden: Der Obermaat macht sich mit dem Fahrgeld aus dem Staub, und Großvater Marsh im fernen England muss erneut für ein Ticket berappen. Sechs Monate ist der Neunjährige ohne Bezugsperson unterwegs. Burrish – den Berichten zufolge »ein mannhafter, schöner Junge« – wird auf dem Schiff misshandelt (ob es auch zu sexueller Gewalt kommt, ist unklar) und langt »fast verhungert und völlig verdreckt«, wie Elizabeth entsetzt schreibt, 1772 in Madras an.
Elternliebe beschränkt sich zu jener Zeit weitgehend auf die Stillung existenzieller Bedürfnisse wie die Zuteilung von Nahrung, Kleidung und Bett. Kinder sind gemeinhin so zahlreich, dass man in ihnen nicht so sehr wie heute individuelle, unverwechselbare Wesen sieht. Zudem werden Kinder weit früher als Erwachsene angesehen und auch so behandelt. Sie werden zur Arbeit herangezogen, um die Familie mit zu erhalten, und man verfügt über sie recht unbekümmert, als wären sie Dienstboten. Auch bei den Crisps geht es nicht anders zu – und die materiellen Nöte und Einschränkungen mögen dazu beigetragen haben. Bereits ein Jahr nach Burrishs Ankunft – er ist elf – wird ein persischer Kaufmann auf den Jungen aufmerksam. In ihrem indischen Tagebuch, das Elizabeth Crisp zu jener Zeit führt, vermerkt sie nüchtern: »Innerhalb eines Jahres nach seiner [Burrishs] Ankunft war ein persischer Kaufmann, der mit seinem Vater zu tun hatte, von dem Jungen so angetan, dass er bat, ihn nach Persien mitnehmen zu dürfen, damit er die Sprache lerne, die ihm nach seiner Rückkehr, wie er vertrat, verhelfen könne, sein Glück zu machen.« So wird Burrish »nach langem Überreden« dem Fremden übergeben und – so die praktische Überlegung der Eltern – in die vielleicht harte, aber nützliche Schule des Lebens entlassen. Wie es Burrish in der persischen Fremde erging, ist nicht überliefert. Immerhin lernt er das Persische fließend sprechen und schreiben und kommt mit zwölf Jahren nach Indien zurück. Dort wird er im März 1774 vom britischen Gouverneur von Bengalen, Warren Hastings, und von den Direktoren der East India Company mit Empfehlungen versehen: »Er ist ein Jüngling von etwa fünfzehn Jahren [Burrish ist zwölf, scheint aber älter gewirkt zu haben] und entsprechend gebildet, von äußerst vielversprechendem Talent und hat bereits so bemerkenswerte Fortschritte im Erlernen der persischen, bengalischen und maurischen [arabischen] Sprache gemacht und ein solches Wissen über Handel und Sitten des Landes erworben, dass wir seine Anstellung bei der ehrenwerten Kompanie wahrhaft für einen Gewinn halten und uns erlauben, ihn zu empfehlen.«
Im goldenen Käfig
Die Lage der Crisps bessert sich in jenen Jahren. James Crisp wird »Salzaufseher« mit festem Gehalt im Dienste des bengalischen Provinzrats in Dhaka (im heutigen Bangladesch). Die Familie zieht dorthin. Die Stadt, in der fruchtbaren Tiefebene des Gangesdeltas gelegen, ist damals Zentrum der Baumwollproduktion und des weiterführenden Handels mit dem gesamten indischen Subkontinent und Großbritannien. Aber auch Reis, Salz, Holz und Gewürze sind Exportgüter des Landes. James Crisp hat als »Salzaufseher« die Kontrolle des Salzhandels unter sich, denn die britische East India Company hat hierauf das Monopol. Bald werden die Crisps so wohlhabend, dass sie sich in Dhaka ein großes Haus mit Garten kaufen können. Freilich ist das Leben in Bengalen für Europäer wohlfeil, zumal Arbeitskräfte billig sind. Sogar ein Palankin – eine landestypische Sänfte – wird erworben, und auch die dazu nötigen vier bis acht Träger wollen bezahlt sein. Das Haus wird neu eingerichtet, mit landestypischen Sofas, Betten und Stühlen aus Schwarzholz, mit Tischchen und Schränken, die mit Japanlack überzogen sind. Allerlei neue Kleidung aus heimischer Baumwolle wird angeschafft, im europäischen Stil, aber bunter gefärbt als in England üblich – hierin passen sich die Crisps der indischen Vorliebe für kräftige Farben an –, und vier große Fächer aus Pfauenfedern, die ursprünglich an den Mogulhöfen als Statussymbol galten, sorgen in der Tropenhitze für angenehme Erfrischung.
Trotz allen materiellen Wohlstandes führt Elizabeth Crisp in jenen Jahren ein eher zurückgezogenes und langweiliges Leben. In Dhaka sind in den 1770er-Jahren nur knapp fünfzig Weiße ansässig – meist in der staatlichen Verwaltung oder in der halbstaatlichen Handelsorganisation der East India Company –, doch die meisten haben ihre Ehefrauen und Familien in Europa gelassen, da sie oft nur für ein paar Jahre in Indien tätig sind. Nur drei verheiratete weiße Frauen, darunter Elizabeth, wohnen in der Stadt, und sie führen, den Konventionen der Zeit entsprechend und in einer überwiegend muslimischen Gesellschaft lebend, ein zurückgezogenes und nahezu unsichtbares Dasein. Es gibt nicht einmal ein protestantisches Gotteshaus, und für die erfolgreicheren europäischen Männer bietet sich zur gesellschaftlichen Abwechslung nur eine Freimaurerloge an, die sich weniger mit spirituellen Fragen und karitativem Engagement befasst als vielmehr recht banal mit der Jagd, die zwanzig Meilen außerhalb der Stadt, wo es dichte Wälder mit Rotwild und sogar Bären gibt, regelmäßig abgehalten wird.
Achtzehn Monate Honeymoon
Statt sich zu fügen und im Alltagstrott, in Müßiggang und der feuchten Tropenhitze abzustumpfen, will Elizabeth diesem goldenen Käfig entkommen. Sie hat sich nicht auf den weiten und gefährlichen Weg von England hierher gemacht, um vor Langeweile schier zu sterben. Und so macht sie sich auf, ein Abenteuer zu bestehen: Ende 1774 verlässt sie Dhaka – angeblich, weil ihr »äußerst schlechter Gesundheitszustand« sie dazu zwingt – und fährt mit einem Schiff flussabwärts nach Kalkutta, von dort auf einem Versorgungsschiff, der »Goodwill«, die indische Ostküste entlang bis nach Madras. Die Stadt besitzt damals keinen natürlichen Hafen, alle Schiffe gehen draußen vor der Küste vor Anker, Passagiere und Ladungen werden in kleinen Lastkähnen durch die gefährliche Brandung an Land gebracht. Elizabeth Crisp vermerkt in ihrem Tagebuch verängstigt die Brandung, »die so erschreckend wirkte, dass der Gedanke, sie zu durchqueren, grauenhaft war«. Unbeschadet langen sie in Madras an, das Abendessen erscheint ihr wie »im Himmel, da wir an Land waren«.
Von dort aus geht es auf dem Landweg zurück, durch die heutigen Bundesstaaten Tamil Nadu und Andhra Pradesh, nach Bengalen, wo sie erst im August 1776 eintrifft. Anderthalb Jahre ist sie unterwegs – aber nicht allein. Die Reise macht sie in Begleitung eines elf Jahre jüngeren englischen Offiziers namens George Smith, den sie ihren »Cousin« nennt, der in Wahrheit jedoch ihr Liebhaber ist. Sie schließen sich militärischen Expeditionstrupps an, mit europäischen und einheimischen Soldaten zum Geleit, zahlreichen Gepäckkulis, Dienern und Dolmetschern und drei Dienerinnen zur persönlichen Verwendung. Teilweise gönnt sich Elizabeth Crisp einen Palankin, eine Sänfte, die von vier Männern getragen wird und, wie sie notiert, »große Bewunderung« erregt, »da sie äußerst aufwendig gearbeitet war«. Die Träger sind schmale, aber zähe und leichtfüßige junge Männer, wie der Landvermesser James Rennell verrät: »Die Palankin-Jungen laufen mit einer Geschwindigkeit von achtundzwanzig Meilen [ca. fünfundvierzig Kilometern] in weniger als sechs Stunden [also etwa 7,5 Kilometer in der Stunde] – nur acht Mann, je vier, die vier andere ablösen.«
In Elizabeth Crisp erwachen die Leidenschaften: die Liebe, das Fernweh, auch die Lust zu schreiben. Erneut arbeitet sie an einem Reisebericht (der später von ihren kleingeistigen Verwandten vernichtet worden ist, nur die dürren Notate des Tagebuchs blieben erhalten). Ob sie an eine Laufbahn als Schriftstellerin gedacht hat, bleibt unklar. Auf ihrer abenteuerlichen Reise in Indiens Süden steigen sie in Niederlassungen der East India Company ab, so in Vellore, Ellore und Pulicat, Ganjam und Aska. Auf dem Landweg kommen sie nur langsam voran. Die Wege sind schlecht und für längere Reisen nicht gedacht. James Rennell schrieb sieben Jahre zuvor über das Wegenetz Indiens: »Die Straßen sind kaum besser als Pfade, und wann immer sich tiefe Flüsse (die in diesem Land häufig vorkommen und keine Brücken haben), Sümpfe, Gebirgszüge oder andere Hindernisse dem Verlauf der Straße in den Weg stellen, umgeht sie diese, um die einfachste Passage zu bieten; aus diesem Grund sind die Straßen hier in einem weitaus höheren Maße gewunden, als wir es in europäischen Ländern finden.«
Elizabeths körperlicher Zustand bessert sich trotz aller Strapazen – vielleicht waren die gesundheitlichen Beschwerden auch psychosomatisch bedingt und auf die Langeweile im goldenen Käfig ihrer Ehe zurückzuführen. Jedenfalls scheint sie die Annehmlichkeiten und Zerstreuungen, die ihr die Reise und ihr Reisegefährte bieten, durchaus zu genießen, wie die kurzen Tagebuchnotizen verraten. Auf Bällen tanzt sie, mit ihren vierzig Jahren noch immer eine schöne Frau, ausgelassen und lebensfroh bis in die Morgenstunden hinein. Sie schwärmt noch viel später davon: »Die Ballsäle verwandelten sich eher in Schwimmbäder, durchtränkt vom Schweiß der Tänzer und vom Wasser, mit dem der Boden immer wieder begossen werden musste, um die Füße erträglich kühl zu halten.«
Zum nächtlichen Picknick begibt man sich in den Garten: »Nachdem das Tischtuch, wie üblich, auf dem Gras ausgebreitet war, gab es kaltes Geflügel und Austern – wir sangen einige Lieder, tanzten einen Reel [schottischer Tanz] und plauderten die Nacht hindurch.«
Wo immer sie auftaucht, wird sie rasch zum gefragten Mittelpunkt der kleinen europäischen Gemeinden. In Machilipatnam lädt man sie wiederholt ein: »Meine Gesellschaft war täglich gefragt. […] mein Teetisch war Treffpunkt aller Vernünftigen und Höflichen und jeden Abend gut besucht.« In Aska bittet man sie, auf einem Fest Lieder zum Besten zu geben. In Ganjam gibt der örtliche Kommandant der East India Company ihr zu Ehren einen Ball, den sie mit einem Menuett eröffnen darf. Nicht nur Elizabeth Crisp, auch ihr Begleiter George Smith wird mit allen Ehren empfangen, denn er ist Captain der Armee der East India Company. So gelten also die Empfänge mit allem militärischen Pomp auch ihm, dem Offizier, was seiner Begleiterin (und Geliebten) Elizabeth imponiert.
Elizabeth Crisp und George Smith gelangen auch ins Hinterland, das noch kaum von Europäern bereist worden ist. Nicht immer sind sie gern gesehen, wie Elizabeth einräumt: »Unsere Sänften ließen sich kaum durch das Gedränge der Männer und Jungen zwängen, die uns, jeder mit einem gezückten Krummsäbel oder Messer in der Hand, mit allen erdenklichen Beschimpfungen bedachten.« In den Wäldern leben wilde Tiere. Aber die Liebe zu Smith macht jede Strapaze zum süßen Vergnügen: »Unsere Leute verirrten sich erneut, daher war ich gezwungen, bis Tagesanbruch oben am Ufer zu bleiben, und obwohl es in diesem Teil des Landes viele Tiger gab, siegte der Schlaf über alle Bedenken, und ich genoss eine süßere Nachtruhe denn je – mein Cousin hielt seine Sänfte in der Nähe der meinen.«
Sie betreten Hindutempel und nehmen an religiösen Feierlichkeiten teil. Vieles versteht Elizabeth Crisp nicht. Aber sie ist neugierig und unvoreingenommen und eine genaue Beobachterin: »Ich stand früh auf und ging in Begleitung einiger Herren, um mir einen berühmten Tempel anzusehen. Ich stieg bis ganz oben (wohin keine Frau je vorgedrungen war), die Stufen waren an einer Seite und nicht mehr als einen Fuß und achteinhalb Zoll tief und etwa einen halben Yard breit. […] Als wir oben in großer Höhe ankamen, war ich begeistert von der Aussicht, welche zu den schönsten gehört, die sich vorstellen lässt.«
Als sie mitten in der Nacht den Ort Aska erreichen, ist Elizabeth Crisp von der Pracht der Landschaft, die sich ihr im geheimnisvollen silbernen Mondlicht darbietet, überwältigt: »Wir kamen durch mehrere ausgedehnte Dörfer, die allen Anschein von Üppigkeit erweckten – der Mond stand hoch, und die meisten Orte waren von vornehmen Pagoden, Flüssen und Getreidefeldern umgeben – kurz, als wir uns Aska näherten, war alles bezaubernd – ein so herrliches Land, stattliche Bäume, gute Weiden, ansteigende Hügel, fruchtbare Täler, gewundene Flüsse, dass ich noch nie einen so himmlischen Anblick sah. An Schlaf war nicht zu denken, da ständig ein neuer Gegenstand das Auge (trotz Mondscheins) beschäftigte.«
Nördlich von Ganjam erreichen sie den fünfundsechzig Kilometer langen Chilkasee, der nur durch eine schmale Nehrung vom Ozean getrennt ist und salziges Wasser enthält. Sie überqueren den See auf einer kleinen Fähre, mit Gepäck, Sänften und Gefolge: »Unsere Palankins kamen quer auf das Boot, Gepäck und Diener darunter; die Nacht verging sehr gut.« Sie erreichen das andere Ufer, kommen immer tiefer in Gegenden, die von den Briten und der East India Company noch nicht unter ihre Kontrolle gebracht worden sind. Im Binnenland hinter Manickpatam herrscht, wie sie erfahren, eine Hungersnot, weshalb die Fortbewegung auf dem Landweg immer gefährlicher wird, da allerlei Wegelagerer umherstreichen. Dennoch wagen sie die Weiterreise in die nördlich gelegene Küstenstadt Jaggurnaut (das heutige Puri). Hier sieht Elizabeth Crisp den berühmten, aus dem 12. Jahrhundert stammenden, sechzig Meter hohen Tempel, der Vishnu in seiner Erscheinungsform als Jagannath oder Herr der Welt geweiht ist. Durch die wogende Menge der Pilger – »viele mit alten, schwachen Männern und Frauen auf dem Rücken, die sie zu Jagannath trugen, um dort zu sterben« – bahnen sich die britischen Reisenden mühsam einen Weg und gelangen zum Tempel mit der Skulptur des Jagannath. Doch ebendieses Bildnis, so schreibt sie enttäuscht, dürfen »die Eingeborenen […] nie sehen, und kein Fremder wird auch nur an seine Mauern gelassen«. Die neugierige Reisende lässt trotz allem nicht locker und fragt die Einheimischen nach dem Aussehen Jagannaths: »Ich bekam eine Beschreibung des Gottes von einem Brahmanen, der sagte, er habe nur ein Auge, und das sei ein Diamant von ungeheurem Wert in der Mitte seiner Stirn, umgeben von anderen Reichtümern.« Das entspricht nicht der Wahrheit, Elizabeth Crisp sitzt einem Spaßmacher auf, der sich über die weiße Frau mokieren will. Immerhin ahnt sie das, wenn sie schreibt, »die Wahrheit ist nicht herauszufinden, jeder Brahmane erzählt eine andere Geschichte«.
Sie reisen weiter, die Hungersnot macht die Menschen den Fremden gegenüber aggressiv. Elizabeth Crisp verlässt zeitweise ihre Sänfte nicht mehr und beobachtet das Geschehen nur noch durch ein Loch, das sie in den Vorhang geschnitten hat, »durch das ich sehen konnte, aber nicht zu sehen war«. Am 13. Juni 1776 heißt es Abschied nehmen: Elizabeth trennt sich von ihrem »lieben, lieben Cousin« [George Smith], der nach Ganjam zurückreist, während sie nordwärts nach Kalkutta fährt. Nur ungern kehrt sie zurück nach Dhaka, zu ihrem Mann und zu ihrem Sohn, in den goldenen Käfig ihres Hauses. Im Tagebuch schreibt sie, sie wünschte, sie »säße wieder unter dem großen Baum, den ich gerade verlassen hatte, und genösse die Freiheit und Ruhe«. Fünf Tage später erreicht sie Kalkutta. Nochmals zögert sie ihre Heimkehr hinaus und bleibt sechs Wochen in der Stadt, wo sie im Gartenhaus einer Freundin wohnt.
Bankrott und Kampf ums Erbe
Erst im August 1776 kehrt Elizabeth Crisp nach Dhaka zurück. Die Reise hat sie verändert und von ihrem Ehemann weiter entfremdet. Sie fühlt sich ihm nicht mehr verpflichtet. James Crisp gelingt es nach anfänglichem Erfolg immer weniger, das von der East India Company geforderte Salzmonopol im bengalischen Distrikt Bhulua umzusetzen. Mitarbeiter und Untergebene opponieren und intrigieren gegen ihn. Zudem stößt man sich im Direktorium der Company an Crisps Handels- und Immobiliengeschäften, die er »nebenher« betreibt. Dass sich Crisp ein neues Haus im von Dhaka hundertzwanzig Kilometer entfernten Lakshmipur gekauft hat, passt nicht ins puritanische Arbeitsethos der Company. Der einflussreiche örtliche Fabrikdirektor Henry Goodwin bemerkt in einem Beschwerdebrief an das britische Handelsamt: »Ich kann nicht umhin […], im Hinblick auf Mr. Crisps Wohnsitz in Lakshmipur hinzuzufügen, dass mir dieser mit den Amtspflichten des Salzaufsehers unvereinbar und dem Sinn seiner Bestallung zu widersprechen scheint, die nach meinem Dafürhalten verlangt, dass er an oder in der Nähe der Orte wohnt, wo das Salz gewonnen wird, damit es seiner unmittelbaren Aufsicht unterliegt, wohingegen ich für meinen Teil nicht sehe, welche Nutzen er für die Company haben kann, wenn die Aufgabe, die er selbst erfüllen sollte, an andere delegiert wird und er ebenso gut ganz in Dhaka oder sogar in Kalkutta wie in Lakshmipur wohnen könnte. Tatsächlich […] hat der Salzaufseher meines Wissens die Orte, wo das Salz gewonnen wird, seit vierzehn Monaten nicht besucht.«
Die politischen und ökonomischen Verwerfungen infolge des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs haben das britische Mutterland politisch und wirtschaftlich erschüttert und schmälern dessen Einfluss in den Kolonien, auch in Indien. Eine globale Krise, ausgelöst durch die Ereignisse im scheinbar so fernen Amerika, bahnt sich an. James Crisp scheitert an politischen, wirtschaftlichen und innerbetrieblichen Schwierigkeiten. Er geht mit seinen privaten Geschäften bankrott, wird von der East India Company als Salzaufseher in Dhaka zum 31. März 1777 gekündigt und sieht nur noch einen Hoffnungsschimmer: nach dem Tod seines siechen Schwiegervaters Milbourne Marsh (Elizabeth Marsh senior ist bereits im Januar 1776 gestorben) ein reiches Erbe zu erlangen. Elizabeth will dem zuvorkommen. Zudem hat sie erfahren, dass ihr Vater im Dezember 1776 die reiche Witwe Catherine Soan geheiratet hat. Sollte Vater Marsh alles seiner zweiten Ehefrau vermachen, gingen Elizabeth und ihre Kinder leer aus. Sollte Milbourne hingegen seine eigene Tochter testamentarisch bedenken, würde nach geltendem Recht alles an ihren Ehemann James Crisp fallen – worauf dieser ja spekuliert. Elizabeth hat sich jedoch einen gewieften Schachzug überlegt. Sie schifft sich Ende 1777 nach England ein. In Portsmouth angekommen, kann sie noch mit ihrem sterbenskranken Vater die Angelegenheiten besprechen. Der ändert sein Testament. Milbourne Marsh stirbt am 17. Mai 1779. Im Testament hat er mit Elizabeths Einverständnis verfügt, dass sie (und damit auch James Crisp) leer ausgehen solle. Stattdessen hat er seine Enkeltochter Elizabeth Maria zur Erbin erklärt. Zudem sollten nach dem Tod seiner zweiten Ehefrau die Söhne und die Enkelin deren Vermögenswerte zu gleichen Teilen erhalten. Das bessert zwar nicht Elizabeth Crisps finanzielle Lage, aber zumindest hat sie nach ihrem Dafürhalten für Gerechtigkeit gesorgt und sich mit diesem Akt der Verweigerung endgültig von ihrem Ehemann gelöst. James Crisp geht leer aus und ist familiär und finanziell »erledigt«. Er verfällt dem Alkohol und ist bald nur noch ein Wrack.
Das Haus ist bestellt
Elizabeth hingegen gelingt es, sich der Hilfe und Fürsorge ihres begüterten Onkels George Marsh zu versichern, der ihr und ihrer Tochter Plätze auf dem Versorgungsschiff »York« kauft. Im November 1779 machen sich die beiden als einzige Frauen an Bord auf den Weg zurück nach Indien. Es geht aber nicht nach Bengalen zu ihrem trunksüchtigen Mann, sondern nach Madras, wo Captain George Smith noch immer stationiert ist. Im selben Monat erhält Elizabeth die Nachricht vom Tod ihres Mannes. Da Crisp kein Testament hinterlassen hat, worin er seine Frau hätte als Erbin einsetzen können (und warum hätte er das tun sollen?), geht Elizabeth nach geltendem Recht ein zweites Mal leer aus. Ihr Sohn Burrish, Erbe seines Vaters und inzwischen Schreiber bei der East India Company, wird zum Nachlassverwalter. James Crisps restliche Habe, das Haus in Dhaka, die Möbel und der gesamte Hausrat, werden versteigert. Doch Burrish, der ein Haus in Kalkutta besitzt, sorgt für Mutter und Schwester: Er kauft in Hooghly, nordöstlich von Kalkutta gelegen, ein kleines Haus für die beiden Frauen und kümmert sich um ihren bescheidenen Lebensunterhalt. Seine erfolgreichen Handelsgeschäfte mit Persien – seine perfekten Sprachkenntnisse sind ihm hierin von Vorteil – bringen ihm gute Gewinne ein. Elizabeth Maria heiratet im August 1783 den ebenfalls bei der East India Company arbeitenden George Shee, einen aus Irland stammenden Sohn eines wohlhabenden Grundbesitzers. Shee hat ein einträgliches Einkommen, aber sein Ruf ist zweifelhaft, stammt sein Vermögen doch hauptsächlich aus dem Opiumhandel.
Elizabeths bescheidenes Haus ist bestellt, im wortwörtlichen wie übertragenen Sinne. Sie geht auf die fünfzig zu, für damalige Verhältnisse eine Frau an der Schwelle zum Alter. Noch immer gilt sie als attraktiv. Sie könnte George Smith heiraten, den sie noch immer liebt, oder als achtbare Witwe ihr bescheidenes Dasein in Zufriedenheit führen – da greift das Schicksal mit harter Hand in ihr Leben ein: 1783 diagnostizieren die Ärzte einen Brusttumor. Anfang 1785 lässt sich Elizabeth Crisp operieren – ohne Narkose. Nach George Marshs Zeugnis übersteht sie den Eingriff, bei dem ein Tumor samt umliegendem Brustgewebe von »über fünf Pfund« entnommen wird, »mit heldenhafter Standhaftigkeit«. Der Eingriff erfolgt zu spät. Wenige Monate nach der Operation stirbt Elizabeth Crisp am 30. April 1785. Sie wird vor den Toren Kalkuttas auf dem heute noch existierenden Friedhof in der South Park Street begraben. Ihre Ruhestätte hat sich nicht erhalten, wohl aber das daneben befindliche Grab ihres Sohnes Burrish, der 1811 starb.
2 Hester Stanhope (1776 –1839)
Die Königin der Wüste
Es ist eine stürmische Nacht, Ende Oktober 1811, vor der Südwestspitze der Insel Rhodos: Eine Caïque, ein griechisches Schiff mit großem Deck und flachem Kiel, kämpft sich durch die hohen, windgepeitschten Wellen. Immer wieder schlagen die Brecher über die Reling. Verzweifelt versuchen die Matrosen mit unzureichenden Pumpen das einbrechende Wasser aus dem Schiffsbauch zu bekommen. Unter Deck harren in Todesangst die Passagiere: Engländer, die von Konstantinopel auf dem Weg nach Alexandria in Ägypten sind. Die kleine Gesellschaft schart sich um die fünfunddreißigjährige Lady Hester Stanhope, eine der vornehmsten Damen der englischen Gesellschaft. Zu ihrer Entourage gehören ihr Geliebter, der dreizehn Jahre jüngere Offizier Michael Bruce, ihr Leibarzt (und zugleich Bruces eifersüchtiger Nebenbuhler) Charles Meryon, eine Zofe und mehrere Diener. Die Reise nach Ägypten sollte eine Flucht in die Freiheit sein, denn Lady Hester wird wegen ihrer freizügigen, außerehelichen Beziehung nicht nur in ihrer englischen Heimat, sondern auch in den Kreisen britischer Diplomaten und Reisender, die sich im Umkreis des osmanischen Sultanshofes in Konstantinopel aufhalten, geschnitten und übel beleumundet. Ägypten, so die Hoffnung der Liebenden, ist weit genug von Europa und der bürgerlichen Konvention entfernt, um dieser Nachstellungen und Gerüchte enthoben zu sein. Doch nun droht das Leben des Liebespaares von der Faust des Schicksals in einem Sturm zermalmt zu werden.
Die felsige Küste von Rhodos ist trotz der Finsternis und des starken Regens als Schemen am Horizont auszumachen. Der Kapitän lässt den Anker werfen, in der Hoffnung, dass er Grund fasst und sie so vom Sturm nicht weiter abgetrieben werden. Vergebens. Das Meer ist zu tief. Da erfasst eine hohe Woge die Caïque mit voller Gewalt, eine Riesenfaust bricht den Mast, kippt das Schiff zur Seite, das Wasser strömt ungehindert hinein, die Caïque ist verloren. Durch das Tosen des Windes schreit der Kapitän seinen Leuten zu, das Beiboot zu Wasser zu lassen. Fieberhaft zerren die Matrosen an den Leinen. Was bei ruhigem Wetter eine leichte Übung darstellt, ist nun, im Prasseln des Regens und Donnern der Wellen, in Aufregung und Panik, ein nervenaufreibendes Unterfangen. Endlich gelingt es. Passagiere und Besatzung, fünfundzwanzig an der Zahl, springen in das Rettungsboot. Alles Gepäck, alle Dokumente müssen zurückgelassen werden. Lady Hester Stanhopes Hündchen steht noch oben, jault und bellt. Hester ruft ihm zu, es solle zu ihr herunterspringen, doch das Tier ist verängstigt und gehorcht nicht. Der Kapitän gibt Befehl, vom Schiff, das im Begriff ist, zu sinken, fortzurudern, um nicht in den tödlichen Sog des Wracks zu geraten. Es gelingt mit Müh und Not. Sie schaffen es, zu einem Felsenriff zu manövrieren, an dessen Leeseite ein kleiner, einigermaßen windgeschützter Einschnitt liegt. Hier legen sie an, klettern aus dem Boot, lassen sich erschöpft und vor Todesangst zitternd zu Boden fallen. So liegt Lady Hester Stanhope da, in Nacht, Regen und Wind. Das Schiff liegt auf dem Grund des Meeres, ihr Hund treibt irgendwo tot im Wasser. Ihr ganzer Besitz liegt im Bauch des Wracks und wird dort vermodern und von Fischen gefressen werden. In diesem Augenblick ist Hester Stanhope wohl zu erschöpft, um an das zu denken, was anderntags sie erwarten wird. In jenen bangen Stunden kann sie nicht im Geringsten ahnen, dass sie England nie wiedersehen wird, dafür aber als »Königin der Wüste« und »Sitt« (Hohe Frau) zur ungekrönten Herrscherin des Orients werden wird, von den Arabern und Osmanen geliebt und verehrt …
Eine Kindheit in »Democracy Hall«
Keiner hätte dieses Lebensabenteuer an der Wiege der kleinen Hester prophezeien können. Das Mädchen kommt am 12. März 1776 auf dem Landsitz Chevening des Barons Charles von Mahon, Sohn des Lord Stanhope, zur Welt. Charles’ Frau Hester – nach ihr wird die neugeborene Tochter benannt – stammt ebenfalls aus vornehmer und wohlhabender Familie, ist sie doch die Tochter von Lord Chatham und Schwester von William Pitt dem Jüngeren (der von 1783 bis 1801 und nochmals von 1804 bis 1806 Premierminister Seiner Majestät, George III., sein wird). Nach Hester kommen noch Griselda und Lucy zur Welt. Die Eheleute sind sich innig zugetan, obgleich Vater Charles ein etwas schwieriger, zwanghafter Charakter ist. Es könnte alles schön und geruhsam in sicheren Gleisen weitergehen, ein sorgloses Dasein in der Sonne, die damals der britischen Aristokratie leuchtet – da stirbt Mutter Hester im Jahre 1780, wenige Tage nach der Geburt des jüngsten Kindes, und hinterlässt Witwer und drei kleine Töchter. Charles’ Mutter kommt nach Chevening, um sich um Sohn und Enkelinnen zu kümmern, doch ist sie kein vollwertiger Ersatz. Charles ist in seiner Trauer versteinert und verbittert, seine Marotten, die bislang von seiner herzenswarmen Frau neutralisiert wurden, brechen sich Bahn: Chevening wird zu einem Ort der Kälte und Freudlosigkeit. Das verschlimmert sich noch, als Charles nur sechs Monate nach dem Tod seiner Frau ein zweites Mal heiratet: Louisa Grenville, eine Cousine der Verstorbenen. Sie ist in allem das Gegenteil von Hester: freudlos, engherzig, gleichgültig und kalt gegenüber den Stiefkindern. Immerhin bringt sie ihrem Mann drei Söhne – Philip, Charles und James – zur Welt, damit sieht sie ihre Pflichten erfüllt und widmet sich nur noch ihren karitativen Interessen.
Zu einer Zeit, als Frankreich von der Revolution und dem nachfolgenden jakobinischen Terror erschüttert wird und Großbritannien sich als Hort bürgerlicher Traditionen und Werte erweist, schockiert Charles seine aristokratische Umgebung mit dezidiert republikanischen und revolutionären Ansichten. Obwohl er selbst Mitglied des House of Lords ist, vertritt er die Ansicht, die Monarchie gehöre abgeschafft, die Privilegien des Adels beseitigt. Zudem macht er als (freilich verkannter) Erfinder von sich reden, indem er eine verbesserte Druckerpresse, eine Rechenmaschine und ein mit einer Schraube angetriebenes Dampfschiff konstruiert – segensreiche Erfindungen, die freilich von den Zeitgenossen nicht als solche erkannt und erst zwei Generationen später von anderen (Charles Babbage und Josef Ressel) erneut aufgebracht werden. Von seinem Landsitz Chevening entfernt dieser republikanische Aristokrat das alte Familienwappen und nennt das Schloss fortan nur noch »Democracy Hall«. Die Zeitgenossen halten ihn gemeinhin für verrückt, aber nicht für gefährlich – und England besitzt auf dem Feld spleeniger Adliger ja genügend Prachtexemplare.
Auch die Kinder sollen zu Paradebeispielen republikanischer Sprösslinge erzogen werden und müssen vieles, was jungen Adligen an Bequemlichkeit und Luxus sonst zur Verfügung steht, entbehren. Hester, die das einzige der sechs Kinder ist, das vor dem Vater keine Angst hat, erinnert sich: »Wenn einer von uns einmal besser aussah als sonst, mit einem besonderen Hut oder Kleid, so nahm er [der Vater] es anderntags mit Sicherheit weg und ersetzte es mit etwas Grobem.« Um den scheinbar verwöhnten Aristokratenkindern das Arbeiten beizubringen, schickt Charles sie nicht zum Unterricht, sondern zum örtlichen Schmied und zum Schuster. Das könnte man noch als Lebensschule oder auch als Spleen abtun, aber Charles scheint bisweilen wirklich den gesunden Menschenverstand verloren zu haben. Hester berichtet, er habe ihr einmal das Messer an die Kehle gehalten. Sie quittiert es – so behauptet sie zumindest – mit menschlicher Größe: »Ich fühlte nur Mitleid mit der Hand, die dieses Messer hielt.« Eine Reihe oft wechselnder französischer und schweizerischer Gouvernanten versucht, den Kindern des verrückten Barons zumindest etwas schulische Bildung angedeihen zu lassen. Freilich sind deren Wertevorstellungen nicht nur konservativ, sondern schlicht abgelebt, und so können auch sie keinen Ersatz für eine ausgewogene, moderne schulische Bildung bieten.