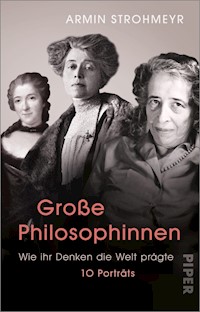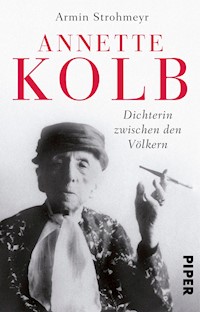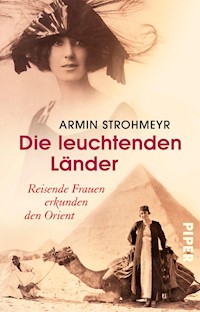13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sie kämpften gegen Vorurteile und bereisten die Welt, getrieben von Mut und Freiheitsdrang: Abenteurerinnen aus fünf Jahrhunderten. Kompromisslos durchkreuzten sie die Pläne ihrer Männer und Familien und zogen in die Welt. So wurden aus braven Gattinnen, Müttern oder Nonnen Hochstaplerinnen, Weltreisende und Soldatinnen – mit Lebensgeschichten von Lou Andreas-Salomé, Mary Read, Agatha Christie, Annemarie Schwarzenbach und vielen anderen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
»Nur Reisen ist Leben, wie umgekehrt das Leben Reisen ist.« Jean Paul
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95895-0
© 2012 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Umschlagabbildung: oben: Getty Images (Agatha Christie),
unten: Slim Aarons/Getty Images (Katharine Hepburn, Antilles)
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
1 Catalina de Erauso (1592–1650)
Nonne und Konquistadorin
Spanien zu Beginn des 17. Jahrhunderts: Es ist das sogenannte Goldene Zeitalter. Das Königreich ist eine Weltmacht. Die Kolonien in der Neuen Welt erstrecken sich von Kalifornien im Norden bis Feuerland im Süden. Spanische Galeonen und Karacken, beladen mit Gold und Silber, mit Mais, Zuckerrohr und tropischen Früchten, überqueren in Flottenstärke den Atlantischen Ozean und löschen ihre Ladungen in den Häfen von Sevilla, Cadiz und San Sebastián.
Manchen Konquistadoren ist das nicht genug: Noch lebt der Mythos von El Dorado, dem sagenhaften Goldland. Was Hernando Cortés und Francisco Pizarro aus den zerstörten Städten der Azteken und Inka an Schätzen geraubt haben, kann – so glaubt man – nur der Abglanz dessen sein, was sich im unzugänglichen Inneren des Kontinents verbirgt. Der Mythos lebt daher fort, er lebt in den Köpfen der Spanier, von König Philipp III. und den Adligen bis hinab zu den Kleinbürgern und Tagelöhnern. Selbst in den weltverschlossenen Klöstern hat der Goldrausch in Gestalt prächtiger Monstranzen und Altäre, die aus den Schätzen der fernen Kolonien gefertigt wurden, Einzug gehalten.
Flucht aus dem Kloster
Auch in den Konvent der Dominikanerinnen von San Sebastián im Baskenland haben sich die Gerüchte von El Dorado eingeschlichen. In diesem Kloster lebt die zwölfjährige Novizin Catalina. Sie stammt aus der vornehmen baskischen Adelsfamilie Erauso. Doch als Mädchen und viertes Kind stellt sie für die Familie nur eine Last dar. Um sie gut zu verheiraten, hätte man ihr eine anständige Mitgift auszahlen müssen. Aber das Erbe wurde bereits den drei älteren Geschwistern versprochen. Also blieb für Catalina nur das Kloster. Bereits mit vier Jahren kam sie zu den Dominikanerinnen. Dort erhält sie eine solide Ausbildung in Lesen, Schreiben und Rechnen, in Latein und Musik. Und sie wird auf das Leben als Klosterfrau vorbereitet: Mit vierzehn Jahren soll sie die ewige Profess ablegen.
Glücklicherweise schrieb sie eine Autobiografie, worin sie minutiös ihre Erlebnisse bis zum fünfunddreißigsten Jahr erzählt. Und sie hatte wirklich eine buchwürdige Vita.
Catalina ist ein selbstbewusstes, etwas störrisches Mädchen. Mit der Lebensweise einer Nonne kann sie sich einfach nicht anfreunden. Als sie zwölf Jahre alt ist, beschließt sie, zu fliehen und ihr Glück in der Neuen Welt zu suchen. Ihre Tante, die ebenfalls im Kloster lebt, wird ihr dabei unwillentlich zur Komplizin:
»Gegen Ende meines Noviziats hatte ich einen Streit mit einer Nonne namens Donna Catalina de Aliri, die als Witwe ins Kloster eingetreten war, und die – sie war stämmig und ich jung – mich grob behandelte, und die ich hasste. […] Am Abend des Sankt-Josephs-Tages [19. März] hatte sich der Konvent um Mitternacht zum Matutin-Gebet erhoben. Ich ging in den Chor der Kirche, wo mich meine Tante herbeirief, mir den Schlüssel zu ihrer Zelle gab, damit ich ihr das Brevier holen solle. Ich ging hin, öffnete die Zelle und sah die Schlüssel zur Klosterpforte an einem Nagel hängen. Ich ließ die Zelle offen und ging zurück, um meiner Tante den Schlüssel und das Brevier zu geben. Als die Nonnen im Chor waren, und die Matutin mit Feierlichkeit begann, bat ich beim ersten Bibelvers meine Tante, mich zurückziehen zu dürfen, ich fühle mich krank. Sie tätschelte mir den Kopf und sagte: ›Ja, geh zurück ins Bett.‹ Ich verließ den Chor mit einer Kerze, ging in die Zelle meiner Tante, nahm Schere, Faden und Nadel, einige Geldmünzen, die ich vorfand, und die Schlüssel zum Kloster. Dann ging ich, öffnete und schloss die Türen, bis hin zur letzten, die die Pforte zur Straße war, wo ich mein Skapulier von mir warf. Ich trat auf die Straße hinaus, die ich noch nie in meinem Leben gesehen hatte, und wusste nicht, wohin ich mich wenden, wohin ich gehen sollte. Ich überließ mich dem Abenteuer und gelangte in einen Kastanienwald, der außerhalb der Stadt lag, hinter dem Kloster. Dort verbarg ich mich drei Tage lang, zerschnitt mein Gewand und nähte ein neues daraus. Ich nähte mir lange blaue Hosen […] und Gamaschen. Das Habit, das ich getragen hatte, ließ ich liegen, ich hatte keine Verwendung dafür. Außerdem schnitt ich mir die Haare kurz. Dann, in der dritten Nacht, zog ich los, wusste nicht, wohin ich gehen sollte, folgte den Pfaden und mied bewohnte Orte. Schließlich gelangte ich nach Vitoria, zwanzig Meilen von San Sebastián entfernt. Ich war müde und hungrig, hatte nichts anderes gegessen als Kräuter, die ich auf meinem Weg gefunden hatte.«
Aus der Novizin wird ein Mann
Mit dem Anlegen von Männerkleidern tut Catalina de Erauso einen entscheidenden Schritt. Sie macht aus der Not eine Tugend: Bis an ihr Lebensende wird sie – von einer kurzen Unterbrechung abgesehen – die Männerkleider nicht mehr ablegen. Mehr noch: Sie wird sich als Mann fühlen, sich einen Männernamen zulegen, sich wie ein Mann gebärden, Männerberufe ergreifen. Unter dem damaligen strengen Sittenkodex muss sie, sollte sie entdeckt werden, mit Gefängnis und Folter, sogar mit der Todesstrafe rechnen. Sie nimmt das Risiko jedoch auf sich, weil sie sich im Innersten als Mann fühlt. Ihr biologisches Geschlecht wird überlagert von ihrer psychischen Identität.
Über die inneren Beweggründe Catalinas wurde viel gerätselt. Selbst die moderne Psychologie, Medizin und Soziologie kamen zu keiner eindeutigen Erklärung. Catalina wurde als lesbische Frau definiert, dann wieder als Transsexuelle oder als Hermaphrodit. An bildlichen Darstellungen glaubte man sogar eine hormonelle Dysfunktion, eine Überproduktion des männlichen Hormons Testosteron, ablesen zu können. Aber keine dieser Interpretationen überzeugt. Dazu wissen wir über die Person Catalina de Erausos zu wenig. Sie erzählt in ihren Memoiren zwar detailfreudig von ihren äußeren Lebensumständen und Abenteuern, aber der Impetus innerer Erkenntnis war der Memoirenliteratur vor vierhundert Jahren noch fremd.
Mit solch müßigen Fragen kann sich die auf der Flucht befindliche jugendliche Catalina ohnehin nicht befassen. Zunächst gilt es, den von den Nonnen alarmierten Stadtwachen zu entkommen. Aber wie soll es weitergehen ohne Geld, ohne Verbindungen? Und wo soll sie unterkommen?
Hungrig irrt sie in der Stadt Vitoria umher, bis ein Mann namens Francisco de Cerralta, Professor für Literatur, sie mitleidig aufliest und mit nach Hause nimmt. Er fördert den vermeintlichen Jüngling, unterrichtet Catalina in Latein und will sie sogar auf die Universität schicken. Doch Catalina schlägt dieses außerordentliche Angebot aus, das Studieren ist nicht ihre Sache. Sie hungert vielmehr nach dem Abenteuer, nach dem prallen Leben. Bei Nacht und Nebel verlässt sie daher das Haus des Professors – nicht ohne ihn um Geld erleichtert zu haben.
Sie schließt sich einem Maultiertreiber an, der nach Valladolid zieht. Dort bewirbt sie sich unter dem Namen Francisco Loyola als Page bei dem königlichen Sekretär Don Juan de Idiaquez und dient ihm sieben Monate lang. Weitere zwei Jahre arbeitet sie als Page in Estella in Navarra. Schließlich kehrt sie in ihre Heimatstadt San Sebastián zurück. Jetzt hat sie nur noch ein Ziel vor Augen: Amerika, die Neue Welt, das sagenhafte El Dorado. Mit ihren Ersparnissen bezahlt sie einen Platz auf einer Galeone, die wenige Tage später ausläuft. Das Ziel: Panama.
Indios, Sklaven, Söldner und Huren
Was für eine fremde Welt ist dieses Amerika! Es herrscht tropische Hitze. Die Stützpunkte der Soldaten und Händler bestehen meist nur aus wenigen Straßenzügen. Von der Kirche und dem Haus des jeweiligen Gouverneurs abgesehen, gibt es nur elende Holzhütten. Auf den Märkten werden fremdartige Früchte angeboten, die Catalina nicht kennt. Sie sieht mit einer Mischung aus Neugier und Abscheu Menschen mit anderer Hautfarbe. Es gibt auf den Märkten bronzefarbene Indios und auf den Zuckerrohrplantagen schwarze Sklaven. Catalina geht in die Hafenkneipen und begegnet Söldnern, Huren und allerlei Gesindel. Alle erzählen sie Geschichten, die vielleicht im Rumrausch zusammenfantasiert sind: Weit im Süden, wo sich die geheimnisvollen, schneebedeckten Anden erheben, soll es noch unerforschte Gegenden geben, mit unentdeckten, unzugänglichen Inkastädten, in denen die Fenster aus Edelsteinen und die Pflastersteine aus Gold sind!
Catalina – oder Antonio, wie sie sich nun nennt – lernt den Kaufmann Juan de Urquiza kennen und schließt sich ihm als Gehilfe an. Sie segeln nach Peru. Schon glaubt sie ihrem Ziel El Dorado nahe zu sein, doch kurz vor der peruanischen Küste geraten sie in einen Sturm: »Als wir uns dem Hafen von Manta näherten, wurden wir von einem so heftigen Gewitter überfallen, dass unser Schiff auf die Seite geworfen wurde und nur die, die schwimmen konnten, wie ich, mein Meister und ein paar andere, sich retten konnten. Alle anderen ertranken.«
Nach ihrer Rettung übernimmt sie in dem peruanischen Ort Zaña eine Handelsfiliale ihres Brotherrn. Mit Fleiß und Wagemut gelingt es Catalina, gute Gewinne zu erzielen. Von Juan de Urquiza erhält sie großzügigen Lohn sowie zwei schwarze Sklaven und eine Köchin.
Liebeshändel und Raufereien
Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Bald gerät sie in Streit mit einem Trunkenbold, der nach kurzem, heftigem Wortwechsel den Degen zieht. Catalina, ebenfalls mit einem Degen bewaffnet, setzt sich zur Wehr und verletzt den Widersacher. Die Wache eilt herbei. Catalina wird ins Gefängnis geworfen. Kurze Zeit darauf kann sie in eine Kirche fliehen, in der ihr Asyl gewährt wird. Versuche ihres Arbeitgebers, sie bei der Gerichtsbarkeit freizukaufen, scheitern. Da verfällt der Kaufmann auf eine List, die nicht ohne erotische Pikanterie ist: Catalina alias Antonio soll die Dame Beatriz de Cardenas heiraten, eine Nichte des verwundeten Widersachers. Durch diese Verbindung – so des Kaufmanns Kalkül – würde man den Gegner versöhnen. Außerdem ist Beatriz de Cardenas die Geliebte Juan de Urquizas: Würde sein Handelsgehilfe die Dame heiraten, könnte der Kaufmann unauffällig in der Nähe von Beatriz sein, die er – da selbst verheiratet – nicht zur Frau nehmen kann. Catalina geht nur widerwillig auf das Spiel ein:
»Nachts schlich ich mich aus der Kirche und ging zum Haus dieser Dame; sie überschüttete mich mit Zärtlichkeiten, und unter dem Vorwand, sie fürchte die Justiz, bat sie mich, nachts nicht mehr zur Kirche zurückzukehren, sondern vielmehr die Nacht bei ihr zu verbringen. Eines Nachts sperrte sie mich ein, und erklärte, ich solle zum Teufel noch mal mit ihr schlafen; sie drückte mich so fest an sich, dass ich gezwungen war, Gewalt anzuwenden, um zu entkommen. Ich sagte meinem Meister sogleich, es sei nutzlos, weiterhin von dieser Heirat zu sprechen, ich würde das um nichts auf der Welt tun.«
Um den Nachstellungen der liebestollen Dame zu entkommen, geht Catalina nach Truxillo, wo sie wieder ein Geschäft ihres Herrn, des reichen Kaufmanns, führt. Doch sie gerät erneut in Streit mit einem Mann. Ein Freund des Degenhelden, den Catalina in Zaña verletzt hat, will Rache an ihr nehmen. Wieder kommt es zum Zweikampf. Diesmal weiß Catalina die Waffe besser zu führen und trifft ihren Gegner tödlich.
Es ist der erste Totschlag, den Catalina begeht. Im Laufe ihres Lebens bringt sie – will man ihren Memoiren glauben – rund ein halbes Dutzend Männer im Streit um. Später, als Soldat, streckt sie im Kampf noch etliche Gegner nieder. Mag man das noch als das mörderische Handwerk des Krieges begreifen, so waren ihre Duelle durchaus von niederen Instinkten geleitet, ausgelöst durch Karten- und Glücksspiel, Trunksucht und kriminellen Umgang.
Nachdem Catalina ihren Gegner tödlich niedergestreckt hat, flüchtet sie erneut in eine Kirche und bittet um Asyl. Mithilfe ihres Herrn kann sie schließlich aus der Stadt fliehen und geht, mit einem Empfehlungsschreiben versehen, nach Lima, die Hauptstadt Perus.
Kurz zuvor hatte sich Catalina noch heftig geweigert, die Geliebte ihres Meisters zur Frau zu nehmen. Jetzt findet sie anscheinend Gefallen am weiblichen Geschlecht. Offensichtlich war die persönliche Identifikation mit der Rolle eines Mannes so fortgeschritten, dass sie auch die Figur des Draufgängers gerne spielte. Immer wieder hat sie Kontakt zu Prostituierten. In Lima tritt sie in die Dienste eines anderen Kaufmanns, der sie jedoch nach neun Monaten aus dem Haus wirft. Catalina erinnert sich: »Der Grund war, dass er bei sich zwei junge Mädchen hatte, mit denen, und vor allem mit einer, mich eine Zuneigung verband. Ich hatte die Angewohnheit, mit ihr zu spielen und zu schäkern. Eines Tages lungerte ich so auf der Terrasse herum, an ihre Seite geschmiegt und ihre Beine streichelnd, als ihr Vater zufällig an einem Fenster erschien, von wo er uns sah, und er mich sagen hörte, ich wolle nach Potosi gehen, um Geld zu verdienen, und sie dann später heiraten. Er zog sich zurück, rief mich einen Moment später zu sich, verlangte meinen Geschäftsbericht und schickte mich dann weg.«
Mit Degen und Arkebuse
Catalina war als Händler und Prokurist gescheitert. Sie besaß keine Empfehlung und musste sich nach einem anderen Posten umsehen. Was lag da näher, als den Soldatenberuf zu ergreifen? Das Vizekönigreich Peru war an seinen Grenzen im Süden und Osten noch immer bedroht: Portugiesen fielen ins Land ein, Indios revoltierten, Rebellen und Räuber machten ganze Landstriche unsicher. Als Soldat der königlichen Armee konnte man Ruhm ernten, guten Sold einstreichen und sich an der Ausplünderung der Einheimischen beteiligen. Ein Leben galt dabei wenig.
Catalina de Erauso wird nun also Konquistador, spanischer Eroberer. Sie wird mit geschlitzten Hosen, eisernem Brustharnisch, hohem Kragen und dem spanischen Helm mit ausladenden eisernen Spitzen ausstaffiert. Als Söldner wurde sie im Jahre 1630 – sie war achtunddreißig – von dem Maler Francisco Pacheco, dem Schwiegervater von Diego Velázquez, in Öl porträtiert. Das Bild befindet sich heute in San Sebastián im Baskenland, der Heimat Catalinas. Auf dem Gemälde blickt einem ein Konquistador mit strengen, etwas verbitterten Zügen entgegen. Die Augen sind groß und dunkel, das rechte schielt etwas. Tränensäcke treten deutlich hervor. Die Nase ist lang und etwas gebogen, der Mund fest geschlossen, das Kinn markant. Eine tiefe Falte zieht sich vom Nasenflügel zum Mundwinkel. Die Gesichtsmuskulatur ist stark ausgeprägt, sie verleiht den Zügen etwas Hartes, Willensstarkes. Das Haar trägt Catalina halblang, es fällt bis über die Ohren – einziges Zugeständnis an ihr biologisches Geschlecht.
Mit einer Kompanie spanischer Söldner erreicht Catalina die Stadt Concepción im heutigen Chile. Der Zufall will es, dass sie hier ihrem älteren Bruder, einem Offizier, begegnet, doch sie gibt sich nicht zu erkennen. Als die Kompanie nach Lima zurückgeschickt wird, erreicht sie, dass sie in Chile bleiben kann. Drei Jahre lang ist sie dort Soldat unter dem direkten Kommando ihres Bruders.
Als sie wieder einmal in Streit gerät, wird sie in die Ebene von Valdivia strafversetzt. Dort widersetzen sich die Indios der spanischen Oberhoheit. Catalina berichtet vom grausamen Vorgehen gegen die Aufständischen: »Die Indios nahmen Valdivia ein und plünderten es. Wir zogen ihnen entgegen und lieferten ihnen drei oder vier Gemetzel, in denen sie stets unterlagen und in die Flucht geschlagen wurden. Aber beim letzten Mal – sie hatten Verstärkung erhalten – setzten sie uns schwer zu, und sie töteten viele von uns, auch Offiziere, unter anderem auch meinen Fähnrich, und entwendeten unsere Fahne. Als wir sahen, dass sie die Fahne mitnahmen, setzten wir hinterher, ich und zwei andere berittene Soldaten, mitten hinein in eine große Menge. Wir warfen sie nieder, schlugen und steckten Schläge ein. Bald sank einer von uns tot nieder. Zu zweit kämpften wir weiter, und wir kamen bis zu unserer Fahne. Mein Kamerad wurde von einem Lanzenstoß niedergerissen, und ich trug eine Verwundung am Bein davon. Schließlich tötete ich den Kaziken [Häuptling], der die Fahne trug, und ich riss sie an mich. Dann packte ich meine beiden Kameraden, stieß noch eine ganze Gruppe von Feinden nieder und tötete sie, obwohl ich selbst verletzt war, getroffen von drei Pfeilen und einer Lanze in der linken Schulter, die mir viel Pein bereitete. Schließlich gelangte ich zurück zu den Unseren, und ich fiel erschöpft vom Pferd.«
Für ihren Wagemut wird Catalina zum Leutnant ernannt. Auch bei weiteren Zusammentreffen mit feindlichen Indios ist sie nicht zimperlich: Sie sticht ihre Gegner meist mit Schwert oder Hellebarde nieder. Gefangene werden nicht gemacht, sondern auf ihren Befehl hin gleich am nächsten Baum aufgeknüpft.
Rausch des Tötens
Catalinas militärische Karriere wird durch ihre Spielsucht gefährdet: Beim Kartenspiel gerät sie mit anderen Soldaten aneinander und tötet zwei. Sie kann zunächst fliehen, wird verfolgt, in der Dunkelheit der Nacht kommt es zum Kampf mit ihrem Verfolger, den sie ebenfalls niedersticht. Zu spät erkennt sie, dass sie ihren eigenen Bruder getötet hat. Sie flüchtet in ein Kloster und verbirgt sich dort acht Monate lang. Dann gelingt ihr der Ausbruch aus dem von Soldaten bewachten Konvent, sie schlägt sich nach Tucumán in Argentinien durch. Auf der Flucht tut sie sich mit zwei anderen Deserteuren zusammen. Gemeinsam überqueren sie die Anden. Es wird ein grauenvolles Erlebnis:
»Auf dreihundert Meilen begegneten wir niemandem. Wir hatten noch eine Handvoll Brot und ein wenig Wasser; wir aßen Gras, ein paar kleine Tiere, Wurzeln. Manchmal sahen wir Indios, die aber vor uns flohen. Wir waren gezwungen, eines unserer Pferde zu töten, um davon zu essen und den Rest mit uns zu nehmen. Aber das Pferd war ganz abgezehrt und nur noch Haut und Knochen. Wir töteten schließlich auch die beiden anderen Pferde, gingen zu Fuß weiter und konnten uns kaum noch aufrecht halten. Die Erde war so kalt, dass sie gefror. Wir sahen schließlich zwei Männer, die an einem Felsen lehnten, was uns mit großer Freude erfüllte. Wir rannten zu ihnen hin, riefen ihnen Begrüßungen zu, noch bevor wir sie erreichten, und fragten, was sie da machen. Sie antworteten nicht. Wir näherten uns; sie waren tot, erfroren, die Münder offen, als würden sie lachen, was uns mit Grausen erfüllte. Wir gingen weiter. Drei Tage später, als wir uns bei einem Felsen zum Schlafen legten, gab einer von uns, der nicht mehr weiterkonnte, den Geist auf. Zu zweit ging es weiter, und am nächsten Tag, gegen vier Uhr nachmittags, ließ sich mein Kamerad fallen und brach in Tränen aus. Er konnte nicht mehr weitergehen und starb ebenfalls. Ich fand in seiner Tasche acht Piaster und setzte meinen Weg fort, ohne zu wissen, wohin, ausgestattet nur noch mit einer Arkebuse und einem Stück Pferdefleisch. Ich hatte das gleiche Schicksal wie meine Kameraden zu erwarten. Man kann sich meine Betrübnis vorstellen, müde wie ich war, ohne Schuhe, die Füße wundgerieben. Ich lehnte mich an einen Baum und fing an zu weinen, ich glaube zum ersten Mal in meinem Leben. Ich betete den Rosenkranz, empfahl mich der Heiligen Jungfrau und dem ruhmreichen heiligen Joseph.«
Doch Catalina hat Glück: Zwei Reiter entdecken sie und bringen sie zu einem nahegelegenen Bauernhof, wo man sie gesund pflegt.
Wieder bei Kräften, kehrt sie nach Peru zurück. In einer Unruheprovinz verpflichtet sie sich erneut als Söldner und wütet im Trupp unter den aufständischen Indios. Catalina, ganz Kind ihrer Zeit, berichtet voller Stolz von den begangenen »Heldentaten«: »Die Indios, mehr als zehntausend an der Zahl, waren in das Land eingebrochen. Wir unternahmen einen Angriff wie im Rausch und richteten ein solches Gemetzel an, dass ein Bach von Blut sich über den Platz ergoss, und wir verfolgten sie weiter und töteten sie, bis hin zum Fluss Dorado.«
Dorado. Das Zauberwort. War Catalina noch immer auf der Suche nach dem sagenhaften Goldland? Wir wissen es nicht. Ihre Autobiografie verrät allerdings, dass sie ganz andere Probleme hatte: Mehrmals gerät sie in den folgenden Jahren beim Spiel in Streit, tötet verschiedene Gegner, wird verhaftet, ins Gefängnis geworfen, flieht wieder, verdingt sich in einer anderen Provinz als Söldner. Einmal wird sie – Ironie des Schicksals – wegen eines Mordes, den sie gar nicht begangen hat, festgenommen. Im Kerker zeigt man ihr bereits die Folterwerkzeuge. Kurz bevor man sie der Marter unterzieht, wird sie auf Geheiß des Gouverneurs freigelassen. Man hat die wahren Übeltäter festgesetzt und ihnen ein Geständnis abgepresst.
Das hätte für Catalina eine Mahnung sein können, ihrem Leben eine Wende zu geben. Doch die Gier nach Abenteuern und Geld lässt sie nicht zur Ruhe kommen. Wieder verdingt sie sich als Söldner. Als sie vor der Küste Perus in einem Seegefecht zwischen Spaniern und Holländern kämpft, wird ihr Schiff geentert, sie selbst gefangen genommen und nach drei Wochen von den großmütigen Niederländern an der peruanischen Küste ausgesetzt.
Ende des Spiels
Ein andermal wendet Catalina eine List an, um der Verhaftung zu entgehen. Als sie in Lima ein Pferd kauft, wird sie von zwei Betrügern beschuldigt, ihnen den Gaul gestohlen zu haben. Ein Offizier will sie festnehmen. Da wirft sie dem Pferd eine Decke über den Kopf und fragt die Betrüger, auf welchem Auge das Pferd denn blind sei. Die Aussagen widersprechen sich: Auf dem linken, sagt der eine, auf dem rechten, der andere. Catalina zieht dem Pferd die Decke vom Kopf: Es ist auf keinem Auge blind!
Schließlich besinnt sich Catalina in einem Augenblick höchster Not. In Cuzco spielt sie Karten, gerät in Streit und tötet erneut einen Mann, den stadtbekannten »Neuen Cid«, einen üblen Säufer und Raufbold. Catalina flüchtet daraufhin und findet Asyl im bischöflichen Palast. Der Bischof, ein alter, weiser und lebenserfahrener Mann, spürt, dass Catalina ein Geheimnis mit sich trägt. Er spricht ihr ins Gewissen. Da gibt der Damm, den sie jahrelang im Inneren aufgebaut hat, nach, und sie bricht – so zumindest erinnert sie sich – in Tränen aus. Es sind Tränen der Befreiung aus innerer Not. Sie beichtet dem Kirchenmann ihre Taten und gesteht, dass sie eine entlaufene Nonne ist. Der Bischof lässt sie daraufhin von zwei Hebammen auf ihr Geschlecht und ihre Jungfräulichkeit untersuchen. Als feststeht, dass sie die Wahrheit gesprochen hat, erteilt er ihr die Absolution. Unter seinem Schutz begibt sie sich nun in das Nonnenkloster der heiligen Klara in der Stadt Guamanga in Peru.
Hier könnte die Geschichte enden, wenn das Ganze ein sentimentaler Roman wäre. Aber es handelt sich um das Leben einer Frau, die nie Frau und Nonne sein wollte. Sie ist im Inneren nicht zu brechen und folgt dem Bischof, ihrem Wohltäter und Retter, nur zum Gefallen. Als der Kirchenmann wenig später stirbt, wird sie vom Orden nach Spanien zurückgerufen. Man möchte den Willen der ungehorsamen Frau brechen. 1624, zwanzig Jahre nach ihrer Flucht, macht sie sich auf den Weg in die alte Heimat.
Vor König und Papst
In Sevilla angekommen, flüchtet Catalina erneut und legt wiederum Männerkleider an. Sie erbittet eine Audienz bei König Philipp IV. und schildert ihm ihre Geschichte. Der König hat schon allerlei von ihr gehört, in Spanien erzählt man sich auf den Straßen viel über sie. Er zeigt sich erkenntlich für ihre soldatischen Verdienste und gewährt ihr eine großzügige Rente. Doch für das andere Problem, die Frage ihrer Geschlechterrolle, fühlt er sich nicht zuständig. In solch schwierigen Sachverhalten kann nur der Papst eine Entscheidung fällen.
Also schifft sich Catalina nach Rom ein. Papst Urban VIII. – auch er hat von der Konquistadorin vernommen – gewährt ihr eine Audienz. Sie trägt auch ihm ihre Geschichte und ihr Problem vor. Schließlich fasst der Heilige Vater einen weisen und großherzigen Entschluss. Catalina erinnert sich: »Seine Heiligkeit zeigte sich sehr erstaunt über solch eine Geschichte und erteilte mir in seiner Güte die Erlaubnis, künftig in Männerkleidung zu leben, ermahnte mich aber, auch in Zukunft meine Keuschheit zu wahren. […] Danach verließ ich ihn. Die Neuigkeit verbreitete sich rasch, und ich sah mich umringt von zahlreichen Persönlichkeiten, Prinzen, Bischöfen, Kardinälen. Alle Häuser standen mir offen, so dass ich anderthalb Monate in Rom zubrachte, und es gab kaum einen Tag, wo ich nicht eingeladen und von Prinzen bewirtet wurde.«
Catalina, die sich stolz bei ihrem Männer- und Adelsnamen »Antonio de Erauso« nennen darf, zieht im Juli 1626 nach Neapel weiter. Hier endet ihre Autobiografie, die viel später, im Jahre 1829, in spanischer Sprache veröffentlicht wird, ein Jahr darauf in französischer Sprache, im 20. Jahrhundert noch in anderen Übersetzungen. Lange hat man die Echtheit der Memoiren angezweifelt und ein paar Datierungsfehler im Text bemängelt. Inzwischen haben verschiedene Forscher jedoch die Authentizität der Autobiografie nachgewiesen. Lediglich ein paar romaneske Szenen scheinen von späterer Hand eingeflochten zu sein.
Rückkehr in die Neue Welt
Das weitere Leben Catalinas ist nur grob nachzeichenbar: Bis 1630 hält sie sich in Sevilla auf, wo auch Pacheco das Ölporträt anfertigt. Dann zieht der Abenteuerdrang sie erneut nach Amerika: Sie schifft sich nach Mexiko ein, wohin man ihr die Leibrente nachsendet. 1645 begegnet ihr der Kapuzinermönch Nicolás de la Rentería und berichtet über das Treffen mit der »Monja Alférez«, der »Nonne als Fähnrich«. Das wurde die volkstümliche Bezeichnung für Catalina, und so lautet auch der Titel eines 1626, also im Jahr des päpstlichen Dispenses entstandenen Theaterstückes über ihr merkwürdiges Leben.
In Mexiko kauft sich Catalina von ihrer Rente Maultiere und Sklaven und unterhält eine Spedition für den Warenverkehr zwischen der Ostküste und der Hauptstadt Mexiko. Ganz so keusch, wie es Papst Urban von ihr gefordert hatte, scheint sie aber nicht gelebt zu haben. Bezeugt ist eine unglückliche Affäre mit einer jungen Dame: Diese soll von den Eltern ins Kloster geschickt werden, verlobt sich jedoch mit einem jungen Mann. Catalina, die im Auftrag der Eltern als »Begleitservice« die Verantwortung für die junge Frau übernommen und sich in sie verliebt hat, wird eifersüchtig. Sie bietet der von ihr Begehrten eine Mitgift von dreitausend Pesos, unter der Bedingung, dass sie ins Kloster eintritt. Sie selbst, Catalina, wolle dann auch den Nonnenschleier nehmen, um der Liebsten nahe zu sein. Aus dem Kuhhandel wird allerdings nichts. Die junge Frau heiratet ihren Bräutigam, Catalina bleibt Unternehmerin, und dem Kloster werden ungeahnte Schwierigkeiten erspart. Freilich verzichtet Catalina nicht so ohne Weiteres: Es kommt zu Szenen im Haus des Bräutigams, der ihr schließlich die Tür weist, woraufhin Catalina ihm eine Forderung zum Duell schickt. Der junge Mann entsinnt sich jedoch des zweifelhaften Ruhmes der Widersacherin und geht auf die Forderung lieber nicht ein: Er wolle sich mit einer Frau nicht schlagen. Eine offene Beleidigung für Catalina de Erauso! Zum Glück schlichten Außenstehende den Streit, und alle involvierten Personen kommen mit dem Leben davon.
Wenig später, im Jahr 1650, stirbt Catalina de Erauso im Alter von achtundfünfzig Jahren in Mexiko und wird unter großer Anteilnahme beigesetzt.
Geblieben ist das Bild einer Frau, die ein Leben lang kämpfte. Sie tat das aus einer etwas primitiven Gier nach Ruhm und Reichtum. Das ist der eine Aspekt. Der andere: Sie kämpfte auch gegen Vorurteile und Konventionen, um endlich das sein zu dürfen, als was sie sich empfand – ein Mann.
2 Hortense de Mazarin (1646–1699)
Femme fatale auf der Flucht
Paris, im Winter 1661: In Frankreich herrscht der zweiundzwanzigjährige König Ludwig XIV. Noch nennt man ihn nicht den »Sonnenkönig«, noch ahnt man nicht, zu welcher Bedeutung er sein Land einmal führen wird. Frankreich ist aus dem Dreißigjährigen Krieg und dem Krieg gegen Spanien gestärkt hervorgegangen. Im Inneren wurde der Aufstand der adligen Frondisten gegen den König niedergeschlagen. Der mächtige, inzwischen achtundfünfzigjährige Kardinal Mazarin hat das Sagen. Er ist krank und weiß, dass er, da er als Geistlicher keine Kinder hat, Macht und Reichtum auf andere Weise vererben muss, wenn sein Name und sein Ruhm weiterleben sollen.
Aus diesem Grund hat er bereits einige Jahre zuvor vier seiner sieben Nichten und seinen Neffen aus seiner Heimat Italien nach Frankreich kommen lassen, um sie am Hof einzuführen, sie französisch zu erziehen und ihnen günstige Verbindungen zu verschaffen. Den Neffen Philippe, einen unruhigen und unsteten Charakter, hält er allerdings für schwach. Seine Nichten verheiratet er nach und nach mit wohlhabenden und einflussreichen Männern, um den Clan der Mazarins mit Frankreichs Geld- und Geburtsadel zu vernetzen.
Mit seiner Lieblingsnichte, der jüngsten der sieben, hat er Besonderes im Sinn: Ortensia oder Hortense – sie ist gerade einmal vierzehn Jahre alt – soll den Titel »Herzogin von Mazarin« erben. Bald werben hochstehende Männer um sie, denn neben dem Titel winkt ihnen auch eine immense Mitgift von einhundertfünfzigtausend Livres, daneben unschätzbarer Diamantenschmuck, zudem das Herzogtum Mayenne, ein Stadtpalais in Paris und Ländereien im Elsass.
Schönheit als Waffe
In späteren Jahren klagt Hortense über diese Heiratspolitik und den frühen Verlust ihrer kindlichen Unbeschwertheit: »Sobald meine Kindheit unter verschiedenen Zerstreuungen dahin war, sprach man darüber, mich zu verheiraten. Das Schicksal, das mich schließlich zur unglücklichsten Person meines Geschlechts machen sollte, begann zunächst, als wollte es mich zu einer Königin küren.«
Hortense macht es dem Onkel und dessen dynastischen Plänen nicht leicht: Im Grunde ihres Herzens hasst sie ihn – und sie weiß um den Wert ihrer legendären Schönheit. Bilder zeigen eine schlanke, schwarzhaarige Frau mit dunklen, mandelförmigen Augen, schwarzen Brauen und einer ausgeprägten, geraden Nase. Sie trägt für die damalige Zeit eher schlichte Kleider mit tiefgeschnittenem Dekolleté, die Schultern frei, ihre Reize selbstbewusst zeigend. Am auffälligsten ist, dass sie auf einigen Stichen und Gemälden keinerlei Schmuck trägt: keine Ohrringe, kein Collier, nicht einmal einen Ring. Ihre schlichte, natürliche Schönheit pries – als sie bereits eine reife Frau war – der damals berühmte Dichter Charles Saint-Évremond mit hymnischen Worten in einem an sie gerichteten Brief:
»Ich habe es unternommen, Ihnen einen Rat zu geben, obgleich Frauen es nicht lieben, einen anzunehmen. Aber das macht nichts. Ich nehme an Ihrer Schönheit zu großen Anteil, um Sie nicht vor dem Unrecht zu warnen, das Sie ihr zufügen würden, wenn Sie zum Geburtstag der Königin Schmuck anlegten. Lassen Sie den Schmuck den anderen! Schmuckstücke sind fremde Schönheiten, die jenen an Stelle der natürlichen dienen. Und bei jenen sind wir verpflichtet, unseren Augen etwas Angenehmeres zu bieten, als es ihre Personen selbst sind. […] Jeder Schmuck, den man Ihnen anlegt, verbirgt eine Schönheit, jedes Schmuckstück, das man Ihnen fortnimmt, gibt Ihnen Anmut zurück. Und Sie sehen niemals so gut aus, als wenn man an Ihnen nur Sie selbst sieht.
Die meisten Damen verlieren sich vorteilhaft unter ihrem Schmuck. Es gibt welche, die man mit ihren Perlen sehr hübsch findet, jedoch sehr hässlich finden würde mit ihrem Hals. Das schönste Halsband der Welt würde auf dem Ihren sehr schlecht wirken. Es würde an Ihrer Person eine Veränderung eintreten, und jede Veränderung an einer vollendeten Sache könnte für diese nicht von Vorteil sein.«
»Gott sei Dank, er ist verreckt«
Nacheinander weist Hortense de Mazarin so illustre Heiratskandidaten wie den Marschall Turenne, Karl Stuart von England, den Herzog von Savoyen, den Prinzen von Courtenay und den Bruder des Königs von Portugal ab. Selbst ein Eunuch findet sich unter denen, die für sie schmachten. Schließlich ist es aber der Adlige Armand de La Porte, der ihre Hand erhält, obwohl gerade er – der Urenkel eines Advokaten – nicht der Wunschkandidat des schon todkranken Kardinals Mazarin ist. Hortense berichtet hiervon in ihren Memoiren: »Ich wurde im Alter von sechs Jahren nach Frankreich gebracht, und wenige Jahre später verschmähte Monsieur Mazarin [Armand de La Porte] meine Schwester, die Connetable Maria Colonna, und empfand eine so gewaltsame Zuneigung für mich, dass er sogar einmal zu Madame d’Aiguillon sagte, dass, würde er mich heiraten, es ihm egal wäre, müsste er drei Monate später sterben.«
Freilich schrieb Hortense diese Erinnerungen später mithilfe eines »Ghostwriters«, des Dichters César Saint-Réal, in der Absicht, ihren Mann, von dem sie inzwischen getrennt lebte, der Lächerlichkeit preiszugeben. Weiter berichtet sie über Armand de La Porte: »Der Erfolg übertraf seine Wünsche: Er hat mich geheiratet und ist immer noch nicht tot.«
Ob Armand de La Porte wirklich so vernarrt in Hortense war, wissen wir nicht. Sicherlich war die in Aussicht gestellte Mitgift auch für ihn ein großer Anreiz. Für Hortense scheint der Wunsch, ihren Onkel zu düpieren, vielleicht auch nur ein pubertäres Aufbegehren, der Anlass gewesen zu sein, den aussichtslosesten der Bewerber zu wählen. Hortense erzählt selbst: »Nachdem der Kardinal Mazarin zum ersten Mal Gerüchte über diese Leidenschaft hörte, war er so unwillig, das anzunehmen, und so außer sich über den Korb, den Armand de La Porte meiner Schwester gegeben hatte, dass er mehrfach sagte, er würde mich lieber an einen Lakaien verheiraten.«
Armand de La Porte gelingt es, den Bischof von Fréjus zu seinem Verbündeten zu machen, indem er ihn mit Geldzusicherungen besticht – ein Versprechen, das er freilich nie einlöst. Kurz: Kardinal Mazarin gibt schließlich seine Einwilligung, und Hortense darf Armand de La Porte heiraten.
Wenig später, am 9. März 1661, stirbt Kardinal Mazarin und hinterlässt seinen Nichten ein riesiges Vermögen, selbst der französische Staatshaushalt wird aus den ihm zugesprochenen Mitteln saniert. Hortense, nun eine der reichsten Frauen Frankreichs, hat für ihren Onkel indes nur Hohn und Spott übrig. Sie vertritt in ihren Erinnerungen eine eigene Version der Todesursache, die – mag sie auch unglaubhaft sein – viel über das Verhältnis zwischen dem Kardinal und seinen Nichten verrät:
»Sobald die Ehe geschlossen worden war, schickte mir Armand ein Schränkchen, worin zwischen lauter Nippes auch zehntausend Pistolen in Gold waren. Ich teilte sie mit meinem Bruder und meinen Schwestern, um sie mit meinem Reichtum auszusöhnen, den sie nicht ohne Neid betrachten konnten, so eine Miene machten sie. Ja, sie brauchten mich nicht einmal darum zu bitten. Der Schlüssel blieb immer dort, wo er gewesen war, als man das Schränkchen gebracht hatte; jeder konnte sich von dem Geld nehmen. Und eines Tages, als wir uns keinen besseren Zeitvertreib wussten, warfen wir mehr als dreihundert Louis aus dem Fenster des Palais Mazarin, um das Vergnügen zu haben, damit eine Schar von Lakaien zu bewerfen, die unten im Hof standen.
Als diese Verschwendung zu Ohren des Kardinals Mazarin kam, empfand er darüber solch einen Verdruss, dass man fürchtete, dies würde seinen Tod beschleunigen. Wie dem auch sei, er starb acht Tage später und ließ mich zurück als die reichste Erbin und die unglücklichste Frau der Christenheit. Auf die erste Nachricht, die wir hiervon erhielten, sagten mein Bruder und meine Schwester zueinander: ›Gott sei Dank, er ist verreckt.‹ Um ehrlich zu sein, ich selbst war auch kaum betrübter; und es ist doch bemerkenswert, dass ein Mann mit diesen Verdiensten, der sein ganzes Leben lang geschuftet hat, um seine Familie nach oben zu bringen und ihr Reichtum zu verschaffen, nur Reaktionen des Widerwillens geerntet hat, selbst nach seinem Tod. Wenn Ihr wüsstet, mit welcher Strenge er uns in allen Belangen behandelte, wäret Ihr weniger erstaunt. Nie zuvor hatte ein Mensch sanftere Umgangsformen in der Öffentlichkeit, und ein so rohes Gebaren zu Hause.«
Ein Tartuffe mit Gesichten
Die Ehe mit Armand de La Porte, dem frischgebackenen Herzog von Mazarin und von Mayenne, ist von Anbeginn unglücklich. La Porte zeigt überaus bigotte und spleenige Züge. Nachdem er die legendäre Kunstsammlung des Kardinals Mazarin erheiratet hat, geht er mit einem Hammer durch die Galerie und schlägt den antiken Statuen die Geschlechtsteile ab, weil sie ihm unschicklich erscheinen. Auch Nacktheiten auf Gemälden von Tizian und Correggio lässt dieser Saubermann überpinseln. Überhaupt erscheint er manchmal wie eine Figur aus einer Molière’schen Komödie: Einmal verlost er die Dienstposten im Haushalt, denn – so Armand – aus dem Los spreche Gottes Wille. So wird der Koch sein Verwalter, der Parkettarbeiter sein Sekretär. Als Feuer im Haus ausbricht und die Leute zum Löschen herbeistürzen, verjagt Armand de La Porte dieses »Gesindel«, das es wagt, Gott ins Handwerk zu pfuschen. Louis Herzog von Saint-Simon schreibt amüsiert: »Dank dieses Verhaltens verringerte er die Last des ungeheuren Vermögens, die ihn bedrückte.«
Auf seinen Gütern verbietet Armand de La Porte den Bäuerinnen, die Kühe zu melken, das sei schlecht für die Keuschheit. Unschicklich gilt ihm auch die Körperhaltung beim Spinnen und beim Butterstampfen. Die Ammen dürfen freitags und samstags nicht stillen, denn das sind die Todestage des Herrn Jesus Christus. Durch seine Dörfer zieht er mit selbst verfassten Katechismen, die er unters Volk verteilt. Überhaupt steht La Porte mit überirdischen Mächten in gutem Kontakt: Er hat Visionen vom Erzengel Gabriel. Als er, der als Gläubiger des jungen Königs sogar Zugang zu dessen Privatgemächern hat, einmal zu später Stunde zu Ludwig XIV. eilt und ihm mitteilt, der Erzengel sei ihm erschienen und habe gefordert, der König solle sich von seiner Geliebten, Fräulein de La Vallière, trennen, erwidert Ludwig schlagfertig, der Erzengel sei auch ihm erschienen und habe verkündet, der Herzog von Mazarin sei verrückt.
Auch gegen seine Frau ist Armand de La Porte streng und von krankhafter Eifersucht. Bereits wenige Wochen nach der Hochzeit versucht Hortense daher, sich zu erdolchen. Er verbietet ihr die »Mouches«, die Schönheitspflästerchen, und nimmt ihr den Schmuck weg. Als Hortense weinend zu ihrem Bruder Philippe eilen will, der im Haus nebenan wohnt, lässt Armand die Verbindungstür kurzerhand zumauern. Sie erklärt daraufhin, sie werde eben über die Straße gehen, woraufhin er den Kopf zum Fenster hinausstreckt und unter dem Gelächter der Passanten lauthals fordert, man solle ihr den Weg abschneiden.
Verdacht auf Inzest
Armand de La Porte versucht, seine Frau wie eine Gefangene zu halten, verbietet ihr den Ausgang oder schickt die Hochschwangere über Wochen mit der Kutsche zwischen seinen Besitzungen in der Bretagne und dem Elsass hin und her. Hortense schreibt: »Wenn ich mit einem Diener redete, wurde er am nächsten Morgen entlassen. Machte mir ein Mann zweimal hintereinander Besuch, so verbot ihm der Herzog das Haus. Gefiel mir ein Dienstmädchen, schickte er es fort. Verlangte ich nach meiner Kutsche, so verhinderte er – wenn auch unter allerlei Scherzen –, dass angespannt wurde.«
Schließlich geht Armand de La Porte mit seinen eifersüchtigen Vorwürfen bis zum Äußersten. Die Herzogin berichtet:
»Urteilt selbst über die Entrüstung, die ich empfand, als ich seine widerwärtigen Verdächtigungen empfing. Mein Mann, hundertmal lächerlicher und verachtenswerter als der allerletzte Bürger, der fürchtet, von seiner Frau entehrt zu werden, mein Mann also erschien eines Abends urplötzlich in meinem Zimmer und fand mich und meinen Bruder dort allein vor, ohne dass ich hätte Kerzen bringen lassen, weil es noch nicht völlig Nacht war. Er zeigte sich befremdet über unser Alleinsein und über die Dunkelheit und rief nach den Hausburschen. Er ließ zwanzig Kerzen anzünden, ganz gegen seine Gewohnheit, und meinte, dass, befinde sich eine junge Frau fast ganz allein, man sie mit lauter Lichtern umgeben müsse, und dass übrigens jeder Tag, wo er das ›Glück‹ besitze, meinen Bruder, den Herzog von Nevers, als Gast dazuhaben, für ihn ein Tag großer Umstände sei. […] Als wir schließlich allein waren, erklärte mir mein Mann, er lese seit Langem schon in den Augen meines Bruders eine leidenschaftliche Liebe zu mir. […]
›Madame‹, sagte er, ›ich weiß selbst geheime Gefühle zu durchleuchten; im Übrigen: Wäre der Herzog von Nevers der erste Bruder, der sich in seine eigene Schwester verliebt? Schließlich haben Geschwister seit der Kindheit Gelegenheit, sich zu sehen; man hat voreinander nichts zu verbergen; diese Vertraulichkeit, der Reiz, den man empfindet, sich täglich ohne Hindernis zu begegnen, lässt eine süße Zuneigung entstehen, die man leicht als brüderliche Freundschaft bemäntelt, die aber sehr schnell zu einem Strafbestand wird.‹«
Eingeschüchtert durch diese maßlose Unterstellung, willigt Hortense ein, eine Zeit lang im Kloster Notre-Dame-des-Chelles, östlich von Paris, Unterschlupf zu suchen, unter den strengen Augen der Äbtissin. Dort freundet sie sich mit einer Altersgenossin an, Sidonie von Courcelles. Die Streiche, die die beiden jungen Frauen den Nonnen spielen, zeugen davon, wie Hortense fern vom Ehemann auflebt:
»Um den Novizinnen, die oft des Nachts gegen ihren Willen aufstehen mussten, einen Gefallen zu tun, füllten wir einmal die Schlösser zu den Zellen der Äbtissin und der Klosterfrau, die die Glocken läutete, mit Sand, so dass beide in jener Nacht nicht mehr aus ihren Kammern herauskonnten. Eines Abends trennten wir alle Glockenseile ab und warfen sie in einen Brunnen, um die Nonnen am Läuten zu hindern, und daran, die Nachtruhe aller zu stören.«
Ein andermal gießen sie Tinte ins Weihwasserbecken oder laufen bei einem Gang durch die Stadt der ihnen zur Bewachung beigegebenen Nonne kichernd davon. All das kommt natürlich Armand de La Porte zu Ohren, und er droht, Hortense zurückzuholen. Die Angelegenheit dringt an die Öffentlichkeit. Schließlich befasst sich sogar das Ständeparlament in Paris mit dem Ehekrach, denn der Friede im Umkreis des königlichen Hofes ist von dem Streit im hochherrschaftlichen Hause Mazarin bedroht. Die Versammlung ordnet an, dass Hortense fortan wieder im Palais Mazarin wohnen solle, ihr Mann, der das Amt eines Artilleriegroßmeisters innehat, im Arsenal.
Fideles Exil in Italien
Hortense de Mazarin hat indes einen Fluchtplan ausgeheckt: Ihr Bruder Philippe bringt sie in einer Karosse vor das Stadttor von Paris. Unterdessen hat Hortense in der Kutsche Männerkleider angelegt. Vor der Stadt besteigt sie ein Pferd, und zusammen mit ihrem Bruder, einem Vertrauten und der Zofe Manon beginnt die Flucht. Zunächst geht es in Richtung Lothringen, dann nach Süden, acht Tage und acht Nächte lang, in denen sie kaum schlafen, über die Alpen nach Mailand, zu ihrer Schwester Maria, die dort mit dem Konnetabel Lorenzo Colonna verheiratet ist. Freilich ist Hortenses Verkleidung – anders, als man das aus Mantel- und Degenfilmen kennt – so überzeugend nicht. Schmunzelnd schreibt Hortense in ihren Memoiren: »Fast überall erkannte man uns als Frauen. Immer wieder entglitt es Manon, mich mit ›Madame‹ anzusprechen. Und manchmal geschah es auch aus dem Grunde, dass mein Teint und die Feinheit meiner Gesichtszüge mein Geschlecht verdächtig machten. Auch wurde ich darüber unterrichtet, dass Leute in den Herbergen manchmal auf den Einfall kamen, uns durchs Schlüsselloch hindurch zu beobachten, wenn wir uns in unseren Zimmern eingeschlossen hatten: Sie sahen also, wie wir unser langes Haar lösten, sobald wir unter uns waren, weil unsere Männerfrisuren uns arg unbequem erschienen. Manon war sehr klein und so wenig überzeugend als Reiter gekleidet, dass ich sie nicht anschauen konnte, ohne in Lachen auszubrechen.«
Armand de La Porte hat unterdessen wieder Visionen vom Erzengel Gabriel (deren Inhalt uns leider nicht überliefert ist). Erneut lässt er eines Nachts den König wecken und bittet ihn, die staatliche Polizei nach Hortense und ihrem Bruder fahnden zu lassen. Ludwig antwortet ungehalten, er habe keine Lust mehr, sich in diese Eheangelegenheiten einzumischen. Bald gehen Lieder um, die den Herzog und seine Engelsvisionen verspotten:
»Mazarin, traurig, bleich und mit gebrochenem Herzen,/fragt: Ach, meine Frau, was ist aus ihr geworden?/Der König darauf: Ist euch das wirklich nicht bekannt?/Hat der Engel, der euch alles sagt, euch diesmal nichts verraten?«
Armands Unruhe steigert sich noch, als Gedichte auftauchen, die Philippe auf seine Schwestern Hortense und Maria Colonna verfasst hat. Wieder wittert der Ehemann einen Bruder-Schwester-Inzest, wenngleich Philippe in den Versen beteuert: »Mit der schönen Hortense und der klugen Marie/verbringe ich so zwischen Schwester und Schwester mein Leben./Ihr beide seid im ganzen Universum einzigartig in eurer Art./Schöner als Venus und keuscher als Lukretia.«
Doch nicht mit dem Bruder lässt sich die lebenslustige Hortense in Mailand und später in Rom ein. Weit schlimmer für die damalige Ständegesellschaft: Sie wählt einen Stallburschen zum Geliebten. Das hat bald Folgen. Ein in Rom lebender Franzose namens Monsieur de Belbeuf berichtet in einem Brief an seine Mutter: »Obwohl man hier nicht übermäßig viele Frauen zu sehen bekommt, verbringen wir die Zeit recht angenehm mit der Frau Konnetabel und Madame de Mazarin, die äußerst zufrieden zu sein scheint, abgesehen von einer kleinen Unpässlichkeit, darin bestehend, dass sie im sechsten oder siebten Monat schwanger ist.«
Hortense de Mazarin gibt ihrem Stallburschen jedoch schon bald den Laufpass. Was aus dem Kind wurde, ist nicht überliefert.
Der König schreitet ein
Schließlich reist Hortense – ihres Exils überdrüssig – zusammen mit ihrem Bruder wieder zurück nach Frankreich. Sie lassen sich ein halbes Jahr lang Zeit, was wieder Gerüchte über einen Inzest schürt. In Nevers angekommen, wartet bereits ein vom Ehemann beauftragter Kommissar der Großen Kammer auf die Flüchtige, um sie zu verhaften. Doch die Bürger der Stadt rotten sich zusammen und demonstrieren lauthals für die schöne Herzogin, so dass man sie wieder freisetzen muss.
Nun verliert der König die Geduld: Er erteilt dem Herzog den Befehl, sich mit seiner Frau auszusöhnen, und empfängt Hortense bei Hofe. Ludwig redet der Störrischen ins Gewissen, sich mit Armand wieder zu vertragen. Sie aber skandiert uneinsichtig den alten Ruf der aufständischen Frondisten, was einem Hochverrat gleichkommt: »Point de Mazarin, point de Mazarin – fort mit Mazarin, fort mit Mazarin!«
Der König seufzt resigniert und bietet Hortense die Rückkehr nach Rom an, sofern sie sich mit einem Bruchteil ihrer Rente, vierundzwanzigtausend Livres, bescheidet. Zähneknirschend stimmt Hortense, die normalerweise ein Jahreseinkommen von anderthalb Millionen Livres gewohnt ist, ein. Unter Geleitschutz wird sie daraufhin nach Italien gebracht.
Doch schon bald nimmt sie – gemeinsam mit ihrer Schwester Maria Colonna, die ebenfalls ihrer Ehe überdrüssig ist – Reißaus. Die beiden Frauen suchen das Abenteuer, fern der höfischen und häuslichen Kontrolle. Sie mieten einen Kutter und segeln acht Tage lang übers Meer nach La Ciotat in der Provence. Armand de La Porte erfährt von der spektakulären Flucht und setzt einen Detektiv auf die Frauen an. Die fahren unterdessen in einer Barke rhoneaufwärts nach Lyon. Dort trennen sich die Schwestern. Maria macht sich auf den Weg nach Paris, Hortense begibt sich, ohne von dem Detektiv aufgespürt zu werden, nach Chambéry in Savoyen.
Bei Herzog Carlo Emanuele, der einst vergebens um ihre Hand anhielt, quartiert sie sich drei Jahre lang ein und wohnt auf dessen Schlössern in Chambéry und Turin. Ganz uneigennützig bietet der Herzog der schönen Frau allerdings nicht Unterkunft, vielmehr wird Hortense seine Geliebte. In Savoyen schreibt Hortense mithilfe César Saint-Réals ihre Erinnerungen, die 1675 zur Rechtfertigung ihres Lebensweges erscheinen. Als im selben Jahr Herzog Carlo Emanuele stirbt, fordert seine Witwe die Herzogin von Mazarin auf, das Land zu verlassen. Hortense entschließt sich, einen weiteren Verehrer zu besuchen: König Karl II. von England. Mit ihrem prachtvollen Gefolge von zwanzig Reitern durchzieht sie die Rheinebene flussabwärts, obwohl dort Krieg tobt – ein etwas gespenstisch anmutender Zug inmitten von Morden und Brandschatzung.
London ist entzückt
Hortense bleibt bis zu ihrem Tod im englischen Exil. Sie gefällt sich darin, die verarmte und verstoßene Ehefrau zu spielen, deren Mann ihr Vermögen einbehalten hat und deren Schmuck vom französischen Finanzminister zur Aufbesserung der Kriegskasse eingezogen worden ist. Somit sind die Bildnisse, die sie ohne Juwelen zeigen, nicht nur Ausdruck der natürlichen Schönheit, die ihr Vertrauter, der Dichter Saint-Évremond an ihr rühmte, sondern auch bildlich gewordener Vorwurf an die Männer, die ihr Unrecht getan haben. Zum tatsächlich erlittenen finanziellen Schaden gesellt sich auch ein gut Maß Selbstmitleid. Arm ist Hortense de Mazarin bis zuletzt nicht. Auch Karl von England verleiht ihr etliche Dotationen: Er schenkt ihr ein kleines Palais im Londoner Park von Saint James und setzt ihr eine Pension von viertausend Pfund aus, von der sie gut und sorgenfrei leben kann. Karl ist der einst von ihm umworbenen Frau gegenüber ein großzügiger und großherziger Kavalier. Als Armand de La Porte dem englischen König schreibt, er anerkenne keine von seiner Frau unterschriebene Quittung mehr, erwidert der König ritterlich, es sei nicht seine Gewohnheit, von Damen solche Zettel überhaupt anzunehmen. Hortense ist ihm am englischen Hof, den der frankophile König als langweilig empfindet, eine willkommene Abwechslung: Französische Kunst, Mode und Mätressen erscheinen ihm als das Nonplusultra feiner Lebensart.
Hortense hält in ihrem Londoner Haus Hof im Kleinen: Um sie gruppiert sich ein Kreis von Adligen, Künstlern, Philosophen und Dichtern – etwa der Schriftsteller und Abbé César Saint-Réal. Auch der damals bereits über fünfundsechzigjährige Dichter Charles Saint-Évremond gehört dazu, der sich in die sechsunddreißig Jahre jüngere Herzogin verliebt, ihr in Gedichten und Briefen Komplimente macht und ihr seine philosophische Abhandlung Über die Freundschaft widmet. Außerdem verfasst er später ihre Lebensgeschichte – und trägt mit seinen parteiischen Lobeshymnen viel zum etwas einseitig positiven Ansehen Hortenses in der Nachwelt bei. Für Vorwürfe, er sei ein alter Narr und höriger Sklave der Herzogin, hat Saint-Évremond indes nur ein Achselzucken übrig:
»Man beschuldigt mich zu Unrecht, zu viel Nachsicht für Madame Mazarin zu üben. Dabei gibt es niemanden, über den Madame Mazarin sich mehr beklagen könnte als über mich. Seit sechs Monaten suche ich schalkhaft etwas an ihr, das mir missfallen könnte, und trotz meiner Unzulänglichkeit finde ich nur Liebenswürdigkeit und Reiz. […] Sie ist die einzige Frau, für die man auf ewig in seinem Verhalten beständig bleiben könnte und mit der man sich in jeder Stunde dem Vergnügen der Unbeständigkeit hingibt.«
Auch Hortense schätzt ihr Faktotum: »Der achtbare Saint-Évremond, dieser teure Philosoph, ergriff alle Gelegenheiten, mir weise Ratschläge zu erteilen, manchmal in einem scherzenden Ton, manchmal ernsthaft. Glücklich die Frau, die solch einen Freund besitzt!«
Freilich hört die noch junge Herzogin oftmals nicht auf die weisen Ratschläge ihres Mentors: Stattdessen verstrickt sie sich in vielfache Liebeshändel. Zum Beispiel ist da der schwedische Baron Bannier (oder Banér), dessen Vorzüge sie – für eine Dame der damaligen Zeit gewagt – offen preist: »Das Objekt meiner lebhaften Gefühle war ein junger Schwede, der Baron von Bannier, Sohn des berühmten Generals dieses Namens [Johan Banér], einer der berühmtesten Zöglinge des Königs Gustav Adolf, der sich in Deutschland so viel Ruhm als Anführer der schwedischen Truppen erwarb. Nie zuvor wurde meinen Augen ein so schöner Mann vorgeführt. Stellt Euch ein Antlitz mit regelmäßigen Zügen vor, große blaue Augen, die zärtlich und ausdrucksstark sind, einen Mund, der von blendend weißen Zähnen geschmückt wird und um den stets das charmanteste Lächeln spielt. Fügt Eurer Fantasie noch frische und tiefrote Farben hinzu, den Glanz eines Pfirsichs oder eines Apfels. Er hat blondes Haar, vergleichbar dem, das die Maler Apoll geben, und eine hohe und edle Gestalt.«
Als 1684 der Sohn ihrer Schwester Olympia, der junge Chevalier de Soissons, nach London zu Besuch kommt, verliebt er sich in die Tante und fordert den Nebenbuhler Bannier zum Duell. Dabei tötet der junge Hitzkopf Hortenses Geliebten. Als Hortense die Nachricht erhält, verschließt sie ihr Haus und lässt es zur Trauer mit schwarzem Samt ausschlagen.
Ihr immer noch geifernder Ehemann überzieht sie unterdessen von Frankreich mit Klagen und Prozessen. Die Schriftstücke der Advokaten wandern zwischen Paris und London hin und her. Glücklicherweise hat Hortense noch immer den treuen Saint-Évremond, der ihr den Papierkram abnimmt und jeden seiner untertänigen Briefe an die Herzogin mit den Worten »Tuyo hasta la morte« unterzeichnet: »Dein bis in den Tod«.
Schulden, Branntwein, Kartenspiel
1689 besteigt der Protestant Wilhelm von Oranien den englischen Königsthron. Im Parlament entbrennt eine heftige Debatte über Hortense: Man fordert, die Pension der ausländischen Katholikin einzuziehen und die allzu leichtlebige Frau vor Gericht zu stellen. Ihr wird sogar die Beteiligung an einer Verschwörung unterstellt. Hortense ist bereit, England zu verlassen, doch ihre Gläubiger lassen sie nicht ziehen. Armand de La Porte, der sich angesichts der bevorstehenden Auslieferung seiner Frau bereits die Hände reibt, meint nun, die Engländer seien Ketzer, deren Forderungen man nicht zu begleichen brauche. Schließlich erbarmt sich Wilhelm von Oranien der in die Enge getriebenen Exilantin, lässt die Untersuchung einstellen und ihr wieder eine Staatspension ausbezahlen.
Hortense de Mazarin verfällt in den kommenden Jahren mehr und mehr dem Kartenspiel, der Wettlust und dem Alkohol. Sie trinkt Branntwein wie ein Matrose. Fassungslos wird berichtet, sie schaue Hahnenkämpfen zu und tanze in kurzen Röcken die ungebärdige Forlane. Doch das Bild der liebes- und vergnügungssüchtigen Herzogin zeigt nur eine Seite ihres unausgeglichenen Wesens. Hortense hadert mit ihrem Schicksal, das es ihr zwar an keiner äußeren Sicherheit fehlen lässt, ihr aber dennoch die Möglichkeit zur Selbstbestimmung verweigert: »Wie ist das Schicksal der Frauen zu beklagen! Sie sind dazu verdammt, die Sklaven der Ehemänner mit ihren seltsamen, unbeständigen und eifersüchtigen Launen zu sein; umgeben von allen Reizen der Verführung, von liebenswerten und zugleich gefährlichen Männern, die sie anbeten, ist ihnen auferlegt, den Illusionen ihrer Sinne zu widerstehen, und dennoch betrachtet man sie als viel schwächer denn die Männer!«
Im Jahre 1699 erkrankt Hortense de Mazarin und begibt sich zur Kur nach Chelsea, wo sie am 2. Juli stirbt. Sofort beschlagnahmen ihre Gläubiger die Leiche. Der Herzog von Mazarin, noch immer begierig nach dem Körper seiner Frau, muss eine hohe Kaution stellen, um den Leichnam auszulösen. Ein letztes Mal kann er wegen seiner Frau das tun, was er am liebsten tut: prozessieren. Auch bleibt ihm die Genugtuung, ihre Rückkunft – und sei es nur die ihres toten Körpers – nach über dreißig Jahren doch noch erzwungen zu haben.
Hortense de Mazarin hinterlässt drei Töchter und einen Sohn. Dessen Urenkelin heiratet 1777 den Fürsten von Monaco. Damit fallen das Herzogtum Mayenne und die Besitzungen im Elsass (unter anderem Pfirt oder Ferrette im Oberelsass) an die Grimaldis, gehen aber wenige Jahre später in der Französischen Revolution verloren. Den Titel »Gräfin und Graf von Pfirt«, den Hortense und ihr Mann ebenfalls führten, tragen die Grimaldis bis heute.
Charles Saint-Évremond, der treue Wegbegleiter von Hortense de Mazarin, überlebt die Herzogin um vier Jahre: Er stirbt dreiundneunzigjährig im September 1703 in London und wird als französischer Dichter neben den großen englischen Geistern in Westminster Abbey beigesetzt.
Man mag der Herzogin Hortense de Mazarin manches vorwerfen, doch oberflächlich war sie nicht. Vieles in ihren Memoiren scheint direkt aus ihrem Munde zu kommen, Gedanken, die ihr Hausautor Saint-Évremond so tief nicht empfunden und erfunden haben kann:
»Ich beende hier die Geschichte meines Lebens, gleichwohl in der Absicht, mir zum Ziel genommen zu haben, zu zeigen, wie viel Unrecht unserem Geschlecht angetan wird. […] Ich habe erfahren, dass selbst der vollkommene Rückzug aus dem öffentlichen Leben und selbst ein einwandfreies Verhalten nicht Schutz vor Verleumdungen bieten. […] Oftmals täuscht uns der Schein, und im Verhalten der Frauen gibt es oft mehr Unglück als Liederlichkeit.«
3 Mary Read(um 1685–1721) und Anne Bonny (um 1690–nach 1720)
Piratinnen der Karibik
Im Jahre 1713 wird der Friede von Utrecht geschlossen. Damit endet nach zwölf Jahren der Spanische Erbfolgekrieg, der Europa verwüstet und ausgeblutet hat. Doch der Friede wird nicht von allen begrüßt. Abertausende von Söldnern der verschiedenen Armeen sind nun ohne Lohn und Brot. Es sind viele »soziale Verlierer« darunter, Menschen ohne Besitz und Beruf. Um nicht als Bettler zu enden, gleiten etliche von ihnen in die Kriminalität ab, schlagen sich fortan als Diebe und Räuber durch. Andere suchen ihr Glück in der Neuen Welt, heuern auf Handels- und Auswandererschiffen an, in der vagen Hoffnung, in Amerika Fuß fassen zu können.
Eines dieser Auswanderer- und Glückssucherschiffe, ein niederländischer »Westindienfahrer«, ist im Jahre 1716 auf dem Weg in die Karibik. Es befindet sich bereits in den Gewässern der Bahamas, als der Matrose im Ausguck, dem sogenannten Krähennest, voller Entsetzen ein Piratenschiff sichtet, das Kurs auf die Holländer nimmt. Auf der Mastspitze des Seeräuberschiffs weht die schwarze Fahne mit Totenkopf und zwei gekreuzten Säbeln. Die damaligen berühmten Piratenkapitäne besitzen alle individuelle Flaggen. Diese hier, das wissen die Matrosen des holländischen Schiffes vielleicht, gehört Jack Rackham. Er ist der Dandy unter den Piraten, ein eitler Mann, der sich gern in bunten Fantasieuniformen zeigt, die aus feinster indischer Baumwolle aus Kalikut geschneidert sind, weswegen er den Spitznamen »Calico Jack« trägt.
Die Piraten holen den trägen Westindienfahrer rasch ein. Als die Enterhaken ausgeworfen werden und die beiden Schiffe Bord an Bord liegen, sackt den Holländern das Herz in die Hose. Zu schrecklich ist der Anblick der bis an die Zähne bewaffneten Piraten, denen die Mordlust in die Visagen geschrieben steht. Die Holländer ergeben sich kampflos und hoffen, so mit dem nackten Leben davonzukommen. Nur einer, ein Soldat namens Marc Read, ein hübscher junger Mann mit feinen Gesichtszügen, zieht Pistole und Degen und stellt sich furchtlos den Angreifern entgegen. Doch Read kann sich nicht lange gegen die Übermacht verteidigen und wird überwältigt. Die Holländer haben indes offenbar falsch kalkuliert. Denn Calico Jack findet ausgerechnet an diesem jungen Soldaten Gefallen und nimmt ihn auf sein Schiff: Der tapfere Kerl soll als Pirat kämpfen! Das Holländerschiff wird geplündert, in Flammen gesteckt und die Besatzung in Beibooten auf offenem Meer ausgesetzt. Ob die Holländer rettendes Land erreichten, ist nicht bekannt.
Was Rackham nicht weiß: Der hübsche junge Mann ist eine Frau und heißt in Wirklichkeit Mary. Calico Jack wird das erst einige Wochen später erfahren, von seiner Geliebten Anne Bonny, auch sie eine Piratin. Eine pikante Dreiecksgeschichte in karibischen Gewässern …
Auf den Schlachtfeldern Flanderns
Bereits zu Beginn der Vita von Mary alias Marc steht ein Betrug. Marys Mutter ist verheiratet mit einem Matrosen, der von einer seiner Seefahrten nicht mehr zurückkehrt. Aus dieser Ehe hat sie bereits ein Kind, einen Knaben. Als Mrs. Read bemerkt, dass sie erneut schwanger ist – nicht von ihrem Mann –, zieht sie unter einem Vorwand aufs Land, denn ihre Nachbarn und die Verwandten in London sollen nichts von ihrem Zustand erfahren. Immerhin unterstützt die Mutter des Seemanns ihre Schwiegertochter und den Enkelsohn finanziell. In der Provinz bringt Mrs. Read dann 1685 diskret ihre uneheliche Tochter Mary zur Welt.
Ende der Leseprobe